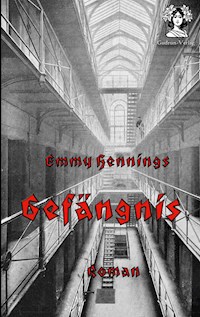Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Sammlung von vierundzwanzig Legenden, die auf unterschiedlichen frühen Quellen beruhen: Neben der titelgebenden Legende geht es beispielsweise ebenso in "Die heilige Cäcilia", "Die Mutter Gottes und der Räuber" oder "Der Soldat und das Jesuskind" um die Wunderwelt der Heiligen, die sich dem Leser beim Eintauchen in das Geschehen offenbart. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emmy Ball-Hennings
Das irdische Paradies und andere Legenden
Saga
Das irdische Paradies und andere LegendenCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1945, 2020 Emmy Ball-Hennings und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726614855
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
VORWORT
Die vorliegende Legendensammlung, die aus verschiedenen, frühen Quellen geschöpft wurde, will nicht als kritischer Beitrag für die Literaturgeschichte der Legende betrachtet werden. Das tiefere Wesen der Legende, ihr Geist läßt sich nicht durch Studium und Wissenschaft erschließen, sondern ergibt sich lieber dem unbefangenen Leser, der mit staunender Freude die Wunderwelt des Heiligen betrachtet, die einem verwunschenen Zauberwald gleicht, dessen märchenhafte Schönheit uns anzieht.
Die Auswahl der Legenden ist nach rein persönlichem Geschmack getroffen worden. Wir waren darauf bedacht, ein Stück echte, volkstümliche Poesie in Verbindung mit dem religiösen Empfinden und Erleben in farbenfroher Mannigfaltigkeit zu zeigen. In unserer lauen, zum Teil glaubenslosen Zeit wollen wir auf den kostbaren Schatz der Vergangenheit zurückgreifen, die edlen Früchte betrachten, die der christliche Glaube selbst hervorgebracht hat. Wohl mag es für den Kunstfreund reizvoll und anregend sein, die Legende daraufhin zu betrachten, wie sie im Lauf der Jahrhunderte für die Literatur, besonders für das Volksmärchen, aber auch für die bildende Kunst, für die Malerei und Bildhauerei bahnbrechend und bestimmend wurde, wie dies noch heute der Fall ist. Schöner aber noch mag es sein, sich dem Urquell der Legende selbst hinzuneigen, denn die Ursache der Legende ist ja das göttliche Leben. Die Heiligen gehören zum Sprachschatze Gottes, und ihr Leben ist gleich Worten, die von Seinem Munde strömen. Im letzten Absatz unseres Bekenntnisses heißt es: «Ich glaube an eine heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen.» Wie könnten wir an diese Gemeinschaft glauben, mehr noch, wie könnten wir sie verwirklichen, wenn wir das Leben der Heiligen uns nicht immer wieder vor Augen führen und es aufmerksam betrachten wollten? Wäre es nicht gut, in dunkler Zeit sich etwas mehr als zuvor an das leuchtende Ideal, an das unsterbliche Vorbild der Menschheit zu halten, an den Heiligen als an den reinsten Spiegel der Seele? Die Heiligen sind und bleiben für uns der innige Ausdruck des Heiligen Geistes auf Erden, dem wir uns in unruhiger, friedloser Zeit mit mehr Gewinn denn je zuwenden wollen, dazu uns die Legende sehr dienlich sein kann.
Nun stammt die Legende aus früher und frühester Zeit, und betrachten wir sie einmal nur als Lehr- und Erbauungsbuch, kommt uns bei manchen Erzählungen vor, etwa bei «Sankt Brendans Meerfahrt» oder beim «Fegefeuer des heiligen Patrizius», um nur einige zu nennen, als würde die Lust am Fabulieren gar oft mit dem Trachten nach seelischer Erbauung verwechselt; doch können wir uns mit solcher Annahme irren. Wir dürfen nicht vergessen, daß frühere Generationen ein wenig mehr besaßen von dem, was uns Heutigen leider etwas verlorengegangen ist, nämlich die Freude am Wunderbaren und Märchenhaften. Und diese reine Quelle der Kunst stammt eben aus dem Religiösen. (Wir Heutigen sind wohl zu sehr abgelenkt von Wundern, die mehr diabolischer als göttlicher Art sind.) Die Legende aber bleibt der letzte, spannende Ausdruck, die dichterische Gestaltung religiösen Lebens, das besonders im Mittelalter, zur Zeit der großen Marienverehrung, zur schönsten, reichsten Blüte gelangte. Wie hätten wir uns versagen können und dürfen, einige Marienlegenden, die unverwelklichen Rosen frommer Dichtung, in unser Buch aufzunehmen? Gerade diese Legenden gehören zu den mystischen, hellen Sternen, von denen wir lernen können, was Glaube und Vertrauen vermag.
Mancher Leser wird in diesen Legenden das Unmittelbare der Anschauung, das Hinnehmen des Wunders als etwas durchaus Selbstverständliches bestaunen, wenn zum Beispiel erzählt wird, wie die Mutter Gottes in der Kirche vom Sockel herabsteigt, um sich mitten in der Nacht in ein Gefängnis zu begeben, und dort einen Gefangenen befreit, oder wenn sie jahrelang für eine vorübergehend treulose Nonne das Amt als Küsterin versieht. Was will dies besagen? Oh, sie kann allmächtig sein, wo sie gläubig ersehnt wird, Unsere Liebe Frau von der immerwährenden Hilfe. Dies ist wohl die nächstliegende Deutung des Wundergeschehens. Sie bringt ein verlaufenes Kind heim, sie hält es an der Hand, sie wärmt es und hüllt es schützend in ihren warmen, blauen Mantel. Und einmal nimmt sie in der Kirche ihr Kind vom Schoß, setzt es auf den Stuhl, und wirft sich vor ihrem göttlichen Kinde auf die Knie, um für irgend jemanden eine Gnade zu erbitten. Sie ist die Fürsprecherin bei Gott, und man kann wohl sagen, daß die Legende dieses im übertragenen Sinne meint.
Wo aber das Übertragene, das Dichterische waltet, ist auch das Unmittelbare, das Wunder ist hier daheim, und es gehört zum täglichen Leben. So erfahren wir in der Legende, wie die Himmelskönigin ihren Thron in der Kirche verläßt, um sich ins Volk zu begeben, denn auch die Seele des Volkes, wie die jedes Einzelnen ist ja der Kirche ähnlich und hat in sich Thron, Altar und ewiges Licht. Von diesem Standpunkt aus läßt sich auch jenes Wunder begreifen oder erahnen, das den Gläubigen auch sichtbar geschah. Wohl stehen wir ergriffen vor der taubenhaften Einfalt, vor dem kindlichen Glauben, von dem die Legende erfüllt ist. Besonders die Einfalt ist eine Herzensbegabung, die sich schwer erklären und beschreiben läßt, und mag geheimnisvoll der unberührten, genialen Weisheit des Kindes verwandt sein, die in bezaubernder Unschuld instinktiv jenes erkennt, was den Klugen der Welt verborgen bleibt: das göttliche Wunder, das Märchen unseres Lebens.
Was sich in der Legende sichtbar zeigt, alles, was Gestalt gewann, jeder kleine Bericht, darf als Gleichnis seelischen Erlebens betrachtet werden. Wir Heutigen sind ja nicht so wundersüchtig, daß wir das Wunder greifen und mit physischen Augen betrachten wollen. Aber die Möglichkeit des Wunders gibt es auch für uns, und es kann uns in bedrängter Zeit näher denn je sein. Wo es dringend notwendig ist, spricht Gott zu uns durch Zeichen und Wunder. Doch auch wenn uns kein sichtbares Wunder begegnet, dürfen wir gleichwohl nie den Zugang zum Wunderbaren verlieren, müssen uns bemühen, die Hieroglyphensprache Gottes zu verstehen, lesen zu lernen, dazu uns die Heiligenlegende viel Anregung bietet.
Es scheint uns keineswegs unzeitgemäß zu sein, den Wunderglauben vergangener Generationen näher zu betrachten, noch dazu, wenn wir in Betracht ziehen, daß die Legendenschreiber auch Männer der Wissenschaft waren, deren hohe, literarische Bildung wohl außer Frage steht. Dies ist ein wichtiges Thema, das jeder Leser für sich erwägen und durchgehen mag. Gewiß, die Legende bietet rein stofflich eine überaus reizvolle Unterhaltung, sie streift weltgeschichtliche Ereignisse, vermittelt uns den Eindruck von einem frühen, intensiven Lebensgefühl und blickt uns über alles hinweg wie aus Traumaugen an. Wir aber wollen nicht nur die leichte, schöne Anregung des Geistes, nicht nur die Befriedigung unserer Neugierde, bei der wir allerdings spüren, daß die Vergangenheit wichtiger, spannender sein kann als die Gegenwart. Wir wollen die Absicht der Legende bedenken, den Geist, in dem sie einmal verfaßt wurde.
Dem frühen «Passionale», dem ein Teil unserer Legenden entnommen wurde, hat man einmal im 15. Jahrhundert eine Widmung mitgegeben, auf die unser Blick verlangend fiel, eine Widmung, die wir bescheiden nachsprechen möchten, auf daß sie sich auch in unserer Zeit ein wenig verwirkliche. Das Leben und Leiden der Heiligen wird noch heute der Menschheit ein Beispiel sein können; denn die großen Heiligen als Spiegel der Menschheit, als Glaubenszeugen für Jesus Christus, können ja nie sterben. Weil es das leuchtende Beispiel der Heiligen ist, das die Menschheit hinanzuziehen vermag und uns den wahren Weg des Lebens zeigen kann, werden wir unserem kleinen Legendenkranz in Bescheidenheit die Widmung von einst zum Geleite mitgeben dürfen, die also lautet:
Der Hohen Unteilbaren Dreifaltigkeit zu Lob, Marien, der würdigsten Jungfrau und Mutter Gottes, zu Ehren
und allen Heiligen, und den Christenmenschen zu Heil und seliger Unterweisung.
DIE LEGENDE VOM IRDISCHEN PARADIES
Das irdische Paradies, jener sagenhafte Garten Eden, in dem Adam und Eva einmal weilen durften, befindet sich in einer bestimmten Gegend auf einem Berge, der im Orient liegt und höher als alle Berge der Erde ist. Vier Ströme haben ihren Ursprung im Paradiese, und ihre hellen Wasser, die talwärts rauschen, berühren auf geheimnisvolle Weise gleich einem Gruß aus seligen Reichen, einmal jedes Land der Erde. Die Ströme aber heißen: Tigris, Euphrat, Nil und Ganges.
Nahe dem Nil befand sich vor vielen, vielen Jahren einmal ein Kloster, in dem eine Anzahl Mönche wohnte, die ein wahrhaft engelhaftes Leben führten und kaum auf etwas anderes als auf ihr Seelenheil bedacht waren. Eines Tages nun ergingen sich drei der Mönche am Ufer des Nils, und weil das klare, frische Wasser sie lockte, kamen sie auf den Einfall, ihre etwas müden, heißen Füße zu baden. Da erblickten sie plötzlich im Wasser schwimmend den Zweig eines Baumes, dessen Blätter in verschiedenen Farben gar seltsam und schön leuchteten. Die Blätter waren nicht nur grün, wie unsere Augen dies gewohnt sind, sondern schimmerten goldig und silbern, korallenfarben und azuren. Beinahe jedes Blatt zeigte eine andere Farbe. Die Mönche nahmen den Zweig an sich, betrachteten erstaunt seine fremdartige Schönheit, lobten den Schöpfer, der so viel Wunderbares sich erdacht hat, und da an diesem Wunderzweig drei köstliche Äpfel hingen, nahm jeder der Mönche einen Apfel und aß.
O, wie die Frucht mundete! Eine namenlose Freude bemächtigte sich der drei Mönche, eine Freude, die so stark war, daß jeder in Tränen ausbrach und der eine den andern fragte:
«Bruder, sprich, warum weinst du?»
«Ich weine, weil meine Seele berührt ist. Und warum weinst du, mein Bruder?»
«Es werden Tränen der Freude sein, die ich weinen muß.»
Der dritte sprach:
«Wahrlich, ich glaube, dieser Zweig muß von jenem Ort stammen, an dem vielleicht Gott selbst im Kreise seiner Engel weilt. Es müssen Früchte aus einem himmlischen Reich sein, die wir gekostet haben. Wollen wir nicht diesen herrlichen Ort suchen gehen?»
«Gehen wir im Namen Gottes.»
Also waren sich die drei Mönche einig, und machten sich auf den Weg, von dem sie voller Vertrauen annahmen, er würde sie zum Paradiese führen. Sie gingen eine Weile am Nil entlang und entdeckten am Ufer Sträucher, die voller Manna hingen, davon sie kosteten. Sie gingen weiter und fanden eine Quelle, die von oben kam und sich in den Nil ergoß. Das Rauschen der Quelle war wie Gesang, der die Mönche entzückte. Sie lauschten eine Weile, neigten sich dann zur singenden Quelle, tranken ein wenig vom klaren Wasser und fühlten sich dadurch ungemein erfrischt. Es wurde ihnen so leicht und selig zumute. Wie schwebend wurden ihre Schritte und so kamen sie wie auf Flügeln getragen den hohen Berg hinan, ohne irgend welche Müdigkeit zu verspüren.
Als sie beinahe die Spitze des Berges erreicht hatten, vernahmen sie, wie aus der Ferne, einen wunderbaren Gesang. Es war den Mönchen, als hörten sie viele Engel singen. Da gingen sie der traumhaften Süßigkeit des Liedes nach, dessen Klänge immer zarter, inniger und feierlicher zu strömen schienen. Die Mönche betrachteten mit staunenden Augen die herrlichen Bäume, die auf diesem Berge wuchsen. Sie sahen Blumen in nie zuvor gesehener Farbenpracht und der feine Duft dieser Blumen erfüllte die Herzen der Mönche mit einer Freude ohnegleichen.
Plötzlich standen sie vor einer hohen, hellen Mauer und vor einem mächtig großen Tor, das geschlossen war und vor dem ein wunderschöner Engel mit lichtschimmernden Flügeln die Wache hielt. Der Engel hielt ein flammendes Schwert in der Hand. Die Mönche blieben scheu vor Ehrfurcht in einiger Entfernung stehen, sahen jedoch in andächtiger Verzückung auf den namenlos schönen Engel, dessen Antlitz wie eine Sonne leuchtete und doch die Betrachtenden nicht blendete. So blieben die Mönche, hingenommen vom Anblick solcher Schönheit, fünf Tage und fünf Nächte hindurch stehen ohne die Zeit zu empfinden.
Am sechsten Tage aber, wie von den Augen des Engels angezogen, wagten sie näher zu treten. Und der Engel fragte sie sogleich:
«Was wollt ihr hier?»
Die Mönche antworteten:
«Ach, wenn wir doch eintreten dürften, um ein wenig nur zu sehen, was sich hinter dem Tor befinden mag. Wenn wir nur drei oder zwei Tage hier bleiben dürften.»
«Oder nur einige Augenblicke», setzte der eine Mönch schüchtern bittend hinzu.
Da öffnete der Engel das Tor, und die Mönche durften ins Paradies eingehen. Vor ihnen ausgebreitet lag der himmlische Garten da in seiner unbeschreiblichen Schönheit. In den Zweigen der herrlichen Bäume sangen die Vögel lieblicher noch als auf der Erde, weil die Mönche vogelsprachekund waren und die süßen. Lieder der Vögel, die zur Ehre Gottes sangen, klar verstehen konnten. Schwiegen dann die Vögel, wie um sich ruhend auf ein neues Lied zu besinnen, vernahmen die Mönche leise, unsagbar anmutige Melodien, sanft strömende Harfenklänge, die von fernen Engeln herrühren mochten. Die Mönche hoben ihre Häupter, sahen in das selige, singende Blau des Himmels und blieben lauschend stehen.
Dann wieder, da eine Duftwelle ihre Stirnen berührte, der innig-feine Hauch der vielen Rosen, senkten sie den Blick. Jede einzelne Blume war ein blühendes Gebet, das die Mönche als Frieden und Seligkeit im Herzen empfanden. Sie selbst, die Mönche, fanden keine Worte, nur ihre Seelen waren von Dankbarkeit erfüllt.
Sie sahen einen freundlichen, hellen Weg vor sich, der in einen Wald zu führen schien, doch waren sie zu sehr befangen und zu demütig, um weiterzugehen.
Es kamen zwei ehrwürdige Greise ihnen entgegen, die eine Helle ausstrahlten wie schimmernder Schnee, auf den die Sonne fällt. Es waren die heiligen Väter Elias und Henoch, die Gott einmal, noch während ihres Erdenlebens, in diesen Himmel erhoben hatte. Die Mönche grüßten, und die heiligen Väter fragten:
«Was suchet ihr hier? Und wie kommt ihr hierher?»
Die Mönche entgegneten:
«O, wir wissen nicht und können nicht begreifen, wie wir an diesen Ort gekommen sind. Hätten wir je ahnen können, daß es uns bestimmt war, solche Herrlichkeit zu schauen?»
«Dann danket Gott, daß er euch solche Gnade widerfahren ließ. Ihr müßt wohl eine Frucht vom Baum der ewigen Jugend gekostet haben, und von der Quelle des Lebens werdet ihr getrunken haben, sonst wäre es euch nicht möglich gewesen, hierher zu kommen. Ihr seid im Garten Eden, den man das irdische Paradies nennt. Kommt mit uns. Wir wollen euch durch den Garten führen.»
Jetzt durften die drei Mönche in solch heiliger Gesellschaft den wunderbaren Garten betrachten. Es wurde ihnen jeder Baum gezeigt, der mit lieblichen Äpfeln behängen war, von denen Adam und Eva einmal gekostet hatten. Die Mönche betrachteten den Baum mit einer gewissen Scheu, und wandten dann ihre Aufmerksamkeit einem andern Baume zu. Es war ein hoher, mächtiger Baum von einer besonderen Tannenart, und Elias und Henoch erklärten, daß dies der Baum des Heiles sei, aus dessen Holz das Kreuz Jesu Christi einst gemacht worden war. Da fielen die Mönche auf die Erde und dachten an das siegreiche Kreuz, an das Holz, an dem das Heil der Welt gehangen.
Nach diesem wurden sie weitergeführt und kamen an jene Quelle, aus der sie unten im Tale vor ihrer Wanderung getrunken hatten. Henoch erklärte den Mönchen:
«Wer von diesem Wasser trinkt, altert nicht. Und wer alt ist und von diesem Wasser trinkt, wird wieder jung, denn es ist die Quelle des ewigen Lebens.»
Den Mönchen erschien alles, was sie sahen und hörten, wie im Traum. Sie waren so überglücklich, daß ihnen die Zeit wie im Fluge verging, und sie waren daher höchst erstaunt, als sie schon so bald wieder am Tor des Paradieses angelangt waren und wieder fortgehen mußten. Da begannen sie sich aufs Bitten zu verlegen, ob sie nicht bleiben dürften, was ja leicht zu verstehen ist. Denn wer im Paradiese war, wie wollte derjenige leichten Herzens wieder in die Welt zurückkehren mögen? Darum baten die Mönche gar flehend:
«O, habt Erbarmen mit uns. Laßt uns doch noch ein paar Tage im Paradiese. Wir sind doch erst soeben angekommen, und haben uns ein wenig an die Seligkeit gewöhnt. Ach, laßt uns doch hierbleiben! Schenkt uns nur noch einen Tag! Ach, nur noch eine Stunde! Wir waren nur so wenige Augenblicke hier. . .»
Die heiligen Väter lächelten geheimnisvoll und gaben zur Antwort:
«Ihr irrt euch. Ihr seid schon siebenhundert Jahre im Paradiese.»
Da konnten sich die Mönche nicht genug wundern und hätten am liebsten noch um siebenhundert Jahre längeren Aufenthalt im Paradies gebeten, doch ließ ihre Bescheidenheit dies nicht zu. Sie waren nur sehr traurig, daß sie sich verabschieden mußten. Elias und Henoch versuchten sie zu trösten:
«Es gibt ein noch schöneres Paradies als dieses, in das ihr bald eingehen werdet. Dieses hier ist nur das irdische Paradies, aber noch ein anderes, ein noch seligeres hat Gott uns bereitet. Und ihr werdet die Erben des himmlischen Reiches sein.»
Obwohl dies eine himmlische Hoffnung war für die Mönche, konnten sie sich gleichwohl schwer zum Abschied entschließen. Sie fragten auch:
«Wie kann nur die Zeit so rasch vergangen sein? Ein Menschenleben währet doch nur siebenzig oder achtzig Jahre. Und warum nur fühlten wir uns mit siebenhundert Jahren so jung?»
«Gott ist es, der die Jugend froh macht auch in hohen Jahren. Ihr aber habet die Frucht vom Baum der Jugend gekostet und vom lebendigen Wasser getrunken. Nun aber geht mit Gott in euer Kloster zurück.»
«Wie wird man uns dort nach siebenhundert Jahren aufnehmen? Niemand wird uns dort mehr kennen. Wer wird uns glauben, daß wir Mönche sind, die in das Kloster am Nil gehören? Wer wird uns dort glauben, daß wir im irdischen Paradiese waren? Woran werden die Brüder im Kloster erkennen, daß wir zu ihnen gehören?»
Die heiligen Väter sprachen:
«In der Kirche auf dem Altar wird ein Buch liegen, in welchem seit 1000 Jahren alle Namen der Mönche eingetragen sind. Nennt den Brüdern eure Namen und man wird sie in dem Buche verzeichnet finden. Ihr sollt euren Brüdern auch sagen, daß ihr nach vierzig Tagen alle drei am gleichen Tage zum ewigen Leben eingehen werdet.»
Da machten sich die Mönche auf den Rückweg, und so schwebend leicht, wie sie den Berg hinangekommen waren, kamen sie auch wieder zu Tale, und wieder bei ihrem Kloster angelangt, begaben sie sich zunächst in die Kirche, um Gott für die große Gnade zu danken, die ihnen widerfahren war.
Als nun die andern Mönche zum Gebet in der Kirche erschienen, waren sie recht erstaunt, die drei fremden Brüder zu Füßen des Altars vorzufinden. Sie fragten die Fremdlinge nach dem Woher und Wohin. Wie aber erstaunten sie, als diese Auskunft gaben! Die fremden Brüder nannten ihre Namen, und der Abt des Klosters fand sie im Buche, das auf dem Altar lag.
Da wurden die drei Mönche mit großer Freude von ihren Brüdern aufgenommen und alle beteten und sangen miteinander im Chor das Lob Gottes.
Nach vierzig Tagen aber wurden die Seelen der drei Mönche von Engeln hinweggeführt und durften eingehen zu den ewigen Freuden. Den zurückbleibenden Brüdern jedoch war dieses Wunder ein mächtiger Ansporn, Gott noch eifriger zu dienen denn zuvor.
SANKT JULIAN, DER GASTFREUNDLICHE
Der heilige Julian stammte von königlichen Eltern und zeigte sich schon im zarten Kindesalter sehr fromm und gottesfürchtig. Es beglückte den schönen Knaben, wenn seine reichen Eltern den Armen Gutes erwiesen, oder wenn sie Obdachlose in Schutz nahmen. Weil er nämlich im elterlichen Schlosse selbst ein solch freundliches, vornehmes Heim hatte, wünschte er das gleiche für die armen Nächsten, die er als seine Geschwister ansah. Obwohl nun Julian ein überaus gütiges, mitleidiges Herz besaß, neigte er gleichwohl zum Jähzorn, der sich bemerkbar machte, wenn er etwas Unrechtes sah, das seinem Empfinden für Gerechtigkeit widersprach.
Als er älter wurde und zu einem stattlichen Ritter herangewachsen war, zeigte er sich seinen Feinden gegenüber leicht aufbrausend und von stark leidenschaftlicher Natur. Er wußte wohl um diesen Fehler und suchte ihn zu bekämpfen.
Er hatte drei Nächte nacheinander den gleichen Traum: er sah, wie er seine eigenen Eltern mit dem Schwert tötete. Dieses Traumgesicht schreckte ihn so sehr, daß er heimlich sein Elternhaus verließ, um niemals in die Versuchung zu kommen, eine solch unselige Tat zu begehen. So floh Julian selbst vor der Möglichkeit einer Sünde.
Auf seiner Wanderung kam er an den Hof des Königs von Ägypten, dem er als Ritter seine Dienste anbot. Der König fand sogleich großes Gefallen an Julian, machte ihn zum Schatzmeister und später zum Befehlshaber über eine Provinz. Dann aber bewies er ihm noch größeres Vertrauen, indem er Julian seine junge, schöne Tochter zur Gemahlin gab, und als der König bald nach der Hochzeit starb, kam Julian als Herr von Ägypten auf den königliche Thron.
Hier waltete er nun überaus umsichtig seines hohen Amtes, so daß überall Ordnung und Wohlstand im Lande herrschte. Seiner Gemahlin war er in inniger Liebe treu ergeben, während sie in ihrem Gatten das reinste Glück ihres Lebens erblickte.
In jenem Lande nun, wo Julians Eltern lebten, brach eine große Hungernot aus und viel Volk flüchtete nach Ägypten, in die reiche Kornkammer des Orients. Auch Julians Eltern kamen nach Ägypten, und da sie vernahmen, daß ihr eigener Sohn dort König geworden war, begaben sie sich an den königlichen Hof, um ihren Julian nach langer Zeit einmal wiederzusehen. Das Schicksal wollte es, daß Julian nicht anwesend war, als die Eltern im Schlosse nach ihm fragten. Sie wurden aber von der Königin liebreich empfangen, die sich ungemein freute, die Eltern ihres Gatten kennenzulernen. Diese waren entzückt von der reizenden, jungen Schwiegertochter, die sie aufs freundlichste bewirtete, und da die alten Eltern von der Reise ermüdet waren, wurde ihnen, um sie besonders zu ehren, das eheliche Schlafzimmer zum Ausruhen angewiesen.
Unterdessen befand sich Julian auf der Jagd, einsam den Wald nach Beute abspähend. Da gesellte sich unversehens der böse Feind zu ihm, den Julian als solchen nicht erkennen konnte, weil dieser die Gestalt von Julians Lieblingsdiener angenommen hatte. Der Diener näherte sich mit devoten Verneigungen und bat höflich um Gehör für eine angeblich dringliche Mitteilung. Julian, der sich im Jagdvergnügen nicht gerne stören ließ, erwiderte etwas ungehalten:
«Sprich rasch, was hast du mir zu sagen?»
«Mein Herr, die betrübliche Kunde, die ich Euch zuüberbringen habe, ist freilich rasch gesagt, doch steckt leider eine Begebenheit dahinter, die sich nicht in wenigen Worten sagen läßt. Es ist übrigens eine recht undankbare Aufgabe, einen Mann von der Untreue seiner Frau zuüberzeugen, aber meine Ergebenheit Euch gegenüber, edler Herr, gestattet es mir nicht, länger zu schweigen. Vielleicht hätte ich schon früher sprechen sollen, aber ich habe stets daran denken müssen, wie sehr es Euch betrüben würde, zu erfahren, daß die Königin, mit Verlaub zu melden, sich nicht so verhält, wie es einer guten Ehefrau geziemt.»
Julian brauste auf:
«Was erlaubst du dir, frecher Bursche? Du wirst deine Unverschämtheit mit dem Leben zahlen.»
Schon wollte Julian sein Schwert aus der Scheide ziehen, um auf den vermeintlichen Diener einzudringen, als dieser geschickt zur Seite wich und Julian zurief:
«Gnädiger Herr, es mag Euch jederzeit frei stehen, mich zu töten. Ihr wisset, ich bin Euer Diener und Untertan. Mein Leben sei Euch gern verfallen, wenn ich die Unwahrheit spreche. Doch werdet Ihr nicht unnütz eine unüberlegte Tat begehen, die Euch reuen könnte. Verzeiht, daß ich also zu Euch spreche. Aber es ist nur die Liebe zu Euch, die mich treibt, Euch die Augen zu öffnen Eurer Gemahlin gegenüber. Während wir nämlich hier miteinander sprechen, ist wahrlich anzunehmen, daß Eure Gemahlin einen stattlichen, bekannten Ritter, ihren Liebhaber in jenem Zimmer empfängt, in das nur Ihr, edler Herr, als Gatte und König eintreten dürft.»
Julian hatte genug gehört. Er hatte den Dolchstich glühender Eifersucht im Herzen empfangen, bestieg, ohne noch ein Wort mit dem Diener zu wechseln, sein Pferd und stürmte nach Hause, wo er in später Abendstunde anlangte. Ohne Überlegung eilte er in sein Schlafgemach, das in tiefe Dämmerung gehüllt war und nichts erkennen ließ.
Julian tastete sich bis an sein Ehebett, wo er zwei Schlafende fühlte, einen Mann und eine Frau. Da spürte Julian sein Blut in heißen Wogen rauschen und nur vom wilden Verlangen erfüllt, seine verletzte Ehre zu rächen, zückte er sein Schwert, tötete die beiden Schlafenden, und eilte fort in ein anderes Zimmer.
Etwas später betrat er mit einem Licht noch einmal den Schauplatz seiner unglückseligen Tat, vielleicht um zu sehen, wer sein Nebenbuhler gewesen sein mochte. Da er aber seinen geliebten Vater und seine geliebte Mutter erblickte, stieß er einen gellenden Schrei des Entsetzens aus, auf den seine Gattin herbeigeeilt kam und sogleich mit Schaudern sah, was hier geschehen war.
Julian aber rief verzweifelt aus: «Komm nicht zu mir! Rühre mich nicht an! Du siehst, ich habe meine Eltern getötet, und dich, du reinste Frau, habe ich verdächtigen können. Verzeih mir, wenn du es kannst. Ich gehe fort, um nie wieder zu kommen. Leb wohl.»
Die junge Frau jedoch hielt ihn zurück und warf sich ihm an den Hals:
«O, ich flehe dich an, zweifle nicht an der Barmherzigkeit Gottes. Deine Sünde kann nicht so groß sein, daß sie dir nicht verziehen werden könnte. Du hast ja deine Eltern nicht töten wollen, Julian, und jetzt bereust du deine rasche Tat. Geh zum Heiligen Vater, geh sogleich nach Rom und lege eine Beichte ab. Und bei der Sühne will ich, dein Weib, dir helfen. Geh mit Gott, mein armer Julian, und komm wieder zu mir zurück. Vergiß nicht, daß ich alles mit dir tragen will.»
Die Frau machte noch das Kreuzzeichen über ihn, und damit nahmen die Gatten Abschied voneinander.
Dann trug Julian die schwere Last seiner Sünde nach Rom, wo er vor dem Papst eine reumütige Beichte ablegte und in Demut um eine heilsame Buße bat. Der Papst trug ihm als Sühne auf, vierzehn Jahre lang ein unstetes Wanderleben zu führen und sich von Almosen zu nähren. Er durfte keine zwei Nächte nacheinander am gleichen Ort schlafen, und somit war es die Heimatlosigkeit, die ihm als harte Sühne auferlegt wurde. Julian war dankbar, büßen zu dürfen. Die Buße erschien ihm im Vergleich zur Sünde so sehr leicht. Es fiel dem einstigen König nicht schwer, als wandernder Bettler die Welt zu durchqueren. Es war nur die Sünde, die ihn drückte und die er nicht genug bereuen konnte.
Die Gattin aber wartete vergeblich auf ihren Mann. Sie konnte nicht begreifen, warum er nicht zu ihr zurückkam. Es beunruhigte sie, nichts über ihn zu wissen, und endlich entschloß sie sich, nach Rom zum Heiligen Vater zu gehn, um sich bei ihm nach Julian zu erkundigen. Der Heilige Vater sagte ihr, daß ihrem Gatten vierzehn Jahre Wanderleben als Buße auferlegt worden seien, und als die junge Frau dieses hörte, bat sie den Heiligen Vater kniefällig, die Hälfte der Sühne auf sich nehmen zu dürfen, was ihr gewährt wurde.
Jetzt kleidete sich die Königin in ein ärmliches Pilgergewand, zog wandernd von Ort zu Ort, und in jeder Kirche, an der sie vorüberkam, betete sie für das Seelenheil ihres Mannes und dann erst für ihr eigenes. Als die Frau nun eines Tages in einer Kirche von Ravenna kniete, erkannte sie in einem Beter neben sich ihren Gatten Julian, der auch hierher gekommen war, seine Sühneandacht zu verrichten. Julian war so tief versunken in sein Gebet, daß er seine Frau neben sich nicht gleich bemerkte. Sie aber sah, wie die Tränen der Reue ihm aus den Augen fielen und über sein leidensvolles Gesicht rannen. Da empfand die Frau ein tiefes Mitleid mit ihrem Manne, bat den lieben Gott, daß er ihr helfen möge, immer treu und standhaft an der Seite ihres Mannes bleiben zu dürfen. Sie empfing die Eingebung, daß Gott ihr Gebet erhörte, und da rückte sie ein wenig näher an den Beter heran, ihm mit holder Zärtlichkeit ins Ohr flüsternd:
«Julian, ich darf als deine Frau wohl mit dir beten.»
Julian blickte auf seine Frau im Pilgerkleid, und es rührte ihn, daß sie ihm gefolgt war. Sie erzählte ihm sogleich, sie sei beim Heiligen Vater gewesen und er habe ihr erlaubt, die Hälfte der Buße auf sich zu nehmen. Julian wollte dieses Opfer nicht annehmen und wünschte, seine Frau möge wieder nach Hause gehen, um dort ein ruhiges Leben zu führen.