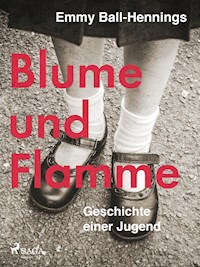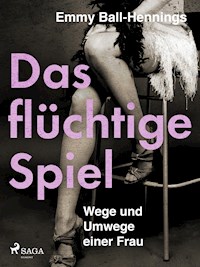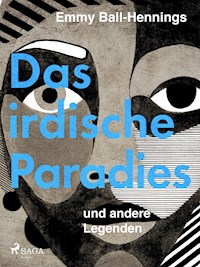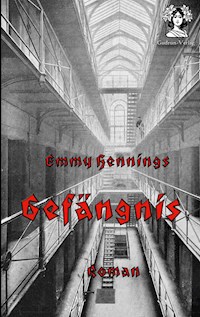
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Books on DemandHörbuch-Herausgeber: LILYLA Hörbuch-Editionen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Emmy Hennings kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs wegen eines Diebstahls in einem Münchner Gefängnis landet, beginnt für die sensible Sängerin und Dichterin ein Leidensweg, der sie im Kern erschüttert. Hennings, die 1916 zusammen mit ihrem künftigen Ehemann, dem Dada-Dichter Hugo Ball, das berühmt-berüchtigte Cabaret Voltaire in Zürich eröffnen sollte, beschreibt in diesem Kurzroman in radikal-subjektiver Weise die Entmenschlichung, die eine sensible Seele durch den Strafvollzug erlebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Als die junge Emmy Hennings kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs wegen eines Diebstahls in ein Münchner Gefängnis landet, beginnt für die sensible Sängerin und Dichterin ein Leidensweg, der sie im Kern erschüttert. Hennings, die 1916 zusammen mit ihrem künftigen Ehemann, dem Dada-Dichter Hugo Ball, das berühmt-berüchtigte Cabaret Voltaire in Zürich eröffnen sollte, beschreibt in diesem Kurzroman in radikal-subjektiver Weise die Entmenschlichung, die eine sensible Seele durch den Strafvollzug erlebt.
Die Autorin:
Die Bohémienne Emmy Hennings-Ball (1885-1948) war Wanderschauspielerin, Dichterin, Sängerin, Morphinistin, Gelegenheitsprostituierte, Muse und Mystikerin. Als eine der wenigen Frauen in der Dada-Bewegung inspirierte sie eine Generation von KünstlerInnen, darunter Erich Mühsam, Johannes R. Becher sowie ihren langjährigen Freund Hermann Hesse.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil
Zweiter Teil
Vorwort
Emmy Hennings’ »Gefängnis«:
Eine Zeitreise ins subjektive Ich
Kann man mir wohl zum Vorwurf machen, mir allein zum Vorwurf machen, ich hätte die traurige Lust in die Welt gebracht? Ich verwahre mich dagegen und sage: ich habe die Lust nicht erfunden. Ein so origineller und zugleich perfider Erfinder kann nicht weiblich gewesen sein.
Für mich ist ein wirklich guter Roman wie eine Zeitmaschine: Er vermag es, uns aus unserer oft recht behäbigen intellektuellen Empfindlichkeit zu entführen und in eine komplett andere Zeit und Umgebung zu transportieren, und zwar an Orte und Situationen jenseits unserer Komfortzone, die wir uns sonst nie hätten vorstellen können. Die Tür geht auf und eine ganz neue Wirklichkeit umschließt uns. Wie wäre es zum Beispiel, nicht nur in eine Münchner Gefängniszelle im Jahr 1914 befördert zu werden, sondern auch unmittelbar in die Seele und in die Gefühlswelt einer jungen Frau zu schlüpfen, die sich auf einmal dort wiederfindet und sich hinter Eisengittern ihrer maroden Vergangenheit und ihrer aussichtslosen Zukunft stellen muss? Mit Emmy Hennings’ autobiographischem Kurzroman »Gefängnis« ist eine solche Reise ins Ungewohnte, aber Allzumenschliche, ohne weiteres möglich.
Emmy Hennings, das spätere It-Girl der Berliner und Münchner Kulturszene, wurde 1885 als Emma Maria Cordsen in Flensburg geboren. Diese Tochter eines einfachen Seemanns und Taklers verdingte sich nach sieben Jahren Volksschule ihrem Stand entsprechend als Dienstmädchen und Wäscherin und später als Kopiererin in einem Fotoatelier, bevor sie ihre Liebe zum Theater entdeckte und ihre ersten Bühnenrollen übernahm. Aus ihrer kurzen Ehe mit dem Schriftsetzer und Laienschauspieler Joseph Paul Hennings mit neunzehn Jahren ging ein Sohn hervor, der schon ein Jahr später starb. Eine außereheliche Tochter, Annemarie, folgte, bevor Emmy, wohl vom Abenteuergeist ihres inzwischen verstorbenen Vaters angesteckt, das Mädchen in der Obhut der Großmutter in Flensburg zurückließ und sich vollends dem Wanderleben widmete.
In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts wird Emmy zu einer klassischen Vagantin und Bohémienne. Ihre späteren Aufzeichnungen sind seltene Zeugnisse dieser untergegangenen Epoche, wo KomödiantInnen noch zum »fahrenden Volk« gehören und entsprechend angesehen werden. Zuerst in Schleswig-Holstein und später in Schauspiel- und Kaffeehäusern zwischen Paris und Budapest – »von einer Spielgier besessen, von einer Wander- und Melodiesucht ... als triebe mich ein Dämon« – spielt sie Jahr für Jahr Theater und gibt die neuesten Chansons zum Besten. Emmy verfügt nämlich über eine Stimme, die »über Leichen hüpft und sie wie ein gelber Kanarienvogel seelenvoll trällernd verhöhnt«, wie ihr ein zeitgenössischer Kritiker bescheinigt. Bald schreibt die talentierte Diseuse eigene Texte und trägt sie vor einem wechselnden Publikum vor, darunter im Berliner Café des Westens und in der Münchner Künstlerklause Simplicissimus.
Aber zum beruflichen Erfolg stellt sich keine finanzielle Sicherheit ein. Längst äther- und morphiumsüchtig und immer am Hungertuch nagend, tut Emmy, was notwendig ist, um in diesem prekären Beruf den Kopf über Wasser zu halten. Dazu gehört neben wechselnden Liebschaften und dem Hausieren mit Toilettenartikeln immer wieder die Gelegenheitsprostitution, was für eine Dame im verruchten Theatergewerbe keinen Seltenheitswert besitzt. Emmy »macht die Straße«. Mit dem ersten Geld, das sie auf diese Weise verdient, betritt die zwischendurch arbeits- und obdachlose Schauspielerin ein Kölner Café. »Dort habe ich ein Butterbrot bekommen und eine Tasse Kaffee, und dafür lege ich mein irrsinniges Zehnmarkstück auf den Marmortisch«, schreibt sie in ihrem 1920 erschienenen Roman »Das Brandmal«. »Für dieses Zehnmarkstück wurde ich selbst auf den Tisch gelegt, es wurde mit mir bezahlt ...«
Das Leben als Prostituierte fällt Emmy alles andere als leicht. Sie hadert mit sich und verwendet eine häufig drastische Sprache für ihr Empfinden der sexuellen Ausbeutung der Frau durch den Mann. »Wahrhaftig, alle Teufel sind über mir!«, schreibt sie in »Das Brandmal.« »Ich bin empfänglich, dafür bin ich eine Frau. Alle Tore zum Innern geöffnet. Es gibt Teufel in der Welt, sonst wäre ich nicht von ihnen befangen. Wo seid ihr, gute Geister?«
Emmys Gedichte werden in Franz Pfemferts »Die Aktion« abgedruckt. Ihr erster Gedichtband, »Die letzte Freude«, erscheint 1913 im Kurt Wolff Verlag. Als Malermodell und Wanderkünstlerin verbinden Emmy enge Kontakte zur Malerin Else Laske-Schüler und zur Kabarettistin Claire Waldorff, mit der sie in Berlin auftritt. In diese Zeit fallen auch Freundschaften bzw. Liebesbeziehungen zu bedeutenden jungen Künstlern und Intellektuellen der Münchner Kulturszene, darunter zu den Dichtern Erich Mühsam, der von ihrem »erotischen Genie« schwärmt, Jakob van Hoddis, Georg Heym, Ernst Bloch und Hugo Ball sowie zum späteren Stalinisten und DDR-Kulturminister Johannes R. Becher, dessen »blonde Muse« sie ist. Ein weiteres erotisches Verhältnis mit dem expressionistischen Autor Ferdinand Hardekopf, mit dem sie durch Deutschland und Frankreich tourt, und der sie offenbar regelmäßig zur Prostitution und zum Diebstahl auffordert, soll verheerende Konsequenzen nach sich ziehen.
Mitten in dieser Zeit, womöglich in Folge der fast tödlichen Typhuserkrankung, die sich Emmy während ihrer Frankreichreise holt, tritt die seit Jahren religiös interessierte Komödiantin 1911 in München der Katholischen Kirche bei, allerdings ohne an ihrer Vagabundenexistenz zwischen dem Kabarett, dem Romanischen Café und – immer wieder – dem Strich zu rütteln. Sie betet, besucht Frühmessen, verehrt die Jungfrau Maria und sucht zwischen schnellen Nummern und Morphiumspritzen nach einer Struktur und einem Lebenssinn, die ihr bislang versagt geblieben sind. So richtig nachvollziehen kann diese Hinwendung zur Kirche freilich nicht jeder. »Es ist allerliebst zu sehen, wie sich bei ihr der Entschluss, katholisch zu werden, so durchaus deutlich aus Neugier, Sentimentalität und Geilheit zusammensetzt«, schreibt beispielsweise Erich Mühsam. »Ich konnte ihr ihre mystische Kindlichkeit so wenig glauben wie [Hugo] Ball seine abbéhafte Ernsthaftigkeit.«
Mit neunundzwanzig Jahren wird Emmy verhaftet und kommt für mehrere Monate hinter Gitter. Wer ihren 1919 erschienenen Roman »Gefängnis« als Anklage gegen ein korruptes Gesellschaftssystem lesen will, kommt allerdings nur teilweise auf seine Kosten. Er ist halb Kafkascher »Prozess«, halb augustinische »Confessiones«. Zwar lässt der Zeitpunkt von Emmys Verhaftung im schicksalhaften Sommer 1914 vermuten, dass der traumatische Gefängnisaufenthalt der eher unpolitischen aber erklärt antimilitaristischen Kabarettistin mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zusammenhängen muss. Aber Emmys eigentliches Vergehen ist denkbar banal: Als Gelegenheitsprostituierte hat sie sich des »Beischlafdiebstahls« schuldig gemacht, indem sie bei einem Aufenthalt in Hannover einen ihrer zahlreichen Freier um seine Barschaft erleichterte. So erlebt sie den Kriegsausbruch Anfang August in Untersuchungshaft. Sie gerät in die Mühlen der bayerischen Justiz, wird für schuldig befunden und sitzt ihre vierwöchige Strafe zwischen September und Oktober ab. Im Dezember desselben Jahres kommt Emmy wieder für mehrere Wochen ins Gefängnis, als die Vorbestrafte im Zusammenhang mit der Desertion des mit ihr befreundeten Schriftstellers Franz Jung von der Ostfront der Fluchthilfe bezichtigt wird.
Eisenstäbe, Wärter, Heiligabend in der Zelle. Klinker, Kohlsuppe, kalter Entzug. Hennings Verhaftung stellt einen radikalen Einschnitt dar, als sozusagen die Titanic ihrer bisherigen subjektiven Selbstwahrnehmung mit dem Eisberg der sich ihr umgebenden objektiven Wirklichkeit zusammenprallt. Sie hat schlicht und ergreifend ihr »Leben überlebt«, wie sie später schreibt. Die Zeit im Gefängnis, wo Emmy auf brutale Weise den Konsequenzen ihres denkbar egoistischen Lebenswandels in die Augen schauen muss, wird zu einer Zeit schonungsloser Gewissensprüfung für die noch frische Konvertitin. Vor allem macht sie sich Gedanken über ihre Beziehung zur eigenen Familie, zumal zu ihrer Tochter, die sie ohne jegliche finanzielle oder gar moralische Unterstützung in Flensburg zurückgelassen hat. Sie stellt auch ihren leichtfertigen Umgang mit ihren Geliebten und Freiern in Frage. Wie sie ihrem Wärter erzählt: »[I]ch habe etwas zu beichten. Staunen würden Sie, wenn Sie es hören würden. Glauben Sie mir. … Mir fällt alles so ein. Ich brauche meine Sünden nicht zu suchen; denn meine Sünde fällt zu sehr auf, weil nur Sünde da ist. Ich habe Schuld. Nur ich habe Schuld. An unendlich Vielem. Vielleicht an Allem. Mein Beichtvater sagte mir, die Unterlassungssünden seien am schwersten zu verzeihen. Ich glaube, es gibt nur Unterlassungssünden.«
Dabei betrachtet sie den eigentlichen Auslöser ihrer Inhaftierung, den »Beischlafdiebstahl«, eher nüchtern und erkennt bereits Jahre vor der Veröffentlichung von Kafkas »Prozess« seine Kafkaschen Implikationen:
Hätte mein Kläger nicht auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen? Aber mein Kläger war gar nicht da. Er ließ sich entschuldigen, hatte keine Zeit. Er ließ sich vertreten. Aber wie kann er sich vertreten lassen, wenn er sich benachteiligt, vergewaltigt oder beleidigt fühlt? … Die Einseitigkeit ist beunruhigend. … Man nehme das schutzloseste Geschöpf, ein Straßenmädchen. Wenn es verboten ist, sich Liebesstunden bezahlen zu lassen, muss es verboten werden, Liebesstunden zu kaufen. Aber die Erfahrung lehrt, dass der Mensch ohne Liebesstunden nicht leben kann. Also müsste die Liebe anders organisiert werden. Aber »organisierte Liebe« klingt so peinlich. Dennoch kommt man darüber nicht hinweg. Der Gerichtshof besteht aus Männern, und es erfordert weniger Kraftaufwand, das schwache Geschlecht zu bestrafen, als Männer zur Rechenschaft zu ziehen, die ihre stärksten Neigungen geheim zu halten wünschen. Ich wünschte, die vergewaltigten Männer könnten einmal die verächtlich lächelnden Gesichter ihrer Verführerinnen sehen, die auf dem Korridor der Strafanstalt leise plaudernd die Geheimnisse ihrer Kläger preisgeben. Im Hofe des Untersuchungsgefängnisses sah ich die lächelnde Überlegenheit auf den Gesichtern der Frauen und Mädchen, die die Straße machen; der Mädchen, die siegen und graziös genug sind, sich für besiegt zu erklären. Diese Höflichkeit scheint gefährlich zu sein, denn man sperrt sie in fußdicke Mauern.
Wie jeder andere empfindsame Mensch kann Emmy ihre Hafterfahrung nicht ohne weiteres wegstecken. Die Tage und Wochen hinter Gittern ätzen sich in ihre Seele und die Strafe wird dadurch »lebenslänglich«. Sie hat nämlich »für immer einen Schock bekommen, einen Knacks, der sich nicht rückgängig machen lässt. ... Ich versuche mir zu helfen, indem ich die Schuld taxiere; denn ein Verbrechen wird doch taxiert und abgestempelt und vom Verbrecher durch Strafe vergütet.«
So wird Emmys Gefängnisaufenthalt zu einem Wendepunkt, sowohl in ihrem persönlichen als auch in ihrem schöpferischen Leben. In dieser Zeit fällt die Intensivierung ihrer Beziehung zum aus gesundheitlichen Gründen ausgemusterten Dichter Hugo Ball, der großen Liebe ihres Lebens - »der Mann, mit dem ich beten konnte« - der sie im Gefängnis besucht und mit dem sie schon im Mai 1915 in die Schweiz auswandert.
Der Traum eines Neubeginns in einem Land ohne Krieg wird allerdings zunächst zum Alptraum. Das Geld ist bald alle, die beiden dubiosen Ausländer werden von der Schweizer Polizei überwacht. Emmy spritzt Morphium und prostituiert sich weiter mit Balls Zustimmung. Hugo verprügelt sie, bis die Gendarmen kommen. Als Emmy eine neue, nicht genehmigte Liebschaft eingeht, jagt Ball sie mit einem Revolver. Im September folgt ein Selbstmordversuch – Emmy nimmt eine Schere und öffnet die Schlagadern – von dem sie sich wieder erholt. Emmy und Hugo leben zunächst von Almosen, treten dann auf Bühnen auf, versuchen wieder künstlerisch Fuß zu fassen.
In Zürich gründet das Paar im Februar 1916 in der Spiegelgasse 1 das berüchtigte Cabaret Voltaire. Die Künstler Tristan Tzara, Hans Arp, Sophie Taeuber, Richard Huelsenbeck und Marcel Janco gesellen sich dazu und gründen eine neue Kunstbewegung. »Dada«, erinnert sich Emmy 1929, » – das Wort stammt von mir. Ich habs in einer Spielerei oft Hugo gesagt, wenn ich spazieren gehen wollte. Alle Kinder sagen zuerst: Dada.«
Während im Cabaret Voltaire gepoltert und provoziert wird, geht der Dadaismus – die organisierte Anti-Kunst – in die Kulturgeschichte ein. Hugo trägt seine »Lautgedichte« vor und Emmy singt. Ein niederländischer Kritiker beschreibt einen ihrer letzten Auftritte im Juli 1916 wie folgt:
Emmy Hennings singt mit einem hässlich expressiven Stimmchen und das magere, vom Morphium zerstörte Gesicht grinst bei den heftigen Bildern, die sie malt. Sie singt ein Soldatenlied von ihrem Freund Hugo Ball auf diesen Krieg, wobei ihr weißer, magerer Kopf einem Totenschädel gleicht. Sie singt es zu einer einfachen, beinahe fröhlichen Melodie, und in jeder Zeile hört man den Sarkasmus und den Hass auf den Herrn Kaiser, die Verzweiflung der in den Krieg gejagten Männer.
Hier schreibt sie auch ihren Kurzroman »Gefängnis«, der 1919 im Berliner Erich Reiß Verlag erscheint und sie in literarischen Kreisen bekannt macht. Die Zusammenarbeit mit den Dadaisten währt allerdings nur kurze Zeit, denn die beiden Literaten erkennen die innewohnende Spießigkeit dieses avantgardistischen Experiments allzu schnell. »[Ich] hatte wenig Lust, mich als dienendes Glied an eine nicht einmal halbe Kunstrichtung anzuschließen«, schreibt Emmy ein Jahrzehnt später. »Es waren mir zu viele Leute entzückt davon.«
Nach seiner Heirat 1920 zieht sich das Paar zusammen mit Emmys Tochter Annemarie ins Tessin zurück und widmet sich einem zwangsläufig kargen Lebensstil sowie einem strengen katholischen Mystizismus, der von zahlreichen Liebesaffären gewürzt ist. Die Familie lebt nur noch von den spärlichen Einkünften ihrer Bücher und Gedichte, die in diesen Jahren der Inflation kaum zum Leben reichen. Nach Balls qualvollem Krebstod im Jahre 1927 bleibt Emmy, die Schmerzensfrau, im Tessin. Sie lebt einfach und ernährt sich von Fabrikarbeit. Hier unterhält sie eine enge Freundschaft mit ihrem Nachbarn Hermann Hesse und schreibt bis zu ihrem eigenen Tod im Jahre 1948 weiterhin spirituelle Gedichte und Memoiren. Trotz ihrer offensichtlichen Frömmigkeit war Emmy allerdings keine traditionelle Katholikin. Wie sie 1927 in einem Brief an Hesse schrieb: »Es ist ein Unterschied, ob ich den lieben Gott bekenne oder die wohlgepflegten Katholiken. Ich gehöre nicht zu diesen, aber kleinkriegen sollen sie mich nicht. Ich hab im Grunde eine unbesiegbare Aversion gegen jedes System und keine Lust, mich einem anderen Gesetz unterzuordnen als dem heiligen Eigensinn …«
Von all Emmys Werken bleibt »Gefängnis« das wohl unmittelbarste und mitreißendste. Es ist mehr als ein Roman und mehr als eine Reportage. »Das Buch ist stilistisch ein ununterbrochenes Feilen und Nagen an Eisengittern«, schrieb ihr Mann bei seinem Erscheinen. »Es kennt keine Kapitulation und keinen Kompromiss. Es ist unerschütterlich in seiner exakten Redlichkeit.« Der expressionistische Schriftsteller Paul Hatvani urteilte so: »Dieses De Profundis einer Frau ist das allererotischste Buch der letzten Jahre. Und es hat von Erotik nicht mehr als den Duft ... Das Buch ist mehr als ein Roman: es ist ein epischer Akt. Ihn hat die harte Wirklichkeit gemalt.«
Vor allem berichtet »Gefängnis« nicht nur von Emmys ganz subjektivem Erleben, sondern auch von den Schicksalen ihrer weiblichen Mithäftlinge, die größtenteils aufgrund ähnlich absurder Anschuldigungen ihr Dasein unnütz im Gefängnis fristen und daher das Los aller Vernachlässigten und Unterdrückten dieser Welt symbolisieren. Jeder Mensch, der in eine aussichtslose Situation gerät, kann sich in Emmy wiederfinden. Wie Hermann Hesse 1938 schrieb: »[Emmy Hennings] lebt lieber unter den Kämpfenden, Armen, Bedrückten, sie liebt die Leidenden, sie fühlt für die Verfolgten und Rechtlosen. Sie bejaht das Leben auch in seiner Härte und Grausamkeit und liebt die Menschen bis in alle Verirrung und Not hinein. Und ich glaube, dass diese aufrichtigen, erlebten und so schönen Bücher uns überleben werden.«
Wie Sie schon sehen – diese Zeitreise lohnt sich.
Leni Waltersdorf, Berlin im November 2020
Literatur
Ball, Emmy: Das Brandmal. Tagebuch. Erich Reiss Verlag, Berlin 1920.
Ball-Hennings, Emmy: Hugo Ball. Sein Leben in Briefen und Gedichten. S. Fischer Verlag, Berlin 1930.
Dieselbe: Hugo Ball. Sein Leben in Briefen und Gedichten. S. Fischer Verlag, Berlin 1930.
Behrmann, Nicola: Geburt der Avantgarde – Emmy Hennings. Wallstein Verlag, Göttingen 2018.
Bürger, Christa : Gasse, Gosse, Gitter. Emmy Ball-Hennings, eine Mystikerin der Straße. Essay im Deutschlandfunk, 10. Januar 2010.
Echte, Bernhard (Hrsg.): Emmy Ball Hennings: ich bin so vielfach … Stroemfeld / Roter Stern, Frankfurt am Main 1999.
Gass, René: Emmy Ball-Hennings. Wege und Umwege zum Paradies; eine Biographie. Pendo Verlag, Zürich 1998.
Hesse, Hermann: Vorwort zu Emmy Ball-Hennings, Blume und Flamme. Geschichte einer Jugend. Verlagsanstalt Benziger & Co., Einsiedeln/Köln 1938.
Koch-Kanz, Swantje: Emmy Ball-Hennings, Fem-Bio, http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/emmy-ball-hennings/
Reetz, Bärbel. Leben im Vielleicht. Eine Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001.
Sobel, Alfred: »Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen«. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glaube. Fe-Medienverlag, Kißlegg 2015.
Süllwold, Erika: Das gezeichnete und ausgezeichnete Subjekt. Kritik der Moderne bei Emmy Hennings und Hugo Ball. Metzler, Stuttgart 1999.
Erster Teil
Inzwischen sind drei Monate vergangen.
Ich habe noch keine Vorladung zur Hauptverhandlung bekommen.
Ich bin nach M. zurückgekehrt. Ich wage nicht, ein Engagement ins Ausland anzunehmen. Ich bin besorgt, meine eventuelle Verurteilung könnte eine sofortige Entlassung aus dem Engagement zur Folge haben.
Ich halte meine Angelegenheit geheim. Warum?
Ich müsste mich erklären; begründen müsste ich … von Anfang an … aber wer fragt nach mir? Sollte jemand nach mir fragen … Oh das Interesse! Restlos wollte ich mich bekennen. Aber die Angst, nicht verstanden zu werden, lässt mich schweigen.
Nur angehört werden, und alles wäre gut. Das ist es: angehört werden. Ich glaube, erstaunt und beglückt würde ich fragen: »Lieben Sie mich denn? Neugierig sind Sie nicht; denn wer kann neugierig sein, das Unglück des andern zu hören?«
Warum kann ich nicht sprechen? Abends singe ich; trete in einer Künstlerkneipe auf.
Man sagt mir manchmal am Abend: »Sie haben famose Schlager.« Oder: »Sie sorgen wirklich für Abwechslung im Programm.«
Dann fällt mir mein Prozess ein. Das Programm; meine Zukunft. Zukunft? Klingt das nicht anspruchsvoll? Welche Zukunft kann jemand haben, der für die Unterhaltung des Publikums sorgt? Ach, die Zukunft wird kommen. Aber welche Zukunft?
Ich will meinen Prozess beschleunigen. Will ich mein Unglück abkürzen? Umgehen? Muss ich denn da hindurch? Gelingt mir keine Schiebung? Ich möchte mein Leben wohl arrangieren nach meinem Gefallen. Ich versuche. Und ich schreibe an das Königliche Amtsgericht folgenden Brief:
»Sehr geehrter Herr!
Da ich für vier Wochen nach Paris reisen möchte, bitte ich Sie höflichst, mir mitzuteilen, ob es nicht möglich ist, die Verhandlung entweder in diesen Tagen oder nach meiner Zurückkunft aus Frankreich anzusetzen. Dankbar wäre ich Ihnen für baldige Antwort.
Mit vorzüglicher Hochachtung usw.«
Ich hoffe, dass ich jetzt alles gut erledigt habe. Habe ich nicht einen Weg gefunden, meinen Prozess zu beschleunigen oder hinauszuschieben? Die verzwickte Situation bestimmt meine Handlungen, scheint mir, nicht ich.
Gleichviel. Ich werde meine Sachen packen. Ich werde nach Paris fahren. Etwas passt mir nicht.
Dass ich immer wegfahre, wenn mir etwas nicht passt. Ich habe ein Telegramm bekommen. Nächste Woche werde ich in Paris erwartet.
Es vergehen zwei Tage. Ich bin müde vor Aufregung. Vielleicht habe ich Reisefieber. Aber das ist gleichgültig. Warum sollte ich kein Reisefieber haben?
Ich bleibe zu Bett. Da kann mir wohl nichts passieren, denke ich …
Es ist acht Uhr früh. Es klopft. Ob ich die Tür wohl verschlossen habe? Soll ich aufstehen, um nachzusehen? Es steht doch jemand vor der Tür …
Es klopft schon wieder. Ich gebe keine Antwort. Nicht um alles in der Welt. Wenn es aber die Antwort vom Amtsgericht ist? Es bleibt mir nicht viel Zeit zum Überlegen. Soll ich sagen: »Bedaure, bin soeben verrückt geworden?« Oder: »Ich bin im Begriff zu sterben?« Das Gesicht zur Tür gewandt, riskiere ich, halblaut zu äußern »Der Tod entschuldigt alles.«
Ein Herr tritt ein. Tür war nicht verschlossen. Natürlich nicht …
»Also, ich komme da von der Polizei. Tag.«
»Ach so.«
Ich richte mich ganz frisch in die Höhe. »Das ist aber nett! Bringen Sie mir vielleicht die Antwort auf meinen Brief? Nun, wie steht’s?«
»Ja, das weiß ich auch nicht. Kommen Sie mal … na sagen wir … bis zehn Uhr aufs Polizeipräsidium. Zimmer 144. Dann können Sie ja sehen.«
»Ja, das kann ich … ja … gewiss … warum nicht? Also um zehn Uhr sagten Sie? Um zehn Uhr … also … ja … sagten Sie nicht: um zehn Uhr Polizeipräsidium?«
»Ja. Wissen Sie, wo das ist? Sie fahren mit der Linie 6, steigen am Bahnhofsplatz um in die 9, dann fahren Sie direkt drauf los.«
Ich fange an nachzudenken: … dann fahre ich direkt drauflos …
»Ja, ich weiß nicht, wo es ist, aber das ist das wenigste. Das finde ich schon mit der Zeit.«
Der Herr sagt bedenklich:
»Ja, dass Sie aber auch pünktlich kommen.«
»Das ist doch selbstverständlich. Ich werde mich sofort auf den Weg machen.«
»Nein, das ist nicht nötig. Es ist erst zehn Minuten nach acht.«
Das finde ich wunderbar. Erst zehn Minuten nach acht? Ich rechne blitzschnell und immer falsch: sechzig Minuten sind ein Jahr, dreiviertel Minuten bis neun … bald Weihnachten; fünfzehn Minuten … März … es wirbelt … selbst mein Irrtum hat noch Gesetze. Meine Hände kleben. Ich krampfe unter der Bettdecke meine Fußzehen zusammen. Das kann ich ganz gut, aber es geht doch nicht auf die Dauer. Wenn der das sieht, denkt er Wunder was. Ob ich ihn mal frage, warum er denn noch immer dasteht, während mein Wecker auf die widerlichste Weise unbarmherzig tickt?
Ich ziehe den Wecker auf. Ich tue ganz unbefangen. Ich stelle den Wecker auf das Nachttischchen zurück. Dort liegen so vornehm meine Bücher. Ja, die liegen sehr vornehm da … Aber das Polizeipräsidium … Steige in die Linie 9, fahre direkt drauf los …
»Bitte, sagen Sie mir, aber wirklich, frei heraus, ob ich verhaftet werde. Das möchte ich sehr gerne wissen. Es nützt mir ja alles nichts. Das muss ich wissen. Danach muss ich mich richten. Das wäre nämlich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Bitte, nehmen Sie doch Platz. So. Ja, sehen Sie, das Verhaften könnte ich nicht vertragen … Ich kann Ihnen das nicht so schnell erklären.«
»Tja, ich verstehe Sie vollkommen, Fräulein.«
Der Herr sieht mich lauernd von der Seite an.
Wie von selbst kommen mir die Worte: