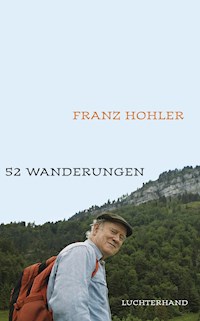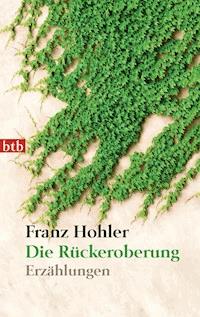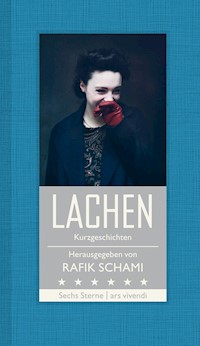Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Franz Hohler nur ein Jahr lang ausprobieren, ob seine Kunst Anklang findet. Entstanden ist ein ganzes Lebenswerk. Seit dem ersten Bühnenerfolg 1965 hat er nicht mehr aufgehört, seine eigenen Ideen zu verwirklichen: als Liedermacher und Kabarettist ebenso wie als Autor von Kinderbüchern, Theaterstücken, Romanen, Erzählungen und Gedichten. Nun blickt Hohler zurück. Im Gespräch mit Klaus Siblewski gewährt er überraschende Einblicke in sein Schaffen, nimmt seine Leserinnen und Leser mit an die Orte und in die Geschichten, in denen er daheim ist. Er erzählt, wie seine Neugier ihm das Leben rettete, wieso General Guisan einst ein Rivale war und weshalb er sich für einen Performance-Künstler avant la lettre hält. Und er erklärt, wie die Tschipo-Kinderbücher, das »bärndütsche Gschichtli« und seine Romane entstanden sind. Von erlebten und erfundenen Geschichten handelt dieser Band, der Hohler als fabulierenden Menschenfreund voller Witz und feinsinnigem Humor zeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Hohler
Das Jahr, das bis heute andauert
Ein Gespräch mit Klaus Siblewski
Kampa
»An Scheitern habe ich nicht gedacht«
Herkommen
Lass uns mit deiner Familie beginnen, mit deinem Vater, der Mutter. Wer waren sie?
Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin. Sie haben sich im Solothurner Lehrerseminar kennengelernt. Es muss die große Liebe gewesen sein. Beim Aufräumen nach dem Tod der beiden habe ich ihre Liebesbriefe gefunden. Die habe ich aber schnell wieder weggelegt. Ich kam mir wie ein Voyeur vor, selbst bei flüchtigem Lesen.
Diese Briefe haben die Eltern sich wann geschrieben?
Nach dem Lehrerseminar, in dem sie sich kennengelernt hatten. Dann beendeten sie ihre Ausbildung als frischgebackene Lehrkräfte, verließen das Seminar und waren an verschiedenen Orten tätig. Meine Mutter war auf dem Brunnersberg, sie hatte dort eine Stelle gefunden. Mein Vater hatte keine feste Stelle.
Wurden Lehrpersonen damals nicht gebraucht?
Doch, aber es war eine schwierige Zeit, die Jahre um 1935, das war die Zeit der Arbeitslosigkeit. Mein Vater bewarb sich für ein Stipendium, erhielt es und konnte mit dem Geld für ein halbes Jahr nach Paris gehen. Die Hälfte des Stipendiums musste er zurückzahlen. Er hatte es von der Firma Bally in Schönenwerd erhalten, dort, wo er aufgewachsen war. Bally war der König in diesem Dorf. Das ganze Dorf Schönenwerd hatte bei Bally gearbeitet, schon der Vater meines Vaters war Webermeister in der Bandfabrik Bally gewesen.
Und in dieser Zeit schrieben sich deine Eltern also Liebesbriefe?
Ja, aber weniger Briefe, vor allem viele Postkarten. Das war billiger, und geschrieben haben sie diese Postkarten meistens in Stenografie, damit der Postbote sie nicht lesen konnte – wie sie annahmen. Da ich der Stenografie mächtig bin, konnte ich sie lesen, habe aber dieses Lesen nicht lange durchgehalten.
Dein Vater kam aus Paris zurück, und die Zeit des getrennten Lebens deiner Eltern endete, richtig?
Ja. Mein Vater bekam eine Stelle in Seewen im Kanton Solothurn. Meine Eltern zogen dorthin, der Krieg war damals schon ausgebrochen. Mein Vater musste dann ins Militär. Er wurde eingezogen, später jedoch als andere Soldaten. Er war wegen einer Krankheit zuerst für dienstuntauglich erklärt worden, wurde dann doch eingezogen und erhielt eine schnelle Ausbildung bei den Flak-Soldaten. Während Vaters Zeit beim Militär hat meine Mutter für ihn seine Lehrerstelle in Seewen übernommen – als seine Stellvertreterin. Sie haben beide gerne und engagiert unterrichtet.
Du bist aber in Olten und nicht in Seewen groß geworden.
Das stimmt nicht ganz. Erst nach dem Krieg fand mein Vater eine Stelle in Olten. Ich habe von 1943, bis ich vier Jahre alt war, in Seewen gelebt, erst danach in Olten. Aber wirklich groß geworden bin ich in Olten.
Wie war Olten damals?
Olten war eine Kleinstadt und ist es heute noch, aber eine Kleinstadt mit Theater, Kino, einem Orchester – wenn auch einem Laienorchester. Es gab eine Dramatische Gesellschaft in Olten. Und was wichtig für mich war: Ich kam mit urbaner Kultur in Berührung.
Kam Kultur auch in deinem Elternhaus vor, oder gab es das nur in der Stadt?
Mein Elternhaus war für mich immer ein Ort, in dem Kultur gelebt wurde. Mein Vater war aktives Mitglied der Dramatischen Gesellschaft und spielte viele Jahre lang Theater. Er war auch jahrzehntelang Redaktor der Theaterzeitung. Darin hat er über Gastspiele am Oltner Theater geschrieben, die ursprünglich im Städtebundtheater Solothurn-Biel oder in den Stadttheatern von Bern oder Basel gezeigt wurden. Die Bürgergemeinde gab zu all diesen Aufführungen ein Heft heraus, in dem die Stücke beschrieben wurden. Auch zu den Konzerten des Stadtorchesters oder der Orchester, die nach Olten eingeladen wurden, entstand jeweils ein Heft. Für diese Hefte schrieb und redigierte er. Er war in einem Sinne aktiv, wie das frühere Lehrergenerationen waren. Dazu gehörte auch, dass er sich beispielsweise in der »Liga gegen Tuberkulose« engagierte. Es gab damals noch mehr Lungenerkrankungen als heute, und mein Vater war eine Zeit lang Präsident dieser Liga. Einige Jahre präsidierte er auch die christkatholische Kirchgemeinde in Olten.
Bisher hast du hauptsächlich von deinem Vater gesprochen. Wie hast du deine Mutter erlebt?
Meine Mutter hat sehr gut Geige gespielt. Sie war Mitglied des Stadtorchesters in Olten und spielte jahrzehntelang in diesem Orchester. Ich habe als Gymnasiast auch in diesem Orchester gespielt. Sie war genauso aktiv wie mein Vater. Sie hat sehr viel Unterricht gegeben. Und das in einer Zeit, als es alles andere als selbstverständlich war, dass Frauen vor Klassen standen.
Welche Art von Stellen hat sie übernommen?
Sie übernahm mehrmals sogenannte Verweserstellen, das heißt, sie vertrat ein ganzes Jahr lang einen Lehrer, der sich weiterbildete oder seinen Militärdienst leistete. Dessen Stelle hatte sie dann auf Zeit inne. Ich ging einmal selbst ein halbes Jahr zu ihr in die Schule. Beim Aufräumen fand ich übrigens einen geharnischten Brief von ihr, den sie an die Erziehungsdirektion geschickt hatte, die ihr für eine Vertretung einen zu niedrigen Lohn angeboten hatte.
Und du, warst du tagsüber alleine und bist ohne Eltern groß geworden, oder sind deine Eltern jeweils zur gleichen Zeit wie du aus der Schule nach Hause gekommen?
Ich habe einen Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich. Wir kamen meistens zusammen von der Schule zurück, und wenn wir nach Hause kamen, waren die Eltern oft noch nicht da. Das war aber nicht weiter schlimm. Zu Hause mussten wir als Erstes den Herd mit dem Dampfkochtopf anschalten. Der passende Satz dazu lautete: »Wenn’s pfüüst, Deckel drauf und kleinstellen.« (»Pfüüst« ist ein Mundartausdruck und meint dieses zischende Geräusch, wenn beim Topf der Dampf entweicht.) Bei diesen Töpfen musste man früher noch ein Deckelchen herunterdrücken.
War es für dich und deinen Bruder schlimm, dass ihr euch selber versorgen musstet?
Nein, das war für uns selbstverständlich, wir waren geübt darin, das Essen fertig zu kochen. Das konnten wir gut akzeptieren. Wir verstanden auch, dass die Eltern Musik machen und an Sitzungen oder Theaterproben teilnehmen wollten. Kultur gehörte zu ihrem Leben. Und mein Bruder und ich haben ebenfalls sehr früh begonnen, ein Musikinstrument zu erlernen. Mein Bruder Geige, ich Cello.
Habt ihr euch dagegen zur Wehr gesetzt, neben der Schule ein Instrument erlernen zu müssen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sahen es bei unseren Eltern: Sie unterrichteten, musizierten, und wir haben es als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, es wie sie zu machen und ebenfalls ein Musikinstrument zu erlernen. Schon bald konnten wir als Familie Streichquartett spielen. Meine Mutter erste Geige, mein Bruder zweite, mein Vater Bratsche und ich Cello. Wir haben es bis zur »Kleinen Nachtmusik« von Mozart gebracht.
Und du, hast du als Kind gleich mit Cello begonnen? Du hast ein halbes Cello für Kinder bekommen, nehme ich an.
In der zweiten Primarschulklasse hatten wir obligatorisch Blockflötenunterricht. Das hat mir gefallen, Blockflöte spiele ich bis heute sehr gerne. Dann fragten mich meine Eltern, welches Instrument ich lernen wolle. Bei uns zu Hause gab es ein Klavier und ein Cello – das meines Großvaters. Als mir diese Frage gestellt wurde, war ich zehn Jahre alt. Ohne zu zögern, habe ich gesagt: »Cello.«
Die Geschichte dieses Cellos hast du doch einmal erzählt.
Ja, im Prosastück »Der Vater meiner Mutter« im Buch Das Ende eines ganz normalen Tages. Mein Großvater hatte es nach einer harten Jugend als Verdingkind geschafft, einen Beruf zu erlernen und auszuüben und eine Familie zu gründen. Und als er 42 Jahre alt war, wollte er sich einen Wunsch erfüllen und Cello spielen lernen. Er ließ sich von einem angesehenen Geigenbauer ein Cello anfertigen, ging damit zu einem Cello-Lehrer und erfuhr von diesem, seine Hände seien zu klein für das Cello. Immer wenn er mir das erzählte, zeigte er mir jeweils, dass er den kleinen Finger nicht weit genug spreizen konnte. Er ging dann in einen Mandolinenklub, das Cello aber musste er noch jahrelang abzahlen. Drei Jahrzehnte lang hat es auf mich gewartet. Ich begann auf einem Dreiviertel-Instrument, aber schon bald waren meine Hände samt meinem kleinen Finger groß genug, sodass ich auf das Cello meines Großvaters wechseln konnte. Auf diesem Cello spiele ich noch heute. Und wenn ich meine Chansons sang, begleitete ich mich damit.
Wann wurden deine Eltern geboren, welche Fächer haben sie unterrichtet, und an welcher Art von Schule haben sie gearbeitet?
Beide wurden 1915 geboren, beide haben in der Grundschule, die in der Schweiz Primarschule heißt, unterrichtet. Mein Vater hat sich später zum Sekundarlehrer weitergebildet. Und ihre Entscheidung, das Lehrerseminar zu besuchen und keine weiterführende Ausbildung, ein Studium zum Beispiel, anzustreben, hatte mit der damaligen Zeit zu tun. Es waren die Jahre zwischen 1930 und 1935, als sie diese Ausbildung machten. In diesen Jahren war die Schweiz ein armes Land.
Heute, mit weniger ökonomischem Druck, hätten deine Eltern eine Ausbildung zu Gymnasiallehrern angestrebt, verstehe ich das richtig?
Ja, in der heutigen Zeit wären sie vielleicht an die Universität gegangen und hätten sich dort für ein Studium eingeschrieben. Meine Mutter hätte vielleicht Musik studiert und mein Vater etwas mit Sprachen, auch Germanistik möglicherweise. Er war ein leidenschaftlicher Leser und besaß am Ende seines Lebens eine große Bibliothek. Aber Anfang der dreißiger Jahre war es schon eine Auszeichnung, wenn man es schaffte, ins Lehrerseminar zu gehen. Das hatten sie beide geschafft.
Hatten deine Eltern das Gefühl, sie mussten ihre Ambitionen unverdientermaßen aufgeben?
Nein, meine Mutter war gerne Primarlehrerin, und mein Vater war ein passionierter Pädagoge. Nach seiner Ausbildung zum Sekundarlehrer unterrichtete er auch gerne auf dieser Schulstufe. Die Sekundarschule steht im Kanton Solothurn zwischen der höheren Schule, der »Bezirksschule«, und der Grundschule. Sie fängt diejenigen auf, die die höhere Schule nicht schaffen, die aber auch nicht in der Grundschule bleiben. In der Sekundarschule zu unterrichten, hat er nicht als etwas minder Wertvolles angesehen.
Welche Fächer hat er unterrichtet?
Die sprachlichen Fächer, Deutsch, Französisch, aber auch das Fach Geschichte. In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern wurde er nicht eingesetzt.
Wie war sein Unterrichtsstil? Kannst du dazu etwas sagen – du warst ja nie sein Schüler, oder?
Nein, das war ich nicht, aber ich habe ihn zwei, drei Mal in seiner Klasse besucht und mit den Schülern und Schülerinnen Sprachspiele gemacht. Mein Vater war offen für diese eher künstlerischen Themen im Fach Deutsch. Er hat gerne auch Gedichte gelesen und darüber diskutiert, etwa über »Manche freilich müssen drunten sterben« von Hofmannsthal, was ja nicht die leichteste Kost ist. Ich habe ihn auch einmal auf einer Schulreise auf den Säntis als einer seiner Helfer begleitet.
Wolltest du denn auch Lehrer werden?
Die Schule als Berufsfeld hat mich interessiert. Zu der Zeit allerdings, als ich meinen Vater in der Schule besuchte, hatte ich bereits ausgeschlossen, selber Lehrer werden zu wollen.
Wie alt warst du zu jener Zeit, und warum wolltest du nicht Lehrer werden?
24 oder 25. Ich war damals bereits mit Erfolg aufgetreten und wollte weiter auf der Bühne stehen und meine Texte schreiben.
Das Leben in der Schweiz
Du hast von den dreißiger Jahren in der Schweiz gesprochen. Du selber bist 1943 geboren worden, während des Zweiten Weltkriegs. Wie war das Leben in der Schweiz in dieser Zeit, welche Folgen hatte der Krieg?
Ich weiß von beidem nur durch die Erzählungen meiner Eltern und meiner Großeltern. Sie sprachen oft über ihr Leben und die Verhältnisse, die sie vorfanden. Mein Großvater väterlicherseits ist in einer Familie aufgewachsen, die einen kleinen Bauernhof bewirtschaftete. Diesen Hof konnte nur eines der Kinder übernehmen, die anderen mussten den Hof verlassen und sich eine Beschäftigung suchen. Mein Großvater erbte nicht den Hof, er hatte dafür eine Ausbildung zum Weber gemacht und hat dann sein Leben lang als Meister in verschiedenen Fabriken gearbeitet, zuerst in Deutschland, in Säckingen. Sein Heimatort war Zuzgen, was nahe an der deutschen Grenze liegt. Um nach Säckingen, heute Bad Säckingen, zu kommen, hatte er einen Weg von anderthalb Stunden zurückzulegen. Morgens um sechs Uhr begann die Arbeit, dann musste er in Säckingen sein. Abends lief er die anderthalb Stunden wieder zurück nach Zuzgen. Alleine diese täglichen Fußmärsche kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Danach bekam er eine Stelle in einer kleineren Textilfabrik in der Nähe von Olten, musste jedoch fast sein ganzes Vermögen einbringen, damit er dort arbeiten konnte. Und du ahnst es – es ging nicht gut aus. Der Betreiber dieser Fabrik war übrigens der Großvater des Schweizer Schriftstellers und meines Freundes Christian Haller. Dessen Großvater führte die Fabrik in die Insolvenz. Mein Großvater verlor nicht nur sein Geld, das er in den Betrieb gesteckt hatte, sondern auch seinen Job.
Weiß Christian Haller davon?
Ja. Als Christian Haller ein Preis für seinen Roman Das schwarze Eisen (2004) verliehen wurde, in dem er auch vom Untergang der Fabrik erzählt, in der mein Großvater gearbeitet hatte, bin ich beim Empfang nach der Preisverleihung zu ihm gegangen, habe ihm zuerst gratuliert und dann im Scherz gesagt, er müsste mir eigentlich einen Teil des Preisgeldes geben.
Wie hat er reagiert? Hat er dir etwas vom Preisgeld abgegeben?
Ach wo, ich hatte das ja nur im Scherz gesagt. Er war aber sehr erstaunt, dass ich von diesen Vorgängen etwas wusste. Er hat mir erzählt, er habe lange nach Details dieser Geschichte gesucht, sei ins Wirtschaftsarchiv des Kantons Solothurn gegangen und habe dort nichts herausgefunden. Auf die Idee, mich zu fragen, war er selbstverständlich nicht gekommen.
Wie ging es dann weiter mit deinem Großvater?
Er ging zu Bally in Schönenwerd. Die Ballys stellten damals nicht nur Schuhe her, sie produzierten auch gewebte Bänder. Das war sogar das Erste, was sie in ihrem Unternehmen herstellten. Diese Bänder müssen beliebt und sehr gefragte Artikel gewesen sein. Noch heute gibt es diese kleinen Stoffrechtecke, die im Hemd festgenäht werden, und auf denen steht, dass man es nur mit 30 oder mit 60 Grad waschen soll. Früher waren Stoffstreifen mit bunten Mustern als Schmuck offenbar gut gehende Artikel.
Wie hoch war der Verdienst in einer Fabrik wie jener der Ballys?
Der Lohn war äußerst bescheiden, hart an der Grenze des Existenzminimums.
Und dieser geringe Verdienst erklärt, warum dein Vater ins Lehrerseminar gegangen ist und nicht studierte?
Ja, für meinen Vater kam ein Studium nicht infrage, weil das Geld dazu nicht vorhanden war.
Hast du deinen Großvater noch kennengelernt?
Ja, beide Großeltern habe ich gut gekannt. Mein Großvater väterlicherseits hat mich auch in die Fabrik mitgenommen. Er wollte mir zeigen, wie seine Welt aussah, die Webstühle und die Produktion. Er erklärte seine Arbeit. Ich weiß noch: Die italienischen Arbeiterinnen haben ihm fröhlich zugelacht, und er selber war auch ein fröhlicher Mensch und konnte gut mit dem umgehen, was er hatte.
Und deine Großmutter?
Die Mutter meines Vaters war eine humorvolle Person – mit einer stark satirischen Ader. Sie hat etwa Verse für die Unterhaltungsabende des Frauenturnvereins geschrieben. Sie konnte damals um die Jahrhundertwende keine Ausbildung nach der Schule machen. Sie hätte bestimmt Lehrerin werden oder vielleicht studieren können, wahrscheinlicher wäre es gewesen, dass sie Primarlehrerin geworden wäre. Ein Studium für junge Frauen war Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch ausgeschlossen.
Dein Großvater war Webermeister. Was machte deine Großmutter?
Nach der Schule war sie ein Jahr nach Zürich als Haushaltshilfe gegangen. Nach diesem Jahr ging sie zurück nach Sisseln und hat auch in der Weberei in Säckingen gearbeitet. Dort hat sie meinen Großvater kennengelernt.
Darüber hast du auch geschrieben.
Im Prosatext »Importzölle« im Band Fahrplanmäßiger Aufenthalt bin ich der frühen Geschichte dieser Großmutter nachgegangen. Ich hatte mich gefragt, warum die Fabrik in Deutschland lag, die Ballys wohnten nämlich in der Schweiz. Dann habe ich herausgefunden, weshalb sie ihre Produktion nach Deutschland verlagert hatten: Deutschland hatte hohe Importzölle auf Textilien aus der Schweiz erhoben. Die Ballys haben gemacht, was alle Unternehmer in einer solchen Situation tun: Sie haben ihre Produktion nach Säckingen ins Ausland verlegt. Dort mussten sie keine Zölle mehr auf ihre Waren bezahlen. Ich habe meine Existenz also diesen Importzöllen zu verdanken. In dem kleinen Prosastück habe ich dann geschrieben: »In dieser Fabrik hat mein Großvater als junger Grenzgänger (…) gearbeitet, und nicht nur er, sondern auch meine Großmutter, und dort lernten sie sich kennen. (…) und bei dem Gedanken, dass weder ich noch meine Söhne und unsere Enkelkinder auf dieser Welt wären, hätte Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Importzölle auf Bänder nicht erhoben, werde ich von einem leichten Schwindel erfasst.«
Das war ein gegen die Schweiz gerichteter Protektionismus.
Ja. Und wenn ich heute Nachrichten höre oder lese, muss ich manchmal an meine Geschichte denken. Importzölle werden ja immer noch als ein politisches Instrument eingesetzt. Donald Trump hat mit Importzöllen oder mit deren Androhung seine Ziele durchzusetzen versucht. Als ich das hörte, dachte ich: Wer weiß, vielleicht werden jetzt neue Familien gegründet, weil zwei Menschen ihr Land wegen der Arbeit verlassen müssen und sich dann im Ausland kennenlernen. Das ist eine Vorstellung, die mich immer noch bewegt.
Hat dein Großvater auch das Erstarken der Nazis mitbekommen?
Nein, sein Arbeitsaufenthalt in Deutschland war viel früher zu Ende. Geboren wurde er 1889, in Deutschland war er um 1905, 1910 herum. Diese Grenzgänge endeten mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Von da an arbeitete er in der Schweiz. Das Aufkommen des Nationalsozialismus hatte er nur von der Schweiz aus mitbekommen.
Dann war er zur Zeit des Kaiserreichs in Deutschland, hat er davon etwas erzählt?
Eine Geschichte ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Es gab eine Menge Schweizer, die nach Säckingen gingen. Einmal kam der deutsche Kaiser Wilhelm II. in Säckingen zu Besuch. Der ganze Ort war beflaggt, um den Kaiser willkommen zu heißen. Als ein Kollege meines Großvaters das sah, sagte er: »Da hängen sie für jeden Schafseckel die Fahnen raus.« »Schafseckel« grenzt in seiner Bedeutung an Arschloch, mein Großvater hatte daraufhin zu seinem Kollegen gesagt: »Geh sofort wieder zurück in die Schweiz!« Der Mann ist über die alte Holzbrücke, die es heute noch gibt, heim in die Schweiz gerannt. Als mein Großvater an seinem Arbeitsplatz ankam, wartete die Polizei schon auf seinen Kollegen.
Hat der Großvater auch vom Leben in der Schweiz erzählt, wie er es erlebt hatte?
Nicht allzu oft. Wenn sie als Kinder auf einen Sonntagsspaziergang mitgingen und man in ein Wirtshaus einkehrte, hätten sie als Getränk einen verdünnten Weißwein bekommen, erzählte er mir einmal. Nicht alkoholische Getränke gab es damals in Gasthäusern noch nicht. Beim Aufräumen meines Elternhauses habe ich auch Briefe meiner Großmutter gefunden. Sie hat sehr gern geschrieben, und in ihren Briefen hat sie festgehalten, was sie unternommen hatte. Mit Witz und leichter Distanz zu den Geschehnissen hat sie geschrieben. Einen Brief von ihr habe ich gefunden mit einem besonderen Schlusssatz. Diesen Brief hatte sie meinem Vater geschrieben, als er im Lehrerseminar war und sein Vater bereits in Schönenwerd in der Bally-Fabrik arbeitete. Das Lehrerseminar war in Solothurn, zu jener Zeit war das eine Tagesreise von Schönenwerd entfernt. Wenn man dort zur Schule ging, musste man im Kosthaus wohnen. Dorthin gingen diese Briefe. Meistens hat der Großvater am Ende noch etwas dazugeschrieben. In einem dieser Briefe lauteten seine Schlusssätze: »Pass gut auf in der Schule, damit du etwas lernst. Ich muss jetzt wieder zurück ins Zuchthaus.« Mit »Zuchthaus« meinte er die Fabrik. Das war ein Satz, der mich erschreckt hat. Ich spürte, dass er das, was er machte, und den Lohn, den er dafür bekam, zumindest als unbefriedigend empfand. »Zuchthaus« ist doch ein furchtbares Wort. Es bedeutete, dass er sich wie ein Gefangener fühlte – ohne Aussicht darauf, rauszukommen. Er meinte diese Formulierung ironisch, so wie auch meine Großmutter den ganzen Brief in einem ironischen Ton verfasst hatte. Trotzdem benutzte er eine grausame Metapher – gleichgültig, wie spöttisch sie gemeint war.
Dein Vater hatte dann aber den Zweiten Weltkrieg erlebt und die Zeit davor, die zu diesem Krieg führte.
Mein Vater musste seine Lehrertätigkeit immer wieder unterbrechen und ins Militär gehen. Manchmal dauerten seine Aufenthalte dort sehr lange. Er hat mir erzählt, er habe, wenn er Wache hielt, den Ulysses von James Joyce gelesen. Er musste nichts tun, nur aufpassen, ob sich jemand ihrer Stellung näherte. Er versuchte, daraus das Beste zu machen und dachte, nun habe er die Zeit, ein umfangreiches Buch der Weltliteratur zu lesen. So besorgte er sich den Ulysses. Während der Corona-Lockdowns, als ich viel seltener das Haus verlassen und nicht ins Ausland fahren konnte, hatte ich einen ähnlichen Gedanken. Ich fragte mich, ob ich nicht einen Roman vom Umfang und der Bedeutung eines –Ulysses lesen sollte. Und nicht nur ich habe an meinen Vater während des Kriegs gedacht. Ich hörte Leute sagen: »Das ist ja furchtbar, wenn ich nicht mehr nach Italien fahren kann, das ist ja wie bei unseren Eltern im Krieg.« Allerdings sind meine Eltern auch in den ersten Jahren unmittelbar nach Kriegsende in der Schweiz geblieben. In den Nachbarländern war sehr viel verwüstet. Das dämpfte die Reiselust. Meine Eltern blieben mindestens acht oder neun Jahre in der Schweiz, bis sie wieder unter halbwegs normalen Bedingungen das Ausland besuchen konnten.
Während des Kriegs dürften die Löhne in der Schweiz ebenfalls niedrig gewesen sein.
Ja, das waren sie. Mein Vater hatte einen Monatslohn von 400 Schweizer Franken. Mit diesem Geld musste die Familie in Seewen auskommen. Meine Eltern haben ein sogenanntes Haushaltungsbuch geführt und genau aufgeschrieben, was sie ausgegeben haben: Brot 55 Rappen, Butter 81 Rappen usw. Brot war rationiert zu jener Zeit. Diese Haushaltungsbücher haben sehr viele Leute geführt, meine Eltern haben während meiner Jugendzeit damit begonnen und bis ins Jahr 2000 damit weitergemacht, als es schon längst nicht mehr nötig war, weil sie nicht mehr auf jeden Rappen schauen mussten. Aber diese Sorgfalt gegenüber der ökonomischen Seite des Lebens, die haben sie während des Kriegs entwickelt und nachher beibehalten. Nach dem Tod der Eltern bin ich mit den Haushaltungsbüchern zum Sozialarchiv in Zürich gegangen und habe dort nachgefragt, ob sie daran interessiert seien. Sie haben fröhlich abgewunken und gesagt, sie hätten Hunderte davon.
In dieser sparsamen Lebensführung und dem genauen Buchführen darüber waren deine Eltern demnach keine Ausnahme.
Nein, das haben damals die meisten gemacht. Die ökonomische Situation verlangte, dass man ganz genau aufschrieb, was man ausgab und was man ausgeben konnte, damit man die Warnsignale früh genug erkennen würde, falls die Ausgaben zu hoch waren.
Zur sparsamen Lebensführung gehörte, die Ausgaben für Kleidung im Blick zu behalten. Ich nehme an, es wurde nichts weggeworfen?
Nein. Schadhafte Stellen an Kleidern wurden geflickt und ausgebessert. Meine Großmutter hat Socken geflickt für uns. Das wird in ihren Briefen auch erwähnt. So schrieb sie etwa: »Ich habe jetzt drei Paar Socken gestopft, zwei für die Buben und ein Paar für den Hans (das war der Vorname meines Vaters), und lege sie dem Päckchen bei.« Dieses Päckchen hat sie dann an uns geschickt. Es war das Gegenteil einer Wegwerfgesellschaft.
Du hast die Situation während des Zweiten Weltkriegs und danach bisher aus der Perspektive deiner Familie beschrieben. Wie verhielt sich die Schweiz als Land in dieser Zeit?
Eine schwierige Frage. Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg würde ein langes Kapitel verdienen, vor allem aus Sicht eines Schweizers. Wir sind ja ohne Kriegshandlungen davongekommen. Doch 1940, als meine Eltern geheiratet hatten, war die Schweiz umgeben von den Achsenmächten. Die deutsche Wehrmacht war in die Benelux-Länder einmarschiert, Frankreich war zu großen Teilen besetzt, in Italien herrschte Mussolini, und in Österreich hatten schon lange die Deutschen das Sagen. Die Gefahr, dass auch die Schweiz angegriffen und besetzt werden würde, bestand. Viele vermögende Leute sind während dieser Zeit in die Berge geflüchtet. Man wusste, im Fall eines Angriffs wäre das Mittelland nicht mit voller Kraft verteidigt worden. Die Armee wollte sich in die Berge zurückziehen und die Berge bis zum Letzten verteidigen, man nannte das »Réduit«. Das war ein sehr fragwürdiges Konzept, denn im Mittelland waren die Arbeitsplätze, und dort lebten die meisten Menschen. Dieses Mittelland mit seinen Bewohnern aufzugeben zugunsten der Bergpässe, der Murmeltiere und Steinböcke – das war eigentlich eine Zumutung für eine Mehrheit der Schweizer.
Aber deine Eltern, die in Olten wohnten, mussten mit dieser Bedrohung leben.
Meine Eltern und die Eltern meiner Frau ebenso. Ihr Großvater war Bankdirektor, er musste Geld- und Gold-Transporte in die Berge organisieren. Dort hatten die Banken Kavernen und unterirdische Tresore angelegt. Diese Transporte musste er begleiten und bei einem Transport auch selber mitfahren, als seine Frau starb. Sie litt an hohem Blutdruck und ist daran gestorben. Doch es stand außer Frage, dass er diesen Transport zu überwachen hatte und nicht bei seiner Frau bleiben durfte. Als er von einem dieser Transporte zurückkam, war sie tot. Das waren die Härten in der Schweiz, ohne dass das Land direkt in den Krieg verwickelt war.
Deine Eltern haben sich trotzdem entschlossen, Kinder zu bekommen, und sie haben ihren Kindern zugetraut, in dieser Welt zu bestehen.
Das haben sie. Gelegentlich werde ich von jungen Menschen gefragt, ob ich es richtig finde, heute Kinder in die Welt zu setzen. Mit all den Zündschnüren, mit denen wir heute leben müssen, von den radioaktiven Abfällen der Kernkraftwerke, der atomaren Aufrüstung der Großmächte, bis hin zur Klimaerwärmung. Dann erzähle ich von meinen Eltern, die während des Kriegs mit der Drohung Hitlers leben mussten, er werde die Schweiz einnehmen und sie unter deutsche Herrschaft stellen. Meine Eltern hatten den Mut, sie haben sich getraut. Und dann sage ich vielleicht noch: »Kinder gehören zum Besten, was du machen kannst. Kinder sind die Botschafter des Lebens.«
Kann man das Zutrauen in die eigene Stärke nennen?
Meine Eltern hatten einfach die Hoffnung, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Oder dass, sollte das Schlimmste doch eintreten, wir trotz allem eine Chance hätten. Nach dem Krieg war die Erleichterung groß – bei meinen Eltern, bei allen. Dazu gehörte dann aber auch, dass die Geschichte verklärt wurde. Es hieß dann, wir seien vor allem dank unserer Armee und unserer Abwehrbereitschaft nicht in den Krieg hineingezogen worden.
Das stimmte aber nur zum Teil.
Historiker haben nach dem Krieg beschrieben, dass es während des Kriegs intensive Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland gab und dass Vereinbarungen getroffen wurden, wie viele Waffen die Schweiz an die Alliierten und wie viele nach Deutschland zu liefern hatte. Dabei war Deutschland daran interessiert gewesen, die Schweiz als Wirtschaftsstandort unversehrt zu lassen. Eine kaputt bombardierte Fabrik, eine zerstörte Gotthard-Eisenbahnlinie nutzte den Deutschen nichts. Vor allem der Finanzplatz Schweiz musste erhalten bleiben und geschützt werden. Die Schweiz hatte enorme Kredite an Deutschland vergeben. Auch über Gefangenentransporte wurde verhandelt. Diese Verflechtungen von Interessen hatten ebenso dazu beigetragen, dass die Schweiz nicht angegriffen wurde.
Wussten deine Eltern über diese Verhandlungen mit Deutschland Bescheid?
Meinen Vater habe ich dazu befragt. Er kannte nicht die ganze Geschichte. In den sechziger Jahren arbeitete der vom Bundesrat beauftragte Historiker Edgar Bonjour die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg auf und schrieb einen mehrbändigen Bericht darüber. Er hatte Zugang zu Dokumenten, die sonst verschlossen waren. Aber: Er durfte keine Mitarbeiterinnen beschäftigen und keine Dokumente fotokopieren. Damals kam die Fotokopie auf, und natürlich hatte die Landesregierung Fotokopierer, aber er durfte sie nicht benutzen. Er musste von Hand alle Dokumente abschreiben, ohne Hilfskraft, die er bitten konnte, ihm von einem Schriftstück eine Kopie anzufertigen. Edgar Bonjour musste unter sehr schwierigen Bedingungen recherchieren, schrieb aber die erste Geschichte der Schweizer Neutralität und deckte viele der Verstrickungen auf, in denen die Schweiz gefangen war.
Hatte Edgar Bonjour nicht auch über die Geschichte der jüdischen Flüchtlinge in der Schweiz geschrieben?
Doch. Diese Geschichte verlief sehr unrühmlich und sehr traurig. Es war auch ein Kuschen vor Deutschland.
Fällt dir ein Beispiel ein?
Der Judenstempel in den deutschen Pässen wurde auf Wunsch der Schweizer Fremdenpolizei eingeführt, damit die Grenzbeamten sofort erkennen konnten, mit wem sie es zu tun hatten.
Stand das im Bonjour-Bericht, und hast du deinen Vater darauf angesprochen?
Ja, das stand in diesem Bericht, und ich habe meinen Vater gefragt, ob er das gewusst habe und ob er Kenntnis von den engen Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu Deutschland besaß. Er hatte es nicht gewusst. Und er sagte auch, man habe es nicht gewusst.
Wie war das möglich?
Durch die Zensur, die es damals gab. Die Schweizer Medien standen täglich vor der Frage, was veröffentlicht werden durfte und was nicht. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Schweiz mit Deutschland gehörte zu den Geschichten, die nicht an die Öffentlichkeit kamen. Das Problem der jüdischen Flüchtlinge und der Flüchtlinge überhaupt war aber bekannt und auch Gegenstand von Parlamentsdebatten. Mein Vater hat einmal in der Schweizer Jugend eine Geschichte über eine nächtliche Begegnung in Seewen mit zwei Flüchtlingen geschrieben.
Damals wurde davon gesprochen, dass das Boot voll sei.
Diese Formulierung stammt von Bundesrat Eduard von Steiger, der Justizminister war. Sie bezog sich auf die jüdischen Flüchtlinge, die ins Land wollten. »Das Boot ist voll« hat Markus Imhoof später auch seinen Film genannt, der sich mit dem Schicksal der Flüchtlinge in der Schweiz beschäftigte und der zeigte, dass das Boot nicht voll war. Wer damals versuchte, gegen die Weisungen der Regierung zu handeln, dem ist es schlecht ergangen, wie etwa dem Hauptmann Paul Grüninger aus St. Gallen. Er hatte sehr viele jüdische Flüchtlinge passieren lassen, weil er wusste: Sie nicht einreisen zu lassen, kann den Tod dieser Menschen bedeuten … Dieser Hauptmann hatte die Flüchtlinge zur jüdischen Gemeinde in St. Gallen geschickt, und der Sekretär der Gemeinde, der Vater der späteren Bundesrätin Ruth Dreifuss, ging zu den Ämtern und besorgte Pässe für die Neuankömmlinge. Als das bekannt wurde, wurde Hauptmann Grüninger degradiert. Er verlor sogar seine bürgerlichen Rechte. Ehe dieser Mann rehabilitiert wurde, musste es zu einer regelrechten Bürgerbewegung kommen, die verlangte, dass die humanitären Leistungen von Paul Grüninger endlich anerkannt werden und er nicht länger wie ein Staatsfeind behandelt wird, sondern als der Menschenfreund, der er war. Heute ist eine kleine Gasse in St. Gallen nach ihm benannt, aber bis es so weit kam, waren große Anstrengungen vieler Bürger und Bürgerinnen notwendig.
Erstes Lernen
Wir haben bisher von der Nachkriegszeit gesprochen und darüber, wie sich die Schweiz in dieser Zeit mit ihrer Rolle während des Kriegs beschäftigte. Woran erinnerst du dich, als du ein Kind warst? Gibt es ein Ereignis, von dem du sagen würdest, damit begann dein Leben?
Ja, das gab es. Wir wohnten in Seewen, das ist ein Dorf im sogenannten »Schwarzenbubenland«. Vor dem Haus, in dem wir lebten, gab es ein kleines Bassin. Das war ein besseres Planschbecken. Ich bin in dieses Bassin reingefallen, als kein Wasser drin war, und habe versucht, mich an den Wänden irgendwie hochzuarbeiten. Der Belag war rau, ich glaube, man nennt diese Art von Belag Besenwurf. Ich stand dort unten, versuchte nach oben zu kommen, merkte aber, dass es mir nicht gelang, und war sehr verzweifelt. Dieses Gefühl ist eines meiner frühesten Kindheitserlebnisse. Wahrscheinlich habe ich dann um Hilfe gerufen, und meine Mutter ist gekommen und hat mich herausgehoben. Ich war nicht verletzt. Trotzdem, dieses Gefühl von Verzweiflung blieb. Ich erinnere mich auch sehr deutlich an meine Mutter, die Englischkurse im Radio hörte, auf BBC. Das war auch in Seewen. Ich habe den einen oder anderen Satz mitgekriegt und habe einen dieser Sätze auf einem Kartoffelacker gerufen. Damals – das muss ich dazu sagen – haben alle versucht, sich so gut wie möglich selber zu ernähren. Man nannte das die »Anbauschlacht«. Der Zürcher Bellevue-Platz, der heute ein Platz für die Öffentlichkeit ist und auf dem der »Zirkus Knie« jeweils sein Zelt aufschlägt, wurde während des Krieges umgegraben und zu einem Kartoffelacker gemacht. Unser Kartoffelacker in Seewen war nur sehr klein, und beim Kartoffelsammeln habe ich einen Stein genommen, ihn in die Luft geworfen und dazu den im Radio gehörten Satz »How do you do?« gerufen. Mit dem Stein hätte ich fast meinen Vater getroffen. Das ist eine starke Erinnerung. Oder diese: Vom Haus in Seewen, das an einem Hang lag, konnten wir auf den Weg vor dem Haus sehen, einen unasphaltierten Fußweg. Mein Bruder und ich haben jeweils gerne auf den Weg hinuntergeschaut, und wenn jemand diesen Weg entlanggegangen ist, habe ich zu meinem Bruder gesagt: »Der ist dumm. Warum rennt der nicht, es geht doch abwärts …« Ich war ein Dynamiker als Kind.
Bist du in einen Kindergarten gegangen?
In Seewen nicht, später in Olten schon. Als ich vier Jahre alt war, zogen wir nach Olten, und ab fünf ging man dort in den Kindergarten.
Du sprichst von Seewen, dann von Olten, ihr seid von Seewen nach Olten umgezogen – warum?
Mein Vater wurde 1947 als Lehrer gewählt. Damals waren Lehrerwahlen interessanterweise noch politische Wahlen. Mein Vater musste in einer Kampfwahl antreten, er war bei der Freisinnigen Partei, einer eher rechten, staatstragenden Partei. Dieser Partei gehörten 1848 auch die Staatsgründer an, die Sozialdemokraten traten erst nach der Jahrhundertwende auf den Plan. Mein Vater trat gegen einen Sozialdemokraten an und wurde zum Lehrer mit einer festen Anstellung gewählt.
Das heißt, man wurde als Lehrer nicht von einer Bildungsbehörde berufen und eingesetzt, sondern man musste sich den Familien, deren Kinder man unterrichten wollte, zur Wahl stellen und hoffen, dass man eine Mehrheit fand?
Den Familienvätern, das Frauenstimmrecht war ja noch weit weg. Das war damals die Praxis in Olten.
Und deine Mutter ging mit, und ihr seid als Familie nach Olten gezogen.
Genau.