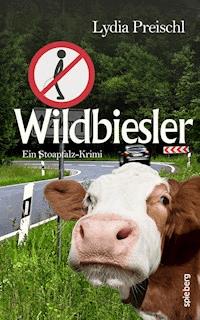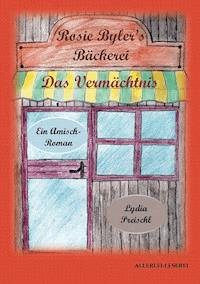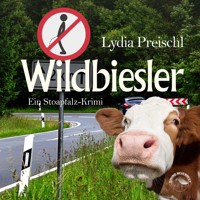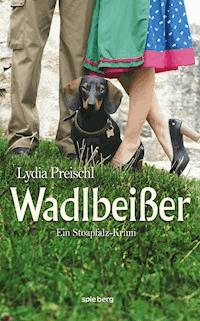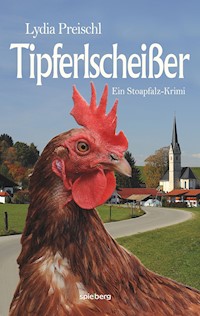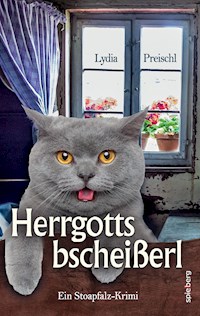Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Jahr des Bären
- Sprache: Deutsch
Die Sprachstudentin Theresa lernt in London einen jungen Kanadier kennen. Beide verlieben sich ineinander und verbringen eine glückliche Zeit zusammen. Dennoch ist eine Trennung zunächst unvermeidlich, da Tim wieder nach Kanada und zu seiner Arbeit als Polizist zurückkehren muss. Ein intensiver Briefwechsel folgt, aber eines Tages bricht der Kontakt ab. Theresa ist verzweifelt und fliegt schließlich mit ihrem letzten Geld nach Kanada. Dort erfährt sie, dass Tim bei einem Einsatz in den Bergen tödlich verunglückt ist. Aber das Leben schreibt manchmal bereits beendet geglaubte Kapitel fort... Die romantische Liebesgeschichte lädt ein zum Mitleiden und Mitfreuen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Preischl lebt mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf im
Oberpfälzer Wald. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Seit sie
denken – und schreiben – kann, widmet sie sich dem Erfinden
von Geschichten. Diese sind so unterschiedlich, dass man sie
auf kein Genre festlegen kann. Ihr Ziel ist es, ihre Leserinnen
und Leser in eine andere Welt zu entführen, zu unterhalten
und zu entspannen.
Besuchen Sie die Website der Autorin:
www.allerlei-leserei.de
Hier erfahren Sie alles über bisherige und
kommende Projekte.
Die Charaktere und Geschehnisse im Roman sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 1
Sie stand wie üblich vor der Glasvitrine, die ihr Lieblingskunstwerk beinhaltete. Theresa war fasziniert von dieser Skulptur. Tippoo’s Tiger stand auf dem Schild darunter. Sie las nicht weiter. Die Geschichte kannte sie.
So oft sie das Victoria und Albert Museum betrat, lenkte sie ihren Schritt in diesen Raum, der nicht weit vom Eingang entfernt war und viele Kunstwerke dieser und ähnlicher Art aus Indien beherbergte. Seit einem Vierteljahr lebte sie in London. Die Zeit, die sie hier verbringen durfte, raste gleichsam dahin und sie hatte nicht die Hälfte der Dinge erledigt, die sie eigentlich zu erledigen gedachte. Ursprünglich besaß sie eine chronologische Auflistung all der Dinge, die zu tun ihr wichtig erschienen, wenn sie schon einmal das Privileg hatte, hier studieren zu können. Von dieser Liste hatte sie sich schnell verabschiedet, da sie ihren selbst gesteckten zeitlichen Rahmen nicht einhalten konnte. Nun beschied sie sich damit, Erledigtes abzuhaken und fand, dass sie viel zu langsam damit vorankam. Aber so war sie eben: Sie nahm sich viel zu viel vor, plante zu genau und war schließlich enttäuscht, wenn es nicht so funktionierte, wie sie es sich vorgenommen hatte. Hinter dem Listenpunkt Viktoria und Albert Museum fanden sich bereits drei Haken, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass der Eintritt kostenlos war. Nicht, dass sie jedes Mal alle Hallen besucht hätte, nein, es war allein dieses eine Bildnis, das sie immer wieder in ihren Bann zog. Sie fühlte eine beinah körperliche Affinität zu diesem Soldaten, der von dem prächtigen Tiger gefressen wurde. Der indische Sultan Tipu hatte es vor langer Zeit anfertigen lassen, um seinen Hass auf die englischen Truppen in seiner Heimat auszudrücken. Lange hatte Theresa nicht gewusst, dass es eigentlich ein Musikautomat war. Im Inneren des Tigerbauches fand sich eine Orgel-Tastatur, dem Mund des britischen Soldaten entrang sich Wehklagen, während es aus dem Tigermaul brüllte, wenn der Apparat eingeschaltet war. Kinder in Schuluniform belagerten „ihre“ Vitrine. Eine Dame erzählte mit eindrucksvollen Gesten die Geschichte zur Figur, was ihre Zuhörer zu „Oh“- und „Ah“-Rufen hinreißen ließ. Vor allem, als die Erzählerin die Laute des Apparates nachmachte.
Theresa betrachtete das Kunstwerk mangels eines besseren Standortes durch das seitliche Vitrinenfenster. Der Soldat in farbenfroher Uniform lag stocksteif unter dem bissigen Untier, das in seiner schönsten natürlichen Pracht und Anmut gefertigt war. Theresa fand, dass der Künstler vor allem in die Darstellung des majestätischen Tieres viel Liebe gelegt hatte. Die Schüler hatten nun offensichtlich den Auftrag bekommen, die Figurengruppe abzuzeichnen. Sie versenkten sich in ihre Malblöcke und versuchten sie mehr oder weniger erfolgreich auf das Papier zu bannen.
Jemand drängelte sich zwischen ihr und der Schülergruppe vorbei. Theresa rückte bereitwillig zur Seite.
„Er muss fürchterliche Angst gehabt haben, bevor er starb.“
Theresa hörte den Satz, glaubte aber nicht, dass er ihr gelten sollte.
„Denken Sie nicht?“ Jemand tippte ihr auf die Schulter, ein Gesicht spiegelte sich vage im Glas der Vitrine.
„Was meinen Sie?“, fragte sie schließlich doch zurück, ohne sich jedoch umzudrehen. Sie standen im engen Durchgang zwischen zwei Glaskästen und mussten einige andere Besucher vorbei lassen. Langsam wurde es eng um Tippoo’s Tiger.
„Ich meine, dass der arme Kerl fürchterliche Angst gehabt haben muss, bevor er starb“, wiederholte die Stimme hinter ihr.
„Eigenartig, aber genau das...“ Theresa wandte sich endlich um und brach mitten im Satz ab.
Da stand ein junger Mann – ein überaus attraktiver junger Mann! - in Uniform. Eine Uniform in der Art, wie sie die bärenfellbemützte Leibwache der englischen Königin zu tragen pflegte, mit roter Jacke und schwarzer Hose. Theresa war derart irritiert, dass sie von dem kleinen Kunstwerk zu dem Uniformierten sah und kontrollierte, ob beide nicht identisch waren. Langsam wich ihre Irritation einem Anflug von Humor. Sie hatte sich wieder im Griff, eine Eigenschaft, die sie eigentlich auszeichnete. Nur selten, so wie jetzt gerade, verschlug es ihr dauerhaft die Sprache. „Hat die Leibwache der Queen heute Ausgang?“, witzelte sie schließlich mit schelmischem Blick.
Er schmunzelte. „Falsch. Ganz falsch. Ich trage keine Bärenfellmütze!“
„Aber Reithosen.“ Theresa runzelte die Stirn und beachtete ihn genauer. Und was sie sah, gefiel ihr ausnehmend gut. Groß und stattlich wirkte er in seiner adretten Uniform, schwarzhaarig mit sonnengebräuntem Teint. Sein Englisch klang anders als das der Engländer, aber auch nicht wirklich amerikanisch. Jetzt erst fiel ihr sein eigenartiger Hut auf, den er in der Hand hielt. „Du bist Kavalleriesoldat, nicht wahr?“ Ihre blauen Augen blickten ihn fragend an. Keck blies sie eine vorwitzige Strähne aus ihrem Gesicht.
„Nicht ganz. Ich gehöre zur kanadischen berittenen Polizei. Wir absolvieren hier eine Spezialausbildung. Terrorabwehr und so was. Ist leider nötig heutzutage. Es sind viele internationale Polizisten hier zur Zeit. Aber was wolltest du eben sagen?“
Sie überlegte. „Ach ja. Ich wollte sagen: Eigenartig, aber genau dieselbe Überlegung stelle ich auch jedes Mal an, wenn ich diese Skulptur sehe, die Sache mit der Angst, meine ich.“
„Ich wüsste gerne, wie das so ist, auf so grausame Art und Weise sterben zu müssen.“
„Ich glaube nicht, dass ich das gerne wüsste“, gab sie zu bedenken.
„Nein, so habe ich es auch nicht gemeint.“ Er tippte mit dem Finger an die Stirn, um einen Gruß anzudeuten. „Aber ich muss jetzt weiter. Hat mich sehr gefreut.“ Er machte Anstalten sich einen Weg durch die Schülergruppe zu bahnen.
„Du bist wohl das erste Mal in London?“, sagte Theresa schnell. Aus einem unerfindlichen Grund wollte sie ihn ungern gehen lassen.
„Das erste Mal in Europa, um genau zu sein. Und ich schätze, so oft werde ich das Vergnügen nicht haben.“ Er drehte den eigenartigen Hut in seinen Händen und wusste nicht so recht, was er nun anstellen sollte. Schließlich entschied er sich dazu, doch zu gehen. „Auf Wiedersehen. Hat mich gefreut“, wiederholte er noch einmal.
Theresa nickte ihm zu. Sie sah ihm nach, und noch lange, nachdem er die Halle verlassen hatte, starrte sie auf den Punkt, an dem er aus ihrem Blickfeld verschwunden war.
Irritiert schüttelte sie den Kopf, als wolle sie sich diese eigenartige Begegnung im sprichwörtlichen Sinne aus dem Kopf schlagen, doch während ihres restlichen Rundganges durch das ausladende Gebäude, ging er ihr nicht mehr aus dem Sinn. Ursprünglich hatte sie vorgehabt, nur den Tiger zu besuchen, doch irgendetwas trieb sie dazu, sich durch die Ausstellungsräume treiben zu lassen. Unbewusst beschleunigte sie ihren Schritt und in jedem Raum, den sie betrat, hoffte sie, ihre Zufallsbekanntschaft noch einmal zu sehen. Nach der dritten Halle, die sie auf diese Weise durchquerte, gestand sie sich offen ein, dass sie auf der Suche nach der roten Uniform war. Endlich, in der Halle mit den größeren Skulpturen, entdeckte sie ihn wieder.
„Ich dachte, du interessierst dich nur für die kleineren Dinge hier“, sprach sie ihn von hinten an und diesmal zuckte er überrascht und ein wenig erschrocken zusammen.
Nach einer Schrecksekunde lächelte er gewinnend. „Mich beeindrucken alle interessanten Dinge, die kleineren wie die großen. Und so klein ist die Tiger-Skulptur nun auch wieder nicht. Aber diese Moses-Darstellung hat mich schon immer fasziniert.“ Er deutete auf die Figur, die in sitzender Haltung modelliert war.
„Ich komme nur nicht dahinter, was sich Michelangelo dabei gedacht hat, ihm Hörner aufzusetzen.“
Theresa lachte laut auf, mäßigte sich aber sofort wieder, als sie den Widerhall ihrer eigenen Stimme in dem hellhörigen Raum wahrnahm.
„Das sind keine Hörner“, erklärte sie amüsiert. „Das ist der beginnende Heiligenschein, so eine Art Strahlenkranz.“
Nun grinste er auch. „Ich dachte wirklich, der Bildhauer hätte ihm die Hörner gegeben, um den schlechten Menschen in Moses zu symbolisieren, der den ägyptischen Aufseher erschlagen hat. Weißt du dann vielleicht auch, wo der Original-Moses steht? Der hier ist ja wohl eine Dublette.“
„Weiß ich zufällig. Aus dem Kunstunterricht. Das Original steht in Rom in einer Kirche.“
„Kaum vorstellbar, wie man aus einem Steinklotz ein solches Kunstwerk zaubern kann. Meister Michelangelo muss wirklich ein Jahrtausendtalent gewesen sein. Einmal im Leben möchte ich die Sixtinische Kapelle sehen und die Peterskirche“, schwärmte er.
Theresa stimmte ihm zu. „Ja, Rom ist sicher eine Reise wert, aber mein Favorit ist und bleibt London. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch noch nicht viele Städte gesehen habe.“
„Na ja, du hast ja noch Zeit, dir das alles anzusehen. Ich beneide euch Europäer schon. Ihr habt so viel Geschichte auf engstem Raum beieinander und müsst nicht teure Reisen auf euch nehmen, um all das zu sehen.“
Theresa schmunzelte. „Und als Europäer kann man es kaum erwarten, nach Übersee zu kommen, um all die aufregenden modernen Bauwerke zu bestaunen. Bei euch ist alles höher, schneller, weiter...“
Während sie sich unterhielten, verließen sie zusammen den Monumentalsaal und strebten dem Ausgang zu.
„Nun, in den Vereinigten Staaten mag das ja stimmen, aber in Kanada, da ist alles, sagen wir: gemütlicher. Die Kanadier unterscheiden sich von den US-Amerikanern gewaltig. Du sagtest eben, dass London dein Favorit unter den besuchenswerten Städten wäre. Ist es denn nicht deine Heimatstadt?“
Sie suchte in seinem Gesicht nach Anzeichen von Spott, fand aber nur Interesse in seinem Blick. „Das ist jetzt aber ein Witz, nicht wahr?“
„Wieso?“
„Ich bin keine Engländerin und dass du mich dafür hältst, macht mich jetzt schon ein wenig stolz.“
Inzwischen waren sie an der belebten Eingangshalle des Museums angekommen und es bestand keine Notwendigkeit mehr, miteinander zu flüstern. Er lachte laut heraus und ein faszinierender Ausdruck lag auf seinem braungebrannten Gesicht, dass Theresa jenes verräterische Kribbeln in der Magengrube spürte, das sie immer empfand, wenn sie einem derart attraktiven Mann gegenüberstand.
„Du sprichst praktisch perfekt Englisch und ja, einen kleinen Akzent habe ich schon gehört, aber ich dachte, das wäre nur eine Färbung aus einem der Londoner Vororte. Und was hat dich nun nach London geführt?“
„Die Sprache. Ich studiere Sprachen. Und ich wollte weg von zu Hause. Mir ein wenig Wind um die Nase wehen lassen.“
Er sah stirnrunzelnd auf seine Uhr. „Ich würde mich gerne weiter mit dir unterhalten, aber ich muss pünktlich in meiner Kaserne sein. Genaugenommen habe ich mir diese Stunde hier von der Mittagspause abgezweigt...“ Es passte ihm gar nicht, sie jetzt stehen lassen zu müssen, aber er hatte keine Wahl.
Theresa nickte schweren Herzens. „Ich habe selbst die Zeit vergessen. Auch ich habe noch eine Verabredung. Es hat mich wirklich gefreut, mit dir plaudern zu können.“
Sie schlugen vor dem Eingangsportal verschiedene Richtungen ein.
Theresa befand sich zum Sprachenstudium in London. Vorerst wollte sie ein halbes Jahr bleiben und dann zu Hause ihre Studien vollenden. Alles, was mit der englischen Sprache und Kultur zu tun hatte, englischsprachige Länder auf der ganzen Welt mit eingeschlossen, war ihr Steckenpferd. Irgendwann einmal, so stellte sie sich vor, würde sie in einem dieser Länder arbeiten. London jedoch war der Inbegriff dessen, was Theresa sich vom Leben erwartete. Sie stammte vom Lande. Der höchste kulturelle Anspruch den man vor Ort erwarten konnte, war der Auftritt einer Blaskapelle auf dem Feuerwehrfest. Im Moment hatte sie die Provinz satt. London pulsierte, überall und ständig war etwas los. Dass der Supermarkt hinter ihrem billigen Hotel, in dem sie sich dauereingemietet hatte, rund um die Uhr geöffnet hatte, gehörte für sie ebenso dazu, wie der permanente Autolärm, der Tag und Nacht durch ihr Hotelfenster drang, sowie der Londoner Smog, der gerade jetzt in der beginnenden Herbstzeit wieder in alle Poren der Stadt drängte.
Alles in allem war sie mit ihrem Dasein sehr zufrieden. Manche ihrer Kommilitonen lebten in den Tag hinein, feierten ganze Nächte durch und kümmerten sich nicht weiter um ihr Studium. Bei ihr sah es etwas anders aus.
Theresa stammte aus keiner reichen Familie. Ihre Eltern standen auf dem Standpunkt, dass sie ihr Studium selbst zu bezahlen hätte und so konnte sie sich Extravaganzen gar nicht leisten. Außerdem waren sie ziemlich altmodisch und hier studieren zu können, hatte im Vorfeld allen Beteiligten viel Nerven gekostet. Das Verhältnis zu ihren Eltern war trotzdem leidlich gut und nachdem diese gesehen hatten, dass ihre Tochter zielstrebig an ihren Lebensplänen arbeitete, schossen sie ihr öfter einmal eine kräftige Summe zu. Dennoch hatte Theresa keine Zeit zu verlieren. Das Leben in London war teuer. Für ihr heruntergekommenes winziges Zimmer im obersten Stockwerk des ebenso heruntergekommenen Hotels musste sie 200 Pfund Dauermiete bezahlen. Und verglichen mit anderen Unterkünften war dies noch sehr günstig. Aber so lange es ihre Finanzen zuließen, wollte sie ihre Chance nutzen. Noch hatte sie ein paar Reserven, die sie gespart hatte, als sie in den Semesterferien am Fließband gejobbt und während der Studienzeit in einem Imbiss gearbeitet hatte. Hier in London hatte sie keinen Nebenjob, weil sie dafür einfach keine Zeit fand.
Der Spätsommerabend versprach schön zu werden und so frönten die jungen Leute, mit denen sich Theresa angefreundet hatte, ihrem sparsamen Vergnügen, sich einen freien Platz auf einer Wiese im Hyde-Park zu suchen und ein Sandwich-Picknick zu veranstalten. Bis zum Einbruch der Dunkelheit blieb der Park geöffnet und sie alle wollten die letzten schönen Tage noch in vollen Zügen genießen, bevor sie der Beginn der herbstlichen Regenzeit in die Studiersäle ihrer Schule verbannte, oder noch schlimmer: in ihre eigenen, heruntergekommenen Appartements.
An diesem Abend saß die kleine Gruppe zwar beieinander auf der abgewetzten Decke, die Runja, eine kleine, blonde Finnin, immer mitbrachte. Doch ein Gespräch kam kaum zustande. Eine wichtige Prüfung beschäftigte die vier, die ihre Köpfe in den Lehrbüchern versenkt hatten.
Theresa hatte zwar ihr Buch auf dem Schoß, konnte sich jedoch auf dessen Inhalt nicht konzentrieren. Der junge Mann aus dem Museum hatte großen Eindruck auf sie gemacht. Gleich nach ihrem Aufbruch hatte sie nicht mehr an ihn gedacht, jetzt aber, aus der Entfernung von ein paar Stunden, drängte er sich immer öfter zwischen die Buchstaben ihrer Übersetzung.
Paul hatte sie angesprochen. Bereits zweimal. Theresa reagierte erst auf seinen freundschaftlichen Rippenstoß.
„Träumst du, Theresa? Ich fragte gerade, ob jemand weiß, was negligence heißt. Ich habe das Wörterbuch nicht mit.“
Außer Runja, der Finnin, gehörten noch Paul und Anna zu ihren engsten Freunden. Alle vier unterhielten sich untereinander in Deutsch, auch Runja, die gut Deutsch sprach.
„Nachlässigkeit – negligence heißt Nachlässigkeit. Kommt doch schon im ersten Kapitel vor.“
„Danke, Frau Professor. Ich wusste eben, dass du alles weißt. Da brauche ich doch nicht nachzusehen, wenn ich dich nur zu fragen brauche.“
Paul war dünn und hochaufgeschossen. Er hatte bereits jetzt, Anfang zwanzig, reichlich schütteres Haar und zu allem Überfluss einen hellen Spitzbart am Kinn, den er auch nicht mit viel Zureden abrasieren mochte. Er war ein Original und aufgrund seiner angenehmen Art bei allen beliebt.
Anna hingegen war eine Einzelgängerin. Sie gesellte sich nur ab und an zu ihnen. Nichts an dem jungen Mädchen war auffällig. Sie war durchschnittlich groß, durchschnittlich hübsch und durchschnittlich intelligent. Theresa wusste nicht allzuviel über sie, da Anna ungern etwas über sich selber erzählte. Dennoch verband die beiden Studentinnen so etwas wie eine lockere Freundschaft.
Anna hatte sie beobachtet. „Sieht so aus, als ob du nicht ganz bei der Sache wärst?“
Diesmal merkte Theresa, dass sie jemand angesprochen hatte. „Stimmt, ja. Ich denke ständig an etwas anderes. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren heute Nachmittag.“
„Ja, ja, lustig ist das Studentenleben“, mischte sich nun auch Runja ein. „Wir sollten aufhören mit Lernen und einen drauf machen. Wie wäre es, wenn wir uns die Frischwarentheken im Harrod’s ansehen würden und dann ein Eis essen gingen?“
Jetzt mussten alle vier kräftig lachen. Runja wusste, dass es zu Theresas Lieblingsbeschäftigung gehörte, durch die Brompton Road zu schlendern und einen Stopp im Nobelkaufhaus einzulegen. Sie mochte die stilvollen Auslagen und obgleich sie nicht so dezent gekleidet war, wie normale Harrod’s-Kunden, fiel sie nicht weiter auf, wenn sie durch die Abteilungen flanierte. Zu viele Touristen waren ebenfalls dort unterwegs, um zumindest einen Blick auf die große, weite und vor allem mondäne Welt der Reichen und Schönen zu erhaschen.
Theresa legte das Buch beiseite. Die drei waren ihre Freunde und absolut zuverlässig, auch die undurchschaubare Anna. Wem sonst, wenn nicht ihnen, sollte sie ihre Gedanken anvertrauen?
„Ich habe heute einen Mann getroffen“, begann sie umständlich und die anderen grinsten. Sie ignorierte den gutmütigen Spott und erzählte weiter: „Er geht mir nicht mehr aus dem Kopf, obwohl wir nur ein paar Sätze miteinander gesprochen haben.“ „Wo denn?“
„Wie sah er aus?“ Die Mädchen wollten alles genau wissen, während Paul an seinem Bärtchen herumzwirbelte und sich gerne ein wenig ablenken ließ.
„Im V&A-Museum. Ich weiß auch nicht. Als wir miteinander sprachen, war es, als ob ich mit einem von euch spreche ... ich meine, einfach ganz normal.“ Theresa zuckte die Schultern, weil sie nicht wirklich wusste, was genau sie so an dieser Begegnung fasziniert hatte.
„Aha“, machte Paul, der nichts verstand, und den das Gespräch langweilte.
„Ich schätze, er hat Eindruck auf dich gemacht“, mutmaßte Anna. „Wie hat er denn nun ausgesehen?“
„Oh. Also, er war groß und na ja, so groß auch wieder nicht. Ungefähr einen halben Kopf größer als ich. Und er trug eine Uniform.“
„Bingo!“, unterbrach sie Runja in ihrem drolligen nordischen Akzent, „Männer in Uniform wirken eben auf Frauen.“
„Ach komm. Davon laufen hier in London doch jede Menge herum. Alles trägt in England Uniform. Sogar die Fünfjährigen in der Schule“, wandte Anna ein. „Aber jetzt erzähl weiter. Ist doch mal eine prima Abwechslung.“
„Also, er trug Uniform. Eine rote Jacke mit schwarzer Hose. Reithose!“
„Und mit einer Reithose läuft er im V&A herum?“
„Wo hatte er sein Pferd geparkt?“
„Oder hatte er es dabei?“
Theresa beschloss, die Flachsereien zu ignorieren. „Er war in Eile. Er sagte, dass seine Zeit sehr knapp wäre und er deshalb nichts davon für das Umziehen verschwenden wolle. Außerdem käme er aus Kanada.“
„Das hat er dir alles einfach so erzählt?“
„Es ergab sich eben so.“
„Dann war es ein Mountie.“
Theresa fuhr herum zu Paul. Der zwischen zwei Bissen eines Apple-Pies diese Bemerkung eingeworfen hatte. „Wie?“
„Na, ein kanadischer Polizist. Die nennt man Mountie. Tragen eine rote Jacke und eine schwarze Hose. Reithose, weil sie reiten. Ist doch logisch, oder? Seht ihr eigentlich nicht fern?“ „Nein, man sagt nur Mountie, in Wirklichkeit mögen die es gar nicht, so genannt zu werden...“, dozierte Runja
„Wie hat er denn nun ausgesehen? Die Uniform allein kann es doch wohl nicht gewesen sein“, unterbrach Anna ungeduldig.
„Also gut. Groß, also, größer als ich...,“
„Das ist ja nun kein Kunststück“, neckte sie Paul.
Theresa warf ihm einen gespielt bösen Blick zu und erklärte weiter: „...dunkelhaarig, überhaupt ein dunkler Typ, freundlich, mit braunen Augen und schlank...“ Theresa hatte die Arme um ihre Knie geschlungen und fixierte einen Punkt in weiter Ferne. „... und er hatte einen heißen Hintern!“
„Einen was?!“ Anna wollte es ganz genau wissen, während Paul lachte.
Theresa kehrte zurück von ihrer Wolkenreise und genierte sich ein wenig.
Doch Paul bemerkte trocken: „Als Reiter muss er doch einen heißen Hintern haben. Also, Mädels, mir wird das Gerede jetzt zu blöd. Weil ich nicht schwul bin, tu ich mir das nicht mehr länger an. Ich denke, ich gehe doch nach Hause und pauke noch ein bisschen. Ich kann’s gebrauchen.“
„Oh Mann, wenn mir das doch auch einmal passieren würde.“ Anna ließ sich in gespielter Verzweiflung hintenüber fallen.
„Ich sehe schon: Ich muss öfter ins V&A gehen.“
Runja lachte. „Hast du vor, ihn einmal wieder zu sehen?“
„London ist keine Kleinstadt. Aber ehrlich gesagt, ärgert es mich maßlos, dass ich einfach weg gegangen bin, ohne ein weiteres Treffen zu vereinbaren.“
Runja winkte ab: „Wer weiß, wofür es gut war. Sieh es doch mal so: Vielleicht ist er verheiratet und er schlägt seine Frau und seine Kinder.“
Theresa seufzte und antwortete nicht mehr darauf. Stattdessen suchte sie wie die anderen ihre Habseligkeiten zusammen, da es empfindlich kühl geworden war.
Dennoch setzte sich ein Gedanke in ihrem Hinterkopf fest: Er trug keinen Ehering und war für Kinder eigentlich viel zu jung!
Kapitel 2
Auch während der nächsten Tage ging Theresa diese Begegnung nicht aus dem Kopf. Glücklicherweise hatte sie kein Problem mit den anstehenden Prüfungen, doch sie ertappte sich immer öfter dabei, wie sie beständig an den Fremden dachte. Bei jedem Rot-Uniformierten hoffte sie, dass es sich um ihre Museumsbekanntschaft handeln könnte.
Drei Tage später, der berüchtigte Londoner Regen hatte eingesetzt, fiel ihr die Decke ihres hässlichen Hotelzimmers auf den Kopf. Es war klamm in dem zugigen Raum und sie fühlte sich unwohl in der tristen Umgebung. Ihre Freunde waren in der einen Woche, da die Schule nun geschlossen hatte, nach Hause gefahren oder verreist. Sie selbst fuhr nirgendwo hin, da sie es sich im Moment nicht leisten konnte. Stattdessen nutzte sie die Zeit, um sich ihren Studien zu widmen. Doch im Laufe des Tages hielt sie es nicht mehr aus. Zum einen war sie hungrig, zum anderen zog sie etwas anderes ganz mächtig in eine bestimmte Richtung, wohl wissend, dass es äußerst unwahrscheinlich sein würde, ihren Mountie noch einmal zu treffen.
Inzwischen hatte sie sich an ihre schäbige Unterkunft im sechseinhalbten Stock, den früheren Dienstbotenunterkünften eines Herrenhauses, das heute als einfaches Hotel betrieben wurde, gewöhnt. Heute jedoch ödete es sie an, noch mehr Zeit in den schiefen Wänden zu verbringen. Um sich abzulenken, beschloss sie, im Supermarkt um die Ecke einkaufen zu gehen und sich auf ihrer Kochplatte im Zimmer etwas Warmes zu kochen.
Mit ihren Tüten betrat sie wenig später die Hotel-Lobby und begrüßte das Personal hinter der Rezeption freundlich. Sie kannten sich naturgemäß alle, und hin und wieder fand sie sogar ein kleines Lunchpaket in ihrem Zimmer, das vom netten asiatischen Koch in der Hotelküche stammte. Seit sie ihm erzählt hatte, dass sie asiatische Küche sehr schätzte, versorgte er sie, wann immer es ihm möglich war, mit Kostproben seiner Kunst.
Kaum als sie ihr Zimmer aufgeschlossen hatte, überkam sie eine unüberwindliche Lust nach ihrem Tiger. Ihr Beschäftigungsprogramm mit Einkaufen und Kochen hatte nicht gewirkt. Sie warf die Einkäufe auf die Kommode, holte sich die Regenjacke und den noch nassen Schirm und trabte wieder hinunter in den schweren Londoner Nieselregen. Sie konnte das Museum zu Fuß erreichen, doch bei diesem schlechten Wetter war sie pitschnass, als sie dort ankam. Die Aussicht darauf, mit nassen und kalten Füßen in das ebenfalls dunkle und kalte Gemäuer zu gehen, heiterte sie nicht gerade auf. Dennoch zog sie eine unüberwindliche Kraft in den riesigen Gebäudekomplex, der bei Sonnenschein und mit warmen Füßen betrachtet, wirklich prächtig war.
Sie betrat die Eingangshalle. Mit klammen Fingern versuchte sie, den Schirm zu schließen, ohne andere Besucher damit nass zu machen. Es war hier sehr belebt, wie stets an Regentagen.
Sie stieß mit jemandem hinter sich zusammen. Als sie sich umdrehte, traute sie ihren Augen kaum: Es war tatsächlich ihr Mountie!
„Oh, du bist das!“ Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, während er ihr den widerspenstigen Schirm abnahm. Diesmal trug er Zivil. Jeans und Pulli, ebenso wie sie. Eine dunkelgrüne Wachsjacke hing über seinem Arm, während sie ihre Regenjacke noch anhatte. Der inzwischen geschlossene Schirm tröpfelte in kleinen Rinnsalen Wasser auf den Steinboden. Nachdem er ihr den Schirm wieder zurückgegeben hatte, rempelte sie damit eine alte Lady an, die gerade an ihr vorbeiging und die Aktion mit einem missbilligenden Kopfschütteln strafte.
Theresa war vollkommen unsortiert und strich sich fahrig die feuchten, kinnlangen Haare aus der Stirn.
„Äh, ja, und danke auch.“ Sie nickte in Richtung des Schirms und stand unschlüssig herum, während ihr Herz wie wild schlug. Er bemerkte ihre Nervosität und lenkte ihren Blick auf eine der beiden wuchtigen Bänke, die im Eingangsbereich des Museums Platz für fußkranke Besucher boten. „Setzen wir uns doch, wenn du ein wenig Zeit hast.“
Sie lächelte. „Oh, ja. Natürlich.“
„Also, was führt dich hierher?“, begann sie, nachdem sie die Jacke ausgezogen und sich gesetzt hatte.
„Ich wollte den Tiger noch einmal sehen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so genau, warum ich meine kostbare Zeit hier in London damit verbringe, in ein Museum zweimal zu gehen. Es gäbe genug andere Dinge zu besichtigen.“
„Ich wollte auch zum Tiger. Komisch nicht?“ Es entstand eine kurze Pause, in der er sie eindringlich musterte. Sie war eigentlich recht unauffällig, mit kurzen, braunen Haaren, die ihr ständig ins Gesicht fielen. Ihre Augen waren blau, nicht braun, wie man es hätte erwarten können. Sie waren von einem derart dunklen Blau, dass er zweimal hinsehen musste, so sehr faszinierten sie ihn. Unter dem dicken Wollpullover waren ihre Formen kaum auszumachen, dennoch schien sie ihm ein wenig kleiner als er selber zu sein, und sie war sicher nicht gertenschlank.
„Gefällt dir, was du siehst?“, quittierte sie sein unverhohlenes Interesse mit Ironie in der Stimme. Theresa waren seine Blicke durchaus nicht unangenehm, aber immerhin saß sie hier mit einem Unbekannten, der sie durchdringend anstarrte. Andererseits wirkte er absolut harmlos und immerhin war er ja ein Polizist. Ein überaus attraktiver Polizist, wie sie auch bei diesem Zusammentreffen sogleich bemerkt hatte. Dennoch kam ihr Runjas Bild vom schlagenden Ehemann wieder in den Sinn.
„Ich hatte gehofft, dich wieder zu treffen“, gab er schließlich ertappt zu.
War es möglich, dass dieser magische Augenblick bei ihrer ersten Begegnung vor drei Tagen sie beide getroffen hatte? Theresa konnte seinem Blick nicht standhalten und sah nervös zu Boden.
„Ich bin Timothy Freeman“, stellte er sich vor, da er ihre Unsicherheit bemerkte. „Tim, für meine Freunde.“
„Theresa, Theresa Frank. Freut mich sehr.” Artig nahm sie die dargebotene Hand. Sie fühlte sich warm und trocken an. Sogleich wurde ihr ein wenig wärmer. Wiederum trafen sich ihre Blicke und wiederum verursachte das zufällige Zusammentreffen weiche Knie bei beiden, ohne dass einer von den Gefühlen des anderen wusste.
Sie schniefte unvermittelt und suchte hastig nach einem Taschentuch. Die Kopfschmerzen, die sie bisher ignoriert hatte, wurden heftiger und sie begann, sich schlecht zu fühlen. Innerlich verwünschte sie diese Schwäche, während sie sich mit dem endlich gefundenen Tuch die Nase putzte.
„Du siehst aus, als ob du eine Erkältung bekämst“, bemerkte er aufmerksam.
Theresa sah ihn mit roten Augen an. „Woran siehst du das?“
„Du hast eine rote Nase und fühlst dich kalt an“, antwortete er, während er ihre Hand berührte, „Wie wäre es, gehst du mit mir eine Tasse Tee trinken?“ Er erhob sich mit einladender Geste.
Theresa dachte kurz nach und kam zu dem Entschluss, dass eine Tasse Tee unverfänglich genug wäre. Also erhob auch sie sich und schlüpfte wieder in ihre kalte Regenhaut. Sie nieste wiederum, was in ihm Skepsis wachrief.
„Hör mal, ich weiß nicht so recht, ob es jetzt gut für dich ist, noch lange herumzulaufen. Es schüttet draußen wie aus Kübeln. Ich möchte dieses Treffen gerne verlängern, versteh mich da nicht falsch. Aber ich denke, es ist für dich gesünder, wenn ich dich nach Hause bringe“, bot er besorgt an.
Theresa war durch die strenge Erziehung ihrer Eltern und die ständigen Ermahnungen zur Vorsicht argwöhnisch geworden. Ganz klar! Er wollte ihre Adresse herausfinden. Doch diesen Gefallen tat sie ihm nicht.
„Mir geht es ganz gut. Und wenn deine Einladung zum Tee noch gilt, würde ich sie gerne annehmen“, wandte sie tapfer ein, denn tatsächlich fühlte sie sich nicht besonders gut. Ihre Beine zitterten und sie sah schwarze Punkte vor den Augen. Dennoch wollte sie sich den Augenblick unter keinen Umständen verderben. Glücklicherweise war die gemütliche, kleine Teestube, in die er sie führte, nicht weit entfernt. Und das heiße Gebräu weckte ihre Lebensgeister wieder. Sie genoss ihren Tee englisch mit Milch und Zucker.
„Du bist also dienstlich hier?“, fragte sie.
„So ungefähr, ja. Wir konnten uns zu diesem Spezialtraining bewerben und ich wurde tatsächlich genommen. Ehrlich gesagt, war es eine günstige Möglichkeit, hierher zu kommen.“
„Und es gefällt dir?“
„Oh ja. Ich liebte England schon immer, obwohl ich es bisher nur von Büchern kannte.“
„Ich hatte mal kanadische Freunde. Sie gingen einige Zeit bei uns zur Schule. Sie meinten, dass die Kanadier den Engländern sehr ähnlich wären. Im Lebensstil und so.“
„Na ja. Ich denke, dass man das so einfach nicht sagen kann. Jedes Land hat seine Eigenart und die Bewohner darin natürlich auch. Aber es stimmt schon. Verglichen mit anderen englischsprachigen Völkern sind wir dem Mutterland wohl am ähnlichsten. Obwohl uns die Engländer interessanterweise nicht leiden können. Ist schon seltsam mit diesen Vorurteilen... und du, woher aus Deutschland kommst du?“
„Aus dem schönsten Teil, wie ich finde. Aus Bayern. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Ich stamme vom Lande. Bei uns zu Hause war nie viel los, deshalb zog es mich auch in die Großstadt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wieder nach Hause zurückzugehen. Es kommt darauf an, wie sich mein Leben weiter entwickelt. Andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, hier in London zu bleiben, oder woanders hinzugehen. Ehrlich gesagt, habe ich vorerst kein festgestecktes Lebensziel. Außer natürlich, eine gute Prüfung zu machen und damit eine gute Grundlage für meine Pläne zu legen.“
„Dein Englisch ist jedenfalls hervorragend.“
„Danke für die Blumen.“ Umständlich goss sie sich die zweite Tasse Tee ein. Die feuchten, losen Blätter fing sie mit einem kleinen Sieb auf.
„Dein Englisch ist aber auch nicht schlecht!“
Beide lachten und Theresa war es, als würden ihr die Beine unter dem Stuhl weggezogen, diesmal aber nicht wegen der heranziehenden Erkältung, sondern wegen seines umwerfenden Lächelns. Endlich gestand sie es sich ein: Sie war wirklich in diese Zufallsbekanntschaft verliebt! Es war ihr, als würde sie ihn bereits seit einer Ewigkeit kennen. Ihre Gefühle, die sie bisher so sparsam an den männlichen Teil der Bevölkerung verschwendet hatte, wirbelten im Kreise und ihr wurde tatsächlich schwindlig vor Aufregung. Es konnte doch nicht sein, dass sie jetzt schlappmachte, jetzt, da sie dem schönsten und interessantesten Mann auf Erden gegenübersaß! So sehr sie sich zusammenriss, es war nicht mehr zu leugnen, dass sie ins Bett gehörte. Unvermittelt überfiel sie Schüttelfrost und so konnte sie es auch vor ihrem Begleiter nicht mehr verbergen, wie schlecht sie sich fühlte.
„Ich glaube kaum, dass du abstreiten kannst, dass es dir wirklich schlecht geht. Keine Widerrede mehr! Ich bringe dich jetzt sofort nach Hause!“, bestimmte Tim und als ob er ihre Gedanken erraten würde, fügte er schmunzelnd hinzu: „Keine Bange. Ich bin Offizier und Gentleman. Ich möchte dich nur gut verpackt im Bett wissen.“ Obwohl es Theresa wirklich schlecht ging, musste sie über seine missglückte Aussage lachen. Er lachte mit ihr.
„Wo wohnst du denn?“
Willig gab sie ihm ihre Adresse und er half ihr in das Taxi, das er herbeigewunken hatte. Theresa widersprach ihm nicht. Bereits als Kind überfielen sie diese Erkältungsanfälle heftig und beinahe ohne jede Vorwarnung. Einmal passierte es ihr sogar, dass sie in der Schule umkippte und postwendend Fieber bekam. An Gefahr dachte sie nicht mehr, nur noch daran, dass er sie hoffentlich bis in ihr Zimmer bringen würde, denn allein würde sie es auf ihren eigenen Beinen kaum schaffen.
Er tat ihr den Gefallen, setzte sie vorsichtig auf ihr Bett und half ihr, Regenjacke und Pulli auszuziehen. „Jetzt leg dich hin“, ordnete er mit fester Stimme, die keinen Widerspruch duldete, an. „Ich werde inzwischen versuchen, heißen Tee zu machen. Hast du hier irgendwo Erkältungsmedizin?“
„Da ist Aspirin in der Schublade unter der Kochplatte. Wenn du mir zwei geben würdest. Es hat mir noch immer geholfen“, antwortete sie matt, während sie sich ihren Pyjama anzog, nachdem er sich umgedreht hatte. Müde sank sie in die Kissen. Sie nahm die Tabletten und trank den heißen Kräutertee, den er aufgebrüht hatte, in kleinen Schlucken. Er hatte sich in den weichen Sessel neben dem Bett gesetzt und sah sich nun ganz offen im Zimmer um. Da sie offensichtlich noch nicht schlafen wollte, unterhielt er sie ein wenig.
„Du hast aus dem heruntergekommenen Zimmer ja eine ganze Menge gemacht.“
Tatsächlich hatte sie mit billigsten Mitteln versucht, dem unpersönlichen Raum eine gemütliche Note zu geben. Dazu diente ihr in erster Linie der Koffer voll mit Stoffen, die ihre Mutter, eine Schneiderin, ausgemustert hatte. Nun waren die abgeschabten Stühle, von denen es zwei im Raum gab, mit fröhlichen Hussen überzogen und auch der weiche Sessel, in dem ihr Besucher saß, hatte einen derben, doch nicht minder hübschen Cordstoff aufgetackert bekommen. Auch die überaus schäbigen Gardinen hatte sie ausgewechselt. An die Wände hatte sie Flohmarktbilder gehängt und besonders schadhafte Stellen zierten Poster mit Bildern von verschiedenen Regionen Englands, die sie in Reisebüros erbettelt hatte. Den einzigen wirklichen Luxus, den sie sich erfüllt hatte, war das Bett. Die Matratzen waren noch ganz gut, doch mit der britischen Art sich mit mehreren Schichten Tüchern und Bettdecken zuzudecken, hatte sie sich noch nie anfreunden können. Also hatte sie sich eine teure Daunenzudecke geleistet. Nun lag sie inmitten der wohligen Zudecke, die mit einer hellen, einfarbigen Flanellbettwäsche bezogen war und fühlte sich schon besser. Doch gegen die bleierne Müdigkeit, die sie plötzlich überkam, war sie machtlos. Obwohl sie wach bleiben wollte, schlief sie erschöpft ein.
Tim bewachte ihren Schlaf. Einerseits verstand er nicht, warum er überhaupt noch hier bei dieser fremden Frau war, während seine kostbare Zeit verstrich, ohne dass er sie anderweitig nutzte. Andererseits ging eine merkwürdige Faszination von ihr aus, die ihn festhielt. Zu sagen, dass sie ihm sympathisch war, träfe nicht den Kern der Sache. Im Stillen gestand er sich ein, dass er sich unsterblich in sie verliebt hatte. Vom ersten Augenblick an. Allein diese Tatsache verleitete ihn dazu, tagtäglich vor dem Museum Ausschau nach ihr zu halten und darum zu beten, dass sie noch einmal vorbeikäme. Immerhin waren seine Gebete erhört worden!
Sie lag in ihren dicken Kissen ohne auch nur einen Laut von sich zu geben oder sich zu bewegen. Ihr Gesicht, das vorhin so angespannt gewirkt hatte, war nun entspannt. Die dunklen, immer noch ein wenig feuchten Haare bildeten einen eigenartigen Kontrast zu dem nach wie vor bleichen Teint. Tim fragte sich, wie alt sie wohl sein mochte.
Leise stand er auf, ging zu ihrem überfüllten Schreibtisch und betrachtete die Dinge, die da herumlagen. Neben den Lehrbüchern entdeckte er einige schmale Heftchen mit Shakespeare-Stücken. Sie waren zerfleddert, wie von tausend Händen benutzt. Daneben lagen einige Briefe, die sie wohl erst vor kurzem erhalten hatte. Er kämpfte mit sich. Diese Briefe gingen ihn nichts an, er durfte sie nicht lesen. Doch die Neugierde war übermächtig. Nein, er hatte nicht vor, ihre Briefe zu lesen, er wollte nur die Absenderadressen begutachten. Daniel Frank hieß der eine Absender. Ihr Ehemann? Er drehte den zweiten Brief um. Familie Frank Georg stand dort. Wenn das ihre Eltern waren, so war der andere wohl ihr Bruder. Die Tatsache, dass es sich um ihre Schwiegereltern handeln könnte ignorierte er in diesem Augenblick. Außerdem war es unwahrscheinlich, dass sie verheiratet war. Er legte die Kuverts wieder an ihren Platz zurück. Mehr gab es nicht zu sehen, kein Hinweis auf einen Mann in ihrem Leben, einen Freund. Kein Bild, kein weiterer Brief.
Der Gedanke an seine bevorstehende Abreise machte ihm Kopfzerbrechen. In seinem Kopf war kein Platz für die Vorstellung, dass er in zwei Tagen abreisen sollte und sie womöglich nie mehr wiedersehen würde. Er sah aus dem Fenster, dessen Ränder schon blind waren. Dabei entdeckte er den Supermarkt und entschloss sich spontan, ein paar Einkäufe zu erledigen. Leise verließ er das Zimmer.
Einige Zeit später erwachte Theresa. Sie fühlte sich jetzt besser als vorhin, wenn auch immer noch krank und schwach. Er war noch da und ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass sie etwa drei Stunden geschlafen haben musste. Inzwischen war es draußen dunkel geworden und Regentropfen patschten gegen die Fensterscheibe. Durch die Regenrinne, die direkt vor ihrem Zimmerfenster verlief, hörte sie das Gurgeln des abfließenden Wassers. Sie setzte sich auf und wartete darauf, dass er etwas sagte. Tim saß in dem Sessel und beobachtete sie noch genauso wie vorhin, als sie vor dem Einschlafen einen letzten Blick auf ihn geworfen hatte.
„Du bist immer noch da?“
„Ich konnte dich doch nicht allein lassen. Ich habe noch nie jemanden so schnell derart krank werden sehen.“
„Passiert mir eigentlich recht selten, aber es passiert eben hin und wieder. In kürzester Zeit geht es mir dann hundeelend.“
Er hatte ein hölzernes Tablett entdeckt und ein Menü darauf angerichtet. Tim hatte es auf einen Stuhl neben ihrem Bett gestellt. „Du musst essen, wenn du wieder zu Kräften kommen willst.“
„Du liebe Zeit! Wie hast du das hier in meiner nicht vorhandenen Küche alles geschafft?“ Er hatte kleine Sandwiches mit verschiedenen Belägen zubereitet und einen bunten Obstsalat in einer Extraschüssel dazugestellt. Daneben standen ein Glas Orangensaft und ein paar ausgesuchte Süßigkeiten. Ziemlich teure Cookies, wie Theresa sofort erkannte. Nun machte er sich in ihrer Kochecke zu schaffen und brachte ihr einen dampfenden Becher herüber. „Und das ist Hühnerbrühe nach Art des Hauses. Geheimrezept von meiner Mutter. Hilft immer und in allen Lebenslagen.“
„Was ist das?“
„Reinstes Instantpulver. Tut aber richtig gut, wenn man auf sonst nichts Appetit hat“, schmunzelte er.
Sie trank artig und stellte fest, dass er wirklich recht hatte. Mit diesem Aperitif schaffte sie es sogar, drei seiner Minisandwiches zu verdrücken und den ganzen Obstsalat aufzuessen.
„Wie komme ich dazu, dass du mich so umsorgst? Du verbringst deine ganze kostbare Zeit hier mit mir! Das ist ja schrecklich!“
Er schüttelte den Kopf. „Ganz und gar nicht! Du bist eben die schönste Sehenswürdigkeit von London. Da brauche ich kein Museum.“
Sie war geknickt. „Das tut mir ehrlich leid. Wenn ich Herr meiner Sinne gewesen wäre, hätte ich es nicht zugelassen. Das kannst du mir glauben. Aber jetzt ist es natürlich zu spät.“
„Bereust du es denn, dass ich hier bin? Ich meine, wenn ich gehen soll ... ich möchte nicht, dass du irgendwie ...“
Sie wollte energisch den Kopf schütteln, brachte jedoch nur eine kleine Bewegung zustande, so sehr schmerzte es sie. Dennoch antwortete sie ihm. „Du musst zugeben, dass es schon eine eigenartige Situation ist, ich meine, wir kennen uns seit ein paar Stunden. Und du begleitest mich auf mein Hotelzimmer. Wenn ich das meinen Eltern erzählen würde ... ich glaube, mein Vater würde dich lynchen!“
„Würde er das wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dein Vater so schlimm sein soll, jetzt, wo ich dich kenne.“
Sie machte ein bekümmertes Gesicht, ersparte sich jedoch eine Antwort. Tim kannte ihren Vater nicht.
„So einfach ist es doch wohl auch nicht, oder?“, sprach er weiter. „Man könnte es auch so sagen: Du hattest Hilfe gebraucht und ich war derjenige, der dir am nächsten stand, im Sinne der Reihenfolge, verstehst du. Und jetzt sitze ich da und weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht verschwinde ich doch besser.“ Er stand auf und sie ließ ihn gewähren. Als er bereits an der Tür war, sagte sie noch: „Ich würde das, was du heute für mich getan hast, gerne wiedergutmachen, aber ich schätze, dazu werden wir keine Gelegenheit mehr haben, nicht wahr?“
„Ich reise bald wieder ab“, antwortete er knapp und Trauer schwang in seiner Stimme mit.
Sie senkte den Kopf. „Schade. Aber ich danke dir für alles.“
Er nickte nur kurz und zog die grüngepinselte, hölzerne Tür ins Schloss.
Kapitel 3
„Hey, Tim! Komm doch endlich einmal mit in das Pub. Da steppt der Bär! Du bist doch sonst keine solche Träne. Jetzt hängst du schon zwei Abende hier im Zimmer herum.“ John Silverman, sein Zimmerkollege, versuchte, Timothy zum Mitkommen zu bewegen. John war erheblich älter als Tim und hatte zu Hause eine nette Frau und zwei kleine Kinder. Tim verstand, dass sein Freund Spaß an einem ungestörten Abend in der Kneipe hatte und wollte es ihm nicht verderben. Dennoch konnte er sich nicht dazu aufraffen, mit ihm zu kommen.
Sie hatte ihn nicht zurück gehalten! Also wollte sie seine Gesellschaft nicht! überlegte er pausenlos. Seine Gedanken kreisten so sehr um seine Zufallsbekanntschaft, dass es für ihn nur zwei Alternativen gab: hier zu bleiben und die Decke anzustarren oder zu ihr zu gehen. Aber er musste annehmen, dass sie keinen Wert auf seinen Besuch legte.
John stand immer noch vor seinem Bett und Tim sah sich zu einer Antwort genötigt.
„Ich habe keine Lust. Ihr seid doch eine ganze Truppe. Da fällt doch gar nicht auf, wenn ich nicht dabei bin.“
John zog ab. Tim lag auf dem Bett und starrte wieder die graue Betondecke an. Sie waren in einer Polizeikaserne einquartiert worden und es war reiner Zufall, dass John und er zu zweit wohnen konnten. Die anderen waren ausnahmslos in Mehrbettzimmern untergebracht, die kaum ein Mindestmaß an Privatsphäre zuließen.
Theresa ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Wie konnte er sich derart von einem fremden weiblichen Wesen vereinnahmen lassen? Wie konnte es angehen, dass er Tag und Nacht nur an sie dachte? Tim hatte eine Menge Fragen und keine Antworten dazu.
Obgleich er sich fest vorgenommen hatte, sie aus seinen Gedanken zu verbannen, stand er eine halbe Stunde später wieder vor ihrem Hotel und brauchte noch einmal zehn Minuten, bis er den Kampf mit sich selber endgültig verlor und das alte Gebäude betrat.
Auf sein Klopfen hin meldete sich niemand und er dachte schon daran, einfach wieder umzukehren, doch was sein Verstand vorgab, führte sein Arm nicht aus. Er betrat das Zimmer ohne Aufforderung. Die Tür war zwar offen, doch sie war nicht da. Wieder wollte er gehen, und wieder brachte er es nicht fertig. Er hörte sie ihm Bad rumoren und rief laut ihren Namen. Keinesfalls wollte er sie in Verlegenheit bringen oder erschrecken, wenn sie herauskam.
Wenige Sekunden später öffnete sie die schmale Badezimmertüre. Sie hatte offensichtlich geduscht, eine Badewanne gab es nicht in der kleinen Nasszelle, und trug ein überdimensionales Badetuch um ihren Körper geschlungen. Die nassen Haare tropften auf ihre Schultern und hinterließen Wasserperlen auf der hellen Haut.
Sie blieb wie angewurzelt stehen. „Du?“ fragte sie eher ungläubig als überrascht.
„Ich ... wollte nur sehen, wie es dir geht. Morgen fliege ich wieder heim.“ Diese Erklärung war mehr als banal angesichts dieses intimen Momentes. Timothy konnte den Blick nicht von ihr wenden. Sie wirkte erholt, frisch wie eine Blüte im Frühling. Er erkannte sofort, dass es ein Fehler gewesen war, noch einmal hierher zu kommen. Ihr wohlgerundeter Körper wirkte derart erotisierend auf ihn, dass er Mühe hatte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie standen beide wie angewurzelt.
Seitdem er vorgestern weggegangen war, hatte sie mit Sehnsucht an ihn gedacht. Es erschien ihr unglaublich, dass sie sich derart mit Haut und Haaren in einen Fremden verliebt haben könnte und jetzt, gerade in diesem Moment erkannte sie, dass sie dabei war, eine ganz große Dummheit zu begehen. Wie hätte sie ahnen können, dass ihr Gegenüber gegen genau die gleichen Gedanken ankämpfte.
„Pass auf, dass du nicht wieder krank wirst. Es ist kalt hier drin“, sagte er und blickte ihr dabei direkt in die Augen.
Theresa bekam eine Gänsehaut, aber nicht vor Kälte. Es war so einfach. Sie musste einfach nur das Badetuch öffnen. Sie sah ganz deutlich, dass auch er wollte. Einmal nur die ihr eigene Besonnenheit ausschalten. Aber Vernunft mischte sich in ihr Verlangen.
Doch Theresa schüttelte sich. Nein! Nicht vernünftig sein! Sie trat auf ihn zu. Kaum mehr ein halber Meter trennte sie voneinander.
Ihr Gesicht nahm einen fast kindlichen Ausdruck an und ihre Miene spiegelte das Verlangen wider, das sie nun nicht mehr verbergen konnte. Tim nahm sie in den Arm und küsste sie begehrlich. Es war keine dumme Schwärmerei für das Unerreichbare oder eine rasche, nichtssagende Eroberung. Dies war tief empfundene Liebe, dessen waren sich beide sicher.
Die Trennung schmerzte unsagbar. Er ging am nächsten Morgen sehr früh, um noch rechtzeitig zum Dienstbeginn anzukommen. Er hatte einen Plan im Hinterkopf, wusste nur noch nicht, wie er es genau anstellen konnte, dass es ihm gelang. Eines jedoch wusste er ganz genau: Es war ihm unmöglich, diese zauberhafte Frau jetzt alleine zurückzulassen, nachdem er sie endlich gefunden hatte.
Tatsächlich gelang es ihm, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass er seinen Jahresurlaub gerade jetzt antreten müsse, und es eben aus finanziellen Gründen schlauer war, gleich da zu bleiben und erst in drei Wochen zurückzufliegen.
Er erzählte John davon.
„Was heißt das, du kommst nicht mit zurück?“ Sein Freund verstand nicht, was Tim ihm erzählte.
„Ich nehme erst einmal Urlaub und komme dann in drei Wochen zurück. Ist doch eigentlich ganz einfach, nicht wahr?“
„Hat das womöglich etwas mit letzter Nacht zu tun, als du zwar nicht in die Kneipe mitkommen wolltest, aber schließlich erst zum Frühstück wieder angekommen bist?“, argwöhnte John.
Als Tim nicht antwortete, lud der Ältere sein Gepäckstück vom Bett und setzte sich darauf. „Hör mal zu. Ich schätze, du hast ein Mädchen kennen gelernt, das dich auch gleich mit auf ihr Zimmer genommen hat. Das ist gut und schön und kommt immer wieder einmal vor. Aber deshalb gleich sein ganzes Herz dranzuhängen ist absoluter Blödsinn.“
Tim unterließ es, John anzusehen. Er schaute aus dem Fenster und beobachtete das Treiben draußen auf dem Kasernenhof. John wartete ab.
„Sie ist phantastisch. Und ich habe sie nicht erst gestern kennen gelernt.“
„Wie lange kannst du sie denn wohl kennen? Drei Tage?“ John war fassungslos über den Leichtsinn seines Freundes. „Du kannst doch nicht wegen einer tollen Nacht dein ganzes Leben aufs Spiel setzen. Ich meine, du hast sie doch wohl wegen, na, du weißt schon, Aids und so was gefragt!“
„Hat sie nicht“, antwortete Tim knapp und wusste nicht, wie das Gespräch diesen Verlauf nehmen konnte.
John stand auf und ging zu ihm hinüber. Hart riss er ihn an der Schulter herum. „Du meinst, ihr habt nicht darüber gesprochen? Verdammt, Tim! Sie kann eine Schnalle sein. Was glaubst du wohl, was sie sonst macht, wenn sie gleich am ersten Abend mit dir ins Bett steigt.“
„Hör auf, sie zu beleidigen!“ Tim war ernsthaft wütend. „Dasselbe könntest du über mich sagen.“
John erkannte, dass das hitzige Gespräch in falsche Bahnen verlief. „Es tut mir leid. Ich kenne sie ja wirklich nicht. Erzähl doch mal.“ Er setzte sich wieder auf sein Bett und wartete geduldig. Der Ältere fühlte sich verantwortlich für seinen jungen Freund und fand, dass es besser wäre, sich etwas näher zu informieren.
„Sie ist wahnsinnig hübsch und anziehend. Ich meine, ich bin von der ersten Stunde an auf sie abgefahren ... nein, das ist falsch. Ich habe mich ganz altmodisch in sie verliebt. Und sie sich in mich. Sagt sie. Das ist alles.“
John nickte. „Na gut. Dann wünsche ich dir alles Gute. Aber hast du dir überlegt, was nach diesen drei Wochen sein wird? Sie ist hier in London und du bist in Kanada ... du wirst doch zurückkommen?“
Timothy nickte. „Natürlich komme ich zurück. Ich habe nicht vor, mein ganzes Leben umzukrempeln, das heißt, ich habe es im Moment nicht vor. Und sie ist nicht aus England. Sie ist Deutsche.“
„Auch das noch!“, entfuhr es John und er bereute es sofort.
„Was meinst du damit?“ Timothy hatte noch niemals rassistische Sprüche von seinem Freund gehört.
„Ich wollte das nicht sagen. Tut mir leid!“ John machte eine fahrige Geste, so als wolle er das Gesagte weg wischen. „Weißt du, Deutsche sind in meiner Familie nicht besonders beliebt!“
Tim senkte den Kopf. „Ja, klar.“ Er hatte vergessen, dass John Jude war und seine Urgroßeltern mütterlicherseits umgebracht worden waren. Seine Großmutter war nur durch einen Zufall gerettet worden. John hatte es ihm einmal erzählt. „Tut mir wirklich leid, John.“
Der Ältere stand auf. Er machte wiederum eine Handbewegung, die wohl die traurigen Erinnerungen an seine Familiengeschichte vertreiben sollte und fuhr fort, seine Tasche zu packen. „Wie gesagt: Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Aber bitte pass auf dich auf. Und vergiss nicht, deine Eltern anzurufen. Sie machen sich sonst Sorgen.“
„Ich kann schon auf mich aufpassen und ich werde anrufen.
Zufrieden, Dad?“ Tim nahm seine Reisetasche und marschierte zur Tür hinaus.
In der U-Bahn kamen ihm erste Bedenken. Er kam einfach bei ihr an und teilte ihr mit, dass er nun drei Wochen bei ihr wohnen würde. Was wäre, wenn sie es wirklich als One-Night-Stand betrachtete und ihn einfach rausschmiss? Gedankenverloren stieg er in der Paddington Road um und wartete auf dem nächsten Bahnsteig auf die District-Line, die ihn nach Earl’s Court bringen sollte. Es war Hauptverkehrszeit und er empfand das Gedränge als beinahe unerträglich. Er war nicht rücksichtslos genug, sich in die nächste U-Bahn zu drücken, und so musste er noch einige Minuten in der Londoner Rushhour aushalten. Seine Gedanken lenkten ihn ab. Am einfachsten würde sein, wenn er die Lage erst einmal abcheckte und so tat, als würde er woanders wohnen. Er würde dann schon ein billiges Zimmer finden. Und es blieb ja immer noch die Option, gleich nach Hause zu fliegen. Andererseits konnte er sich kaum vorstellen, dass sie ihn nicht mehr sehen wollte, nicht nach dieser Nacht.
Getöse im Inneren der U-Bahn-Röhre kündigte den nächsten Zug an und ein Schwall kalter Zugluft ergoss sich in die Wartehalle. Earl’s Court war eine oberirdische Station. Kalte Herbstluft, nicht so stickig wie in den zugigen unterirdischen Bahnhöfen und doch durchtränkt von den Düften der Großstadt, zog durch die Haltestelle, als er die Treppen zum Ausgang hinaufstieg. An der Barriere musste er noch einmal sein Ticket benutzen, um den U-Bahnhof verlassen zu können.
Er musste drei Blocks weit gehen, um zu ihrem Hotel zu kommen. Drei Blocks, in denen er sich die Worte zurecht legte, die er ihr sagen wollte.