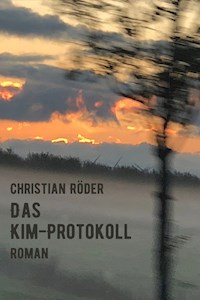Christian Röder
Das Kim-Protokoll
Die Geschichte einer Befreiung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort der Herausgeber
10.09.2014
Dezember 2012
11.09.2014
Februar/März 2013
12.09.2014
Februar/März 2013
13.09.2014
März 2013
15.09.2014
April 2013
15.09.2014
August/September 2014
16.09.2014
September 2014
17.09.2014
18.09.2014, vormittags
18.09.2014, nachmittags
19.09.2014
20.09.2014
20./21.09.2014, nachts
21.09.2014
21.09.2014, später Abend
Herbst 2013
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
28.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
04.10.2014
05.10.2014
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
Nachwort der Herausgeber
Impressum neobooks
Vorwort der Herausgeber
Das Kim-Protokoll ist ein einzigartiges Dokument, das eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte schonungslos aufdeckt. Es beweist, dass nichts ist, wie es scheint.
Zwischen dem 03. September und dem 14. Oktober 2014 verschwand Kim Jong-un aus der Öffentlichkeit. Der nordkoreanische, sogenannte Diktator sei während dieser Zeit entmachtet worden, habe einen Unfall gehabt, sei gestorben oder habe gesundheitliche Probleme gehabt, logen die Systemmedien weltweit.
Was wirklich geschah, enthüllt nun das Kim-Protokoll.
Kim Jong-un ist das Opfer westlicher Manipulation und Propaganda, das an der Spitze eines Staates steht, den der Westen über viele Jahrzehnte systematisch zum Sündenbockstaat aufgebaut hat. Der IT-Sicherheits-Experte Tom unternahm den heroischen Versuch, Kim Jong-un während dessen geheimen Urlaubs in der Schweiz bzw. Deutschland zu befreien.
Das Kim-Protokoll ist die Sammlung von Artikeln eines im Internet versteckten Blogs, in dem Tom minutiös sämtliche Vorgänge festgehalten hat und das erst jetzt gefunden werden konnte. Seine Veröffentlichung ist moralische Pflicht.
Wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass die Gegenseite das Kim-Protokoll attackieren und in den Dreck ziehen wird. Selbstverständlich wird angezweifelt werden, dass Tom den echten Kim Jong-un in seinem Bunker aufgenommen hat. Die Systempropaganda wird alles abstreiten, vielleicht der Welt sogar ein „Entführungsopfer“ präsentieren, das angeblich statt Kim Jong-un in Toms Bunker festgehalten wurde. Es wird den Eliten nicht schwerfallen, Verleumdungswege zu finden. Zudem sind die meisten Menschen käuflich, wie wir wissen. Doch dieser Widerstand wird letztlich nur erst recht davon zeugen, wie wahr und brisant der Inhalt des Kim-Protokolls ist.
Wir haben das Kim-Protokoll nur an wenigen Stellen angepasst. Die Datumsangaben beziehen sich auf den dokumentierten Tag, nicht auf das jeweilige Veröffentlichungsdatum.
True Anonymous, 2019
10.09.2014
Ich dachte, ich hätte ihn umgebracht.
Kim lag regungslos auf dem schmalen Bett in meinem Bunker. An seinem linken Mundwinkel war Speichel zu sehen. Ich ekelte mich und schämte mich gleich darauf. Einen Menschen umzubringen und sich dann vor ihm zu ekeln, war respektlos. Der Elektroschocker glitt aus meiner Hand.
Was würde ich tun, wenn Kim jetzt wirklich tot wäre? Ich müsste ihn verschwinden lassen. Wie aber sollte ich seinen leblosen, massigen Körper aus meinem Bunker schaffen? Vermutlich nicht in einem Stück. Mir wurde übel.
Und es konnte sogar noch schlimmer kommen, dachte ich. Ich sah schon mehrere schwarze SUVs vor meinem Haus halten. Ein paar maskierte Gestalten sprangen heraus, die dann die äußere Bunkertür sprengten, in den Raum stürmten und mich sofort erschossen. Was wäre das Letzte, das ich sehen würde? Ein vermummtes Gesicht? Mündungsfeuer? Ein lachender Kim?
Ich beruhigte mich. Du bist sehr gut vorbereitet, sprach ich mir tapfer zu. Selbst die Sache mit den RFID-Chips hast du exzessiv recherchiert. Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass implantierte Chips mangels eigener Stromversorgung nur im Nahbereich funktionieren. Das meiste, was man über ihre angeblichen Fähigkeiten und Eigenschaften liest, ist reine Panikmache: Kim trägt kein RFID-Chip-Implantat. Sie werden ihn nicht finden. Du bist sicher, das Projekt ist sicher. Und: Kim ist nicht tot!
Hatte er sich gerade bewegt? Es war ein kurzer Ruck durch seinen Oberkörper gegangen, den ich aus dem Augenwinkel bemerkt hatte, während ich zur Tür spähte, in Erwartung der todbringenden nordkoreanischen Geheimdienstkiller. Kims Brustkorb hob und senkte sich jetzt kontinuierlich.
In Deutschland zugelassene Elektroschocker waren schwach und verursachten höchstens ein Kitzeln, sie waren für meine Zwecke also völlig ungeeignet. Deshalb hatte ich zu einem illegalen Import aus Japan greifen und eine eventuelle Todesfolge einkalkulieren müssen. Kim hatte soeben einen repräsentativen Test bestanden: Ich war enorm erleichtert! Es war sehr wichtig für meine Aufgabenbereiche, über einen hoch effizienten Elektroschocker zu verfügen, der keinesfalls letal wirkte.
Hatte er sich geräuspert? Es klang so. Seine Augen waren geöffnet. Er sah mich mit einem Ausdruck an, als wäre er genervt. Fast war ich beleidigt: Ich hatte diesen prominenten Diktator gerade in einer sensationell unauffälligen Aktion aus seinem bisherigen Leben gerissen. Nichts würde sein wie zuvor – und er sah mich an, als hätte ich mir einen Schülerstreich erlaubt?
Ich wollte ihn ansprechen, ließ es dann aber sein. Mein Mund stand offen, sicher sah es idiotisch aus. Ich schloss ihn bemüht würdevoll und schwieg. Kim blickte jetzt ins Leere. Ich dachte daran, was diese Augen alles gesehen haben mussten: Raketentests, Hinrichtungen, Militärparaden, Dennis Rodman. Auf Bildern war er meistens gut gelaunt.
Seit er hier im Bunker war, hatten wir noch kein einziges Wort gesprochen, wie mir auffiel. Nun gut, ich wollte ihn nicht drängen. Wir hatten ja Zeit. Der Bunker liegt unter einem Carport. Das dunkle Geheimnis dieser biederen Idylle ließ mich bereits mehrmals schmunzeln.
Kim ist gut gesichert. An seinem linken Handgelenk befindet sich die eine Hälfte einer Handschelle. Von ihr führt ein mit flexiblem Kunststoff ummanteltes Stahlseil zu einer Halterung an der Wand. Kim hat exakt den Bewegungsradius, den er benötigt, um Toilette und Dusche zu benutzen. Gleichzeitig ist er stets weit genug von Eingang und Küchenzeile entfernt, die ich als Gefährdungsbereiche eingestuft habe. Ich bin ein bisschen stolz auf diese Leistung, da ich eigentlich kein handwerklicher Typ bin. Nach Recherchen im Internet hatte ich das Material besorgt, gründlich berechnet, welche Kräfte es aushalten musste und schließlich alles selbst montiert. Das Stahlseil schränkt Kim nur minimal ein: Wenn er ein T-Shirt oder einen Pulli anzieht, schlängelt es sich durch den linken Ärmel sowie an der linken Seite seines Oberkörpers vorbei, bis es unten am Saum das Kleidungsstück wieder verlässt. Ich habe das alles vorher ausprobiert, es funktioniert tadellos. Kim zu gestatten, das Stahlseil abzunehmen, wäre hingegen einfach zu riskant.
Ich lehnte mich zurück und spürte das schwere Metall des
Ruger Redhawk von 1986 im Kaliber .357 mit 5,5 Zoll Lauflänge auf der linken Seite meiner Brust. Eine seltene Waffe, die genau meinen Geschmack trifft. Sie saß fest im Holster, das von meinem Sakko überdeckt wurde. Ich trug heute eine beigefarbene Chino, weiße Sneaker, das besagte Sakko (marineblau), ein weißes Hemd und eine Sonnenbrille und sah wie jemand aus, dessen Lebensziel es war, eine Yacht zu besitzen. Als ich Kim heute Nachmittag im Freibad traf, hatte ich zusätzlich zu einer Perücke noch ein dunkelblaues Basecap (ohne Emblem oder Beschriftung) auf dem Kopf.
Ich werde meinen Stil für die Gespräche mit Kim geringfügig modifizieren. Ein Sakko werde ich nicht mehr tragen, sondern nur ein weißes Hemd. Das Holster mit der Waffe wird also immer gut sichtbar sein. Außerdem werde ich auf das Basecap verzichten und ausschließlich Perücke, Sonnenbrille und falschen Schnauzer tragen. Ich werde
Good Cop und
Bad Cop in einer Person sein, wie in einer amerikanischen Krimi-Serie der Siebzigerjahre. Wo wir gerade bei Äußerlichkeiten sind: Kim trug Badeshorts, Flip-Flops und ein Hawaiihemd. Es ist ein ungewöhnlich warmer Spätsommer.
Mitten in der Nacht sitze ich nun an meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Ich muss immer wieder aus dem Fenster sehen, während ich Ihnen das hier schreibe. Allerdings blicke ich jedes Mal nur in mein erschrockenes Gesicht, das sich zusammen mit der Schreibtischlampe in der Scheibe spiegelt. Bei Tage sehe ich Zweige eines Baumes, eine Straße, die direkt an meinem Haus entlangläuft sowie endlos weite Felder. Mein Haus steht einsam in der Landschaft. Sollte sich jemand nähern, kann ich ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit schon frühzeitig erkennen – wenn es nicht gerade dunkel ist.
Ich muss feststellen, dass mich die nächtliche Blindheit etwas unsicher macht. Um den Anblick meines erschrockenen Gesichts zu vermeiden, könnte ich die Fensterläden schließen – was ich gemacht habe, bevor Kim mein Gast war – oder den Raum wechseln. Aber nein, das kommt nicht in Frage. Lieber sehe ich wenig als gar nichts. Und in einem anderen Raum weiterzuschreiben, geht auch nicht. Dafür bin ich zu sehr Gewohnheitstier – es ist das erste Mal, dass ich dieses Wort benutze: Gewohnheitstier. Ich kann nur hier, in meinem Arbeitszimmer, arbeiten. Die Stille drückt. Sie ist massiv wie ein Granitblock, der mich zerquetschen will.
Ich werde im Wohnzimmer Musik anmachen und laut genug stellen, damit ich sie auch hier höre. Erledigt. Ich habe
Diamond Dogs von David Bowie gewählt. Nur wenige Menschen können David Bowie wirklich verstehen. Ich zähle dazu, weil Bowie und ich etwas ganz Wesentliches gemeinsam haben. Das erkläre ich Ihnen später noch. Übrigens höre ich fast ausschließlich Schallplatten: Falls Sie sich fragen sollten, warum ich Musik in einem anderen Raum anmache und nicht einfach über den Rechner streame.
Es ist übrigens ein Wunder, dass Sie das hier lesen können. Ich habe dieses Blog so gut im Internet versteckt, dass es fast nicht zu finden ist. Vielleicht wird es auch nie gefunden werden und ich schreibe gerade einer vollkommen imaginären Person. Streng genommen habe ich versagt, wenn Sie dieses Blog gefunden haben. Ich hoffe also sehr, dass es Sie nicht gibt.
Wenn Sie jedoch wirklich existieren sollten, dann müssen Sie ein ganz besonderer Mensch sein, und ich würde es sehr bedauern, Sie nicht zu kennen. Aber wer weiß: Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages.
Warum ich überhaupt ein Blog im Internet verstecke, um darin ein Tagebuch zu führen, fragen Sie sich? Na ja, mich hat einfach die Idee gereizt, in der Öffentlichkeit quasi unsichtbar zu sein. Jeder könnte das lesen, gleichzeitig ist es extrem unwahrscheinlich. Die Wahrheit – unentdeckt in einem Netz aus Lügen. Der kleine Kitzel, entdeckt zu werden.
… Come out of the garden, baby / You’ll catch your death in the fog …
Ich will Ihnen noch schnell erzählen, wie mein erster Tag mit Kim weiter verlief.
Kim hatte sich aufgerichtet. Es war ein langsamer, mühevoll wirkender Prozess. Er schien gründlich zu überlegen, ob er wirklich von der horizontalen in eine eher vertikale Körperhaltung wechseln sollte. Ich ließ ihn sich selbst entscheiden; schließlich will ich ja, dass Kim sich hier völlig frei entfaltet. Als er dann aufrecht dasaß, dauerte es immer noch eine ganze Weile, bis er mir in die Augen sah. Als er es dann tat, geschah es mit einer Plötzlichkeit, die geradezu unheimlich war. Kims Blick bohrte sich durch meine Pupillen, schien meine Netzhaut anzusengen. Dennoch hielt ich ihm stand. Das war wichtig, dachte ich mir schon währenddessen. Es musste jederzeit diskussionslos klar sein, dass er hier nicht bestimmte. Gar nicht so einfach, wenn man einen professionellen Diktator vor sich hat.
Es war goldrichtig, dass ich mir einen Drehstuhl besorgt hatte, auf dem ich mal mit der Lehne im Rücken, mal verkehrt herumsaß, und mit dem ich schnell zur Küchenzeile rollen konnte, um mir eine Tasse Kaffee zu holen. Das Ganze wirkte lässig und unberechenbar. Erst recht jemandem gegenüber, dessen Bewegungsradius stark eingeschränkt war.
Nachdem Kims Blick von mir abgelassen hatte, rollte ich zur Küchenzeile, schnappte mir eine Tasse, goss Kaffee hinein, rollte zurück und kippte mir dabei etwas aufs Bein. Ich sah sofort zu Kim, der genau in diesem Moment von mir wegsah. Ich nahm einen Schluck vom restlichen Kaffee und lehnte mich zurück. Jetzt stand Kim auf. Er ging in Richtung Sanitärbereich, dann auf mich zu, sah kurz ausdruckslos in meine Richtung und setzte sich wieder. Er hatte sein Revier ausgemessen. Ruhig und souverän. Ich war beeindruckt. Er atmete tief durch, vielleicht war es auch ein Seufzen. Wieder wirkte er genervt, wie das Opfer eines Schülerstreichs.
„Warum bin ich hier? Wollen Sie Geld? Vergessen Sie’s! Meine Familie ist arm, Freunde habe ich keine.“
„Ich habe nur fluoridfreie Zahnpasta für Sie. Ich hoffe, das macht Ihnen nicht allzu viel aus. Weder geschmacklich noch von der Konsistenz her werden Sie einen Unterschied bemerken. Ich will Sie trotzdem darauf hingewiesen haben.“
„Was?“
„Fluoridfrei! Weil Fluorid giftig ist. Bei Kindern mindert es die Intelligenz, bei Erwachsenen verursacht es Demenz und Krebs. Das weiß man mittlerweile, aber die Industrie propagiert natürlich weiterhin, dass Fluorid ein Segen für Zähne und Knochen sei.“
„Nur so als Tipp: Ich kann mir Gesichter nicht merken. Genetischer Defekt! Sie haben also nichts zu befürchten, wenn Sie mich einfach gehen lassen.“
„Sie putzen sich doch die Zähne? Ich meine: regelmäßig? Und Sie nutzen in Nordkorea wahrscheinlich auch fluoridhaltige Zahnpasta, nehme ich an? Das habe ich leider nicht genau herausfinden können.“
„Okay, dann lassen Sie mich eben nicht gehen.“
„Also: Zahnpasta ist da. Und Mundwasser, ebenfalls fluoridfrei. Und natürlich Duschgel und Shampoo und so weiter, alles ohne Aluminium und vegan. Handtücher sehen Sie gleich, wenn Sie die Nasszelle noch mal betreten, links im Regal. Ach ja, ein Bademantel ist auch für Sie da und ein paar Kleidungsstücke, denn Sie werden ja sicher mal wechseln wollen. Wäsche bringe ich Ihnen täglich, eine Garnitur finden Sie jeweils im Regal. Bitte werfen Sie die gebrauchte einfach in Richtung Küchenzeile, so dass sie nicht mehr in Ihrem, Sie wissen schon, Radius liegt, ja?“
„Ach, eigentlich auch egal. Mein Leben ist sowieso ein Flop.“
„Wir verstehen uns, denke ich. Gute Nacht, Kim!“
„Kim?“
Ich verließ den Bunker und fühlte mich gut. Ein paar Skrupel habe ich natürlich. Kein Wunder: Rein formal gesehen, habe ich ein Staatsoberhaupt entführt und bringe ein Land damit potenziell in große Schwierigkeiten.
Allerdings ist Kim ein Marionetten-Diktator, eine Gruselpuppe des Westens, nur dazu geschaffen, die eigene moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Indem er sein Volk unterdrückt, macht er genau das, was der Westen mit seiner geschickten Manipulation immer schon bezweckt hat. Kim ist ein Opfer. Ich werde ihm eine Herberge geben, bis mein Projekt vollendet sein wird. Mein Bunker wird zu seinem Kokon. Kim wird als grausamer Diktator gekommen sein und als ein vollkommen neuer Mensch wieder gehen.
Alles wird sich ändern. Ich werde Kim befreien!
Dezember 2012
Ich zog mich mit einem energischen Ruck aus dem Pool. Wie immer hatte ich dabei Angst, meine Badeshorts zu verlieren, wollte mir aber nichts anmerken lassen und ließ es darauf ankommen, verzichtete also auf einen kontrollierenden Blick nach unten, ging dann ein paar Schritte und spürte plötzlich einen universellen Schwindel. Ich schaffte es gerade noch auf meinen Liegestuhl. Doch hier gab es nicht die Sicherheit, die ich mir erhofft hatte. Ich starrte in den Bilderbuchhimmel über Hongkong, am Rooftop-Pool meines Lieblingshotels. Während man schwamm, konnte man über den Victoria Harbour sehen und den Peak auf Hongkong Island sehr gut erkennen, ich hatte das alles immer genossen und mich großartig gefühlt. Ich war gerade mal einunddreißig Jahre alt und hatte mehr erreicht als viele in ihrem ganzen Leben. Jetzt lag ich in diesem Stuhl und es fühlte sich gar nicht wie Liegen an, es war ein haltloses Schweben, alles war in Bewegung, nichts unter Kontrolle. Aber es machte außen nicht halt. In mir ging es weiter. Ich konnte mein Herz nicht fühlen und wusste doch, dass es viel zu schnell schlug. Ich sah ein Gerinnsel in meinem Gehirn, wie es ein Gefäß verstopfte. So fühlt es sich also an, wenn man stirbt, dachte ich, und rief mit letzter Kraft nach einem Arzt, der dann auch verblüffend schnell kam, als hätte er nur für diesen Zweck bereitgestanden und eine geheime Regie nicht darauf geachtet, wie unrealistisch es war, wenn er sofort da wäre. Es war ein gut gelaunter, junger Chinese, der routiniert meinen Puls fühlte, mir eine Tablette unter die Zunge legte, mit dem Zeigefinger warnte, ich solle sie langsam zergehen lassen, nicht kauen, nicht schlucken. Sein Gesichtsausdruck wechselte währenddessen ständig von besorgt über ernüchtert zu enttäuscht hin und her, bis sich schließlich alles in einem spöttischen Lächeln auflöste. Ich sei noch mal davongekommen, kicherte es unverschämt aus ihm heraus. Ich wollte protestieren, hatte aber nicht die Kraft dazu und wurde außerdem von der Tatsache aus dem Konzept gebracht, dass alle Menschen um mich herum anfingen zu lachen. Es war erst ein unterdrücktes Prusten, dann lachte man frank und frei heraus, es wurden Gläser aneinandergestoßen, bis das Lachen irgendwann verebbte und ein gemütlich-geselliges Gemurmel aufkam. Man unterhielt sich angeregt, vermutlich über mich, vielleicht aber hatte man schon angrenzende Themen erreicht: Menschen, die sich über Sie unterhalten, unterhalten sich auch über Clownerie, Blamage, Hysterie (umgangssprachl.) und Cardiophobie. Der Arzt hatte sich bereits verabschiedet. Ich hasste ihn, wie ich auch alle anderen Menschen hasste. Sie hatten allesamt den Tod verdient, den ich eben noch befürchten musste! Wie konnte man darüber bloß lachen? Ein Getränk wurde mir gereicht, man wollte wohl nett erscheinen, es war Wasser – war es wirklich Wasser? Meine Zunge vergewisserte sich mehrere Male, ja, es schmeckte wie Wasser, es sah aus wie Wasser, wahrscheinlich war es Wasser. Wie aber konnte man da so sicher sein, in einer Gesellschaft, die Todesangst als amüsante Anregung zu einem abendlichen Smalltalk am Pool missbrauchte? Nachdem ich die furchtbare Beklommenheit hinter mir gelassen und mich in einem Moment aufs Zimmer geschlichen hatte, in dem ich sicher sein konnte, nicht beobachtet zu werden, fühlte ich, dass meine Zeit hier vorbei war.
Am nächsten Morgen war dieses Gefühl immer noch da. Es hatte sich sogar zu einem konkreten Gedanken ausgeformt. Ich würde nicht nur Hongkong und Asien hinter mir lassen, sondern auch die Verlogenheit und Ignoranz der allermeisten Menschen, die ich einfach nicht mehr auszuhalten bereit war.
Ich resümierte mein kurzes, aber ereignisreiches Leben: Hacker schon als junger Teenager, Studium der IT-Sicherheit im Ruhrgebiet, der Studiengang war relativ neu damals, alles war spannend, aufregend – bis auf die hohe Zahl wichtigtuerischer Professoren und subalterner Studenten. Schon nach wenigen Seminaren durchschaute ich, dass selbstständiges Denken hier nicht wirklich gefragt, geschweige denn wertgeschätzt wurde. Wenn man ein wirklich kritischer Mensch ist, sieht man so etwas sehr schnell. Glücklicherweise musste ich aber gar nicht an der Uni bleiben, denn schnell interessierten sich große Unternehmen für meine außergewöhnlichen Fähigkeiten.
Als IT-Security-Analyst war ich an spektakulären Penetrationstests beteiligt, lernte dabei ununterbrochen weiter, vernachlässigte private Kontakte und ging schließlich in die USA, nach Südafrika und Asien, wo ich jeweils in verschiedenen Teams daran arbeitete, Schwachstellen aufzudecken, reproduzierbare Tests durchzuführen und Patches zu programmieren, um es ganz grob und für Laien verständlich zu sagen. Die Welt war in Ordnung, mein Leben fantastisch.
Mit der Zeit aber verengte sich alles. Es gab nur noch Arbeit und Geld, alles wirkte groß, war in Wahrheit aber entsetzlich klein. Und künstlich. Ich hatte lange gebraucht, um das zu registrieren. Ich bemerkte, wie oberflächlich die meisten Menschen, wie desinteressiert sie an mir waren. Ich fühlte mich wie ein Tropfen im Strom, mehr und mehr gab man mir das Gefühl, unbedeutend zu sein, was in krassem Gegensatz zu meinem Talent stand. Anerkennung fehlte in dieser Welt völlig. Ich wollte ihr nicht weiter hinterherhecheln. Das war meiner einfach unwürdig.
Jetzt war ich dem Arzt und diesen idiotischen Leuten, die mich am Pool ausgelacht hatten, geradezu dankbar. All das hatte mir deutlich gemacht, dass ich nicht hierhergehörte, in diese Welt, in der jeder glaubte oder vorgab, bedeutend zu sein und letztlich doch nur eine Marionette darstellte, eine Funktion erfüllte, ein Werkzeug war. Sie alle waren Sklaven. Und ich wurde ausgelacht – weil ich anders war!
Was ich brauchte, war eine Welt, in der alles echt war. Ich sehnte mich nach Wäldern und Wiesen, die einfach nur Wälder und Wiesen waren und nicht Kulissen für Selfies von Menschen in teurer Kleidung. Ich sehnte mich danach, jemandem den Ort zu nennen, an dem ich lebte und als Antwort keinen Ausruf der Bewunderung zu erhalten, sondern gefragt zu werden, wo das sei. Und ich sehnte mich danach, von Menschen umgeben zu sein, mit denen mich anderes verband als Präsentationstermine und Zielvereinbarungen, nach Beziehungen, die mehr waren als Win-win-Situationen. Friedlich grasende, ehrliche Kühe wären mir lieber als Menschen, die dumm lachten. Ich stand am Fenster meiner Suite, sah auf den Victoria Harbour hinaus und wusste: Ich wollte zurück nach Deutschland.
Dann ging alles ganz schnell. Ich beauftragte einen Makler und besprach meine Umzugspläne mit meinen Auftraggebern, von denen einige so unflexibel waren, dass ich sie verlor. Mein Leistungsspektrum war jedoch breit genug, so dass ich mich vielfältig anbieten konnte, es deckte auch IT-Administration und Anwendungsentwicklung ab sowie die Entwicklung eigener Tools und natürlich eine klar strukturierte und verständliche Report-Erstellung. Angst musste ich also nicht haben, in Deutschland bestand ein großer Bedarf an IT-Sicherheit, die meisten Unternehmen waren völlig unzureichend geschützt.
Der Makler hatte schnell Erfolg: Ich liebte das Haus im Schwarzwald auf den ersten Blick. Es war schlicht, umgeben von einer tollen Landschaft, eine Straße schlängelte sich unbefangen an ihm vorbei. In der Nähe war eine Kreisstadt, etwas weiter weg eine größere Stadt. Man war schnell in Frankreich und in der Schweiz. Das Haus selbst hatte nur ein Erd- und ein Dachgeschoss, einen Keller und einen Carport. Und einen Bunker. Der Vorbesitzer sei wohl etwas paranoid gewesen, meinte der Makler scherzhaft, für viele Interessenten sei der Bunker ein Nachteil. Er verfügte über zwei schmale Betten, eine Art Wohnbereich mit Sofa, Couchtisch und Sideboard, eine Küchenzeile, eine Nasszelle und einen Dekontaminationsbereich am Eingang, der allerdings nicht einsatzbereit war. Strom und Wasser waren an die öffentlichen Netze angeschlossen, der Bunker war also nicht autark. Der Makler war etwas ratlos, als er mir alles gezeigt hatte. Der Vorbesitzer, der verstorben war und dessen Kinder das Haus einfach nur loswerden wollten, hatte den Bunker anscheinend in den Sechzigerjahren bauen lassen. Er hatte ursprünglich unter einem alten Schuppen gelegen, der dann abgerissen und durch einen Carport ersetzt worden war. Der Bunker war regelmäßig gewartet worden, wovon Rechnungen in einem Ordner zeugten. Ich sah in dieser ganzen Bunker-Geschichte erst einmal nur ein skurriles Detail. Mir gefiel das Haus, ich mochte die Lage, die Landschaft und das Gefühl, weit ab von allem Falschen und Verlogenen ganz neu anfangen zu können. Vielleicht auch: überhaupt erst anzufangen, richtig zu leben.
Ich dachte nicht zu viel darüber nach und kaufte das Haus. Es war perfekt. Das ist jetzt etwa eineinhalb Jahre her.
11.09.2014
Es ist schon wieder mitten in der Nacht. Immer noch verunsichert mich diese Dunkelheit, wenn ich aus dem Fenster schaue. Dort ist nichts außer meinen erschrockenen Augen. Aber ich glaube, ich werde mich allmählich daran gewöhnen. Außerdem habe ich nun wirklich jeden Grund, mir zu vertrauen: Ich habe alles so gut vorbereitet, dass es im Grunde ausgeschlossen ist, dass sie mich finden.
Dafür habe ich ein anderes Problem, mit dem ich so nicht gerechnet hatte: Kim gibt nicht zu, Kim zu sein – ganz gleich, wie viele Beweise ich ihm vorlege! Ich war nicht darauf gefasst, dass er sich dermaßen hartnäckig selbst verleugnen würde. Denn seine Fake-Identität hatte ich während meiner Recherche mühelos aufdecken können. Seine Social-Media-Kontakte waren gefälscht, die Personen existierten entweder nicht oder waren Unbeteiligte. Es war einfach lächerlich, auf der Korrektheit dieser getürkten Informationen zu beharren.
„Sprechen Sie doch mit meinen Eltern. Ich gebe Ihnen gerne die Nummer. Sie werden Ihnen bestätigen, dass ich kein nordkoreanischer Diktator bin.“
„Das habe ich schon getan. Ihre angeblichen Eltern sprechen beide kein Deutsch. Also habe ich auf Englisch nach Ihnen gefragt. Sie konnten mich dann zwar verstehen, wussten aber beide nicht, wen ich meinte.“
„Wundert mich nicht. Sie haben keine besonders hohe Meinung von mir. Kann schon sein, dass sie mich Fremden gegenüber verleugnen. Gut zu wissen übrigens: danke dafür!“
„Auch ein Mann, der ein Freund von Ihnen sein soll, wusste nicht, wer Sie sind.“
„Sagen Sie, muss ich noch deutlicher werden? Wollen Sie mich noch mehr demütigen? Reicht es Ihnen nicht, mich anzuketten wie einen Hund? Ich bin ein Loser! Jemand, der weder Freunde noch Bekannte hat. Klar, irgendwen gibt es immer, der auf Facebook mal was kommentiert. Aber Sie wissen doch selbst, was man darauf geben kann.“
„Sie sind kein Loser, Kim.“
„Ich bin Verkäufer für Herrenoberbekleidung in einem Kaufhaus in Bern. Meine Eltern sind Südkoreaner, ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich war nur wenige Male in Korea, habe mich mit meinen Verwandten aber nicht besonders gut verstanden. Oder, um es klar zu sagen: Wir waren einander völlig egal.“
„Das klingt gut. Ihre Legende haben Sie drauf, was mich nicht überrascht. Wo sind Sie in den Kindergarten gegangen?“
„Gar nicht. War zu Hause, bis ich in die Grundschule gekommen bin.“
„Wo sind Sie zur Grundschule gegangen?“
„In Muri bei Bern.“
„Ach, schau an …“
„Was soll das heißen?“
„Das soll heißen: Sieh mal einer an …“
„Sieh mal einer was an?“
„In Muri bei Bern sind Sie zur Grundschule gegangen? Von Tausenden von Grundschulen waren Sie ausgerechnet auf der in Muri bei Bern?“
Kim verdrehte die Augen. Ich wurde nicht schlau aus ihm, was ich mir keinesfalls anmerken lassen durfte.
„Kim, ich bitte Sie! Lassen Sie das Spielchen. Sie haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das mit der Grundschule für Ihre Legende zu ändern.“
„Welche Legende?“
„Verdammt noch mal!“
Ich musste mich zusammenreißen. Aggressivität war jetzt unbedingt zu vermeiden. Es war entscheidend, souverän zu bleiben.
„Also: Sie haben einen großen Teil Ihrer Kindheit und Jugend in Bern und Umgebung verbracht, wie man inzwischen weiß. Unter anderem sind Sie in Muri bei Bern zur Grundschule gegangen. Sie sprechen fließend Deutsch, wie wir beide gerade am besten bezeugen können.“
„Einen großen Teil? Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht.“
„Sie haben etwa elf Jahre lang in der Schweiz gelebt. Sie waren ein guter Schüler, haben begeistert Basketball gespielt. Anschließend sind sie zurück nach Nordkorea und haben dort die für sie vorgesehene Identität angenommen.“
„Ich war nur ein paar Mal in Südkorea, um meine Verwandten dort kennenzulernen. Wir hatten uns nichts zu sagen. Habe ich gerade schon erzählt. Was für eine Identität überhaupt? Und glauben Sie mir: Ich würde was drum geben, eine andere Identität annehmen zu dürfen!“
„Warum tun Sie das?“
„Warum tue ich was?“
„Sich verleugnen? Warum leugnen Sie, Kim Jong-un zu sein?“
Kim schüttelte nur den Kopf, wie jemand in einem Film, dessen Schuld längst feststeht, der sich aber dagegen sträubt, alles zu gestehen. Es war peinlich.
„Warum wollen Sie denn unbedingt, dass ich Kim Jong-un bin? Schon klar: Es wäre eine Sensation, ein großer Fang sozusagen. Warum gehen Sie nicht angeln? Einen dicken Fisch rausziehen, Foto für Facebook, reicht das nicht? Warum müssen Sie einen Fremden entführen und darauf bestehen, dass er Kim Jong-un ist?“
„Ich entführe keinen Fremden. Ich befreie ein Opfer düsterer Machenschaften.“
Kim lachte laut auf.
„So kommen wir nicht weiter.“
„Natürlich kommen wir so nicht weiter! Ich kann Ihnen alles haarklein erzählen, würde mich fast geehrt fühlen. Immerhin hat sich noch nie jemand so sehr für mein Leben interessiert wie Sie. Fragen Sie mich nach Grundschulfreunden, nach Hobbys, nach Sportvereinen, nach Lehrern. Fragen Sie mich, wo ich gewohnt habe, wie mein Zimmer eingerichtet war. Wo ich eine Ausbildung gemacht habe, in welche Kollegin ich mal verknallt war. Welche Arbeitgeber ich hatte, was ich verdient habe. Ich erzähle Ihnen alles! Sie können es nachprüfen!“
„Oh, daran habe ich keinen Zweifel, Kim. Ich bin sicher, Sie könnten mir viel erzählen, und einiges davon könnte als überprüfbar erscheinen. Da gibt es nur ein Problem, Kim.“
„Was für eins?“
„Ich würde es nicht glauben.“
Februar/März 2013
Ich musste ein Haus einrichten. Wie machte man das? Soweit ich zurückdenken konnte, war immer schon alles für mich erledigt worden. Vom Kinderzimmer über das möblierte Studentenstudio bis zur Hotelsuite. Jetzt musste ich Möbel aussuchen und zusammenstellen, Vorhänge und Lampen besorgen, praktische Geräte kaufen und die Räume insgesamt möglichst effizient nutzen. Der einzige Raum, der bereits eingerichtet war, war der Bunker.
Aber dann fiel es mir ganz leicht. Es ging wie von selbst. Als hätte ich seit Jahren einen Plan dafür gehabt, ohne es zu wissen, und würde ihn nun einfach ausführen.
Bald hatte ich ein schickes und gemütliches Wohnzimmer, nicht überladen mit Möbeln, nur das Nötigste. Ich besorgte mir einen Schallplattenspieler und zig Platten. Ich kaufte Herd, Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner, einen Schreibtisch, einen antiken Stuhl und eine Chaiselongue fürs Powernapping im Arbeitszimmer. In der Küche war sofort Ordnung, alles hatte sein Fach und seine Schublade. Ich ließ den Kamin fit machen und freute mich im Winter an authentischer Wärme. Und unter dem Dach richtete ich noch eine Art Trainingsraum ein, ich hatte mir ein paar Geräte liefern und aufbauen lassen und nutzte sie tatsächlich hin und wieder für ein bisschen Workout.
Alles war schlicht, aufgeräumt, zurückhaltend, übersichtlich. Und so sah es auch in meinem Kopf aus. Scheinbar plötzlich sah ich alles immer klarer. Dabei war es ein langer Prozess gewesen, wie mir bewusstwurde.
Es musste mit dem 11. September angefangen haben. Ich sah, wie die Flugzeuge in die Twin Towers krachten. Anschließend sah ich, wie Aliens die Erde eroberten. Bands in Musikvideos. Prominente in Interviews. Tiere in der Wildnis. Alles auf ein und derselben Mattscheibe. Als ich 2004 als junger Twenty-Something den hämisch lachenden George W. Bush sah, der sich in einer Rede vor Vertretern der amerikanischen Radio- und Fernsehsender über die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak lustig machte und dabei hemmungslos die Maske fallen ließ, da bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie die Welt wirklich funktionierte. Nichts passierte einfach so. Hinter allem musste ein Drehbuch stecken. Es waren nicht Filme, die realistisch waren, sondern die Realität, die filmisch war, wie mir immer öfter auffiel. 9/11 war viel zu fantastisch, um das Werk irgendwelcher Terroristen gewesen zu sein – es war Storytelling, jemand dachte sich hier Geschichten aus und ließ sie grandios produzieren!
Nach und nach wurde mir bewusst, dass Ereignisse wie 9/11 davon ablenken sollten, dass in Wirklichkeit alles, auch völlig banale Vorgänge, inszeniert war. Sie schufen diese gigantischen Events, damit man die vielen kleinen gar nicht mehr wahrnahm. Damit man das große Ganze nicht erkannte.
Das Raffinierte daran: Die kleine, elitäre Clique, die seit Jahrhunderten hinter all dem steckte, hatte auch immer schon ihre eigenen Feinde und Gegner geschaffen. Sie beherrschte diese dialektische Methode des Machterhalts souverän. Sie lieferte die offizielle Version vom Anschlag aufs World Trade Center und lancierte zugleich wirre Theorien, in denen beschrieben wurde, dass 9/11 nie stattgefunden hätte, dass alle Videos davon Fake und alle Zeugen bezahlt worden waren. Sehr geschickt: Wer sich von nun an kritisch zur offiziellen Version von 9/11 äußerte, wurde sofort in eine Ecke mit Irren gestellt. Der Begriff „Truther“ war eine Wortschöpfung der Clique. Oft hatten diese Verschwörungstheoretiker keinen Schimmer davon, dass alles, was sie dachten und wofür sie kämpften, Konstrukte zum Machterhalt dieser kleinen Gruppe waren. Sie deckten unfreiwillig die wahren Urheber von 9/11. Sie wurden missbraucht, genauso wie weltweit Präsidenten, Vorstandsvorsitzende, Diktatoren, sogenannte „Opinion Leader“, wer auch immer. Sie versuchten, von Elektrosmog und schädlichen Impfungen abzulenken, indem sie wirre Theorien über Reptiloiden und eine flache Erde verbreiteten. Wer den angeblich vom Menschen verursachten Klimawandel anzweifelte oder die systematische Vergiftung unseres Trinkwassers durchschaute, wurde auf eine Stufe mit Menschen gestellt, die glaubten, Elvis im Supermarkt gesehen zu haben.