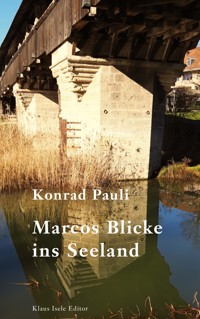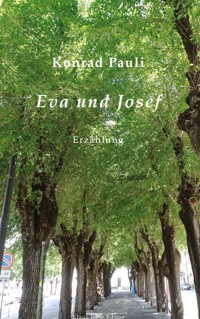Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor schöpft in seinen Erzählungen aus der Fülle des Lebens - zu dem allerdings auch Abschiede, Trennungen, Abstürze gehören. Erotische Verführungen wechseln sich ab mit Geschichten, die sich mit den letzten Lebensjahren beschäftigen. Auch Schulzeiten und dort gemachte Erfahrungen spielen eine Rolle in diesem prallen Geschichtenbuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor schöpft in seinen Erzählungen aus der Fülle des Lebens – zu dem allerdings auch Abschiede, Trennungen, Ab stürze gehören. Erotische Verführungen wechseln sich ab mit Geschichten, die sich mit den letzten Lebensjahren beschäftigen. Auch Schulzeiten und dort gemachte Erfahrungen spielen eine Rolle in diesem prallen Geschichtenbuch.
Inhalt
Romeo und Julia
Papa Moll
Heute allein
Für einmal Tränen
Endstation
Der Indianer
Höhenflüge
Gegenwart
Der Junglehrer
Ein Versprechen
Lob der Langsamkeit
Amolika
Carlo
Beste Freundinnen
Scherben
Das Kreuz
Ruth und Hannes
Aussicht gerahmt
Die Niederlage
Das Foto
Groß und Klein
Das Inserat
Das kleine Gehege
Das Unbehagen
Nichtstun
Endspiel
Peppino
ROMEO UND JULIA
Warten hatte ihm nie Mühe gemacht. Es gab immer etwas zu sehen – auch fernab aller Sehenswürdigkeiten. Es gab immer etwas zu hören – auch in der Stille. Es gab immer etwas zu besinnen – selbst wenn sich kein konkreter Gedanke aufdrängte. Im Wartenkönnen war er ein Profi. Über Leute, die an einem Ort alles gesehen zu haben glaubten, staunte er. Diese Fähigkeit, in die er sich, seinem Wesen gemäß, über Jahre eingeübt hatte, ließ ihn bei nahe vergessen, dass es so etwas wie eine Wartezeit überhaupt gab.
Zu einem anderen Warten wurde er diesmal aber gezwungen. Eine zwar kleine, aber nicht ganz harmlose Fußoperation hatte ihm ein paar Tage Hausarrest verordnet. Den Fuß durfte er nicht belasten, das Bein sollte er möglichst ständig hochlagern. Er begriff diesen Umstand als Test, ob ihm das Warten auch in dieser Zeit gelingen würde. Vorsorglich klammerte er sich an seine Devise, dass man ja immer und überall … Auch das Wetter sollte für ihn kein Hindernis sein. Keine faulen Ausreden also.
Das Wetter freilich war ihm wohlgesonnen. Im Juni waren die Tage lang, das Wetter abwechslungsreich – Regen, Wind, jagende oder still lagernde Wolken, Sonne und Wärme. Auf dem Balkon richtete er sich ein; auf dessen Mäuerchen ruhte das Bein stabil. Nun also Augen auf. Aber hier hatte er doch alles schon hundertmal gesehen. So nahm das Teufelchen Anlauf, seine Gewohnheit des Sehen- und Wartenkönnens auf die Probe zu stellen, ja, anzukratzen oder gar kaputt zu machen. Er sollte eine Lektion erteilt bekommen.
So rasch aber wollte er sich nicht kleinkriegen lassen. Er hätte sich geschämt, wäre er hilflos geworden. Sein Blick streifte nun in wiedergewonnener Ruhe über die vertrauten Dinge: das rostende Geländer, die Flechten in der Mauerecke, das Rasen- und Grasstück unten, den Holunder, in dem die Spatzen herumtollten, die Fens ter und Dächer der Nachbarschaft, das ferne Hügelstück zwischen zwei Häuserblocks, die Trauerweide, die beiden Rotbuchen, die sich im Frühling Zeit ließen, ihre Knospen in Blätter zu verwandeln. Hinter dem Hausdach stand die Pappel, im Wipfel geteilt in einen größeren und einen kleineren Ast.
Alles hatte er gesehen, aber wie sollte er damit zufrieden sein? Noch hatte er ein paar Tage auszuharren, noch musste er warten.
Die Pappel. Seine Sinne und Gedanken blieben hängen an deren obersten Zweigen. Nun wusste er nicht: Hatte sich sein Blick eingetrübt oder war er klarer geworden, als schaue er gleichsam durch diesen Wipfel hindurch, der momentan ausschließlich aus diesen beiden obersten Ästen zu bestehen schien. Im leichten Wind spielten sie die Zuneigung von Verliebten. Ihm fiel es leicht, sie sogleich zu taufen: Romeo und Julia. Im Ballett schaukelten sie aufeinander zu, berührten und umarmten sich, um sofort neuen Anlauf zu nehmen in unerschöpflicher Zärtlichkeit. Je länger er dieser Innigkeit zuschaute, umso mehr festigte sich das Bild des Liebespaares. Brauste der Wind auf, zerzauste er die Frisuren, flaute er ab, fanden sie kurzum zurück ins Wohlgeordnete. Auf immer wollten, ja mussten sie beisammenbleiben, waren sie weit unten doch gemeinsam verwurzelt.
Wie vernarrt blieb er hängen an diesem Schauspiel. Ex travorstellung ohne Pause. War das ein Necken, Stupsen, Packen und Loslassen! Dann aber kam der Sturm. Mit über zweihundert Stundenkilometern raste er dahin, rüttelte an Festgebautem mit Erfolg. Äste knickten, Dachteile flogen weg, Ziegelsteine knallten auf den Boden und auf Autodächer. Auch das Elastische der Pappeläste war überfordert. Julia knickte ein und lag zerbrochen auf dem Asphalt, Romeo schien ihr folgen zu wollen, hielt sich jedoch knapp.
Später rückten die Sicherheitsleute an und stutzten, was weiteren Schaden hätte anrichten können. Zwar blieb die Pappel stehen, aber Romeo musste abgesägt werden.
Vielleicht würde aus dem unversehrten Restbaum ein neues Liebespaar heranwachsen.
PAPA MOLL
Die ewig unbeantwortete Frage: War es Zufall oder Fügung? Eine entschiedene Antwort hängt an der Glaubensfrage. Das Geschehene spricht ohnehin für sich selbst.
Wir nannten ihn Papa Moll. Die Zeitschrift Junior begleitete uns durch die Kinderjahre. Dort erzählte der liebenswürdige, bauchstarke Papa Moll in sich reimenden Vierzeilern aus seinem Leben: Immer hatte er eine Schwierigkeit auszuhalten oder ein Problem zu lösen. Das Gereimte spielte eine eigene Musik und brachte alles auf den Punkt. Bald versuchte sich das Kind in eigenen Reimen: Im Auto fuhr Papa Moll, irgendwas weckte seinen Groll. Oder: Papa Moll fing einen großen Fisch, eine Stunde später war er auf dem Tisch.
Im Hotel am Meer war nun die Figur von Papa Moll leibhaftig geworden. Es hieß, er sei Fahrlehrer, was der Phantasie aber keinen Abbruch tat. Man grüßte sich zu den Essenszeiten, wechselte darüber hinaus aber nie ein Wort. Es hieß zuweilen: »Papa Moll sitzt schon am Tisch. Im Vergleich zu gestern ist er jetzt leicht gebräunt.«
Wie wir war auch er Jahr für Jahr da, saß – mit Abstand zu uns – meistens am gleichen Tisch. Ein alter Bekannter, den man nicht kannte.
So ging das Sommer für Sommer. »Oh«, hieß es, »Papa Moll (eine welsche Dame sagte Papa Schmoll) ist auch wieder da – deutlich runder als letztes Jahr.«
Papa Moll und seine Frau hatten ihre Liegestühle in einem kleinen Sandstreifen. Übers Ufergestein führte ein Holzbrettersteg ums Hotel herum und weit bis in die Bucht ragend. Wollte man vom Sandstreifen auf den Holzsteg gelangen, galt es drei Stufen hochzusteigen.
An diesem Nachmittag wollte es der Zufall oder die Fügung, dass Papa Moll Anlauf nahm für die erste Stufe. Gerade als ich an ihm vorbeigehen wollte, stand er auf der zweiten Stufe und blieb, als er mich sah und womöglich froh war um eine Atempause, lächelnd stehen. Ich grüßte ihn und sagte: »Noch eine Stufe, und Sie sind oben!«
Papa Moll hob den rechten Arm, streckte den Zeigefinger ins Himmelsblau und sagte: »Richtig, denn ganz hinauf will ich noch nicht!«
Wir lachten. Ich ging weiter und blickte nicht zurück.
Etwa eine halbe Stunde später eilte Papa Molls Frau in heller Aufregung auf dem Steg hin und her und blieb bei den Strandschuhen über dem Einstieg ins Meer stehen. Menschen kamen hinzu, begriffen, ohne zu fragen, was passiert war, hielten Aus schau ins Wasser und guckten in alle Spalten der Strandfelsen – Papa Molls Strandschuhe, exakt nebeneinander, standen wie verloren da.
Bange Minuten später ein Rettungswagen in der kleinen Bucht nebenan. Es stellte sich heraus, dass Papa Moll auf der kurzen Strecke, die er, wie gewohnt, zu durchschwimmen gedachte, an einem Herzinfarkt verstorben war.
HEUTE ALLEIN
Sie kam von der Arbeit nach Hause und wusste gleich, dass sich etwas verändert hatte. Sie ging auf die Suche. Auf dem Nachttischchen fand sie den Zettel: »Ich bin ausgezogen«, las sie. »Ich liebe dich nicht mehr.« Hat er mich denn jemals geliebt? Mag sein. Aber jetzt meldete er sich ab. Seine wenigen Sachen schien er mitgenommen zu haben. Einerlei.
Nun auch er. Niederlage reihte sich an Niederlage. Sie war es gewohnt. Sich jedoch daran zu gewöhnen, war nicht leicht. Sie wurde dazu gezwungen. Sollte sie womöglich erleichtert sein? Andere jubelten in solcher Lage von wiedergewonnener Freiheit und neuen Möglichkeiten. So viele Mög lichkeiten hatte sie ausprobiert und zu leben versucht. Und sich von jeder neuen Möglichkeit Beständigkeit, Liebe und Geborgenheit versprochen. Verlangte sie zu viel? Sie verlangte gar nichts, sie hoffte bloß. Es gab doch welche, die blieben jahrelang, ein Leben lang zusammen. Sie wäre schon mit weniger zufrieden gewesen.
»Ich bin ausgezogen. Ich liebe dich nicht mehr. Kurt.« Er hatte sich entschieden, hatte sie fallen lassen wie einen faulen Apfel. Es sah so aus, als sei sie tatsächlich von Fäulnis befallen. Eine Fünfzigjährige war nicht mehr zwanzig. Dafür konnte sie nichts. Ihr wurde schwindlig. Sie setzte sich an den Bettrand. Nein, nur nicht hier sitzen bleiben. Die Bettwäsche musste sie wechseln. Als wäre dies die erste Notwendigkeit. Gestern noch hatten sie sich geliebt. Geliebt? Während er in ihr war, hatte er bestimmt schon gewusst, dass … Oder fällt man einen solchen Entscheid in Minutenfrist?
Sie ging ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Sofa. Erschöpft lehnte sie sich zurück und schloss die Augen. Nein, sie wollte nicht sehen, was sie mit geschlossenen Augen sah. In den weißen Vorhängen strahlte die Abendsonne. Es war die Stunde, in der man nach draußen ging zum kleinen Spaziergang. Lange hatte man in diesem Spätwinter auf die Sonne warten müssen. Jetzt war sie da – und er war weg. Nichts konnte sie dagegen tun. Würde sie ihn heute, morgen vermissen? Acht Jahre waren sie zusammen gewesen. Und sie hatte gedacht … Der Schock war nicht aus heiterem Himmel gekommen. Aber so drastisch? Nicht jeder Wechsel war ein Neuanfang. Altlasten und sich selbst schleppte man mit, brachte sie ein ins angeblich Neue. Und Befangenheiten wuchsen ins Ungeheure. Nicht nochmals! Zu kompliziert und schmerzhaft wird alles, zu ungewiss der Weg der Gemeinsamkeit. Wenn’s denn eine Gemeinsamkeit wäre. Aber wer wusste das, wer vermochte dies zu erraten, im Voraus?
Wenn doch die lang ersehnte Sonne endlich verschwände, die Dämmerung und Nacht sie umfinge. Doch selbst in der Finsternis brannten grell die Lichter. Hinter den Augen und im Gemüt wartete kein Erlöschen. Auf dem Küchentisch stand die Tasche mit den Einkäufen. Sie hatte weder die Lust noch die Kraft, sie auszupacken. Aber etwas musste sie doch tun. Bloßes Nichtstun war unerträglich. Kein hilfloser Vorsatz half weiter. In welche Richtung sie auch ginge, es wäre die falsche. Und was ist die richtige? Sie wagte nicht, daran zu glauben. Sie war frei. Er war weg und hatte sie sitzen lassen. Sie war verwirrt. Sie durfte es sein, aber ging’s ihr wirklich unter die Haut? Wär’s der Richtige gewesen, dann wäre sie, wie man so sagt, am Boden zerstört gewesen. Aber immerhin acht Jahre. Anzeichen eines Mangels an Liebe hatte es immer gegeben. Sie hatte das hingenommen. Keine, keiner war vollkommen und fehlerfrei. Aber so … Hätte sie aufmerksam auf ihre Gewissensstimme gehört, was hätte sie unternommen, anders gemacht? Von sich aus hätte sie ihm den Laufpass wohl nicht gegeben. War’s nun besser so? Was hatte sie verloren, was gewonnen? Weder das Eine noch das Andere vermochte sie abzuwägen. Sie hatte Kopfschmerzen. Dagegen war etwas zu tun. Aber gegen deren Ursache …
In den weißen Vorhängen verblasste die Sonne. Sie hoffte, dass es morgen regnen würde. In den Regen sich einwickeln wie in einen Mantel. Die Aussicht auf einen blauen Himmel steigerte die Angst, die Haltlosigkeit. Hatte Kurt ihr Halt gegeben? Wovor hatte sie Angst? Sie sollte vernünftig sein. Die Vernunft wollte ihr befehlen, die Lage genau zu überdenken und ihre Möglichkeiten zu erforschen. Ob das Vernünftigsein gelänge und genügte? Sie saß still und sah sich um. Ihr wurde schwindlig. Die Hausschuhe beim Schirmständer hatte er vergessen mitzunehmen. Sie würde sie morgen entsorgen. Ent-Sorgen. Sorgen ade! Weg mit der Hinterlassenschaft – die Sorgen aus dem Sinn. Und er? Was tat er jetzt, in diesem Augenblick? Nicht ihr Problem. Was sollte sie das kümmern? Aber sie war voller Sorge. Um ihn oder um sich selbst? Er hatte gewählt. Damit musste er zurechtkommen. So wie sie auch. Jeder auf seine Weise.
Die Art, wie er gegangen war, passte zu ihm. Oft schon war er gegangen, ohne sie zu verlassen. Vielleicht käme er zurück. Wie auch schon. Doch diesmal würde sie ihm den Gefallen nicht tun. Er würde staunen. Sie musste ihm dies zumuten. So wie er ihr Vieles zugemutet hatte. Aber jetzt war Schluss. War es so – oder glaubte sie bloß daran? Von Frauen wusste sie, die wollten am Dienstag ihr Leben von Grund auf ändern; am Donnerstag war man müde oder sonstwie abgelenkt oder neuerdings versöhnlich gestimmt, bis das Wochenende die alte Katastrophe ausschüttete – und am Dienstag flammte das schüchterne Flämmchen zu aller Veränderung wieder auf. So verging die Zeit – und die meisten blieben kleben in den alten Verhältnissen.
Hatte sie Angst vor dem Alleinsein? Natürlich. Sie hatte aber auch Angst vor falscher Zweisamkeit. Doch sie wollte nicht allein sein. Freilich war sie es auch mit Kurt oft gewesen. Zu zweit allein sein, das war das Schlimmste. Allein allein sein? Das müsste gehen. Wenigstens eine Zeitlang. Sie lief in die Küche, war sich ihrer Schritte nicht sicher. Sie torkelte und fasste sogleich den Entschluss, dieses Torkeln zu genießen. Warum nicht ein Glas Wein trinken? Es brächte sie ins Gleichgewicht. Vielleicht ein bisschen mehr? Sie lachte in sich hinein. Betäuben wollte sie sich nicht, aber herausfinden, ob ihr noch Flügel wüchsen. Vielleicht rief er sie an, um ihr zu sagen, es tue ihm leid, er habe es sich anders überlegt. Aha! Liebe, zumindest Zuneigung, nährte sich aus anderen Vorräten. Er hatte sie allein gelassen, und jetzt wollte sie allein sein. Sie würde seinen Anruf nicht entgegennehmen.
Langsam packte sie ihre Tasche aus. Beim Einkauf hatte sie an das gemeinsame Abendessen gedacht. Womöglich bei Kerzenlicht. Das Fleisch stopfte sie ins Gefrierfach. Hunger? Nein, aber etwas musste sie essen. Sie hatte sich darauf eingestellt. Sie griff nach einer Pfanne, aber sie war ihr zu schwer. Stattdessen ging sie unter die Dusche, blieb lange darunter stehen. Dann zog sie sich um, schlüpfte in Kleider für ein besonderes Ausgehen. Das Sommerröckchen stand ihr gut, auch die halb hochhackigen Schuhe gefielen ihr. Zwar tat ihr darin der Fuß weh, zumeist aber nur die ersten Schritte. Sie ging zum Spiegel und fasste den Entschluss, sich selbst zu gefallen. Sie lachte auf. Wär’s besser gewesen mit ihm? Doch wohl nicht. Nicht mehr. Vieles hatte sie vor sich hergeschoben. Zu lange schon. All das Verschobene holte sie jetzt ein – oder lag schon hinter ihr. Was war denn gewesen, dass es so rasch verflogen war? Konnte sie ihrer Erleichterung, ihrer Beschwingtheit, ihrem Lachen trauen? Je höher hinauf, umso tiefer der Fall. Ach, was – sie war vorher schon unten gewesen.
Sie füllte das Glas nach, legte eine CD ein, war erleichtert, dass die Kopfschmerzen nachließen und fing an zu tanzen. Ohne ihn glückte der Tanz besser. Einen Tänzer aber wünschte sie sich. Schließlich war sie müde und ließ sich aufs Sofa fallen. Streckte die Beine von sich. Nicht alles sollte sich wiederholen. Ganz an die Anfänge wollte sie nicht zurück. Sie musste aufpassen. Hinter den Augen drückten die Tränen. Auch mit ihm hatte sie im Stillen oft geweint. Hatte gedacht, manches, wenn nicht alles, werde besser mit der Zeit. Mit der Zeit … Er hatte sich mit ihr eingerichtet in seinem Unvermögen. Seine Schuld war es nicht. Ein Versuch war’s gewesen, ein acht Jahre dauernder Versuch.
Als wäre das Leben eine Versuchsanordnung. Nun ja, in gewisser Weise traf das zu. Wie kamen andere Paare damit zurecht? Kannten sie das Glück? Das dauerhafte? Oder wenigstens die Geborgenheit? Zärtlichkeit? Eine Art Verschworenheit für Gemein sames. Ein Ausschwärmen ins Leben – zu Hause und draußen.
Leicht hatte sie es von Anfang an nicht gehabt. Jung hatte sie geheiratet; nach der Geburt der zweiten Tochter dann der Autounfall. So wenig hatte es gebraucht, um den Mann und Vater ihrer Kinder zu verlieren. Nun waren die Töchter verheiratet. Sie waren ihrer Wege gegangen. Dann für kurze Zeit Stefan, später Roland – nun für acht Jahre Kurt. An Vielem trug sie wohl die Schuld. Aber mit der Schuldenlast hatte sie nun nichts mehr im Sinn. Fort damit.
Aber sie wusste: So rasch ging das nicht. Endlich raffte sie sich auf, zupfte den Rock zurecht, frischte das Make-up auf, zog die Lippen nach, blinzelte sich selbst zu, so keck es ging, schlüpfte in die Jacke, griff nach den vergessenen Hausschuhen und ging hinaus. Mit Schwung warf sie die ausgelatschte Hinterlassenschaft in den nächsten Müllkübel, fuhr zwei Stationen mit dem Bus und ging ins italienische Restaurant. »Heute allein?«, fragte sie der Kellner. »Ja«, sagte sie lächelnd. Und dachte: Das kommt vor. Der Kellner entzündete eine Kerze. Sie träumte in die leise flackernde Flamme, aß mit Genuss und war sich beinahe sicher, das Genießen auch anderswo wieder entdecken zu können.
FÜR EINMAL TRÄNEN
Nie hatte er ernsthaft geglaubt, es gebe in den Wiederholungen der Generationen jemals einen Zuwachs an Neuem. – Er ging an diesem milden, halbwegs sonnigen Novembertag durchs Quartier, zögerte angesichts der Wit terung das Heim- und Hineingehen hinaus, sah der Sonne zu, wie sie sich hinter leichtem Gewölk früh schon davonmachen wollte, bezog auch mal einen Beobachtungsposten in einer Hausecke, war froh, dass eine quengelnde Kinderschar endlich vorbeigerauscht war, und ging schließlich weiter durch die ihm wohlvertraute Gegend, als gelte es, den Augenblick zu dehnen, einen Abschied hinauszuschieben.
Er ging also umher und sah, wie der Coiffeur (Meine Stärke ist der Haarschnitt!) sich über den schaumigen Kopf eines Kunden beugte, zwischendurch jedoch die Dinge im Auge behielt (Äpfel, Quitten, Honig), die draußen auf dem Holzgestell und auf dem Fenstersims zum Verkauf gestapelt waren. Vorne an der Ecke hatte sich eine junge Frau mit einem Geschäft für ausgefallene Kleidermode eingerichtet und hoffte nach dem Debakel ihrer Vorgängerin auf Beständigkeit und Erfolg. Sie saß, der Außenwelt halbwegs den Rücken zugewandt, auf einem Stühlchen und hielt auf den zusammengepressten Knien eine Näharbeit ausgebreitet. Ein paar Schritte nebenan beluden der Bäcker und seine Gehilfinnen den Kastenwagen mit Kartons voll duftenden Brotes. An den schon lange zerbeulten Kotflügel schien man sich gewöhnt zu haben. Alle waren in Eile. – In seiner immergleichen, arg strapazierten Arbeitsschürze, die Hände in den Hosentaschen, stand der Schuhmacher vor seinem mit Rabattartikeln vollgestopften Schaufenster und blickte mit säuerlicher Miene den davonfahrenden Broten nach, als würde ihm etwas weggenommen.
Die Anhäufung solcher Szenen führte ihn in die Kinder- und Jugendzeit zurück. Wie oft war er doch zum Bäcker geschickt worden, einen Vierpfünder zu holen. Brot für die ganze Familie, zwei oder gar drei Tage lang. Aber zuerst mussten die alten Brotstücke gegessen werden. Es kam vor, dass man diese rasch hinunterwürgte, um schnell in den Genuss eines neuen Brotes zu kommen. Der Junge half gelegentlich beim Bäcker aus. Er ging, vor allem samstags, mit vollbeladenem Korb auf dem Rücken auf Tour – mit Vorliebe in die nobleren Quartiere. Die Crème-dela-crème deckte sich ein mit Leckerbissen und feiner Patisserie, während andere sich begeistert zufrieden gaben mit rustikalerem Gebäck. Mit Trink geldbatzen kehrte er zufrieden nach Hause zurück. Der Bäckermeister, ein kleiner, schlanker, ja dünner Mann mit schütterem Haar (während seine Gattin eine stattliche, geradezu üppige Frau war) lud ihn nach getaner Arbeit zum Ausflug an den See inklusive Bootsfahrt mit Fischfang ein. Er ging gerne mit und erlebte den Bäckermeister als Mann, der, mit dem stillen Jungen zusammen, die Ruhe und Stille auf dem See in allen Zügen genoss. Ein wenig gelangweilt schaukelte das Boot auf dem unbewegten Wasser, das einen ebenso ruhigen Himmel spiegelte. Die Fische bissen nur zögerlich an, und wenn, waren sie zu klein.
Auch der Coiffeur tauchte in der Erinnerung des Jungen auf. Das Kind, für gewöhnlich geschoren vom Vater (nicht ohne Tränen), musste notfallmäßig zum Coiffeur: Vaters Schere war mitten in der Arbeit entzwei gebrochen – der Kopf erst zur Hälfte bearbeitet. Hurtig eine Mütze drauf, um das Missgeschick zu verstecken, und so zum Coiffeur. Dort die Mütze abgezogen – welch Gelächter … Der Junge schämte sich nicht, er war wütend. Doch was nützte ihm dies.
Auch einen Schuhmacher gab’s – hinter vorgehaltener Hand verschrien als Heimlichtuer, wenn nicht sogar als Schmutzfink. Als Anhänger der Freikörperkultur (an der Wand der Werkstatt dokumentierten drei Fotos auf die in jenen Jahren anrüchigste Weise die weibliche Nacktheit) witzelte man über ihn, während der Fund eines Präservativs auf dem Schulgelände an den Rand eines Skandals rückte. –
Der Coiffeur schaute immer noch nach seinen unverkauften Äpfeln, die Näherin war mit ihrer Arbeit noch nicht fertig, der Bäckermeister war zurück und rieb seine Hände an der vormals weißen, von der Tagesarbeit nun fleckigen Schürze.
Zuletzt das Bild vom schneidernden Vater, als der Junge mittags von der Schule nach Hause kam und Mutter ihn tuschelnd ermahnte, er solle Vater in Ruhe lassen, Großvater sei gestorben. Gleichwohl ging er in die Werkstatt und sah Vater über eine Arbeit gebeugt, mit ge senktem Kopf und Tränen auf den Wangen. Kein Wort, kein Aufblicken. Bloß die notgedrungene Verbissenheit, die Stich an Stich setzte. Lass ihn in Ruhe. Das Sterben verlangte nicht nach vielen, auch nicht nach wenigen Wor ten. Es war einfach so, und man richtete sich danach. Jeder kam auf seine Weise damit zurecht.
ENDSTATION
Fabian Hirsch war ein sanfter Mann, kein Draufgänger, mitunter packte ihn aber das Spontane, das gewiss in seinem Wesen begründet lag und sich Luft verschaffte mit der Würze der Anzüglichkeit. Er saß im Bus, eine hübsche kleine Frau setzte sich neben ihn. Der Bus fuhr an, holperte, zog erneut an und stoppte – der Fahrer mochte wenig geübt sein in einer harmonischen Fahrweise.
Sie saß also neben ihm und entzückte ihn sehr. Bloß aus den Augenwinkeln gestattete er sich solche Zudringlichkeit. Zwei, drei Worte flogen zu ihr und von ihr zurück. Was eine harmlose Nähe versprach für zwei, drei Stationen. Er glaubte, ein Strahlen in ihrem Gesicht zu entdecken, als sei sie einverstanden mit dem zufälligen Mit einander.
Von Anfang an waren ihre Schenkel fast hautnah neben den seinen. Hob er den Blick, keineswegs in der Absicht, sie anzustarren, schenkte sie ihm ein Gesicht der betörendsten Art. Er hätte sie, was das Natürlichste gewesen wäre, umarmen, ja küssen mögen. Er wusste, das wäre ein Übergriff der plumpsten Art, also mitnichten statthaft gewesen. Zwischen seinem rechten Bein und ihrem linken gebräunten Oberschenkel schätzte er verstohlen den Abstand auf zehn Zentimeter. Eine Handbreit also. Solche Nähe – und doch unüberwindbar.
Zum Aussteigen verspürte er, wie gelähmt, keine Lust. Einmal fing er ihren Blick aus strahlenden Augen auf, was nichts und alles zu bedeuten hatte. Stiege sie bei der nächsten Station aus, was ja zu befürchten war, wäre er gezwungen gewesen, sich mit einer lebensvollen Episode abzufinden, sich damit zufriedenzugeben.
Ihm fiel es oft zu schwer, solch Beglückendes als belanglos wegzustecken. Allerhand malte er sich aus. Er rühm te sich seiner zuweilen schmerzhaften Empfänglichkeit – und wollte sie nicht missen. Das war das Leben. Die Stunde der wahren Empfindung – wie einmal ein Dich ter geschrieben hatte.
Er durfte nicht hoffen, dass die Weiterfahrt sich zur Stundenlänge weitete. Doch ihm schien, der Beinabstand sei ohne sein Dazutun auf fünf Zentimeter geschrumpft. Er geriet in eine Art Steifheit, um ihr nicht den geringsten Anlass einer Zudringlichkeit zu geben. Und wieder schenkte sie ihm ein Lächeln.
Falsch konnte er dieses Lächeln nicht deuten, er deutete es gar nicht. Oft hatte er im Leben die Erfahrung gemacht, dass er zwar begabt war für das Spontane, nicht aber zum Draufgängertum. Dieses forsche Draufgängertum schien auch bei Frauen von heute an Reiz und Wirkung nichts oder nur wenig verloren zu haben. Er kannte den Spruch: ›Ich wehre mich, hör’ aber bitte nicht auf.‹ Das war die Gratwanderung, die sowohl Gelingen wie Scheitern enthielt.
Er hoffte, sie bliebe bis zur Endstation sitzen – ihm fiel es leicht, dieses Ziel gelassen vorzutäuschen. So groß war die Stadt aber nicht, die Endstation versänke wohl im Wunschtraum. Dabei war er hellwach, geradezu aufgereizt wach. Er musste etwas tun, wusste auch was, aber das durfte er sich nicht erlauben. Drehte er den Kopf, schenkte sie ihm ihr Lächeln. Hoffte sie vielleicht auf das, was er zu tun nicht wagte? Viele Haltestellen blieben nicht mehr – an der Endstation blühte dann die Rückfahrt. Aber sie, die Zauberhafte, würde da gewiss nicht sitzenbleiben. Bestenfalls würde sie ihm ein letztes Mal ihr Lächeln schenken, während sie mit ihren braunen Schenkeln davoneilte. Zu allem Überfluss dachte er, braun müssten sie nicht sein.
Noch drei Stationen. An der nächsten würde sie gewiss aussteigen. Doch sie blieb sitzen. Verwunderung und Hitze stiegen ihm zu Kopf. Der Bus war nun halbleer. Sie saßen wie Zusammengeleimte, Hüfte an Hüfte.
Und er tat, wie zu erwarten, nein, zu befürchten war, das unerlaubt Ungehörige: Er schob seine flache Hand auf ihren Oberschenkel – und erschrak zutiefst. Jede Erklärung, jede Entschuldigung war nutzlos und kam zu spät. Rasch zog er die Hand wieder weg. Die Haut brannte wie lange nicht. Er sah sie an, stammelte sofort eine hilflose Entschuldigung, die bedeuten mochte, so habe ich es nicht gemeint, wenngleich es mein größtes Verlangen war. In aller Heiterkeit sagte er: »Nun können Sie mich verklagen, ich begleite Sie sofort auf den Polizeiposten. Übergriffe sind strafbar, ich werde angeklagt, verurteilt und komme womöglich hinter Gitter. Die Fahrt mit Ihnen war mir ein Vergnügen, ein zwar auch schmerzhaftes, aber zum Verlangen passt das. Gemäß heutiger Norm habe ich Sie ungebührlich berührt. Jetzt können Sie mich anklagen, widerstandslos komme ich mit.«
Beinahe enttäuschte ihn ihre wunderbare Reaktion. Zumindest eine Ohrfeige hätte er eingesteckt, sie aber, zwar erstaunt, lächelte ihn an und sagte: »Ja, Sie haben recht, man tut das nicht. Wenn frau das täte, wär’s aber genauso ein Übergriff, obwohl der Mann daran wohl sein Vergnügen hätte.«
Fabian schien gezwungen, die Regeln einer neuen Zeit zu begreifen. Ein Aufschrei, eine heftige Geste der Zurechtweisung wäre das Gewohnte gewesen. Ihr Verhalten hatte ihm gleichsam den Wind aus den Segeln genommen. Was nun? Endstation. Kurzer Aufenthalt, gerade lang genug, um sich zu besinnen.
Er hörte sich stammeln: »Es tut mir leid.«
»Ach ja«, sagte sie strahlend. »Reut es Sie, es getan zu haben?«
»Ja … nein …«
Sie war die Überlegene, er knickte gleichsam ein.
»Weder Sie noch ich haben zum Ziel die Endstation gehabt. Was wollen wir da?«
Er habe keine Lust gehabt, früher auszusteigen, habe sich die Fahrt an ihrer Seite um viele Stationen länger gewünscht. Ein Lied habe er kürzlich im Radio gehört: Ewig bei dir zu sein – und einen Tag länger