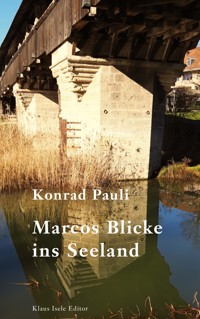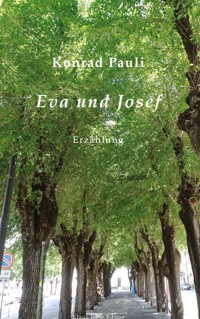Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann von 68 Jahren in einer für Männer dieses Alters nicht untypischen Situation: Er ist pensioniert, ihm fehlt die Herausforderung durch den Beruf, und dann stirbt auch noch seine Frau Rahel innerhalb weniger Monate an Krebs. Verzweiflung und Schmerz machen sich breit, aber auch Langeweile und Lebensüberdruss. In einem Schweizer Bergdorf lässt er sein gesamtes Leben Revue passieren. Bruno Amberg stellt sich viele existentielle Fragen: Was hat er getan und geleistet? Welche Höhepunkte hat er erlebt? Hat er noch Pläne, die sich zu verwirklichen lohnen, oder befindet er sich bereits auf einer Bahn, die stetig bergab führt und deren unspektakuläres Ende absehbar ist? Diese Fragen sind einschüchternd, brutal, entmutigend, beschämend. An einer Stelle des Romans heißt es: »Meine Bilanz, zusammengefasst zwischen dämmrig-kühlen Sandsteinmauern, ist kurz und knapp: Einsamkeit. Nichts bedeutet wirklich etwas. Mir passieren Dinge, aber ich handle nicht. Ich existiere, aber ich lebe nicht. Mir ist, dies sei mir aus einer Lektüre hängengeblieben. Rahel ist tot, und ich bin am Leben. Muss etwas tun gegen die Lebensmüdigkeit, selbst wenn's ein letzter Anlauf wäre.« In dieser tristen Lebenssituation lernt Bruno Amberg in einer Bibliothek die rund 25 Jahre jüngere Luisa kennen, die anscheinend ein Faible für ältere Männer hat. Eine Liebesgeschichte mit ungewissem Ausgang beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich gab mir Mühe, damit ich nicht an Unlust früh verglühe.
Robert Walser
Noch diesen letzten Ast des Apfelbaums gilt es zu stutzen, zu formen, bereitzumachen für den Winter und vorzubereiten für das Aufblühen im Frühling. Gleich wird es zu regnen, wenn nicht gar zu schneien anfangen auf solcher Höhe, während unten im Tal der Winter gewiss auf sich warten lässt. Der Versuchung, sich zu beeilen und dabei die falschen Triebe und Zweige zu opfern, ist zu widerstehen. Ein Werk, mit grösster Sorgfalt begonnen, geht kaputt, wenn die Geduld, es zu vollenden, verlorengeht. Der Regen tropft in den Nacken, man könnte sich erkälten, aber dieser Teil muss noch beschnitten werden, morgen bin ich darüber froh. Werde nachher ein paar Scheite in den Ofen legen, den dicken Pullover anziehen und mich auf die Ofenbank setzen. Aufheizen. Mich selbst zum Glühen bringen.
Eine weitere Nacht hier oben auf der Neuegg. Aufs beste vertraut. In vielen Jahren zur Gewohnheit geworden. Seit zwei Jahren bin ich, Bruno Amberg, ohne Rahel, meine Frau. Meine einzige Frau. Meine Ohren, mein Gehör machte mir Sorgen, klirrte hier und knackte dort – Schäden und Abnützung waren nachweisbar durch den Arzt. Die Behandlung brachte Erklärungen ohne Verbesserung. Und Rahel, zu Recht ein wenig ungeduldig, sagte, es wäre wünschenswert, wenn meine Ohren einer Besserung entgegengingen. Ja, sagte ich, ein wenig hoffend, ja. Rahel hatte bald darauf zwar keine Ohrenprobleme, dafür aber eine versteckte Krankheit, eine Wucherung in Lungennähe, die zu dauerhaftem Husten führte, den kein Arzt, kein Medikament zu lindern wusste. Rahels Krankheit stellte meine Ohrenkrankheit bald in den Schatten – sie war es nun, die zu ernsthafter Sorge Anlass gab. Wie bald sich doch Hoffen und Bangen erschöpften und umschlugen in Ausweglosigkeit. Rahels Weg führte schnurstracks ins Sterben, in den Tod. Was sollen jetzt meine Ohrenprobleme. Sie bleiben mir erhalten, doch niemand spricht mehr darüber.
Sehe ich all die Dinge rings ums Haus und füge noch hinzu, was drinnen ist, so schrumpft alle Bereitschaft, ja aller Mut, ans Aufräumen zu gehen. Aber auf Dauer geht es so nicht, ganz besonders nicht ohne Rahel. Ihre Abwesenheit füllt jeden Raum, jede Ritze. So zügig hatte sie sich davongemacht; es schien, als sei sie in Eile. Unfähig, mit ihr Schritt zu halten, klammerte ich mich ans Verstehenwollen, ans Trösten, das sich jedoch als wirkungslose Anstrengung entpuppte. Es durfte doch nicht sein, dass die Krankheit Rahel solcherart in Besitz genommen hatte und bloss die Hoffnungslosigkeit als Fratze übrigblieb. Rahel wusste es besser. »Lass mich gehen«, sagte sie lächelnd. Ausserstande, sie eines Besseren zu belehren, musste ich ihr Lächeln gelten lassen. Alles ging so schnell, dass nun Ungesagtes durch die Räume dröhnt und sich Gehör verschaffen will. Zuweilen schäme ich mich, dass die letzte Zeit mit Rahel, ohne zu ahnen, wie bald sie vorbei sein würde, besetzt war vom Ohrenproblem – ich hatte zu klagen, Rahel versuchte zu verstehen, zu beschwichtigen. Trotz all ihrem Bemühen half dies kaum. Das Pfeifen, Ticken, Rauschen und Rumoren in den Ohren übertönte alles, was um Einlass bat in das Denken. So ausdauernd hatte ich mit mir selbst zu tun, dass ich ausserstande war, mitzubekommen, was in Kürze mit Rahel geschehen würde. Als der Augenblick kam, in dem ihre Krankheit offen ausbrach, war es für vieles zu spät. Ungesagtes blieb auf der Strecke. Ungefragt nahm Rahel diesen ganz andern Weg.
Nun stehe ich da, neben dem aufflackernden Ofenfeuer, verspüre die Wärme, blicke durchs Fenster in den Dämmer und betrachte den beschnittenen Baum. Ein Spatz sucht seinen verlorengegangenen Ast. Er wird sich an die Veränderung anpassen müssen.
Und alles blieb liegen im Haus – ich sollte doch … heute Abend nicht mehr – morgen ist auch noch ein Tag. Mit Sicherheit kam der andere Tag – und alles war wie zuvor. Niemand hatte mit nachtstiller Hand die Materialien in Ordnung gebracht.
Jetzt müsste man weggehen, bald wäre es zu spät. Ob es mit Achtundsechzig nicht ohnehin zu spät war? Wie verjüngte man sich andernorts? Wo fände man die Frau dazu? Ein unerhörter, unzulässiger Gedanke. Eine unerlaubte Verlockung. Als hinge das Fortkommen davon ab.
Doch da war das Angebot des Freundes. Er, der Maler, ginge demnächst für ein halbes Jahr nach New York. In Bern bewohnte er eine Mansarde. In ihr dürfte ich wohnen und leben, wenn ich denn wollte. Veränderung, Abstand von der Neuegg, von den Verhältnissen, sagte der Freund, würden dir guttun. Du musst ausbrechen aus deiner Abgeschiedenheit, musst zurückkehren in die Welt, in das Gewimmel der Menschen – so, als wäre hier oben keine Welt.
Was wäre zu erwarten von Bern – gerechtfertigt wäre der Aufenthalt bloss durch eine Aufgabe, eine Arbeit. Auffrischung? Was um Gotteswillen soll denn aufgefrischt werden? Welcherart wäre der Gewinn, was brächte ich zurück, wenn ich wieder, was vorauszusehen war, nach oben ginge?
Muss Holz nachlegen, darf aber nicht jetzt schon zuviel verbrennen. Der Winter steht vor der Tür. In der warmen Stube hat man zuweilen gleichwohl kalt. Dieses Frieren muss eine innere Kälte sein. Wie ihr entgehen …
Sollte Kuno anrufen, bin aber für eine Antwort noch nicht bereit. Bin unschlüssig – bin ich zu faul? Bin ich ein Opfer der Gewohnheit, ein Gefangener der Verhältnisse, unfähig zu jeglicher Veränderung, zum Aufbruch? In welche Richtung sollten denn Aufbruch und Veränderung gehen? Werde ich unter einem andern Dach ein Anderer? Will ich das? Manches an mir ist mir doch auch lieb. Ist die Liebenswürdigkeit sich selbst gegenüber verdächtig? Auch ein langes Leben ist zu kurz, um auf alles eine Antwort zu geben. Selbst Antworten werden alt und verdorren. Für Vieles ist es ohnehin zu spät. Das Wenige gilt es zu betreuen, zu hegen und zu pflegen.
Die Stille von draussen gleicht beinah einem Lärm. Es ist, als sei in ihr eine Mahnung, als erwarte sie von mir den nächsten Schritt. Nun gut, ich hole Holz aus dem Schuppen und schnappe nach ein paar Windstössen. Aber da ist keine Bewegung in der Luft, zaghaft winkt das Türlicht in die Dunkelheit. Es leuchtet Jenen, die mich ohnehin nicht besuchen werden. Mir scheint, die Stube, die Küche und jeder Raum seien zu Wartesälen geworden, vollgestopft mit Unabgeholtem – darin nehme ich Aufenthalt und bewege mich wie in einem Provisorium. Früher, in den Jahren mit Rahel, war das nicht so. Mal war ich, mal war sie zuerst daheim. Jeder wusste, kurzum käme der Andere. Man war seine Wege gegangen durch den Tag, hatte Pflichten und Bedürfnisse erfüllt, Abmachungen eingehalten. Nun gab’s ein Abendessen – von ihr, von mir zubereitet, manchmal von beiden. Man teilte sich mit, tauschte Erlebtes aus, wunderte sich und stellte Fragen. Antworten blieben zuweilen Stückwerk, aber das Aufgeworfene hallte nach. Der Rotwein entspannte und beflügelte. Später Lektüre, eine Sendung im Radio oder Fernseher. Die Turbulenzen der Welt purzelten in die Stille und Abgeschiedenheit. Im Bett, vor dem Einschlafen, hielt man sich an der Hand und spürte die Nähe und Wärme des andern Körpers, selbst wenn man sich nicht ineinander verschlungen hatte. Ein wenig knisterte darin das Bedauern, dass es nicht mehr war wie ehedem – aber man war sich nah und vertraute auf die nächste Umarmung.
Sollte es morgen früh eine Menge Schnee haben, müsste ich mich ins Freie schaufeln. Die zehn Meter bis zum Strässchen. Wie habe ich doch den Schnee geliebt, wie habe ich mit Kraft und Schwung uns beiden den Weg gebahnt. Keine Schneehöhe war mir zu hoch. Es galt, meine Energie und Ausdauer an ihr zu messen. Allemal gelang mir dies; wir hatten Zeit und Laune, bewarfen uns mit Schneebällen, bekamen rote Gesichter, bauten auch mal einen Schneemann oder eine Schneefrau. Jetzt will ich hoffen, dass mir die Arbeit erspart bleibt. Was vormals ein Vergnügen war, ist zur blossen Notwendigkeit geschrumpft. Tief im Wald ruft ein Käuzchen. Was will es von mir? Will es, dass ich bleibe? Es kommt doch ohne mich aus, setzt seinen Gesang oder Lockruf fort, auch wenn ich es nicht mehr höre. Aber womöglich wird es mir fehlen. Wie lange ginge es wohl, bis ich zu benennen vermöchte, was mir fehlt? Was fehlt einem mit achtundsechzig Jahren?
Fehlendes aufzuzählen geriete allzu rasch zum Klagelied. Auch handelte man sich den Vorwurf ein, versagt und den Mangel nicht rechtzeitig korrigiert zu haben. Ich bin also dankbar für alles, zumindest für Vieles. Für neue Freiheiten, in die mich Rahel ungewollt entlassen hat? Doch wohl kaum. Es schneit, der Holzkorb ist gefüllt, der Ofen wartet. Die Rotweinflasche auch. Und das Buch.
Die Nacht ist da. Sie hat nichts Erschreckendes, gar Bedrohliches – sie gleicht jeder andern. Im Ofen brutzelt das Feuer; man weiss nicht, wird es Trost bringen oder bloss sich selbst genügen? Mit Rahel hatte man an kühlen Tagen so ein Feuer entfacht, es gut unterhalten und zeitlich in die Länge gezogen – so als wäre es eine Notwendigkeit zum geglückten Tagesende. Nirgendwo anecken, über nichts mehr stolpern am Tagesausklang.
Ich weiss nicht, ist es der Rotwein oder die Wärme auf dem Ofen oder beides, die mir zu schaffen machen, die die Müdigkeit nähren und mich in solche Gedanken verstricken. Dabei sind sie mir auch mal leicht und lieb gewesen. Nicht alle Gedanken zielen am Leben vorbei. Aber zuweilen laufen sie sich tot; ihrer sind es zu viele.
Ich muss vom Ofen weg, er verbrennt mir den Hintern. Es ist bald Zeit, schlafen zu gehen. Zwar gelingt das Einschlafen reibungslos, aber nach zwei Stunden bin ich oft mit einem Ruck wach, schrecke hoch, nicht einmal aus einem Traum – einfach so, als wäre der Morgen schon da und zwei Stunden Schlaf seien genug gewesen. Ich weiss, ich werde wieder einschlafen und wieder erwachen. Darauf bin ich gefasst. Im Wachsein horche ich auf die fernen leisen Geräusche der Nacht – ihrer sind hier nicht viele. Eher schon herrscht Totenstille. Welche Geräusche wären denn wünschenswert? Es genügt, den Wind zu hören, die feinsten Ausläufer an der Nase zu spüren, das Käuzchen zu vernehmen und gelegentlich das Knistern und Knacken in den Balken, im Fussboden, in einem Holzschrank. Was geht hier entzwei? denke ich. Vielleicht hält das Knacken ja alles zusammen?
Mir scheint, der Ofen sei gefrässig und verschlinge mehr Holz als je zuvor. Ein Scheit lege ich noch nach, eines muss für heute genügen. Es gibt welche, die sagen, ein Kaminfeuer tröste. Gerne will ich das glauben, wenngleich mir das schwerfällt. Es klingt wie befohlenes Getröstetsein – wehe, man packt die Botschaft nicht; leicht wird man eingereiht in die dicht besetzte Galerie der Ahnungslosen und Versager. Man kann mich mal. Das Versagen habe ich einzig mir selbst gegenüber zu verantworten. Kein Gericht, keine Instanz wird mich jemals dafür zur Rechenschaft ziehen. Menschsein hat naturgemäss das Misslingen zum Inhalt. Gut, wenn man nicht pausenlos daran erinnert wird. Als Versager hätte man sonst keine Überlebenschance.
Das Kaminfeuer also genügt sich selbst und tröstet. Zufrieden bin ich, wenn es mich wärmt. Wohligkeit wäre übertrieben, sie wird verhindert durch meine Unruhe. Behaglichkeit scheint ein Fremdwort geworden zu sein. Ein älterer Kerl in Strickjacke und Filzpantoffeln, mit auf dem Schemel ausgestreckten Beinen – vertieft in einen gemäss Zeitschriftenversprechen gescheiten Artikel, daneben ein Glas Wein, ein Traubensaft, vielleicht ein Whisky: Ich fliehe solche Vorstellung.
Dafür streift der Blick die Bilder, die rundum die Wände füllen; selbst über der Treppe in das Obergeschoss hängen sie dicht an dicht. Jedes Bild hat seine Geschichte – manchmal will die Galerie ins Erzählen kommen, alle Bilder auf einmal. Habe ich Laune, lasse ich mich darauf ein, höre, woran sie mich erinnern, was sie mir erzählen wollen. Vergangenes Leben holt einen ein, sitzt hartnäckig oder sanft im Nacken, will bedeuten, dass solange das Gedächtnis funktioniert, etwas von Bedeutung ist, seine Sinnhaftigkeit fordert. Im Alter habe man – so der Trost – ein Lebenskapital, eine stattliche Summe an Erlebtem und Gedachtem, heisst es; einen Reichtum, den die Jugend nicht haben kann. Ein Alter hat mehr erlebt als ein Junger. Nichts oder wenig ist dabei aber ausgesagt über die Tiefe des Erlebten. Sofort rätsele ich über allfällige Tiefen nach. Gibt es ein Messgerät oder eine Wertetabelle, die der Vorstellungskraft, Empfindsamkeit, der Daseinslust, dem Glücksgefühl, der Leidensfähigkeit und der Trauer eines Menschen gerecht wird?
Das letzte Holzscheit knistert und knackt und scheint sich lustig zu machen über meine hochstelzigen Weisheiten. Rahel hätte die Stirn gerunzelt – eine herrliche Falte gezogen, hätte mir widersprochen und mich ermuntert zu neuem Gedankenanlauf. Hätte Abgeschlossenes nicht gelten lassen. So lange nicht, bis sie sich um den Abschluss ihres Lebens kümmern musste. Lass mich gehen – das klingt nach.
Schlecht und recht ist es gegangen die zwei Jahre, viel Zeit verstrich, oder die Stunden blieben stehen. Mir scheint, es gehe inzwischen besser, doch immer noch schlecht genug. Besser insofern, weil ich das Unabänderliche anzunehmen gezwungen bin, schlecht genug, weil ich aus ihm nicht herausgefunden habe. Ob das jemals gelingt? Mein Leben ist doch in Rahel angelegt – wie soll ich es zurückbekommen? Gescheitert sind bis anhin alle Versuche.
Anfänglich hat man mich ermuntert, nun an mich selbst zu denken. An mich denke ich doch immerzu und werde kaum klug daraus. Ich könnte ins Auto steigen und hinunter in die Ortschaften oder nach Burgdorf fahren. Zum Einkaufen fahre ich nach Sumiswald. Weil die Bäume kahl geworden sind, sehe ich die Dorflichter. Auch höre ich, je nach Windrichtung, die Kirchturmuhr schlagen, wenn sie mir mitteilt, es sei eine weitere Stunde verflossen und mich mit geradezu erhobenem Zeigefinger befragt, was ich mit ihr gemacht, wie ich sie genutzt habe. Weshalb muss denn jede Stunde einen Nutzen bringen? Einen Sinn braucht das Leben nicht zu haben, zumindest nicht jeden Tag – es wäre zu anstrengend. Ein wenig kurzweilig, wenn möglich schmerzfrei, sollte es aber schon sein. Der Schmerz macht sein Opfer buchstäblich zur Sau – er raubt ihm alles, was ihn antreibt. Es gibt allerdings welche, die sagen, Schmerzerfahrung sei heilsam, also eine Hilfe, ein Ansporn zum Leben.
War denn all mein Lebenssinn in Rahel angelegt? Mit ihrem Weggang stünde ich nicht bloss alleine da, ich wäre sozusagen lahmgelegt, leergefegt und ausgehöhlt. Übrig bliebe bloss noch die Hülle meiner selbst. Ein Windhauch bliese sie zu Staub. Ein Staubhäufchen. Die traurige Hinterlassenschaft all meiner Anstrengungen, meiner Nöte, meines Wünschens, meines Versagens, meiner Daseinslust. Aller Lebenssinn aufgehoben, eine kurze Weile noch geduldet in einem Staubwölkchen. Von Erde zu Erde, von Staub zu Staub – wie eindrucksvoll und sinnig.
Dass ich noch da bin, ist vielleicht gar ein Glück. Am Leben bin ich geblieben, in aller Bedrängnis habe ich es nicht hingeworfen, habe mich vom Dasein nicht abgemeldet, sondern durchgewurstelt. Und habe so, zumindest organisch-biologisch, überlebt. Das Gehör ist halbwegs kaputt, die Gelenke knacken, die Zähne brauchen die Hilfe des Zahnarztes, die Augen wollen ihre Tropfen. Der Kopf immerhin hat seine Fähigkeit behalten, allmonatlich die Einzahlungen zu erledigen.
Bin ich dazu verurteilt, einzig noch von den Erinnerungen zu leben – kommt nichts mehr dazu, das mir fortlaufend und für später neue Erinnerungen schafft? Betrachte ich die Bilder ringsum an den Wänden, so wimmelt es von Erinnerungen. Käme mit einem neuen Bild Neues dazu?
Aus Angst zögere ich das Zubettgehen hinaus – was ist, wenn ich nicht schlafen kann? Bedrohlich ist das abrupte Erwachen nach zwei Stunden, ein Hochschrecken zur Unzeit, verbunden mit Herzklopfen und Schweissausbrüchen, manchmal Atemnot. Zu früh beginnt so der Tag. Mitten in der Nacht. Und die Wunde reisst wieder auf, das Spiel des Wünschens wird neu gespielt, geweckt vom Verlangen, Rahel möge neben mir im Bett liegen, wie immer.
Jetzt lenke ich mich ab mit dem Bild überm Gestell, diese bäuerliche Pflugschar, gezogen von zwei kräftigen Gäulen, der Bauer gebieterisch in ihrem Schlepptau. Schmelzende, schmutzige Schneeränder und tief aufgeworfenen Gräben von Pferd und Gerät. Schollengebirge. Und der Bauer, der das Vorankommen breitbeinig überwacht, die Pferde bloss gewähren lässt, damit alle Furchen gelingen und der Acker gepflügt ist. Düsteres Gewölk über allem, wohl auch im Gemüt des Bauern – spukhaft beinah dieser verbissene Vollzug des Tagewerks in Besinnungslosigkeit; automatisch geht alles voran, denn nur so scheint die Leistung möglich, das Tagesziel erreichbar. Motorik des eingeschliffenen, auch abgenützten Lebens. Zweckmässig zurechtgestutzt auf das Notwendige und Nützliche.
Das Bild war das Geschenk des Künstlers für einen Katalogtext, den ich auf Anfrage einer Galerie vor vielen Jahren geschrieben habe. Jetzt pflügt dieser Ackermann Tag für Tag, jahraus, jahrein sein Feld und erinnert mich an mein Feld, das ich zu pflügen und neu zu bestellen hätte.
Kurz gehe ich vor die Tür, lasse ein paar Schneeflocken meine Stirn kühlen, erinnere mich, wie ich sie als Kind mit aufgesperrtem Mund geschnappt habe, verzichte mit einem schiefen Lächeln auf solchen Versuch, gehe wieder hinein, bin geneigt, den Fernsehknopf zu drücken, verzichte aber und gehe erhobenen Hauptes zu Bett.
Mag sein, der Schneefall verhilft zu besserem Schlaf und baut sowohl wirre wie klare Träume ein – jedenfalls komme ich beim Erwachen frühmorgens aus den Tiefen der Nacht. Halb sechs. Das ist nicht schlecht – und mir scheint, die Stille ringsum sei noch stiller als sonst. Ich schalte das Radio ein und fülle so die Stille mit klassischer Musik. Weshalb ich gerade den Valse triste von Sibelius erwische, liesse sich mit der Programmplanung leicht erklären. Einen traurigen Walzer tanzen. Bis zu seinem Ausklingen bleibe ich liegen, und die Sorge, alles wiederhole sich auch heute, sitzt wie Blei in den Gliedern.
Das Glied freilich juckt auf, wie oft am Morgen – die Engländer nennen das morning glory; wunderbar, doch glory scheint mir die Erscheinung gerade nicht. Was hat Mann davon … Ausser Acht lassen lässt sich das Phänomen allerdings auch nicht, also nehme ich mich seiner mit Sorgfalt und Heftigkeit an, drücke, streichle und massiere den Stengel, bis er seine Ladung los wird und halbwegs zufrieden in sich zusammenfällt. Aus biologischen Gründen, sage ich mir. Wie machen das die Andern? frage ich. Kenne aber keinen, dem ich diese Frage stellen könnte.
Der Blick aus dem Fenster geht in eine Schneelandschaft; auf jedem Ast und Zweig zieht sich der Schnee wie ein dickes Band, wie eine sattgefressene Raupe – weiss nicht, ob dieser Vergleich taugt; als Hauben krönt er die Pfosten des Zaunes – selbst in den feinen Maschen des Drahtgitters hat er sich eingenistet. Nur die längsten Grashalme gucken noch hervor. Im Radio ist aber schon die Rede von Tauwetter. Müsste also zeitig hinausgehen und losschreiten auf den vertrauten, inzwischen gewiss auch ausgetretenen Pfaden; weggehen und sich auf das Unerwartete einlassen. Ach, wie oft habe ich das versucht.
Hat denn aller Auslauf die Frische verloren, lauert in jeder Ecke bloss die Wiederholung, das Bekannte? Schrumpft die körperliche Bewegung lediglich zur gymnastischen Aktion? Fit bleiben wofür? Bin ich fit?
Ich gehe vor die Tür und sehe, dass keine Wege freizuschaufeln sind, damit der Briefträger ungehindert meinen Briefkasten finden wird. Gewohnheiten erleichtern das Leben, zumindest den Alltag. Erwarte ich denn Post, eine wichtige Nachricht? Die Botschaft, die mit einem Ruck das Gemüt und den Verstand auslüftet, die den ganzen Tag, wenn nicht die Woche, den ganzen Lebensrest zu erhellen vermöchte. Nur zu gern erwartet man von Aussen, was im eigenen Innern lahm und grau geworden ist. Eine Art Erlösungshoffnung. Doch die Hoffnung wird müde. Anzeichen des Alters?
Man weiss zu viel und von Vielem zu wenig. Man kommt sich allmählich abhanden. Doch was soll’s. Wer nicht stirbt, wird alt.
Als alles stockte und die Freunde und Bekannten sagten, dies sei normal, schliesslich sei ich in einer Phase des Trauerns, sah ich das zunächst als hilfreiche Geste und Zuspruch an. Eine Phase, ja – doch bald klang’s eher wie eine Phrase. Diesen Unterton hätte ich gerne überhört. So aber nistete er sich ein. Man schien mich zwar zu verstehen, mit Schweigen und Zureden inszenierte man Anteilnahme, aber all diese forcierten hilflosen Anstrengungen und Bekenntnisse des Verstehenwollens brachten mich beinahe um. Man griff mir unter die Arme, stützte mich, wenn ich schwankte, nahm mir das Wort aus dem Mund, wenn ich leer schluckte, und nickte fürsorglich, wenn sich in mir ein Schrei ansammelte. Ja, ja, vielen Dank! Ihr meint es gut, ihr könnt ja nichts dafür. Einige von euch reden oder schweigen aus Erfahrung, haben auch Schweres durchgemacht. Ganz weg davon kommt man nie. Wie damit fertigwerden? Nie damit fertig werden wollen? Wär’s besser gewesen, man hätte miteinander in Zerrüttung gelebt? Der Verlust gar kein Verlust, vielmehr Befreiung und Erlösung von Ballast? Neue Freiheiten? Mit Rahel war dies nicht möglich, stellte sich nicht einmal als Frage.
Trete ich vors Haus, sehe ich die blassen Konturen des Hauses mit dem ausladenden Dach; erinnere mich, wie ich von solchem Schauen, solcher Verheissung anfänglich regelrecht erschüttert war – ich ging zügig auf dieses Haus an der Horizontlinie zu; nicht das Haus barg ein Versprechen, vielmehr pulsierte im Weitergehen das Neuland, die Unverbrauchtheit, das Abenteuer; es war, als wartete hinter der zarten Dunstlinie das Gelobte Land. Welche Erregung und Verheissung es doch damals war, solche Linien und Begrenzungen auszukundschaften – jetzt bloss noch die kurzatmigen, abgehackten Anläufe und die Illusion, es möchte sein wie am Anfang. Nach wenigen Schritten die Entzauberung, das Altbekannte – und die Umkehr. Der Horizont hatte alle Verlockung verloren. Unwiederbringlich. Nicht einzig auf Rahel durfte dieser Zustand abgewälzt werden. Man war meilenweit, ja Lichtjahre entfernt von der Jugendzeit, vom Jungsein. Was wäre hervorzuholen aus Verschüttetem, was aufzufrischen? Wiederbelebungsversuche? Schon morgens diese Müdigkeit – Lust losigkeit? – und am Abend diese forcierte Wachheit. Eine verkehrte Welt.
Jeder Tag hier oben ist ein verlorener Tag. Doch was soll’s, wofür verloren? Was wäre noch zu gewinnen?
Es lässt sich noch etwas machen aus meinem Leben, fordert eine Stimme. Ist denn nicht alles schon getan? Und Rahel? Hatte sie vielleicht die Wahl? So gehe ich ins Haus und überlege, was heute erledigt werden müsste. Ertappe mich dabei, von der Post etwas erwarten zu wollen. Ist all dies Zögern und Fragen die Frucht von Antriebslosigkeit und Langeweile? Selbst wenn – darf ich mir das Gefühl der Langeweile vielleicht nicht erlauben? Einzig die Frage zählt, ob sie mir behagt, ob sie mir aufgezwungen, ob sie erträglich ist. Im Zimmer gehe ich umher, unschlüssig und zu Vielem halbwegs entschlossen – es ist Vormittag und der Tag noch lang.
Wende mich also zurück in die Behaglichkeit. Bilde mir ein, sie dauere an. Stürze mich wahllos in die Erinnerung und nach Berlin. Fehlt die Gegenwart, so wuchert das Vergangene. Wie war das doch ein Höhenflug, auf Geheiss der Zeitung am Theatertreffen teilnehmen zu dürfen. Dieser Monat Mai in Berlin. War schon wiederholt in Berlin gewesen, oft mit dem Auto. Einmal im Schneegestöber. Zum Theatertreffen aber ging’s durch einen Gewittersturm. Aus der Schweiz nahm ich das Unwetter gleichsam mit in Richtung Deutschland. Kurz vor Schaffhausen schob sich eine