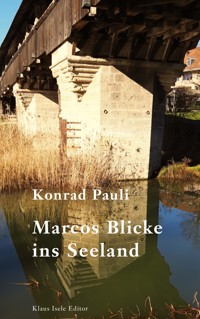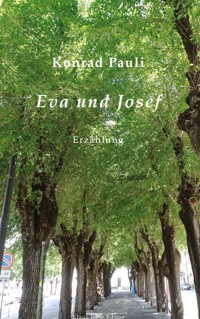Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Collection Montagnola
- Sprache: Deutsch
Geschichten aus dem Alltag. Erzählungen über Lebens- bzw. Schaffenskrisen in nüchterner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Johannes Brahms
Herbstsonne
Die falsche Richtung
Lebensgefahr
Im Tief
Wunschträume
Ein Romantiker in nüchterner Zeit
Gut versorgt
Eine kleine Nachtmusik
Geldregen
Johannes Brahms
Dort drüben, in der Sonnenecke eines Cafés der Bieler Altstadt, sitzt Johannes Brahms. Gedrungen die Gestalt, das dichte, weisse Haar zurückgekämmt, der weisse Vollbart kinnverlängernd zugespitzt. Ohne Müh, mit leicht zugekniffenem Auge, gelingt’s dem Betrachter aus einigem Abstand, dort den Komponisten sitzen zu sehen beim Glas Wein in der Spätnachmittagssonne. Wenig braucht’s, und ich ginge hin, ihn zu grüssen und ihm zu sagen, wie sehr ich seine Werke liebe. Hundert Jahre nach seinem Tod.
So unverbraucht seine Musik heute noch klingt, so leibhaftig sitzt er dort, womöglich nach geglückter Arbeit, zur Erholung, zum andern Genuss. Das Trugbild hält aller Nachprüfung stand. Kein Blinzeln, kein kurzes Wegschauen vermag es zu vertreiben. Und so gesellen sich in Gedanken noch Brahms’ Zeitgenossen dazu – Bruckner, Wagner – , sofern sie sich aus vertretbaren Gründen nicht gemieden haben.
Ich ziehe, um meinem Wunschbild nicht ganz zu erliegen, ein paar Runden um die Altstadthäuser und komme, wie verhext, wieder zurück: Er sitzt immer noch da. Neben ihm jetzt eine Frau – aber nicht Clara Schumann. Eine Gönnerin? Gewiss eine Verehrerin. Leicht lässt man sich von der Vorstellung verführen, die letzten Sonnenstrahlen strengten sich an, um die Berühmtheit in eine Aura zu hüllen, die andern Café-Gästen vielleicht auch gut angestanden hätte. Er aber ist Johannes Brahms.
Unwillkürlich fangen in mir Melodien zu summen an, Harmonien, die sich in willkommener Weise zu halben Sinfoniesätzen weiten. Von der Szene will ich, bevor naturgemäss die Ernüchterung kommt, nicht lassen – also trete ich wie beiläufig näher, zufrieden, dem Meister einige Atemzüge lang so nahe zu sein. Johannes Brahms hebt den Blick und schaut mich an; wir kennen uns (wiewohl wir uns manches Jahr nicht mehr gesehen haben) – es ist Heini Stucki, ein weit über die Region hinaus bekannter Fotograf. Dass er mir als Johannes Brahms begegnet ist, verrate ich ihm nicht, staune bloss darüber, wie das Ferne oft näher heranrückt als das Nahe. Überaus gerne nehme ich die Verwechslung mit auf meinen weiteren Weg durch den Tag.
Herbstsonne
In hilfloser Entschlossenheit ging Aldo Ferrari im Atelier umher, trat wiederholt vor die bereitstehende Leinwand, wich dann aber zum farbrestübersäten Tisch mit Tuben und Pinseln aus. Er müsste – welch seltsamer Anflug – hier mal wieder Ordnung schaffen und die Gläser und Büchsen auswaschen.
Ihm schien es, das Chaos wachse ihm über den Kopf, und die Farben und verkrusteten Hinterlassenschaften gerieten auf unerwünschte, ja bedrohliche Weise durcheinander. Er zwang sich zur Bereitschaft, wandte sich der Leinwand zu und scheute sich doch vor dem Anfang. Gleich mit dem ersten Pinselstrich würde er sich festlegen. Wofür? Fürs neue Bild, fürs Werk. Misslänge dieser Ansatz (nach welchen Kriterien?), fiele er weiter zurück als an den Anfang.
Jedes Anfangen barg das Verheissungsvolle in sich. Käme er erst einmal in Schwung, so wäre er nicht mehr aufzuhalten. Doch in letzter Zeit überwucherten Zweifel die Zuversicht ins Gelingen. Voll vermeintlicher Sicherheit wandte sich Aldo der Malfläche zu, um kurzum zu erlahmen. Rasch schlich sich Müdigkeit in Arme und Beine und ins Gemüt. Kopfschmerzen und ständiges leichtes Fieber waren seine treuesten Begleiter. Der nächste Arzttermin stand bereits in der Agenda.
Ihm war, kein Strich passe mehr zum andern – er schien etwas angefangen zu haben, das keine Fortsetzung erfuhr. Aldo Ferrari starrte die Malfläche an. Auf ihr musste doch, wie zuvor, etwas möglich sein und Gestalt annehmen. Doch ihn dünkte, er widerspreche sich selbst und zerstöre, was womöglich richtig gewesen wäre. Also wich er aus und suchte Ablenkung und schwachen Trost in einer Zigarette, die er hastig rauchte. Dabei schielte er auf die Leinwand, erntete von ihr aber bloss Gleichgültigkeit. Anders als in früherer Zeit half auch die Musik von Gustav Mahler und Jean Sibelius nicht weiter. Nach der dritten Zigarette griff er direkt nach der Weinflasche, verzichtete gar auf ein Glas. Dann setzte er seine Runden im Atelier fort, ein wenig schwankend schon, aber wie besessen von der Grimasse, vom Rätsel der leeren Leinwand.
Aldo hustete und griff sich an die heisse Stirn. Leichtes Fieber hatte er schon seit vielen Tagen. Er bildete sich ein, er habe sich daran gewöhnt. Die Hitze war wohl die Folge seiner Anstrengung, das nächste Bild zu schaffen. Der Ausstellungstermin war festgesetzt. Ein paar Werke mussten noch gelingen. Für sie hatte er, weil sie aus einer Art Zyklus herauswachsen sollten, ziemlich klare Vorstellungen. Aber der Pinsel schien ihm auf einmal zu schwer zu sein. Er lachte auf. Vielleicht gelänge die Arbeit mit einem kleineren Pinsel – dann wäre aber die Malfläche zu gross.
Mit einer weiteren Zigarette – oh Gott, wie rasch sie verglimmten – trat Aldo Ferrari vors grosse Atelierfenster mit Blick in einen Hinterhof. Ganz in Aldos Sinn war er überwuchert von allerhand Pflanzlichem. In diesem Wildwuchs rumorten das Sonnenlicht und der Wind. Nie genug konnte er davon bekommen. Indes war der Genuss erst da, wenn ihm die Arbeit gelungen war; wenn Anstrengung, Ausdauer und Müdigkeit ein Glück bedeuteten. Im Augenblick sah er, ohne hinzuschauen, hinter sich bloss die Leinwand. Ihm war, sie verhöhne ihn, lache ihn ob seines Zögerns, seiner Unfähigkeit aus.
Die Herbstsonne im Hinterhof schmerzte. Sie erinnerte ihn an Vieles und wollte nichts mehr versprechen. Dieses Wetterleuchten der Farben selbst in den kleinsten Blättern! Oft hatte er versucht, dieses Aufflammen mit dem Pinsel einzufangen, das Dahinterliegende zu beschwören. Ein paarmal mochte es ihm geglückt sein. Seinerzeit fand er viele Käufer, auch Anerkennung in der Presse. Von Misserfolg konnte nicht die Rede sein. Aber die Kritik anlässlich seiner letzten Ausstellung sass wie ein Stachel in ihm. Messerscharf suchte sie zu unterscheiden zwischen seinen anfänglich überraschenden, also vielversprechenden Arbeiten und den Werken der grossen Meister. Was er, Aldo Ferrari, zustande bringe, sei zwar bemerkenswert – ihm fehle aber doch das gewisse Etwas, jene Besonderheit und gestalterische Vision, die ihn über das Gängige, übers Mittelmass emporhebe. Ein talentierter Epigone.
Man brauchte ihm nicht vorhalten, dass er kein Genie sei. Das wusste er längst. Nicht vom Echo hatte er die Antwort erhalten. In den Bergen hatte einer gegen die Felswand geschrien: Bin ich ein Genie? – Naturgemäss antwortete das Echo: Nie …!
Das Genie war die Ausnahme. Aldo Ferrari gehörte zu jenen fünfundneunzig Prozent Talentierter, die den Unterbau, den Humus bilden für das Genie, das an der Spitze der Pyramide lebte und wirkte. Glückte Aldo Ferrari aber ein Werk, so vergass er seinen Standort in der Pyramide – er war ganz einfach ein Schaffender und schöpferisch mit den Grössten verwandt.
Er stand am Fenster und starrte in das Farbfestival der Novembersonne. Kurzum verschwände das Licht; mattes Grau würde sich auf das Leuchten legen. Und morgen war Regen angesagt, gleichsam als Todesstoss für den Blätterrest.
Genie ist die Ausnahme – keiner brauchte ihn daran zu erinnern. Aber als Schaffender hatte dies keine Bedeutung. Man stelle sich vor: Ein Talent ist am Werk und hält sich alle Augenblicke vor, er sei nun einmal kein Genie. Statt ihn über die Leinwand zu führen, müsste er den Pinsel sofort wegwerfen. Wollte er also vor der Leinwand und vor sich selbst bestehen, musste er alle Einwände und Vorbehalte vergessen und so tun, als sei er ein Genie. Mit etwas Glück gelänge ihm so etwas Anständiges. Dafür würde er sich nicht zu schämen brauchen. Für seinen Standort in der Pyramide konnte er nichts. Notfalls fände er Zuversicht im Spott und Trotz. Eine Art Selbstbehauptung.
Weil es nun dämmerte, ging Aldo Ferrari zurück zur Staffelei und schaltete das Licht ein. Nun war es ihm zu grell, aber er entschied, er müsse es aushalten. Aldo zündete sich eine weitere Zigarette an und erhoffte sich, dadurch neuen Anlauf zu nehmen ins Angefangene. Er benötigte noch eine zweite Zigarette, dann ein Glas Wein. Er steigerte sich, um den Knopf zu lösen, um von sich wegzukommen, um ganz bei sich zu sein – um dadurch gleichsam über sich selbst hinauszuwachsen. Nun fing das Angefangene auf der Leinwand zu tanzen an – so als wolle es sich aus sich selbst heraus vollenden. Das wäre schön, dachte Aldo – ich schaue bloss noch zu und wundere mich. Wundere mich über den Selbstläufer, der mir die Arbeit abnimmt.
Aldo Ferrari hustete. Der Husten trieb ihm die Tränen aus den Augen – und er hatte Fieber. Seit Tagen, wenn nicht gar Wochen. Zeit war’s, sich abzukühlen. Im Bistro nebenan. Er schwankte hin. Aber in allem Zirkeln und Schwanken war er felsenfest davon überzeugt, aufrecht zu gehen. Am Tresen gab man ihm, was er immer zu trinken beliebte. Er rutschte auf den hohen Stuhl, winkte Bekannten zu, erwiderte Begrüssungen. Erika kam zu ihm, strich als Altbekannte mit der Hand über seinen Oberschenkel. Ach, war das schön! Weißt du noch, Erika, wie wir … Ja, natürlich … Aber die Zeiten ändern sich – und wir werden alt. Nein, lallte er, du bist immer jünger als ich. Beide lachten. – Du hast einen roten Kopf, Aldo! Ist dir nicht gut? Doch, doch, du siehst doch, wie gut mir ist – neben dir! Ich wünsche mir, lallte er, du kämst mit und lägst bei mir die ganze Nacht. Ein Bild habe ich angefangen, du musst es sehen! Fertig ist es noch nicht, aber es wird dir gefallen …
Erika legte den Arm um seine Schulter und stammelte Beschwichtigendes. Ihr war, Aldo wolle vom Stuhl kippen, aber nicht, weil er zuviel getrunken hatte. Etwas anderes spielte hier ein ernsthaftes Spiel. Nein, das Bild muss ich nicht vollenden, brummelte Aldo – aber du kommst gleichwohl zu mir heute Nacht.
Aldo Ferrari war nicht mehr in der Lage, ihre Antwort zu vernehmen. Aber eine Weile lebte der Traum in ihm weiter, er sei in ihren Armen eingeschlafen.
Die falsche Richtung
Es fing damit an, dass er in die Strassenbahn Nummer neun stieg, sich nach dem Erreichen des Bahnhofs aber in eine andere Richtung fahren sah, als er erwartet hatte. Weiter nicht schlimm, dachte er, an der nächsten Station steige ich aus und gehe dorthin, wo ich hin will. Doch das Rätsel blieb: War die Strassenbahn auf einer Irrfahrt – oder habe ich mich getäuscht? Nur zu gerne schob er den Fehler den Städtischen Verkehrsbetrieben zu. Es konnte doch nicht sein, dass alles Vertraute und Eingeübte ins Wanken kam und ihm ein X für ein U vormachte. Mit seinen zweiundsiebzig Jahren war er doch noch Herr seiner selbst. Freilich wusste er von andern, die, jünger noch, bereits in vielerlei Hinsicht die Orientierung verloren hatten.
Aber er war sich sicher: Ich bin in die Nummer neun eingestiegen. Zumal – und diese Gewissheit kam ihm zu Hilfe – auf dieser Linie nur die Nummer neun verkehrte. Er erinnerte sich, nur flüchtig auf das Schild hingeschaut zu haben, das die Nummer der Strassenbahn trug und, in weiter Ferne, die Endstation ankündigte. Weshalb um alles in der Welt bog die Strassenbahn am Hirschengraben nach rechts ab? Mit der Nummer drei fuhr er gewöhnlich zum Arzt.
Er warf sich vor, beim Aussteigen aus der Nummer neun nicht nochmals auf das Schild geschaut zu haben, was freilich die Überzeugung, am Viktoriaplatz in eben diese Nummer eingestiegen zu sein, nicht im geringsten erschüttert hätte. Zunächst erledigte er seine Geschäfte, die im Abholen eines Formulars auf der Steuerbehörde bestanden – dann ging er weiter in die andere Richtung, wo er bald zu einer Tramstation kam, an der wiederum nur die Nummer neun verkehrte.
Er überlegte, ob er, zu seiner Entlastung, sogleich im Büro der Städtischen Verkehrsbetriebe vorbeischauen sollte, um sich zu erkundigen, ob vielleicht vor kurzem, ja, vor einer halben Stunde, auf der Linie Nummer neun womöglich eine andere Zahl … Er hätte sich erleichtert und glücklich geschätzt, wenn die Panne dem Betrieb anzulasten wäre – und seine Ungewissheit über das eigene Fehlverhalten sich in Luft auflöste.
Unterwegs schaute er auf die Anzeigetafeln der Strassenbahnen – die Nummer neun kam ihm entgegen; richtig so. Weiter oben zweigte die Drei ab. Auch richtig. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn sich vor seinen Augen ein Durcheinander abgespielt hätte und alle Trams mit den richtigen Nummern die falschen Linien befahren würden. Wäre ringsum alles falsch … Er schmunzelte, kam sich richtig gescheit vor. Fest setzte er Fuss vor Fuss, guckte in Schaufensterauslagen, betrachtete Plakate und Litfasssäulen, schaute auch den Frauen nach oder ihnen entgegen. Alles war wie immer. An ihm selbst konnte es nicht liegen. Die Abweichung von der Norm schuldeten andere. Sein Blick war klar, die Schritte gingen nicht fehl.