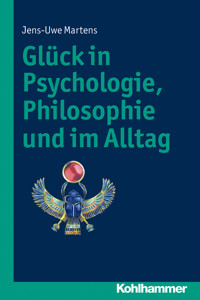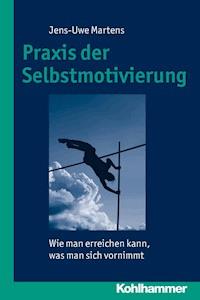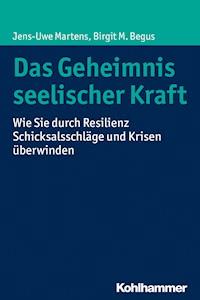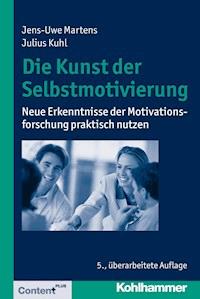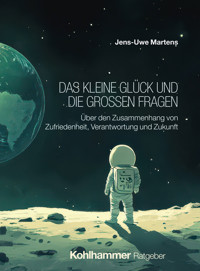
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Glück ist mehr als ein angenehmes Gefühl. Es beeinflusst unsere Gesundheit, unser Denken und unser Miteinander. Wissenschaftliche Studien zeigen: Zufriedene Menschen sind gesünder, empathischer und kreativer. Doch warum fällt es vielen so schwer, glücklich zu sein? Warum scheint unsere Gesellschaft trotz Wohlstand oft von Unzufriedenheit geprägt? Dr. Jens-Uwe Martens setzt sich mit diesen Fragen auseinander und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Erfahrungen. Er zeigt, welche Faktoren unser Glück beeinflussen, welche Hindernisse uns im Weg stehen - und wie wir sie überwinden können. - Wie beeinflusst Glück unser Denken, unsere Entscheidungen und unseren Umgang mit Krisen? - Welche Hindernisse stehen einem erfüllten Leben im Weg und wie können wir sie überwinden? - Warum haben wir nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, glücklich zu sein? Mit inspirierenden Denkanstößen, fundierten Studien, lebensnahen Beispielen und praktischen Impulsen lädt dieses Buch dazu ein, Glück nicht dem Zufall zu überlassen, sondern aktiv zu gestalten. Es zeigt, wie wir unser persönliches Wohlbefinden steigern und gleichzeitig zu einer besseren Gesellschaft beitragen können. "Wir sollten das Glück nicht länger als etwas betrachten, das uns widerfährt, sondern als eine Kunst, die wir erlernen können." Ein kluger und tiefgründiger Ratgeber für alle, die sich nicht nur mit Glück beschäftigen, sondern es bewusst in ihr Leben integrieren möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KOH_Schriftzug_schwarz.eps
Der Autor
Dr. Jens-Uwe Martens, Dipl.-Psychologe, leitet das 1967 von ihm gegründete Institut für wissenschaftliche Lehrmethoden (IWL) in München. Er war lange Zeit Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und an der Universität der Bundeswehr in München. Er ist heute als Buchautor, persönlicher Coach und Vortragender aktiv.
Korrespondenzanschrift des Autors:
Jens-Uwe Martens
Das kleine Glück und die großen Fragen
Über den Zusammenhang von Zufriedenheit, Verantwortung und Zukunft
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagabbildung: RizArt – stock.adobe.com
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045578-8
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045579-5
epub: ISBN 978-3-17-045580-1
Für meine Enkelkinder
Stephanie und Levi,
Nora, Julian und Caspar sowie
Róisin.
Möge ihnen ihr Leben gelingen.
Inhalt
Cover
Einführung
„Die Neunte“, die Freude und das Glück
Sind wir unseres Glückes Schmid?
Warum schreibe ich ein Buch zum Thema Glück?
Ist Glücklichsein ein Teil der Lösung unserer Probleme?
Ist unser Planet noch zu retten?
Ein kurzer Überblick über die aktuellen Probleme und Krisen
Ist eine Lösung der Krisen aus heutiger Sicht überhaupt denkbar?
Streben die Menschen denn nicht schon immer nach Glück?
Teil I – Zufriedenheit und Glück als wichtige Motivatoren für das Verhalten der Menschen
Was verstehen wir eigentlich unter „Glück“ oder „Glücklichsein“?
Ist das Glück ein „Geschenk des Himmels“?
Glück ist etwas sehr Individuelles
Es gibt nicht nur „glückliche Zeiten“!
Das Wesen des Glücks
Dauerglück oder Glücksmomente?
Was können wir dazu beitragen, glücklich zu werden?
Warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten?
Kann man Glücklichsein überhaupt lernen?
Grundbedingungen für die Fähigkeit, Glücklichsein zu lernen
Erfolg und Glück
Gibt es Glück ohne die gegensätzliche Erfahrung von Unglück?
Warum gelingt es so vielen Menschen nicht wirklich, glücklich zu sein?
Bemühen wir uns um die falschen Ziele?
Warum viele Menschen Glücklichsein vermeiden?
Viele Menschen haben Angst vor dem Glücklichsein
In welchem Verhalten zeigt sich die Angst vor dem Glücklichsein?
Weitere Hindernisse auf dem Weg glücklich zu sein
Sorgen, Angst, Unsicherheit, Trauer
Ärger, Wut, Hass und Aggression
Auch Rachegefühle machen unglücklich
Mangelnde Gesundheit
Negative innere Orientierung
Materielle Orientierung
Materialismus und Glück
Das Bruttonationalglück in Bhutan
Schicksalsschläge
Warum gelingt es denen, die glücklich sein wollen, nicht, ihr Ziel zu erreichen?
Selbstreflexion als Voraussetzung für das Glücklichsein?
Klugheit und Intelligenz als Voraussetzung glücklich zu sein?
Wir werden von unseren Gefühlen gesteuert (die PSI-Theorie)
Exkurs über das Selbstbild
Verteidigung des Selbstbildes
Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir glücklich sind
Glückliche Menschen sind die besseren Menschen, weil ihnen all ihre Ressourcen zur Verfügung stehen:
Glückliche Menschen sind gesünder:
Schülerinnen und Schüler, die sich wohl fühlen, lernen besser.
Glückliche und zufriedene Menschen sind weniger anfällig gegenüber Suchtverhalten
Glückliche und zufriedene Menschen sind hilfsbereiter, sozialer, empathischer
Glückliche Menschen sind kreativer und damit erfolgreicher
Glückliche Menschen sind weniger leicht manipulierbar
Kann man denn wirklich aktiv zu seinem Glück beitragen?
Teil II – Wege zum Glücklichsein
Physische Bedingungen
Wege zum Glücklichsein: Sinnliches Genießen
Glücksgefühle durch Bedürfnisbefriedigung
Richten wir unser Verhalten an unserer Vernunft oder unserer Lust aus?
Kann man Glücksmomente wie Briefmarken sammeln?
Wege zum Glücklichsein: Körperliche Bewegung, Sport treiben
Wege zum Glücklichsein: Schönheit erleben, Kunst genießen
Die Schönheit der Menschen
Soziale Beziehungen
Wege zum Glücklichsein: Freundschaften
Familie und Kinder
Wege zum Glücklichsein: Die Liebe
Definition und Formen der Liebe
Die auf den Partner gerichtete Liebe
Die romantische Form der Liebe
Die Unterscheidung von Liebe, Verliebtsein und Sex
Für die Liebe muss man etwas tun
Liebe ist eine Entscheidung
Verliebtsein, Sex und Liebe mit dem gleichen Partner?
Was sagt die medizinisch-biologische Forschung zu diesem Thema?
Was hat das alles für praktische Konsequenzen für die Partnerschaft?
Wege zum Glücklichsein: Anderen helfen, anderen Gutes tun, Empathie erleben
Wege zum Glücklichsein: Die Stellung in der Gesellschaft
Geistige Bedürfnisse befriedigen
Wege zum Glücklichsein: Dankbarkeit empfinden
Wege zum Glücklichsein: Verzeihen
Wege zum Glücklichsein: Sinn erleben
Wege zum Glücklichsein: Glaube, Spiritualität
Buddhismus und Meditation als Weg zum Glück?
Aufbau eines positiven Ich-Bewusstseins
Wege zum Glücklichsein: Aktiv sein, arbeiten
Seinem Beruf nachgehen
Freizeitaktivitäten
Fernsehen und Smartphones
Wege zum Glücklichsein: Flow erleben
Wege zum Glücklichsein: Sport treiben
Wege zum Glücklichsein: Erfolg haben, sich mit anderen vergleichen
Wege zum Glücklichsein: Neue Erkenntnisse haben, Geheimnisse entdecken, neugierig sein
Wege zum Glücklichsein: Die innere Bestimmung finden, lernen
Wege Zum Glücklichsein: Gestalter sein, Selbstwirksamkeit erleben
Gestaltergrundhaltung in Phasen des Unglücks
Können wir eine Gestaltergrundhaltung lernen?
Einüben der Gestaltergrundhaltung durch Askese und Beeinflussung von Gewohnheiten
Gestalterhaltung: Ziele haben und verfolgen
Wege zum Glücklichsein: Sein Selbstwertgefühl stärken
Wege zum Glück: Resilienz zeigen
Übergeordneter Glücksfaktor
Wege zum Glücklichsein: Die richtige Einstellung zum Leben finden
Wie kann man hinderliche Einstellungen ändern und Glück fördernde Einstellungen übernehmen?
Optimismus
Lachen, Humor zeigen
Teil III – Fazit
Zusammenfassung: Empfehlungen für ein glückliches Leben
Wie Sie mit den vier Hindernisse auf dem Weg zum Glück umgehen:
Um glücklich zu sein, müssen wir vier Mangelzustände berücksichtigen:
Welche der 21 Glücksfaktoren bevorzugen Sie?
Physische Bedingungen
Soziale Beziehungen
Geistige Bedürfnisse
Aufbau eines positiven Ich-Bewusstseins
Übergeordneter Aspekt
Schlussbetrachtung
Streben nach Glück und Egoismus
Glück und die Gesellschaft
Sie sind Ihres Glückes Schmied!
Teil IV – Anhang
Literatur
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Einführung
„Die Neunte“, die Freude und das Glück
In meiner Familie wurde ich früh mit klassischer Musik konfrontiert. So lernte ich auch die Neunte Symphonie von Beethoven kennen. Ich hörte sie zum ersten Mal im Alter von etwa 14 Jahren und ich war sofort begeistert. Meine Eltern hatten damals 1954 schon einen Plattenspieler, auf dem man Schelllackplatten abspielen konnte. Maximale Laufzeit einer Plattenseite: sechs Minuten. Für den Genuss klassischer Musik eigentlich völlig ungeeignet – von dem permanenten Rauschen ganz abgesehen. Trotzdem war mein größter Wunsch zu Weihnachten 1955 „die Neunte“ auf Schallplatten. Ich rechnete mir aus, wie oft ich die Platten wechseln musste, um die ganze, über eine Stunde dauernde Symphonie hören zu können.
Unter dem Weihnachtsbaum erwartete mich eine große Überraschung – ein unvergesslicher Moment des Glücks: Da lag für mich ein elektrischer Plattenspieler für Vinyl-Platten, den sogenannten Langspielplatten (LP). Ich wusste von dieser neuen Erfindung noch gar nichts. Die Laufzeit einer dieser neuen Platten betrug bis zu 30 Minuten pro Seite. Ich konnte den vierten Satz der Symphonie ohne Unterbrechung anhören!!![1]
Die „Ode an die Freude“, ein Gedicht von Schiller, das Beethoven in seiner letzten Symphonie vertont hat, konnte ich natürlich mitsingen:
Freude, schöner Götterfunken,Tochter aus Elisium,Wir betreten feuertrunken,Himmlische, dein Heiligthum.Deine Zauber binden wieder,Was die Mode streng getheilt,Alle Menschen werden Brüder,Wo dein sanfter Flügel weilt.
Obwohl ich den Text oft sang, habe ich damals nie über den Inhalt dieser Zeilen nachgedacht. Aber ich habe mich zu dieser Zeit in meinem Tagebuch gefragt, was das mit meinem Leben eigentlich soll? Warum war ich geboren, was sollte, was wollte ich auf diesem Planeten, wenn ich ihn doch nach ein paar Jahren wieder verlassen muss?
Diese Fragen haben mich sehr umgetrieben. Ich hatte damals niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Schließlich glaubte ich, für mich eine Antwort gefunden zu haben, und ich habe ihr eine Doppelseite meines Tagebuches gewidmet. In großen Lettern hielt ich fest:
Ich möchte glücklich werden!
Dass diese „Erkenntnis“ etwas mit der Ode an die Freunde zu tun haben könnte, ist mir damals nicht in den Sinn gekommen. Erst viele, viele Jahre später ist mir die inhaltliche Verwandtschaft aufgefallen. Ich bin heute überzeugt davon, dass mein Unbewusstes diesen Zusammenhang schon damals gesehen hat, dass ich hier zum ersten Mal eine besondere Fähigkeit der Menschen erfahren hatte: Wir können intuitiv Erkenntnisse haben und Zusammenhänge erkennen, deren Entstehen das bewusste Denken nicht erreichen. Das ist mir später noch öfter passiert und davon wird auch in diesem Buch zu berichten sein.
Heute, ca. sieben Jahrzehnte später, komme ich auf dieses Thema zurück: In diesem Buch möchte ich ausführen, dass durch Freude und Glücklichsein nicht nur „alle Menschen Brüder werden“. Ich werde auch auf andere Aussagen Schillers zurückkommen, die er in seiner „Ode an die Freude“ so meisterhaft in Worte fasst:[2]
→ Wie wichtig Freunde oder (Ehe-)Partner dabei sind:
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu seyn;
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
→ Wie wichtig der Glaube an einen Schöpfer ist:
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahndest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt,
über Sternen muss er wohnen.
→ Dass Freude und Glück einer der wichtigsten Motivatoren sind:
Freude heißt die starke Feder
in der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
in der großen Weltenuhr.
→ Dass Freude und Wohlbefinden die Kreativität der Forscher fördern:
Aus der Wahrheit Feuerspiegel
lächelt sie den Forscher an.
→ Dass Freude eine wichtige Quelle für die Überwindung von Rache, Groll, Vergeltung und Reue darstellt:
Groll und Rache sei vergessen,
unserm Todfeind sei verziehn.
Keine Thräne soll ihn pressen,
keine Reue nage ihn.
Unser Schuldbuch sei vernichtet!
ausgesöhnt die ganze Welt!
Auf diese schon in der „Ode“ angesprochenen Themen werde ich zurückkommen und sie durch viele positive Eigenschaften ergänzen, die sich durch Freude, Glück und Wohlbefinden verstärken oder vermehren lassen. Allerdings werde ich mich nicht auf Dichterahnungen verlassen, werde nicht nur die Denker und Poeten, die Philosophen und Schriftsteller zu Worte kommen lassen, sondern ich werde mich vor allem auf die empirische Wissenschaft stützen. Welche Wirkungen der Freunde und des Glücklichseins können durch wissenschaftlich kontrollierte Versuche untermauert oder sogar bewiesen werden? Sie werden überrascht sein, welche Wirkungen die im Herzen getragene, tief empfundene Freude und das Glück auf Körper und Seele, auf Einstellungen und Verhalten haben.
Aber ich werde hier auch untersuchen, warum diese Erkenntnis so selten umgesetzt wird, warum es so viele Menschen gibt, die Glück und Freude offensichtlich eher zu vermeiden suchen. Um ein Bild aus der Mythologie der indigenen Völker Nordamerikas zu verwenden: Wir haben zwei Seelen (in der Geschichte der indigenen Völker: zwei Wölfe) in uns. Der eine ist auf Sorgen, Probleme, Kummer und seine oft aggressive Abwehr spezialisiert, der andere sieht die Schönheit der Welt, sieht die Liebe und die Freude, die wir auf Erden erleben dürfen. Es kommt darauf an, welchen „Wolf wir füttern“, welcher Seele wir mehr Beachtung schenken. Wir haben es in der Hand, die „richtige“ Seele in den Vordergrund unseres Bewusstseins zu rücken und damit glücklich zu sein.
Sind wir unseres Glückes Schmid?
Viele Menschen, mit denen ich über dieses Buchprojekt gesprochen habe, sind sich sicher, dass ein glückliches, zufriedenes Leben etwas ist, dass man von seinem Schicksal oder einem höheren Wesen geschenkt bekommt, dass man „Glück haben muss“, um ein glückliches Leben zu führen. Doch Arthur Rubinstein, dieser bemerkenswerte Pianist und Denker, hat uns einen anderen Weg aufgezeigt: „Genieße das Leben, ohne Bedingungen zu stellen!“[3] Was für ein schöner Gedanke! Er erinnert uns daran, dass das Glück nicht in äußeren Umständen steckt, sondern in uns selbst – und genau das entspricht meiner Erfahrung.
Ich will damit nicht sagen, dass das Schicksal, in das man hineingeboren wird, dass die vielen glücklichen Umstände oder Schicksalsschläge keinen Einfluss auf das Glücksempfinden haben. Aber ich folge in diesem Punkt dem Zitat von Rubinstein und werde in diesem Buch aufzeigen, dass die zufälligen Umstände, denen wir im Leben begegnen, nur eine untergeordnete Rolle dabei spielen, wie wir das Leben empfinden.
Ich habe Menschen getroffen, die mit ihrem Verhalten mir und ihrer Umgebung vermittelten, dass sie ihr Leben genießen, oder die auf Befragen versicherten, dass sie glücklich sind, obwohl sie in Umständen lebten, die nicht dazu geeignet waren, Wohlbefinden, Erfüllung oder andere gute Gefühle auszulösen. Hier zwei Beispiele für solche Menschen:
In Kapstadt, Südafrika, habe ich ein Seminar für die Bewohner der riesigen Slums durchgeführt.
[4]
Dabei habe ich zwei dunkelhäutige, etwa 20-jährige Mädchen kennengelernt, die mit ihrer positiven, fröhlichen Stimmung die ganze Seminargruppe über mehrere Tage bei Laune gehalten haben. Ob die beiden Schwestern oder enge Freundinnen waren, habe ich sie nicht gefragt. Sie waren beide behindert, hatten wahrscheinlich Kinderlähmung durchgemacht und konnten nur mit Krücken gehen. Dunkelhäutig, behindert, in Slums großgeworden und lebend: und trotzdem glücklich, das konnte ich mir bisher nicht vorstellen.
Das zweite Beispiel kennen Sie vielleicht: Stephen Hawking. Der weltberühmte Astrophysiker, bei dem im Alter von 21 Jahren ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert wurde. Die Ärzte prophezeitem ihm damals, dass er in einigen Jahren keinen Muskel mehr bewegen könne und wenige Jahre später daran sterben werde. Mit der ersten Diagnose hatten die Ärzte Recht, mit der zweiten nicht. Als er erfuhr, dass sein Kopf nicht betroffen sein würde, verlegte er sich aufs Denken. Von 1979 bis 2009 war er Inhaber des renommierten Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge. Er lieferte bedeutende Arbeiten zur Kosmologie, zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu Schwarzen Löchern und wurde auch durch seine Bücher weltberühmt
[5]
.
Stephen Hawking behauptete in einem Interview 1993, dass er „heute glücklicher sei als vor seiner Krankheit“
[6]
.
Andererseits bin ich Multimillionären begegnet, die gesund sind, eine Familie haben, die sich alles leisten können und die trotzdem nicht nur keinen glücklichen Eindruck machten, sondern die es als eine Zumutung empfinden, wenn man sie ehrlich danach fragt, ob es ihnen gut geht. Ich werde hier keine konkreten Beispiele nennen. Ich würde Persönlichkeitsrechte verletzen. Die Betroffenen würden sich (zu Recht) beschweren. Auch Goethe war überzeugt: „Unser Herz allein macht unser Glück.“ Es ist fast so, als ob er uns zuruft, dass wir die Bedingungen für unser Glück selbst schaffen müssen. Das wahre Glück liegt in der Fähigkeit, unser Herz zu öffnen und das Leben in seiner Fülle zu genießen. In seinem Buch „Die Leiden des jungen Werthers“ schreibt Werther an seinen Freund Wilhelm:
„Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht so ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach so gewiss ist’s, dass unser Herz allein sein Glück macht.“[7]
Müssen wir also in unserem Leben nur vermeiden, ein Tor zu sein und unser Herz empfänglich machen?
Wir sollten das Glück nicht länger als etwas betrachten, das uns widerfährt, sondern als eine Kunst, die wir erlernen können. Lassen wir uns darauf ein – ohne Bedingungen, mit vollem Herzen! Vielleicht kann Ihnen dieses Buch dabei ein „Wegweiser“ sein.
Warum schreibe ich ein Buch zum Thema Glück?
Ich wäre heute nicht so glücklich, wenn ich gestern nicht so unglücklich gewesen wäre.
Heinrich Pestalozzi[8]
Der „Todestrieb“[9] über den Freud schreibt, sollte man in Beziehung setzen zu seinem bösartigen Tumor im Gaumen. Das moralische Konzept von Kant[10] sollte man auf dem Hintergrund seiner Lebensumstände und seiner Disziplin sehen. Die Aphorismen von Nietzsche sollte man im Zusammenhang mit seiner Erkrankung interpretieren.[11] Jedes psychologische und philosophische Konzept, das sich auf das Leben oder diese Welt bezieht, ist auch von der individuellen Lebensgeschichte des Autors abhängig und kann auch nur bezogen auf diese Geschichte vollständig verstanden und beurteilt werden.
Das heißt nicht, dass die Konzepte der erwähnten Autoren „nur“ subjektiv und damit falsch bzw. auf das eigene Leben nicht anwendbar seien. Man sollte sich aber der Entstehungsgeschichte bewusst sein und sie bei der Beantwortung der Frage berücksichtigen, in welchem Ausmaß die Ausführungen für einen persönlich relevant sein könnten.
Auch meine intensive Beschäftigung mit dem Thema Glücklichsein hat mit meinem Schicksal zu tun. Zwar habe ich mich natürlich nach Kräften bemüht, in diesem Buch objektiv zu sein und Erkenntnisse zum Thema Glück darzustellen, die von meiner subjektiven Sichtweise unabhängig sind, aber sie bleiben subjektiv.
Meine persönlichen Erlebnisse, die ich in dieses Buch immer wieder einstreue, sollen das Dargestellte konkreter, nacherlebbarer machen. Ich wünschte mir, dass Sie sich in dem einen oder anderen Erlebnis wiederfinden, dass Sie meine Schlüsse nachempfinden und auf Ihr eigenes Leben beziehen können. So könnte ich vielleicht dazu beitragen, dass Ihr eigenes Leben in dem einen oder anderen Punkt glücklicher und zufriedener wird.
Das ist auch der Grund, warum ich mit meiner Lebensgeschichte beginne, denn ohne Zweifel hat sie etwas damit zu tun, dass ich dem „Glücklichsein“ einen so hohen Stellenwert einräume – und wie alle Geschichten, die ich hier erzähle, offenbart sie uns einiges über das Glücklichsein, über Zufriedenheit und Freude.
Mein persönlicher Weg zu den Theorien des Glücks:
Mit dem Thema Glück beschäftige ich mich inzwischen seit über 70 (!) Jahren.
In meiner frühen Jugend, an meinem siebten Geburtstag litt ich an immer schlimmer werdenden Schmerzen in der linken Hüfte. Ich humpelte nur noch. 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, suchten meine Eltern mit mir zahlreiche Ärzte auf, bis wir schließlich auf Professor Max Lange in Bad Tölz trafen. Er war international anerkannt und als einziger überzeugt, eine Diagnose stellen zu können: „Knochentuberkulose“. Diese Diagnose stellte sich später als zu pessimistisch heraus; tatsächlich litt ich an einer weniger schweren Krankheit: an einer Hüftgelenksentzündung.
Die Therapie bestand damals (in beiden Fällen) darin, dass man das betroffene Bein ruhigstellte. Ich musste über Monate in seiner Klinik den ganzen Tag im Bett liegen, wobei ein Gewicht über Rollen am Bettende an meinem linken Bein zog, um so die Hüfte zu entlasten.
Ich hatte keine Schmerzen, aber ich durfte und konnte mich fast nicht bewegen. Bad Tölz war von unserem Wohnort München etwa 60 Kilometer entfernt. Meine Eltern hatten 1947 kein Auto und die Züge waren meist überfüllt, so dass auch der versprochene, wöchentliche Besuch meiner Mutter nicht immer möglich war. Ich war sehr einsam, langweilte mich den ganzen Tag über Wochen und Monate. Ich konnte mich nur mit mir selbst, mit meinen Gedanken beschäftigen.
Es gab zu meiner Unterhaltung kein Radio, das Fernsehen war noch nicht verbreitet. Als einziges Spielzeug hatte ich drei Puzzle, die alle drei auf meinem Nachtisch Platz hatten und die ich immer zusammensetzte, wenn ich meine Mutter erwartete – und ich war bitter enttäuscht, wenn mir die Schwester die Nachricht brachte, dass meine Mutter nicht kommen konnte, da sie – mal wieder – nicht in den überfüllten Zug hineingekommen war. Ich weinte mich an solchen Tagen in den Schlaf.
Die Bedingungen in dem Krankenhaus waren mit heutigen Kliniken nicht zu vergleichen. Das Bett war entsetzlich unbequem und es viel mir immer wieder schwer, eine erträgliche Lage zu finden, in der trotzdem mein linkes Bein in der richtigen Stellung war, um mit den Gewichten entlastet zu werden. Ich durfte auch nicht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Ich brauchte immer die Hilfe einer Schwester und es war mir sehr peinlich, wenn „etwas“ neben der Bettpfanne landete. Das Essen widerstand mir oft. Ich wusste als Kind noch nicht, was ein Würgereiz ist und klagte daher immer über Halsschmerzen – aber man fand natürlich keine Entzündung in meinem Hals. Viel später kam meine Mutter auf die Idee, dass ich keine Halsschmerzen hatte, sondern mir nur einfach schlecht war.
Bei einer der vielen Untersuchungen lernte ich einen jungen Soldaten kennen, der im Krieg an seinem rechten Arm verletzt wurde. Eine Kugel hatte den Knochen in seinem Oberarm zerfetzt. Professor Lange hatte ihm versprochen, dass er seinen Arm retten könnte, indem er Knochen aus dem Oberschenkel in den Arm transplantieren würde. Michael, so hieß der junge Mann, konnte sich im Krankenhaus frei bewegen und besuchte mich – wenn auch aus meiner Sicht viel zu selten – an meinem Krankenbett. Wir wurden Freunde, obwohl er mit seinen fast zwanzig Jahren viel älter war als ich.
Michael musste mehrfach operiert werden. Die Operationen misslangen immer wieder. Ich hoffte und litt mit ihm bei jedem Eingriff. Ich weiß noch, dass er vor einer erneuten Operation, dem letzten Versuch entsetzliche Angst hatte. Er wusste, wenn auch diese misslänge, müsste sein rechter Arm amputiert werden. Seine Angst übertrug sich auf mich. Auch ich hatte Angst davor, operiert zu werden, obwohl das nie zur Diskussion stand.
Nachdem auch diese Operation von Michael fehlgeschlagen war, beging er Suizid. Er stürzte sich vom obersten Stockwerk in den Hof der Klinik, wobei er sich vorher noch die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Ich erlebte einen ersten für mich schrecklichen Verlust.
Ich erzähle das hier so ausführlich, um deutlich zu machen, dass ich schon als Kind erfahren habe, was es heißt, unglücklich zu sein. Ich habe extreme Langeweile, Trauer und letztlich auch Existenzangst in einem Alter kennengelernt, in dem man solche Gefühle nur schwer verarbeiten kann. Das war wohl auch der Grund, warum für mich einige Jahre später, als ich schon gesund war und in die Pubertät kam, auf die mir selbst gestellte Frage, was ich mir auf dieser Welt wünsche, wie erwähnt antwortete: Ich wollte glücklich werden.
Ich habe das Bild dieses Tagebucheintrags noch heute ganz konkret vor Augen, obwohl ich das Tagebuch schon lange nicht mehr besitze.
Ich hatte also in meiner Kindheit und Jugend keine sehr guten Startbedingungen und heute, viele Jahrzehnte später ist mir klar, dass davon natürlich mein späteres Leben wesentlich beeinfluss wurde. Als Psychologe frage ich mich heute, ob solche Kindheitserfahrungen den Betroffenen oder die Betroffene empfänglicher für Glück, für Glücksempfindungen, für Glücksmomente macht, oder ob man dadurch eher abgestumpft wird.
Dieses Thema erscheint in unserer Zeit besonders aktuell, wenn man daran denkt, wie viele Kinder von Flüchtlingen in Lagern unter schrecklichen, traumatisierenden Bedingungen heranwachsen.
Unsere Vergangenheit prägt uns. Mich hat meine Vergangenheit dazu gebracht, entgegen vielen Widerstände, mich nicht nur mit dem Thema Glück zu befassen, sondern sogar als Legastheniker Bücher zu schreiben. Handelt es sich um eine „Trotzhandlung“?
„Wenn mir Weisheit angeboten würde unter der Bedingung, dass ich Stillschweigen darüber bewahren müsse und sie niemandem weitergeben dürfe, würde ich diese Weisheit ablehnen. Es liegt keine Freude darin, etwas zu besitzen, was man nicht weitergeben kann.[12]“
Diese Aussage stammt von Seneca, einem Philosophen, einem Zeitgenossen von Christus, der in Rom lebte und „der meistgelesene Schriftsteller seiner Zeit“ war (Wikipedia). Sie entspricht heute meiner inneren Einstellung und meiner Motivation, bei allem, was ich tue, seit ich aus meinen persönlichen Schwierigkeiten einigermaßen erfolgreich herausgefunden habe.
Aber ich war nicht immer voller Tatendrang. Sicher kennen auch Sie Zeiten, in denen keine Zuversicht mehr in Sicht ist, in denen Sie das Gefühl haben, einem negativen Schicksal, negativen politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen ausgeliefert zu sein. In solchen Zeiten scheinen nur negative Artikel aus der Zeitung oder aus den Nachrichten im Fernsehen oder im Radio im Vordergrund zu stehen.
Ich habe mich ein langes Leben mit solchen Stimmungen auseinandergesetzt, habe sie in mir und in den Berichten anderer, die wissenschaftlich untersucht wurden, gesammelt. Ich habe einen Weg gefunden und jahrelang ausgetestet, wie man damit erfolgreich umgehen kann. Dieses Buch stellt die Quintessenz dieser jahrzehntelangen Studien dar.
Manchmal machen positive Beispiele Mut. Können Ihnen meine Erfahrungen oder die Erfahrungen anderer, über die ich in diesem Buch berichte, helfen?
Ich werde die These vertreten, dass wir nicht nur das Recht haben, nach diesen positiven Gefühlen zu streben, sondern die Pflicht. Denn wir sind „bessere“ Menschen, wenn wir uns gut fühlen. Aber ich werden nicht nur die Forderung aussprechen, dass Sie nach Glücklichsein und Zufriedenheit streben sollten, sondern ich werde auch beschreiben, wie Ihnen das gelingen kann – selbst, wenn die Umstände nicht immer „glücklich“ sind.
Daraus ergeben sich für dieses Buch die folgenden Fragen, auf die ich im Detail eingehen werde:
Warum gibt es so viele Menschen, die diese Pflicht, glücklich zu sein, nicht erkennen oder nicht erfüllen wollen?
Welche Probleme stellen sich uns, die wir als glückliche Menschen besser lösen können?
Warum ist „Glücklichsein“ überhaupt so wichtig? Was macht dieses Gefühl mit uns? Warum haben wir die Plicht, uns um dieses Gefühl zu bemühen?
Und schließlich die wichtigste Frage: Was können wir im Einzelnen ganz konkret dazu tun, damit wir mehr Glücksgefühle erleben und sich unser Leben insgesamt glücklicher anfühlt und wir auf diese Weise das Unsere zum Wohlergehen des Planeten beitragen können?
Ist Glücklichsein ein Teil der Lösung unserer Probleme?
Welche Probleme stellen sich den Menschen in unserer Zeit? Können wir sie eher lösen, wenn wir unsere Pflicht, glücklich zu sein, ernst nehmen?
Ist unser Planet noch zu retten?
Vor kurzem bin ich einem kleinen Witz begegnet, der sich besonders eignet, in dieses Kapitel einzuführen:
Es treffen sich zwei Planeten im Weltall. Sie sind sich vor Jahrmillionen das letzte Mal begegnet und freuen sich über das unverhoffte Wiedersehen.
„Wie geht es dir?“ fragt der eine Planet.
„Ach nicht so gut!“ erhält er von dem anderen Planeten zur Antwort.
„Was ist denn los? Du machst wirklich keinen glücklichen Eindruck.“
„Ich habe die Menschen!“, antwortet der Planet Erde.
„Ach mach dir nichts draus. Die hatte ich auch. Das Problem löst sich von selbst. Du musst nur etwas Geduld haben. Das vergeht wieder!“
Wenn die Geschichte nicht so traurig wäre, könnte man darüber schmunzeln. Sind wir nicht wirklich auf dem Weg, unseren Planeten Erde immer „menschenfeindlicher“ zu machen, die Daseinsgrundlagen, die dieser Planet uns in so vielfältiger und wunderbarer Form zur Verfügung stellt, selbst zu zerstören?
Ein kurzer Überblick über die aktuellen Probleme und Krisen
Die Menschheit steht vor bisher nie gekannten Herausforderungen. Zwar hat das Verständnis von den Zusammenhängen, wie es zu diesen Krisen gekommen ist, in den letzten Jahrzehnten sehr zugenommen, aber die notwendigen Veränderungen im Umgang mit unserem Planeten werden nicht in dem notwendigen Umfang praktiziert.
Ich bin überzeugt, dass die Menschheit dann, wenn sie gemeinsam all ihre Kräfte auf die Lösung dieser Probleme konzentrieren würde, diese lösen könnten. Wir müssten „nur“ eine neue Sichtweise von den „Gefahren“ entwickeln, denen wir gegenüberstehen. Unsere Gegner sind nicht die anderen Menschen, die anderen Ideen oder Ideologien, sondern unsere „Gegner“ sind die globalen Probleme unseres Planeten:
der kurzfristige Egoismus des Einzelnen oder einiger Gruppen,
die begrenzten Ressourcen unseres Planeten,
die unterschiedlichen politischen Systeme und die Bereitschaft, zur Durchsetzung der eigenen „berechtigten“ Interessen Kriege zu inszenieren, sowie
der Klimawandel und aus den beiden letzten ergeben sich
die Migration ganzer Völker in andere Länder.
[13]
Ich lege diesem Buch eine optimistische These zugrunde:
Alle Probleme des Planeten Erde könnten langfristig gelöst werden, wenn wir alle Ressourcen und unsere ganze Kreativität auf die Lösung dieser richten würden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass es uns gelingt, wirklich alle (oder zumindest eine große Mehrheit der) Menschen auf diesem Planeten glücklich und zufrieden zu machen, dann könnten wir uns auch auf die Lösung der „wirklichen“, der existentiellen Probleme unserer Zeit konzentrieren.
Warum komme ich auf diese, auf den ersten Blick absurde Schlussfolgerung, dass ein Gefühl, das Gefühl von Freude und Glück, uns helfen könnte?
Ist eine Lösung der Krisen aus heutiger Sicht überhaupt denkbar?
Ich bin kein Universalwissenschaftler und habe mich zu wenig mit den Details der hier aufgezählten Probleme beschäftigt, aber aus meiner Sicht gibt es für alle Krisen, in denen sich der Planet Erde befindet, eine Lösung, die ich im Folgenden kurz andeuten möchte. Allerdings setzt das voraus, dass man die finanziellen Möglichkeiten und die kreative Intelligenz der Völker dieser Erde auf die Lösung dieser Probleme ausrichtet.
Der kurzfristige Egoismus des Einzelnen oder einiger Gruppen:
Wir wissen heute, dass – vereinfacht ausgedrückt – Menschen vor allem dann dazu neigen, ihre Motivation nur auf ihre eigenen Interessen auszurichten, ohne auf die langfristigen Folgen ihres Verhaltens zu achten, wenn sie Angst haben, wenn sie Stress erleben. In dem Moment, in dem es gelänge, diese Ängste auszuschalten oder zumindest von den Mächtigen nicht mehr instrumentalisieren zu lassen, würde auch dieser kurzfristige Egoismus weitgehend verschwinden.
Die begrenzten Ressourcen unseres Planeten:
Die schwindenden Ressourcen sind vor allen deshalb ein Problem, weil der wachsende Konsum weltweit das Ziel der Wirtschaft ist. Zufriedenheit und Glück kann man auch mit einfachen Mitteln ohne Maximierung des Konsums erreichen – wie ich in diesem Buch aufzeigen werde.
Die unterschiedlichen politischen Systeme und die Bereitschaft, zur Durchsetzung der eigenen „berechtigten“ Interessen Kriege zu inszenieren:
Wieder vereinfacht dargestellt, kann man feststellen, dass es bei kriegerischen Auseinandersetzungen letztlich um Macht geht. Einzelne Menschen oder Menschengruppen sind der Überzeugung, dass sie nur dann „angemessen“ überleben können, wenn sie möglichst viel Macht besitzen. Auch hier spielt Angst, Not oder Neid eine entscheidende Rolle, die aber verschwinden, wenn alle Betroffenen wirklich glücklich und zufrieden sind.
Der Klimawandel:
Auch in diesem Punkt scheint ein „vernünftiges“ Handeln der Schlüssel zur Lösung des Problems oder der Folgen dieses Problems zu sein. Auch hier ist ein Umdenken dringend erforderlich. Wir müssen uns bewusst sein, dass es sich bei dem Klimawandel um ein globales Problem handelt, von dem wir alle direkt oder indirekt betroffen sind. Wir müssen dringend Kompromisse finden, die von allen Beteiligten akzeptiert werden.
Die Migration ganzer Bevölkerungsteile in andere Länder:
Wenn wir akzeptieren könnten, dass alle Menschen auf dieser Erde es verdient haben, zu überleben und ein menschenwürdiges Dasein zu führen, dann könnten wir ihnen diesen Wunsch erfüllen. Wir dürften nur keine Angst mehr haben, dass andere Völker uns „entfremden“, oder gar „versklaven“. Wenn wir einen Weg für die Entwicklung unseres Planeten finden, bei dem man auf „Verteidigungsausgaben“ weitgehend verzichten kann, hätten wir genügen Mittel frei, um allen ein menschenwürdiges Dasein zu gewährleisten. Wenn alle glücklich sind, brauchen wir keine Angst mehr vor „den Fremden“ zu haben und auch keine immensen Verteidigungsausgaben.
Ich gebe zu, dass die hier skizzierten Lösungen für die Krisen unsere Zeit heute nicht in Sicht sind und auch nicht bis zuletzt durchdacht. Andererseits halte ich sie auch nicht für völlig unrealistisch. Nach dem zweiten Weltkrieg hat die allgemeine Bedrohungslage dazu geführt, dass man übernationale Institutionen geschaffen hat, die die Konflikte zwischen den Völkern und Nationen friedlich regeln sollten. Im Mittelpunkt stehen hier die Vereinten Nationen. Leider ist man bei der Konstruktion dieser übernationalen Institutionen, wie z. B. auch der internationale Gerichtshof in Den Haag, nicht weit genug gegangen. Man hat ihre Möglichkeiten durch Vetorechte sehr eingeschränkt und ihnen keine Macht zugestanden, ihre Entscheidungen durchzusetzen.
Vielleicht verdichten sich die oben angesprochenen Krisen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder zu einer „allgemeinen Bedrohungslage“, die die Motivation liefert, wirklich mächtige, international orientierte Institutionen zu schaffen, die die Beschlüsse auch gegen die Interessen einzelner durchsetzen können. Das liefe auf eine Art „Welt-Schiedsrichter“ oder sogar „Weltregierung“ hinaus. Dann wären wahrscheinlich auch die oben angesprochenen und die noch nicht erwähnten Probleme dieses Planeten lösbar.
Nach meiner Überzeugung kann das aber nur gelingen, wenn alle, oder die überwiegende Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten, glücklich und zufrieden sind. Wenn Neid und Missgunst, Rache, Hass und Angst durch Toleranz und die Überzeugung ersetzt sind, dass wir alle glücklich sein könnten. Wir müssten uns nur gemeinsam darum bemühen, dass jeder sein Auskommen haben kann und schließlich, dass alle (oder die Mehrheit) glücklich sein könnte.
Streben die Menschen denn nicht schon immer nach Glück?
Meine Forderung, dass alle Menschen glücklich sein sollten, ist nicht neu! Schon seit Jahrtausenden wollen das alle Menschen?! Warum gibt es kaum Fortschritte in diesem Bereich?
Als ich mich in meinen frühen Jahren als Teenager so unglücklich fühlte und nach dem Sinn und Zweck meines Daseins suchte, empfahl mir mein Lateinlehrer, mich mit den alten Philosophen aus Griechenland zu beschäftigen. Die hätten schon damals die gleichen Probleme gehabt und einen Weg gefunden, der auch mir helfen könne.
Ich beschäftigte mich also u. a. mit Aristoteles (384–322 v. Chr.), dem wahrscheinlich bekanntesten und einflussreichsten Naturforscher und Philosophen der westlichen Welt. Er behauptete schon damals, dass es das letzte, das eigentliche Ziel aller Menschen sei, glücklich zu sein[14], darin liege „der Sinn es menschlichen Daseins“.
Ich fühlte mich auf einmal verstanden (und natürlich aufgewertet). Meinen Freunden erschien ich damals (gelinde gesagt) etwas merkwürdig. Sie interessierten sich mehr für Fußballspielen und Mädchen. Mir aber wurde auf einmal klar, dass sich solche Fragen, wie die nach dem Sinn des Lebens oder wie man glücklich werden kann, schon andere und zwar sehr bedeutende Menschen gestellt haben.
Diese Ansicht, dass es das eigentliche Ziel aller Menschen ist, glücklich zu sein, übernahm auch eine berühmte philosophische Schule, die ihren Ausgangspunkt in Griechenland hatte, sich aber auch nach Rom verbreitete: die „Stoa“. Einer ihrer berühmtesten Vertreter ist Seneca (1–65), der Lehrer des berüchtigten Kaisers Nero war.
Von ihm ist folgender Text zum Glücklichsein überliefert:
„Glückselig zu leben … wünschen alle, aber um zu durchschauen, was es sei, wodurch ein glückseliges Leben bewirkt werde, dazu sind sie zu blödsichtig. Und zu einem glückseligen Leben zu gelangen, ist eine so gar nicht leichte Sache …!“[15]
Man kann sich darüber streiten, ob wirklich „alle“, oder die Mehrheit zu „blödsichtig“ sind, um zu erkennen, wie man glücklich werden kann, aber unbestritten ist, dass es „gar keine so leichte Sache ist“. Wir werden in diesem Buch versuchen, es zu einer, wenn auch nicht leichten, so doch von allen nachvollziehbaren und umsetzbaren „Sache“ zu machen.
Aber die Auseinandersetzung mit dem Streben nach Glück ist noch viel älter. Einer der ersten, von dem überliefert ist, dass das Streben nach Glück in allen Menschen zu finden ist, war der chinesische Weise Laotse, der oft auch als Gott verehrt wurde. Er hat schon 600 Jahre vor Chr. gelehrt: „Es gehört schon eine Menge Mut dazu, schlicht und einfach zu erklären, dass der Zweck des Lebens ist, sich seiner zu erfreuen.“
Sogar Denker der Neuzeit, wie z. B. Alain[16], waren der Meinung, dass es „auf allen Schulen Unterricht in der Kunst glücklich zu sein geben müsste“. Bekannt wurde er durch sein Buch „Die Pflicht glücklich zu sein“.
Ich habe hier nur einige wenige berühmte Denker zitiert, die die Bedeutung des Glücklichseins herausgestellt haben. Natürlich gibt es viele mehr bis hin zu Hollywoodgrößen wie Audrey Hepburn. Mir kam es darauf an, aufzuzeigen, dass es keiner egoistischen Laune entspricht, wenn man behauptet, dass man glücklich sein will. Es gibt also schon lange die Überzeugung, z. B. der Stoa, dass alle glücklich sein könnten und sollten; ebenso sind sich eine große Zahl dieser Autoren sicher, dass dieses Ziel durch entsprechendes Handeln bzw. durch Unterweisung erreichbar ist.
Wenn man sich umsieht, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass offensichtlich viel Menschen dieses Ziel nicht teilen. Zumindest verhalten sich viele so, als wollten sie unbedingt und dauerhaft unglücklich sein. Bevor wir aber näher darstellen, woran wir diese Behauptung fest machen und wie man diese Tendenz erklären kann, wollen wir näher auf den Begriff Glück bzw. Glücklichsein eingehen.
Teil I – Zufriedenheit und Glück als wichtige Motivatoren für das Verhalten der Menschen
Ich wende mich damit dem Thema Glücklichsein zu, denn darin sehe ich den Kern der Lösung der meisten Probleme unseres Landes und unseres Planeten. Um es etwas plakativ zu formulieren: Wenn Hitler und die Menschen um ihn herum sowie die Mehrzahl der Deutschen rundherum glücklich gewesen wären, hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben.
Was verstehen wir eigentlich unter „Glück“ oder „Glücklichsein“?
Glück ist dauerndes Sich-behaglich-fühlen.
Robert Walser[17]
Glück ist ein inflationär gebrauchter Begriff. Es gibt zigtausend Bücher zu diesem Thema. Der Begriff wird in diesen sehr unterschiedlich gebraucht.
Persönliches Glück wird für dieses Buch sehr umfassend definiert. Ich fasse unter diesem Begriff jede Art von positiven Gefühlen zusammen. Der Begriff Glück oder Glücklichsein wird hier weitgehend gleichgesetzt mit den Begriffen (subjektives) Wohlbefinden, Wohlsein, Wohlergehen, wohlige Gefühle erleben, Freude empfinden, (Lebens-)Zufriedenheit, Erfüllung, Stressfreiheit, Eudämonie, Freude, Sorglosigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung genießen. Glücklichsein, Glück erleben bedeutet in diesem Buch in seiner Summe auch: Ein gelungenes Leben führen. Das Glücklichsein, wie es in diesem Buch verstanden wird, erlebt man auch, wenn man sich im vollen Sinn des Wortes „lebendig“ fühlt. All diese Bedeutungen haben viel damit zu tun, dass wir in engem Kontakt zu unserem Selbst stehen.[18] (Der Begriff wird aber abgegrenzt von dem Gebrauch des Begriffes Glück in „Glück gehabt“[19].)
Was für mich (auch) Glück bedeutet, wird aus dem folgenden eindringlichen Erlebnis deutlich:
Ich erkenne mein Lebensziel
Wenige Jahre nach meinem 30. Geburtstag wurde bei meinem Vater ein inoperabler Lungenkrebs entdeckt. Damals haben die Ärzte es den Angehörigen überlassen, ob sie dem Patienten die Diagnose mitteilen wollten. Meine Familie entschied sich (gegen mein Votum), ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Aber das war kein Problem, denn mein Vater wusste auch ohne diese Diagnose der Ärzte, wie es um ihn stand. Bei einem der vielen Spaziergänge im Park seines Sanatoriums gestand er mir: „Ich weiß, das ist meine letzte Krankheit!“ Aber er sagte das ohne Bitterkeit, sehr gefasst. Er blickte auf sein sehr reiches, erfülltes Leben zurück: Er war als Sohn eines Großbauern zur Welt gekommen, hatte aber auf sein Erbe verzichtet. Er wollte lieber studieren. Er war Soldat in beiden Weltkriegen, hatte zusammen mit seiner Frau fünf Kinder großgezogen und ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut.
Während wir so zusammen durch den Park schlenderten, meinte er: „Ich kann mich nicht beklagen. Mein Schicksal meinte es gut mit mir und ich denke, ich habe alles gut gerichtet. Ich kann mit gutem Gefühl abtreten. Du und deine Geschwister seid auf einem guten Weg und ich weiß, eure Mutter ist bei euch Kindern in guten Händen.“
Auf einmal wusste ich, was man damit meint, wenn man sich wünscht, ein „erfülltes“ Leben zu führen. In diesem Moment kannte ich mein Lebensziel. Ich wünschte mir ebenso zu fühlen, wenn ich einmal am Ende meines Lebens angekommen bin. – Wenige Tage nach diesem Gespräch wurden wir informiert, dass mein Vater am Morgen nicht mehr aufgewacht war. Er hatte ein friedliches Ende gefunden.
Wenn ich hier davon schreibe, dass es unser Ziel sein sollte, ein glückliches Leben zu führen, dann meine ich keines, das jahraus jahrein aus Party, fröhlichem Zusammensein mit Freunden und ununterbrochenem Hochgefühl besteht. Ich meine keines, bei dem man immer auf der Jagd nach Augenblicken ist, die man in den Sozialen Medien posten kann und für die man möglichst viele „Likes“ erntet. Ich meine eher ein „gelungenes“ Leben, so wie es mein Vater in seinen letzten Tagen rückblickend erlebt hat.
Robert Walser spricht in dem oben erwähnten Zitat von einem „dauernden Sich-behaglich-Fühlen“. Ich glaube, dass selbst dieses Ziel in einem Leben hier auf Erden nicht erreichbar ist. Das Leben ist ohne Zweifel für alle von uns eine mehr oder weniger schwierige und oft beschwerliche Aufgabe. Die Aufgabe „sein Leben zu meistern“ ist nicht für alle gleich schwer. Es gibt auch keinen objektiven Maßstab, nach dem man beurteilen kann, ob ein Leben gelungen ist oder nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Glücklichsein heißt auch, ein Leben zu führen, in dem die positiven Gefühle im Vordergrund stehen. Was das im Einzelnen heißen und wie das gelingen kann – auch dann, wenn das Schicksal schwierige Aufgaben für einen vorgesehen hat – werde ich in diesem Buch im Detail darlegen.
Ist das Glück ein „Geschenk des Himmels“?
Abgrenzen möchte ich mich hier von den esoterischen Glückspropheten, die Glück als ein vom Himmel oder übersinnlichen Kräften herrührendes Phänomen betrachten, das man mit „wishful thinking“, mit „positiven Gedanken“, oder mit Gebeten herbeiführen kann.
Es geht auch nicht um billige Glücksversprechen, die behaupten, durch spezielle Entspannungsübungen, positives Denken, der Gefolgschaft einer Religion oder Sekte usw. würde man dauerhaftes Glück erreichen. Es geht hier um die Darstellung von empirisch abgesicherten, d. h. wissenschaftlich untersuchten und bestätigten Regeln, die die Entstehung guter Gefühle und die Auswirkungen solcher Gefühle auf unseren Körper, auf das Verhalten und auf die Gesellschaft darstellen. Die Quelle der Erkenntnisse ist daher primär die empirische Psychologie und Soziologie, wenn auch häufiger Philosophen zitiert werden, da schon die Denker einer längst vergangenen Zeit viele Regeln für ein glückliches Leben erkannt und beschrieben haben, noch bevor man daran ging, solche Regeln einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen.
Glück ist etwas sehr Individuelles
Es gibt nicht nur sehr viele Begriffe, die eine positive Stimmungslage kennzeichnen, es gibt auch viele verschiedene Formen von Glück. Das Glück des einen ist nicht unbedingt auch das Glück des anderen. Glücksempfinden ist so subjektiv wie alle anderen Gefühle auch. Der Weg zu diesem positiven Gefühl fällt daher auch ganz verschieden aus. Jeder muss seinen eigenen, individuellen Weg finden.
Positive Gefühle werden so unterschiedlich empfunden und beschrieben, dass man hier nur von einem diffusen Begriff „Glück“ ausgehen kann. Allerdings ist es wohl auch nicht nötig, die verschiedenen Bedeutungen dieses Begriffes gegenseitig abzugrenzen. Die Auswirkungen, die diese positiven Gefühle haben, sind bei allen einzelnen Formen von Glück weitgehend gleich.
Es gibt nicht nur „glückliche Zeiten“!
In turbulenten Zeiten, wenn das Schicksal uns wieder einmal herausfordert, wenn die Befürchtungen um unsere Gesundheit und die notwendigen Arztbesuche nicht aus unserem Kopf weichen möchten, wenn die Sorge um den Job und die Ungewissheit, wo das Geld für die nächste Miete herkommt, nicht schlafen lässt, wenn wir unter Konflikten mit unserer Umgebung leiden und die ganze Last der Ungerechtigkeit dieser Welt zu tragen glauben, dann stellt sich die Frage, was Glück sei, nicht mehr. Glück ist in einem solchen Augenblick nur Befreiung von Sorgen, nur Unbeschwertheit und Ruhe.
Das Leben ist kein sorgenfreier Spaziergang. Für niemanden! Das Leben ist eine Wanderung durch manchmal sehr unwegsames Gelände, mit steilen Bergen und tiefen Schluchten, in die wir abzustürzen drohen, mit rauem, unbarmherzigem Wetter, mit Regen, den der Sturm in unser Gesicht peitscht, aber auch mit viel Sonnenschein und lieblichen Wiesen, mit Bänken, die eine herrliche Aussicht bieten, auf denen wir wieder Kraft schöpfen können.
Das Leben ist wie die Reise des Odysseus in der Odyssee. Es ist voller Hindernisse und mit beinahe unlösbaren Problemen gespickt. Aber jede dieser unerwünschten, ärgerlichen oder sogar schrecklichen Herausforderungen auf unserem Weg macht uns reicher, führt dazu, der zu werden, als der wir wohl gedacht sind. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen, wir dürfen sie nicht vermeiden oder beseitigen, indem wir den Kopf in den Sand stecken, oder – wie es in der Psychologie heißt – verdrängen. Unser Leben ist also für viele vergleichbar mit dieser Odyssee des Odysseus „ein Weg der Weisheit, mühselig und höchst verschlungen, doch sein Ziel immerhin ist absolut klar: Es geht darum, zum guten Leben zu gelangen, indem man das sterbliche Schicksal akzeptiert, das jedem Menschen eigen ist.“[20]
Ich habe es ausprobiert und bin der Überzeugung, dass ein solches Leben möglich ist und dass wir das unsere dazu beitragen können, dass es uns schließlich „gelingt“. Dazu soll dieses Buch ein Wegweiser sein.
Das Wesen des Glücks
Glücklich zu sein, hängt von uns selbst ab.
Aristoteles[21]
Folgt man Aristoteles[22], kann man zwei Formen des Glücks unterscheiden:
das hedonistische Glück (Hedonismus), das Wohlfühlglück, und
das eudämonistische Glück (Eudämonia), das Werteglück.
Das hedonistische Glück (Wohlfühlglück) erlebt man, wenn man das Leben genießt. Es stellt sich ein, wenn man sich etwas gönnt, z. B. Essen und Trinken genießt, sich massieren lässt, ein schönes Konzert hört, Sex hat, aber auch einen schönen praktischen Gegenstand kauft usw. Hedonismus bezeichnet eine lust- und genussorientierte Lebensführung. Wer sein Leben an diesen angenehmen Empfindungen ausrichtet, strebt nach einem schönen, leichten und freudvollem Leben.
Im Unterschied zum hedonistischen Glück fokussiert man beim eudämonistischen Glück (Werteglück) nicht auf angenehme Sinneswahrnehmungen. Aristoteles bezeichnet damit ein Glück, das sich auf Werte, auf Einstellungen bezieht. Man erlebt diese Form des Glücks, wenn man positive Gefühle aus dem Erreichen eines Zieles, oder auch dem Streben nach solchen Zielen erlebt; wenn man das Engagement in Projekten oder die Hilfe, die man anderen angedeihen lässt, positiv erlebt; ebenso, wenn man etwas Wertvolles unterstützt, das einem am Herzen liegt. Auch die „Arbeit an sich selbst“, etwas neues lernen, sich optimieren, kann ein solcher Wert sein. Für Viele liegt das höchst Glück darin, sich als Gestalter ihres Lebens und vielleicht der Welt zu erleben und dabei positiven Werten mehr Bedeutung zu verschaffen. Jemand dem es gelingt, sein Leben am eudämonistischen Glück (Werteglück) zu orientieren, führt ein zielorientiertes, erfüllendes, tief befriedigendes und glückliches Leben.
Diese beiden Formen des Glücks sind keine Gegensätze, Aristoteles so wie auch seine Nachfolger, die Stoiker, schätzten beide Formen und ein gelungenes Leben besteht in einer Balance zwischen beiden Glücksarten.
Menschen, die sich zu sehr oder sogar ausschließlich am eudämonistischen Glück (Werteglück) orientieren, schauen oft verächtlich auf die „nur an sinnlichen Genüssen ausgerichteten Kollegen“ herab und beklagen, dass unsere Welt verkommt, weil diese die „wahren Werte“ missachten. Die Gefahr für die nur am Werteglück orientierten Menschen liegt darin, dass sie sich nicht oder schwer fallen lassen können, dass sie den Augenblick nicht genießen können, da sie immer auf Ziele hin orientiert sind. Ihnen fehlt die „Leichtigkeit des Seins“.
Ein vollkommenes Glück ist eine Mischung aus „sein Leben genießen“ (Hedonismus) und „im Einklang mit seinen Werten leben“ (Eudämonismus).
Letztlich geht es darum, sich selbst, sein „Selbst“ zu leben, sich „zur Geburt zu verhelfen“. Wenn man von der Freud’schen Dreiteilung in Es, Ich und Überich ausgeht, so kann man den Hedonismus mehr der Befriedigung der Bedürfnisse des Es zuordnen, während der Eudämonismus sich vor allem auf die Realisierung der Werte bezieht, die man im Laufe seiner Entwicklung im Überich gespeichert hat. Beides in Einklang zu bringen ist eine Leistung des Ich.