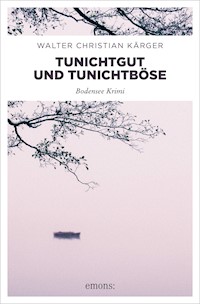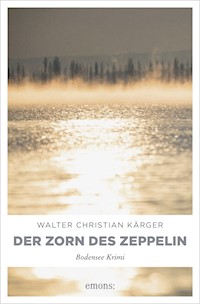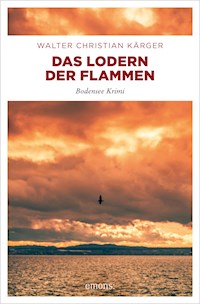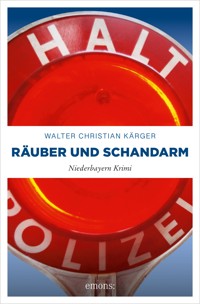Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Schnörkellos, packend, vielschichtig – ein Thriller, der es in sich hat. Winterliche Beschaulichkeit am Bodensee? Fehlanzeige! Ein skrupelloser Auftragskiller zieht eine blutige Spur durch die Region. Kommissar Max Madlener und seine Assistentin Harriet Holtby sind dem Mörder dicht auf den Fersen, doch er scheint ihnen stets einen Schritt voraus. Die Situation verschärft sich, als sich die lästigen Kollegen vom LKA einschalten. Eine gnadenlose Hetzjagd beginnt . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/BY
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-282-3
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Gabriele F. und ihre Engelsgeduld.Und für Edith P., meine erste Kritikerin.
Through long December nights we talk in words of rain or snow,while you, through chattering teeth, reply and curse us as you go.Why not spare a thought this day for those who have no flameto warm their bones at Christmas time?Say Jack Frost and the Hooded Crow.
Aus: »Jack Frost and the Hooded Crow« von Ian Anderson (Jethro Tull)
I knew a girl who tried to walk across the lake,course it was winter when all this was ice.That’s a hell of a thing to do, you know.They say the lake is as big as the ocean.I wonder if she knew about it?
Aus: »Walking on Thin Ice« von Yoko Ono
1
Ende November, an einem bitterkalten Mittwochnachmittag gegen zwölf Uhr zwanzig, gleich nach Schulschluss, wagte sich die zehnjährige Sigrun Leitner, im Freundeskreis nur »Sissi« genannt, trotz der Warnungen und Ermahnungen ihrer Eltern zusammen mit ihrer besten Freundin bei Bad Schachen auf das Eis, das sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten schon so ungewöhnlich früh an einigen Rändern des Bodensees gebildet hatte und auf die beiden Mädchen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte. Ihre Schulsachen hatten sie auf einer Bank abgelegt und tasteten sich erst einmal übervorsichtig die ersten Zentimeter hinaus auf den See, um herauszufinden, ob das Eis sie schon trug. Nach drei oder vier Schritten auf dem knirschenden und geheimnisvoll knisternden Untergrund verloren die beiden Mädchen allmählich ihre anfängliche Scheu und wagten sich immer weiter hinaus, weil es dort noch glatter und aufregender war. Sie kicherten ausgelassen, und jedes wollte dem anderen zeigen, dass es mit einem kleinen Anlauf noch weiter rutschen konnte.
Die Sicht war nicht besonders gut, schwere Nebelschwaden verhängten den Horizont wie ein Theatervorhang.
Zwei Krähen beendeten ihr krächzendes Gezänk und ließen sich in der kahlen Baumkrone einer Ulme nieder, neugierig auf das, was sich vor ihren schwarzen Augen abspielte.
Außer den beiden Mädchen war nur ein einsamer Spaziergänger mit Lodenmantel und tief ins Gesicht gezogenem Trachtenhut am verschneiten Uferweg unterwegs, mit seinem Hund, der hechelnd unermüdlich ein Stöckchen apportierte, das sein Herrchen für ihn immer wieder wegschleudern musste. Während der Hund erneut dem Stöckchen hinterherjagte, sah der Mann die bunten Schulranzen der zwei Mädchen und dann nach einem suchenden Blick die Mädchen selbst, die sich in ihrem Übermut selbstvergessen immer weiter auf die Eisfläche hinauswagten.
»He!«, rief er ihnen zu, so laut er konnte. »He, ihr zwei da – kommt sofort vom Eis runter! Das hält nicht da draußen!«
Die beiden Mädchen reagierten nicht.
Im Gegenteil – sie gerieten immer noch weiter hinaus.
Der Mann achtete nicht mehr auf seinen Hund, der das Stöckchen wieder vor seinen Füßen fallen gelassen hatte und ihn auffordernd anbellte, sondern machte ein paar Schritte durch den knirschenden Schnee auf den Rand der Eisfläche zu, winkte und schrie erneut: »Hallo! Ihr zwei da! Kommt auf der Stelle zurück!«
Sigrun hatte gerade einen unbezwingbaren Lachkrampf, weil ihre Freundin ausgerutscht war und sich unsanft auf ihren Hosenboden gesetzt hatte, und konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, so lustig fand sie das.
Am Ufer schrie ein Mann ihnen irgendetwas zu und fuchtelte herum, aber beide Mädchen waren so in ihr hitziges Spiel vertieft, dass sie immer noch nichts davon mitbekamen oder mitbekommen wollten. Plötzlich gab es einen unheilvollen Ton im Eis, es klang, als ob ein armdickes Stahlseil gerissen wäre. Gleichzeitig bildeten sich in Sekundenbruchteilen Risse im Eis, und Sigrun fuhr der Schreck in alle Glieder. Sie wollte eben noch ihre Freundin packen und mit sich von der zersplitternden Gefahrenstelle wegziehen, da war es auch schon zu spät: Das Eis brach auf einen Schlag unter ihren Füßen weg, und sie versackten bis zu den Schultern im schwarzen Wasser.
Der Mann am Ufer hörte ihre gellenden Schreie und sah, wie die zwei Mädchen verzweifelt um sich schlugen und vollends unterzugehen drohten.
Er überlegte nicht lang, schlüpfte hastig aus seinem Mantel, ließ ihn zu Boden fallen und rannte unter dem hysterischen Gekläffe seines Hundes, der lieber bei seinem Stöckchen blieb, auf die Eisfläche und auf die beiden Mädchen zu. Nach ein paar Schritten schon brach er bis zu den Knien ein, trotzdem mühte er sich weiter, obwohl er gegen die Eisschollen ankämpfen musste und das Wasser eiskalt war, aber er hatte wenigstens noch festen Grund unter den Füßen, weil das Wasser im Uferbereich flach war.
Eine Frau, die ein kugeldick vermummtes Kind auf einem Schlitten hinter sich herzog, tauchte aus dem Nebel auf und erfasste mit einem Blick die gefährliche Situation. Sofort griff sie zu ihrem Handy und setzte einen Notruf ab.
Draußen auf dem See schlugen die Mädchen in wilder Panik um sich, japsten nach Luft und drohten den letzten Halt an einer abbröckelnden Eiskante zu verlieren.
»Hilfe!«, konnte Sigrun gerade noch schreien. »Hil…«, bevor sie, indem sie sich in Todesangst an ihre Freundin klammerte, mit ihr zusammen unterging.
Der Mann, dem das Wasser inzwischen bis zur Brust reichte, verdoppelte seine Anstrengungen und warf sich mit einem letzten, verzweifelten Hechtsprung auf die Stelle, an der die beiden Mädchen ein aufgewühltes Wasserloch im Eis hinterlassen hatten. Wasser und Eisbrocken spritzten auf, als der schwere Körper des Mannes dort eintauchte.
Die Frau mit dem Kind auf dem Schlitten war wie erstarrt stehen geblieben und beobachtete entsetzt, dass von den dreien, die im Loch mitten in der Eisfläche verschwunden waren, niemand mehr auftauchte. Das schwarze Wasser schwappte sprudelnd hin und her, Luftblasen stiegen auf, und dann waren da nur noch das Loch im Eis und eine lähmende Stille, als ob sich Watte auf alles im Umkreis eines Steinwurfs gelegt hätte.
Allein der Trachtenhut des Mannes kreiselte lustig mit seiner kecken blauschwarzen Eichelhäherfeder am Hutband auf der Wasseroberfläche.
Sogar der Hund hatte aufgehört zu kläffen und starrte auf den See hinaus, wo Nebelbänke waberten und sein Herrchen mit den zwei Kindern verschwunden war. Er ließ ein leises Winseln hören.
Es war, als hätte jemand die Zeit angehalten und die ganze Welt wäre gleichsam zu Eis erstarrt.
Das Einzige, das anzeigte, dass es nicht so war, waren die weißen Atemwolken, die aus den Nasen und Mündern derjenigen kamen, die regungslos am Ufer standen und warteten, dass etwas passierte, um den bösen Zauberbann zu brechen – die drei unfreiwilligen Zuschauer, die Frau, das Kind und der Hund. Die zwei Krähen in der Ulme hatten genug gesehen, flogen auf und flatterten unter lautem Gekrächze davon.
Die Zeit schien sich zu dehnen, bis schließlich, als man schon nicht mehr damit rechnen konnte, der Mann aus dem Wasser schoss und sich mit den zwei Mädchen, die er am Kragen gepackt hatte, in jeder Hand eines, auf das Ufer zuschleppte. Er stolperte und strauchelte fast, fing sich im letzten Moment wieder und schaffte es tatsächlich, die beiden Mädchen hinter sich herzuziehen, bis er das Ufer erreichte und dort zusammenbrach, die nach Luft schnappenden und spuckenden Mädchen links und rechts neben sich. Dampf stieg von ihren klatschnassen Körpern in der eisigen Kälte auf.
Vorsichtig näherte sich der Hund seinem Herrchen und leckte über dessen Gesicht.
Das schien seine Lebensgeister wieder zu wecken. Während er sich mühsam in die Höhe stemmte, konnte sich auch die Frau aus ihrer Starre lösen, lief heran und kniete sich zu den beiden Mädchen nieder. Das Wasser in ihren Haaren bildete schon Eiskristalle, sie waren leichenblass, spuckten und wimmerten – aber sie lebten.
In der Ferne waren Sirenen zu hören, die schnell näher kamen.
2
In den Tagen darauf war das Foto des Retters in allen Zeitungen, regional und überregional. Es war ein miserables Bild – anscheinend gab es nur eines –, aber es zeigte den Moment, in dem sich die Eltern von Sigrun und ihrer Freundin persönlich bei ihm mit einem großen Blumenstrauß bedankten. Er lag in einem Krankenbett und lächelte händeschüttelnd nicht sehr glücklich in die Kamera.
Wie der Bildunterschrift zu entnehmen war, hieß der gute Samariter André Maiser und musste noch einen Tag zur Beobachtung im Klinikum bleiben, bevor er wieder entlassen werden sollte. Genauso wie die beiden Mädchen, denen er das Leben gerettet hatte; auch sie hatten glücklicherweise bis auf eine Unterkühlung keine weiteren Schäden davongetragen.
Über André Maiser erfuhr der Leser nicht mehr, als dass er zurückgezogen lebte, eine kleine Kunstgalerie in Lindau sein Eigen nannte und dass sein Hund, ein Husky, Toto hieß und für die Zeit ohne Herrchen im Tierheim untergebracht worden war.
Ein Foto des Hundes, das fast so groß war wie das seines Herrchens im Krankenbett, war am Ende des Artikels. Toto schaute mit einem treuherzigen Hundeblick in die Kamera, der steinerweichend war und mehrere Leser der Lokalzeitung umgehend dazu veranlasste, spontan beim »Südkurier« anzurufen, um anzubieten, den Hund bei sich und ihrer Familie aufzunehmen.
3
Sich einen Generalschlüssel für die Suiten im Hotel »Bayerischer Hof« im Herzen Münchens am Promenadeplatz zu verschaffen war eine seiner leichtesten Übungen. Die Putzkolonnen, die im Akkord die Zimmer und Suiten schnellstens wieder auf Hochglanz bringen mussten, waren so auf ihre Arbeit konzentriert, dass ihnen gar nicht auffiel, wie ihnen in einem unbeobachteten Augenblick eine der Chipkarten abgeluchst wurde.
Die Orientierung im riesigen und unübersichtlichen Grandhotel fiel ihm nicht schwer, er hatte Grundriss und Stockwerke vorher genau im Internet studiert und sich schon seit zwei Tagen unter dem Namen Sven Söderberg in einer Juniorsuite einquartiert, um als unauffälliger Gast alle Treppenhäuser, Flure, Fluchtwege und die grandiose Dachterrasse mit dem Panoramablick über die bayerische Landeshauptstadt abchecken zu können. Die spektakuläre Aussicht auf die Stadtsilhouette und die Zwillingstürme der Frauenkirche im Vordergrund interessierte ihn nicht, wichtig war nur, dass er sich einen allgemeinen Überblick über den gesamten Hotelkomplex verschaffte, das konnte im Fall eines schnellen Rückzugs überlebenswichtig sein.
Er betrat die Cosmopolitan-Suite erst, als er ganz sicher war, dass sie für den gegenwärtigen Gast, einen levantinischen Waffenhändler undurchsichtiger Herkunft namens Konstantin Sokratis, der geschäftlich in der Stadt unterwegs war, fertig präpariert war und er nicht unliebsam von einem Zimmermädchen überrascht werden konnte.
Sanft ließ er die Tür hinter sich ins Schloss gleiten und begann, sich die Räumlichkeiten und jede Einzelheit genau einzuprägen. Bei seiner Inspektion der mit scharlachroten Tapeten ausgestatteten Zimmer, an deren Wänden gefakte Gemälde hingen, die Renaissancebilder von Hofdamen im modernen Stil interpretierten, achtete er sorgfältig darauf, nur ja nichts zu verändern. Mit dem Berühren war das eine andere Sache. Er war ein haptischer Mensch und musste geradezu zwanghaft über den opulenten Blumenstrauß in der teuren Vase streichen oder über die Zweitausend-Euro-Maßanzüge, die im Kleiderschrank fein säuberlich aufgereiht waren – er konnte einfach nicht anders. Aber zu diesem und dem eigentlichen Zweck seines heimlichen Eindringens in die fremden Wohnräume hatte er Vinylhandschuhe an, um keinerlei Spuren zu hinterlassen. Das war die Grundvoraussetzung für seinen Job, den er ausübte, solange er denken konnte.
Söderberg war ein Auftragskiller, obwohl er sich selbst nie so tituliert hätte. Er fühlte sich als selbstständig agierender Geschäftsmann, der von seinem Agenten ein Dossier ausgehändigt bekam und danach gegen entsprechende Bezahlung auf das Konto einer Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands eine spezielle Transaktion ausführte, exakt und zuverlässig, um dann wieder spurlos zu verschwinden. Die Transaktion bestand darin, die im Dossier aufgeführte Person vom Leben zum Tode zu befördern.
Er war gut in seinem Job.
Der Beste.
Aber er war alt geworden. Und müde. Nicht mehr so schnell wie früher. Das konnte in seinem Metier fatale Folgen haben. Ein Fehler und er wurde geschnappt. Oder noch schlimmer: Ein Fehler und er wurde von seinem Auftraggeber zum Abschuss freigegeben.
Das eine wie das andere glich einem Todesurteil.
An manchen Abenden, wenn alles getan war, was für die erfolgreiche Durchführung seines Auftrags erledigt werden musste, saß er einfach nur da und starrte in seinem Hotelzimmer vor sich hin. Dann träumte er davon, all das hinter sich zu lassen, womit er die letzten fünfundzwanzig Jahre seine Brötchen verdient hatte. Er hatte eigentlich genug Geld gemacht und zurückgelegt. Es reichte für einen Lebensabend in angenehmer, warmer Umgebung und ohne finanzielle Sorgen. Er hatte sich die halbe Welt angesehen und sich dabei lange überlegt, wo er sich einmal niederlassen sollte, wenn er in den wohlverdienten Ruhestand ging. Thailand war lange Zeit eine Option gewesen, Marokko ebenfalls, die Mittelmeerküste der Türkei. Er hatte auch mit Costa Rica geliebäugelt, mit Belize, mit Aruba, mit der Dominikanischen Republik. Er konnte sich theoretisch alles leisten, war nicht auf die örtliche Mafia angewiesen, weil er sein Geld hätte waschen müssen; er konnte nicht verraten oder erpresst werden, weil niemand auch nur ahnte, wie er zu seinem Vermögen gekommen war. Sein Geld war sauber, nicht zurückverfolgbar, niemand kannte seine wahre Identität, und er war nie mit seinem richtigen Namen auf irgendeiner Fahndungsliste gewesen.
Aber wenn er eines nicht ertragen konnte, dann war es hohe Luftfeuchtigkeit und tropische Hitze. Wärme im Winter, das ja. In Thailand war es im Winter sommerlich. Doch wenn er zum Beispiel an all die trostlosen Horrorgeschichten dachte, die er über deutsche Rentner in Thailand gelesen hatte, die sich am Ende ihrer Tage für ihr Geld von irgendwelchen Frauen pflegen lassen mussten, deren Sprache und Kultur sie nicht verstanden, bis sie endlich das Zeitliche segneten, dann wurde ihm speiübel.
Nein, er hatte sich letztendlich für ein Refugium in Südfrankreich entschieden, auf der Insel Porquerolles bei Hyères. Dort sah es im Sommer aus wie in der Karibik. Nur dass er in Europa war. Und er sprach perfekt Französisch. Ein ehemaliges Fischerhäuschen, zu Wohnzwecken umgebaut und mit allem ausgestattet, was das Leben angenehm machte. Mit einem Privatsteg, an dem sein kleines Segelboot vertäut lag. Eine Haushälterin kümmerte sich um alles, sie war gleichzeitig seine Geliebte. Keine Schönheit wie aus dem Modemagazin, aber sie war immer für ihn da, wenn er sie brauchte. Er zahlte ihr ein gutes monatliches Gehalt, damit sie das Haus in Schuss hielt, auf ihn wartete und keine Fragen stellte. Das perfekte Zuhause. Schade nur, dass er so selten da war. Aber das würde sich ändern.
Noch dieser eine Auftrag – und dann war Schluss. Für immer.
Obwohl – ein allerletzter Job konnte nicht schaden. Wenn es sich gerade so ergab. Nur um ganz sicherzugehen, dass es für seinen Lebensabend reichte. Frauen waren anspruchsvolle Wesen, und er wollte alles tun, um Madeleine glücklich zu sehen. Denn nur dann, wenn sie glücklich war, würde er es auch sein. Wenn er die Augen schloss, konnte er Madeleine neben seinem Boot am Anlegesteg im Gegenlicht der provenzalischen Sonne sehen, wie sie ihm zulächelte.
Also doch noch ein weiterer Job nach diesem.
Wenn ihm das Angebot nicht gefiel, konnte er immer noch Nein sagen.
Je nach Bedarf ließ er sein Werk wie einen tödlichen Unfall aussehen oder wie einen Suizid, bei entsprechender Order war er aber auch bereit und in der Lage, den Mord nicht zu vertuschen, sondern ihn ungeschminkt als solchen wie auf einer Bühne des Schreckens zu präsentieren. Gelegentlich war eine entsprechende Ausführung als Abschreckungsmaßnahme sogar ausdrücklich erwünscht, um etwa säumige Schuldner oder potenzielle Verräter oder Whistleblower mit einer dramatischen, aber wirkungsvollen Geste daran zu erinnern, dass es ihnen genauso ergehen könnte, wenn sie nicht spurten.
Die Planung, Vorbereitung und Durchführung seiner Arbeit berührte ihn nicht im Geringsten – wenn er im Arbeitsmodus war, funktionierte er wie ein Schweizer Uhrwerk und ohne jegliche Emotion. Eines jedoch war unumgänglich: Er musste wissen, warum seine Zielperson ihr Leben durch ihn verlieren würde, wozu er den Todesengel spielte. Nicht weil er moralische Skrupel hatte, so etwas kannte er nicht. Sondern weil er, bevor er zur Tat schritt, alles wissen musste, was es über diese Person zu wissen gab. Um perfekt zu sein. Um die Tat auf eine Stufe zu heben, die sie zum Kunstwerk machte. Das Warum interessierte ihn dabei nur zur persönlichen Motivation, das Wie war es, worauf es wirklich ankam. Und natürlich der reibungslose Abgang vom Tatort, den er hinterlassen hatte.
Schwieriger war es, wenn er die Anweisung bekam, jemanden spurlos verschwinden zu lassen. Auch diese Variante gehörte in sein Repertoire. Aber das war hier nicht der Fall. Konstantin Sokratis’ gewaltsamer Tod sollte als warnendes Beispiel dafür herhalten, was einem zustoßen konnte, wenn man sich in gewissen Kreisen nicht an bestimmte Regeln und Abmachungen hielt. An ihm musste ein Exempel statuiert werden, das war die Aufgabe von Söderberg im Hotel »Bayerischer Hof«.
Er blickte auf seine Uhr: Es blieb ihm noch genügend Zeit, und er konzentrierte sich darauf, wie er vorgehen würde. Er musste das Überraschungsmoment nutzen, weil sein Auftrag beinhaltete, dass er nicht mit einer Schusswaffe vorgehen durfte. Die Umstände von Sokratis’ Hinrichtung sollten für diejenigen, für die sie inszeniert wurden, ein eindeutiges Menetekel sein, ein Zeichen dafür, wer dahinterstand.
Er fühlte nach der Garotte, einem stabilen Drahtseil mit selbst gefertigten Holzgriffen an den Enden. Ein Mordwerkzeug, das insbesondere von Killern der Cosa Nostra schon im 19. Jahrhundert benutzt worden und dessen Anwendung ein einziger überdeutlicher Fingerzeig war, mit wem man sich besser nicht anlegen sollte.
Den Umgang damit hatte er oft genug geübt, trotzdem konnte es unnötige Komplikationen geben, wenn der erste Zugriff nicht perfekt saß.
Er wusste, dass die zuständige Hausdame den letzten Zimmercheck schon durchgeführt hatte, was für Zimmer dieser Luxuskategorie zum Standard gehörte. Kein Stäubchen durfte sich auf den Marmoroberflächen befinden, den Glastischen oder den Spiegeln, jeder Quadratzentimeter des Teppichbodens musste aufs Penibelste gesaugt worden sein. Aber darauf war das geschulte Hauspersonal spezialisiert. In dieser Kategorie waren zudem zusätzliche Sonder- und Extrawünsche obligatorisch, die anspruchsvollen Gäste konnten selbstverständlich davon ausgehen, dass diese während ihrer Abwesenheit auch bis ins Kleinste so ausgeführt wurden, wie es dem astronomischen Preisniveau des Hauses angemessen war.
Söderberg war beeindruckt, die Zimmermädchen hatten tatsächlich perfekte Arbeit geleistet.
Er konnte das beurteilen – bevor und während er sich erste Meriten in seiner jetzigen Branche verdiente, war er als Hoteltester unterwegs gewesen, so wie ein Restaurantkritiker anonym für den Guide Michelin die gehobene Gastronomie heimsuchte und kontrollierte, ob sie hielt, was sie versprach. Die Bettwäsche war frisch gefaltet und geglättet, die Kopfkissen geradezu kunstvoll drapiert, das Bad makellos, die flauschigen Handtücher ganz nach Wunsch des Gastes in doppelter Anzahl deponiert.
Er schnüffelte gern noch ein bisschen herum, um ein Gefühl für den bevorstehenden Akt der Gewalt und Grausamkeit zu bekommen, irgendwie erregte ihn das.
Im Kühlschrank standen drei Flaschen SPA-Mineralwasser aus Belgien, zwei Flaschen Tonic Water von Schweppes und eine Flasche Absolut Vodka sowie im Tiefkühlfach Eiswürfel in Kugelformen.
Sven Söderberg sah sich bestätigt: Eiswürfel mit Ecken und Kanten konnte Sokratis nicht ausstehen. Söderberg wusste bestens selbst über die skurrilsten Eigenheiten seiner Zielpersonen Bescheid, er hatte sie genauestens studiert und sein potenzielles Opfer wenn nötig tagelang observiert, seit er den Auftrag mit Fotos, Lebenslauf, Daten und Bedingungen übermittelt bekommen hatte.
Wie immer in Hotels machte er sich einen Spaß daraus, in alte Verhaltensmuster zu fallen und die Arbeit der Zimmermädchen und der Hausdame zu überprüfen, sofern die Zeit es erlaubte. Sein Opfer würde erst in einer Stunde eintreffen. Er war schon in so vielen Hotels gewesen, dass er genau wusste, wo normalerweise geschlampt wurde. Aber hier war wirklich alles tipptopp. Sogar in den kritischen Zonen hinter dem Bidet und unter den Matratzen war kein Härchen oder der geringste Schmutz zu finden.
Er wusste nicht, warum er das nachprüfte, aber es war eine Manie von ihm aus seinem früheren Leben, die er einfach nicht lassen konnte. So wie die Tatsache, dass er sich tagsüber dutzendfach die Hände waschen musste. Eine Zwangsneurose, die ihm durchaus bewusst war, die er sich aber einfach nicht abgewöhnen konnte.
Nach seinem Rundgang blieb er stehen und starrte durch das Fenster im Schlafzimmer ins Nichts. Sven Söderberg war nicht sein richtiger Name, er hieß auch nicht Flavio Rizzitelli oder Bertram Verhaag, aber er hatte Pässe auf diese und noch andere Namen. Im »Bayerischen Hof« hatte er als Sven Söderberg aus Malmö eingecheckt. Identität und Nationalität wechselte er je nach Bedarf, so wie es eben angebracht war, wenn er in einer heiklen Mission unterwegs war.
Er holte die Garotte aus seiner Tasche und überprüfte sie, indem er sie spannte und gegen das Licht hielt. Der Draht war eine Klaviersaite, und wenn sie erst einmal von hinten um den Hals eines Menschen geschlungen worden war, von einem skrupellosen und entschlossenen Attentäter, der kräftig und lange genug zuzog, war sie mit absoluter Sicherheit tödlich.
Gerade überlegte er, wo in der Suite die geeignete Stelle für den Zugriff war, als er ein Klicken vernahm.
Jemand öffnete die Tür zur Suite und kam herein. Die Tür wurde wieder ins Schloss gedrückt.
Söderberg fluchte innerlich – seine Zielperson war anscheinend eher zurück, als er kalkuliert hatte. Verdammt, jetzt musste er improvisieren. Nichts hasste er mehr als das. Er trat hinter den Vorhang, machte seine Garotte scharf, indem er die Holzgriffe mit der rechten und der linken Hand packte und mit der Klaviersaite eine große Schlinge bildete. Dann spannte er die Muskeln an.
Der Duft eines teuren Aftershaves stieg ihm in die Nase. Sein eigenes hatte er an diesem Tag absichtlich weggelassen, aus der professionellen Erwägung heraus, der Geruch könnte seine Anwesenheit in der Suite verraten.
Er hörte hinter dem Vorhang, wie etwas auf das Bett geworfen wurde, und trat lautlos im selben Augenblick hervor.
Konstantin Sokratis kehrte ihm den Rücken zu und zog umständlich sein Jackett aus. Das war genau der richtige Moment, weil die Zielperson ihre Hände nicht im Reflex zur Abwehr hochreißen konnte.
Söderberg machte zwei rasche Schritte nach vorne, schwang die Schlinge der Garotte von hinten über den Kopf des Mannes und zog mit aller Kraft zu.
4
Sun turning ’round with graceful motion
We’re setting off with soft explosion
Bound for a star with fiery oceans
It’s so very lonely
You’re a hundred light years from home …
Es war noch dunkel.
Kriminalhauptkommissar Max Madlener saß in aller Herrgottsfrüh als Einziger im leeren Großraumbüro des Polizeipräsidiums Friedrichshafen. Er hatte nur seine Schreibtischlampe an und blickte aus dem Fenster, ein paar Lichter glitzerten in der Ferne.
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier …
Nur noch ein paar Tage bis zum dritten Advent.
Mist, Mist, Doppelmist!
Ihn schauderte. Aber nicht etwa, weil die Heizung nicht richtig funktionierte, sondern weil es ihm vor den anstehenden Wochen regelrecht grauste. Und das hatte mehrere Gründe.
Je mehr er darüber und über das Leben im Allgemeinen nachdachte, desto deprimierter wurde er. Der private Ärger, der ihm da noch bevorstand, rollte unaufhaltsam mit den kommenden Feiertagen auf ihn zu. Und egal, wie er die möglichen Optionen drehte und wendete: Es war wie mit der Quadratur des Kreises – die absehbaren Konflikte waren nicht lösbar. Jedenfalls nicht in einem Leben.
Vorsichtig betastete er seine Unterlippe. Eindeutige Anzeichen eines aufkeimenden Herpes labialis, er spürte es deutlich.
Natürlich, was sonst!, dachte er missvergnügt und fischte in seiner Tasche nach der Minitube Zovirax, die er normalerweise bei sich trug, für alle Fälle. Außer er hatte sie wie seine Dienstwaffe, die SIG Sauer, wie immer im Safe seines Hotelzimmers vergessen. Wieso er das Zovirax in den Safe tat, genauso wie seine Pistole, statt sie, wie es Vorschrift war, bei sich zu tragen, war ihm selbst ein Rätsel. Vielleicht eine Art unbewusste Übersprunghandlung, wer weiß. Er konnte ja mal seinen ehemaligen Therapeuten Dr. Dr. h. c. Auerbach danach fragen …
Nein, da war es ja – das Zovirax zumindest. Erleichtert schraubte er die Tube auf und gab vorsichtig einen kleinen Klecks der Salbe auf die brennende Stelle an der Unterlippe, in der stillen Hoffnung, dass es noch rechtzeitig half.
Eigentlich mochte er die Zeit vor dem Morgengrauen ganz besonders. Weil er dann das Gefühl hatte, dass sie ihm allein gehörte. Die Stunde, wenn die Nacht am dunkelsten war, wie es so poetisch hieß. Noch störten weder klingelnde Telefone noch schwatzende Kollegen oder die hyperaktive Chefin Frau Schwanitz-Terstegen die göttliche Ruhe, die er genoss. Er wippte probeweise auf seinem nagelneuen Schreibtischstuhl, die Füße auf dem Schreibtisch, nippte dazu an seinem mitgebrachten Pappbecher Kaffee und wunderte sich beim Anblick der auf den Becher gedruckten Worte. »Coffee to go« hieß das jetzt auf einmal auch in seiner alteingesessenen Lieblingsbäckerei, wo er den Kaffee nebst zwei Croissants mitgenommen hatte, sie öffnete schon um sechs Uhr dreißig in der Früh. Die Ladeneinrichtung stammte noch original aus den 1960er Jahren, »retro« sagte man heutzutage dazu.
Jeden Morgen, wenn er vor Dienstbeginn noch einen kleinen Umweg an seiner Bäckerei vorbei machte, befürchtete er, dass Bauarbeiter dort anfingen, alles herauszureißen, weil irgendeine Drogeriemarktkette den Laden aufgekauft hatte, um dort eine neue Filiale einzurichten.
Die einzige Kontinuität war, dass sich ständig alles änderte.
Nur nicht unbedingt zum Besseren.
Er seufzte aus vollstem Herzen, was er nur tat, wenn er allein war und vor sich hin philosophierte. Er wusste genau, was ihn quälte – es war der Weihnachtsblues. Er musste nur einen Blick aus dem Fenster auf das trübkalte Winterwetter werfen, das seit Wochen auf dem Bodensee lastete, und schon war seine Laune weit unter dem Gefrierpunkt. So wie die Temperatur seit Wochen, die bereits jetzt, zu dieser Jahreszeit, am Ufer für eine dicke Eisschicht gesorgt hatte, die nach und nach, wenn es so kalt blieb und der eisige Wind wie bisher aus dem Osten blies, weiter in den See hineinwuchs.
Und das im Dezember – und nicht erst im Januar oder Februar!
Madleners mentale Verfassung schien sich an den Außentemperaturen zu orientieren. Spätestens Mitte Oktober ging es steil bergab mit ihr.
Sobald der hartnäckige Nebel einsetzte und sich wie ein perlgrauer Bleideckel auf das Wasser legte, breitete sich nicht nur über dem gesamten Bodenseeraum, sondern auch in seinem Kopf unvermeidlich eine gewisse Tristesse und Melancholie aus, die in etwa der Trostlosigkeit des Himmels entsprach.
So, wie seine gegenwärtige Gemütsverfassung war, je mehr es auf Weihnachten zuging, würde er sich nicht wundern, wenn der Bodensee ganz zufror, was sehr selten vorgekommen war. Im strengen Winter 1962/63 war es das letzte Mal der Fall gewesen, dass der gesamte See mit so einer kompakten Eisschicht bedeckt war, dass man zu Fuß an der breitesten Stelle von Friedrichshafen zum Schweizer Ufer nach Romanshorn kam und umgekehrt. Er konnte sich noch an Fotos der großen »Seegfrörne« erinnern, wie das die Einheimischen auf Alemannisch nannten, bei der sogar Autos auf dem Eis gefahren waren, so dick war es gewesen.
Er rieb sich die Augen, nahm noch einen Schluck von seinem inzwischen lauwarmen Kaffee und fragte sich, warum er trotz seiner latenten Müdigkeit im späten Herbst oder besser: im frühen Winter nicht richtig schlafen konnte.
Es war wie verhext – sobald die ersten Frostnächte kamen und die Herbststürme einsetzten, die das Laub von den Bäumen fegten und den Bodensee so aufwühlten, dass zornige Wellenberge an die Kaimauer der Seepromenade von Friedrichshafen klatschten und endgültig die letzten Touristen für dieses Jahr vertrieben, da begann für ihn die Zeit der quälenden Schlaflosigkeit. Auch Insomnie, Agrypnie oder Hyposomnie genannt, er hatte das gegoogelt; eine leichte zerebrale Irritation, beruhigte ihn sein Doktor und empfahl ihm Fußbäder, Melissenblätterextrakt und gutes Durchlüften des Schlafzimmers, woraufhin Madlener beschloss, seinen Arzt zu wechseln.
Die einzige Person, bei der er zur inneren Ruhe fand, war seine Lebensgefährtin, die Pathologin Dr. Ellen Herzog, die gelegentlich, wenn es nötig war, auch als Gerichtsmedizinerin bei der Kriminalpolizei aushalf, sie hatte die entsprechende Zulassung. Leider war Ellen momentan auf Fortbildung, und er logierte wieder wie in alten frauenlosen Zeiten in seinem Zimmer im Hotel »Zum silbernen Zeppelin« gleich hinter dem Busdepot. Es war nichts Besonderes, ein kleines, einfaches Drei-Sterne-Hotel in einem Hinterhof zwischen anderen Häuserblocks, aber in Gehweite von der Polizeidirektion und zehn Minuten von der Hafenpromenade entfernt.
Beim Stichwort »Lebensgefährtin« schüttelte er erneut den Kopf und seufzte. Auf seiner Liste der Wörter, die seltsam diffus und irgendwie hässlich waren, nahm »Lebensgefährtin« einen der ganz vorderen Plätze ein. Irgendwo zwischen »Hämorrhoidenverödung« und »Reichsbürger«.
Jedes Mal, wenn er Ellen Herzog vorstellen musste – »… und das ist meine Lebensgefährtin …« –, blieb ihm dieser Begriff schier im Hals stecken. Gab es denn keinen besseren Ausdruck, der Ellens und seinen Zusammengehörigkeitszustand – auch so ein schreckliches Wort – einigermaßen zutreffend beschreiben konnte, ohne grauenhaft vorgestrig, total verklemmt oder irgendwie anrüchig zu sein?
Als seine Partnerin konnte er sie auch nicht bezeichnen, das war für ihn eine eindeutig berufliche Zuordnung, seine Assistentin Harriet Holtby war das, aber doch nicht Ellen.
Seine Freundin? Das klang nun wirklich albern, wenn man die vierzig weit überschritten hatte. Und mit »Das ist meine Geliebte« konnte er seine Begleitung auch nicht bei einem der alljährlichen obligaten Rathausempfänge der Kripo – mit Anwesenheitspflicht – der Frau des Bürgermeisters präsentieren, ohne Gefahr zu laufen, zu Recht von Ellen geohrfeigt und auf der Stelle verlassen zu werden, obwohl es stimmte.
Für dieses grundsätzliche gesellschaftliche und sprachliche Dilemma hatten sie beide einfach noch keine Lösung gefunden.
»Das ist meine Frau« wäre wahrscheinlich die beste, ehrlichste und einfachste Charakterisierung ihres Zusammenlebens gewesen, aber eine Verheiratung scheuten beide wie der Teufel das Weihwasser. Ellen hatte eine, Madlener bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich …
Inzwischen konnte man die tief hängenden, vom Ostwind über den Seehimmel gescheuchten Wolken erkennen, aus denen leichter Schnee rieselte. Er dachte daran, wie Ellen im »Pinocchio«, ihrem Lieblingsitaliener in Konstanz, an einem romantischen Abend – sie feierten den Jahrestag ihres ersten Rendezvous, den Madlener trotz seines schlechten Gedächtnisses für Daten erinnert hatte – bei einer Flasche Brunello di Montalcino und Lamm-Pappardelle sowie gegrillter Dorade damit angefangen hatte, ob es denn nicht für beide besser wäre, wenn sie zusammenziehen würden. Konkret: wenn Madlener bei ihr einziehen würde. Ohne Trauschein natürlich.
Wie gesagt: Es war ein romantischer Abend, und Madlener hatte im Überschwang des Augenblicks und der Gefühle bereits die zweite Flasche Brunello geordert. Er musste zugeben – der Gedanke, seinem tristen Hotelzimmer ein für alle Mal Adieu zu sagen, war verführerisch. Einfach so gleichzeitig von seiner unpersönlichen Junggesellenbude im »Silbernen Zeppelin« und seinen Beziehungstraumata Abschied zu nehmen und sie für Ellens geräumiges Erdgeschoss in einer stilvoll renovierten Kaffeemühlenvilla einzutauschen, wäre für beide am unkompliziertesten gewesen, groß genug war die Wohnung allemal.
Aber nachdem er sich diesen Vorschlag eine schlaflose Nacht durch den Kopf hatte gehen lassen – im Übrigen in ebenjenem unpersönlichen Hotelzimmer –, war ihm klar geworden, dass das für ihn absolut nicht in Frage kam. Denn im ersten Stock wohnte der Besitzer des Anwesens, Dr. Dr. h. c. Auerbach, der Vater seiner – schon wieder dieser ätzende Ausdruck – Lebensgefährtin und bis vor Kurzem Intimfeind von Kriminalhauptkommissar Max Madlener. Der renommierte Psychiater Dr. Auerbach hatte sich in den Kopf gesetzt, dass für seine Tochter nur ein ebenbürtiger und selbstverständlich adäquater Partner mit akademisch gleichwertiger Laufbahn in Betracht kam, nachdem ihr erster Eheversuch kläglich an den Seitensprüngen ihres damaligen Ehemannes gescheitert war, der zwar ein namhafter Chirurg, aber auch ein notorischer Fremdgänger gewesen war.
Verschärfend war noch dazugekommen, dass Madlener, als er sich von Stuttgart an den Bodensee versetzen hatte lassen, bevor er Ellen kennenlernte, sich bei Dr. Auerbach wegen einiger beruflicher Extratouren, die ihm den Spitznamen »Mad« Max Madlener eingetragen hatten, einer Therapie unterziehen musste, die Madlener damit konterkarierte, dass er Dr. Auerbach nach Strich und Faden belog, was seine innere Verfassung und seine Psyche anging. Er lehnte es grundsätzlich ab, sich analysieren zu lassen, und machte sich einen Jux daraus, den Psychiater an der Nase herumzuführen, indem er die absurdesten Dinge über sich und sein Sexleben fabulierte, was wiederum dazu führte, dass Dr. Auerbach annehmen musste, es mit einem Perversling zu tun zu haben, der sich an seine einzige Tochter heranmachte.
Inzwischen waren alle Missverständnisse dieser Art aus dem Weg geräumt worden. Seit Madlener Ellens Vater, auf den es ein ehemaliger Patient und Amokläufer abgesehen hatte, sogar das Leben gerettet hatte, konnte man tatsächlich von einem halbwegs zivilisierten Umgang miteinander sprechen. Aber unter das Dach eines Mannes zu ziehen, der versucht hatte, ihn zu analysieren und für dienstuntauglich zu erklären, um ihn aus dem Bereich seiner Tochter zu entfernen, kam für den Kommissar trotzdem niemals in Frage.
Never ever.
5
Madlener äugte in seinen Coffee-to-go-Pappbecher und stellte fest, dass er leer war. Seufzend stemmte er sich aus seinem Stuhl und suchte die Teeküche auf, die wie immer von Frau Gallmann, der Sekretärin des früheren Kriminaldirektors – sie war nun die rechte Hand von Frau Schwanitz-Terstegen – tadellos in Schuss gehalten wurde und für sämtliche Bedürfnisse mit Getränken und Snacks ausgestattet war. Dort setzte er die monströse, von Frau Schwanitz-Terstegen als Einstandsgeschenk spendierte und von Frau Gallmann stets ausreichend präparierte Kaffeemaschine in Gang. Für deren Bedienung und Inspektion brauchte man eigentlich ein zweiwöchiges Seminar oder die bibeldicke Gebrauchsanweisung, aber er ging diesmal aufs Ganze und wagte es, die seiner Meinung nach korrekte Tastenkombination zu drücken, wobei er sich vorkam wie ein Astronaut beim Starten der Rakete ohne Checkliste.
Zu seinem großen Erstaunen zapfte er, ganz wie er es vorgehabt hatte, tatsächlich das gewünschte Ergebnis, nachdem das Mahlwerk und diverse Lämpchen und Piepstöne ihre langwierige und umständliche Vorarbeit endlich vollbracht hatten: eine Tasse stinknormalen schwarzen Kaffees, ohne Milchschaum oder künstlichen Coffeecreamzusatz, wahlweise low fat, koscher, halal oder vegan (ganz oben auf Madleners Liste von Dingen, die der Mensch nicht brauchte) oder sonstiges Chichi.
Von seiner unerwarteten technischen Versiertheit selbst überrascht, schlürfte er das starke Gebräu im Stehen, verbrannte sich, wie es sich gehörte, Lippen und Zunge und dachte beim Anblick des am Horizont verblassenden Mondes darüber nach, wie er mit seiner Schlaflosigkeit fertigwerden sollte. In diesem Moment wusste er nicht einmal, ob er in dieser Nacht überhaupt wenigstens für eine oder zwei Stunden geschlafen hatte.
Nein, hatte er nicht.
Er war nach dem x-ten vergeblichen Anlauf, endlich wegzudriften, wütend wieder aufgestanden, hatte geduscht, frische Sachen angezogen – es war kurz vor fünf Uhr morgens gewesen – und hatte sich zu einem Spaziergang an die Seepromenade aufgemacht. Nur um die Zeit totzuschlagen, bis seine Bäckerei geöffnet hatte. Er war schnell marschiert, um durch die Bewegung ein wenig warm zu werden, und starrte auf der Mole zum Mond hoch, der wie ein unbelegter Pizzafladen aussah und unwirklich groß am Firmament stand.
Es war bitterkalt, und Madleners Atem bildete eine Dampfwolke. Aber er spürte die Kälte nicht, weil er mit seinen Gedanken auf einmal wegdriftete. Ein Song aus den späten 1960er Jahren fing an, in seinem Kopf herumzugeistern.
Two thousand light years from home …
Der Mond umkreiste zuverlässig die Erde und die Erde die Sonne.
So weit, so gut.
Nur die Marssonde Schiaparelli zickte und war letztes Jahr wegen einer Fehlprogrammierung auf dem Roten Planeten zerschellt.
Und die Rolling Stones gaben bekannt, sich im nächsten Jahr auf ihre wirklich allerletzte, erdumspannende Abschiedstournee zu begeben.
Bei den Stones wunderte sich Madlener über gar nichts mehr. Wahrscheinlich würden sie, wenn sie auf Erden alle Veranstaltungsorte abgeklappert hatten, dann eben in Gottes Namen quer durch die Galaxis touren.
Two thousand light years from home …
Wenn er an all die Pop- und Rockgrößen dachte, die er verehrte, weil sie irgendwie auf magische Weise imstande waren, sein geheimes seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, und die in letzter Zeit unvermutet ins Jenseits abberufen worden waren – Joe Cocker, Prince, David Bowie, Keith Emerson, der scheinbar unverwüstliche Lemmy Kilmister, Leonard Cohen und Greg Lake –, wurde es ihm um Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood angst und bange.
Ihre Songs verkörperten den heimlichen Soundtrack seines Lebens und waren wie das Leben selbst, manchmal exaltiert, manchmal zornig, manchmal banal, manchmal brillant, manchmal euphorisch, manchmal todtraurig. Aber sie alle gehörten zu ihm, wie sein Pulsschlag. Unvorstellbar, dass die Welt, so wie er sie kannte und sich mit Müh und Not in ihr zurechtfand, weiter ohne sie existieren konnte.
Und damit auch er selbst.
Wie nannte Phil Collins seine aller-allerletzte Tour? »Not dead yet«.
Irgendwie passend. Die ersten zwei Konzerte waren zwei Stunden nach der Ankündigung ausverkauft, und Phil Collins kam mit Krückstock auf die Bühne gehinkt.
Lange, ganz lange hatte Madlener darauf gewartet, dass vielleicht eine gnädige Sternschnuppe aus dem Sternbild der Geminiden vom Himmel fiel, damit er sich wünschen konnte, dass seine noch übrig gebliebenen Idole ewig leben würden.
Aber es war keine gekommen.
Er merkte, dass er mit seinen mäandernden Gedankenassoziationen wie so oft ganz woanders gelandet war, vorzugsweise gleich in einem anderen Universum, nur nicht in der schnöden Wirklichkeit. Um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, nahm er widerstrebend den neuesten Bericht zur Hand, der in seiner Ablage zuoberst lag, und warf einen Blick darauf.
In Friedrichshafen war gestern Großalarm ausgelöst worden, weil ein fremdländisch aussehender bärtiger Autofahrer eine Passantin nach dem größten Platz in der Stadt gefragt hatte und ob dort ein Weihnachtsmarkt stattfände. Die gute Frau hatte auf dem Rücksitz des Autos verdächtig aussehende Kabel und eine Gerätschaft gesehen, die ihrer Meinung nach nur eine Bombe sein konnte, als sie aufgeregt unter Angabe des Kfz-Kennzeichens der Notrufzentrale durchgab, dass ein potenzieller Attentäter, der, soweit sie es verstanden hatte, unverständliches Kauderwelsch gesprochen und irgendwie arabisch ausgesehen hatte, am Bodensee unterwegs war.
In Vertretung der Kriminaldirektorin in Friedrichshafen, Rita Schwanitz-Terstegen, die auf einer Tagung in Stuttgart weilte, zögerte ihr übereifriger Stellvertreter, Jungkommissar Götze, der in diesem Moment als einziger Verantwortlicher im Präsidium anwesend war, keinen Augenblick und gab eine Großfahndung nach Auto und Besitzer durch. Es war Vorweihnachtszeit, und die Angst vor einem hinterhältigen terroristischen Anschlag grenzte schon an Hysterie. Erst kürzlich war in Ludwigshafen ein zwölfjähriger Junge festgenommen worden, der auf dem dortigen Weihnachtsmarkt eine selbst gebastelte Nagelbombe deponiert hatte, die er nach einer Anleitung, die er über einen Messenger-Dienst auf seinem Smartphone erhalten hatte, hergestellt hatte und die Gott sei Dank nicht losgegangen war.
Was Götze sich am wenigsten vorwerfen lassen wollte, war, im Büro gesessen und Däumchen gedreht zu haben, während draußen irgendein durchgeknallter Terrorist Friedrichshafen in die Luft zu sprengen drohte. Heutzutage musste man mit allem rechnen. Also handelte er nach Dienstvorschrift.
Zwei Streifenwagen und eine Zivilstreife konnten den Wagen schließlich auf einer Kreuzung am Stadtrand von Friedrichshafen stellen. Der Verdächtige, der die ganze erforderliche Härte eines baden-württembergischen Polizeieinsatzes abbekam, indem ihm auf dem Bauch auf der Straße liegend Handschellen verpasst wurden und er in die Mündungen von Pistolen sehen und derbe Stiefel auf dem Rücken und im Nacken spüren durfte, stellte sich aber letzten Endes als harmloser Auswärtiger heraus. Sein angeblich morgenländischer Dialekt war Allgäuerisch – die ihn anzeigende Frau hatte ihn nicht verstanden, weil sie eine Zugereiste aus Hamburg war –, sein Salafistenbart die vorbildliche physische Vorbereitung auf das Memminger Wallenstein-Fest, wo er einen Pikenier aus dem Dreißigjährigen Krieg authentisch verkörpern sollte. Die Kabel auf dem Rücksitz seines Autos waren stinknormale Verlängerungskabel und die vermeintliche Bombe ein von seiner Mutter ausgeliehenes Raclette-Gerät, das er seit Wochen mit sich herumkutschierte und ebenso lange zurückgeben wollte, wozu er bisher aber noch nicht gekommen war.
Der Verdächtige war Eventveranstalter und hatte nur herausfinden wollen, ob der Buchhornplatz groß genug sei, um dort im nächsten Sommer ein Beachvolleyballturnier auf aufgeschüttetem Sand zu organisieren.
Madlener seufzte noch einmal tief, blickte auf den Bericht und überlegte sekundenlang, ob er nach dem Anruf der besorgten Passantin genauso gehandelt hätte wie Götze. Er war sich nicht sicher.
Erste Türen gingen auf, klackernde Schritte waren zu hören, allmählich kam Leben in die Bude.
Harriet Holtby, Madleners Assistentin, enterte das Büro, stellte ihren Rucksack und ihren Motorradhelm auf ihrem Schreibtisch ab und ließ sich in den Stuhl Madlener gegenüber fallen, von wo aus sie ihm kurz zunickte – was der Ausdruck ihrer besonderen Zuneigung war –, und versuchte, mit den Händen zuerst einmal ihre durch das Tragen des Helms platten Haare wieder in die punkige Igelfrisur zu verwandeln, die ihr Markenzeichen war.
»Ich wünsche dir gleichfalls einen guten Morgen, Harriet«, sagte er übertrieben freundlich, obwohl er genau wusste, dass er mit seinem süffisanten Morgengruß auf taube Ohren stieß und bei seiner Assistentin nicht den geringsten pädagogischen Effekt erzielte.
Genauso war es.
Vollkommen unbeeindruckt von dem kleinen rhetorischen Nadelstich ihres Chefs schaltete Harriet ihren PC ein, hob kurz die Hand, zum Zeichen, dass sie ihn verstanden hatte, und machte sich ohne ein unnötiges Wort an ihre Arbeit.
Madlener konnte im letzten Moment einen weiteren Weltschmerzseufzer unterdrücken. An Harriets grenzwertig autistisches Benehmen würde er sich nie gewöhnen.
Gedankenverloren blätterte er noch einmal in dem Bericht, den sein junger Kollege Götze geschrieben hatte. »Much ado about nothing«, hätte sein früherer Chef, der in Pension gegangene anglophile Kriminaldirektor Thielen, wohl dazu gesagt. Er hatte englische Zitate geliebt, egal ob passend oder unpassend – und am allerschönsten war es für ihn, wenn sie auch noch von Shakespeare waren.
Diesmal hätte es gepasst. Viel Lärm um nichts.
Irgendwie vermisste Madlener seinen anstrengenden Chef, bei dem man wenigstens wusste, woran man war. Wenn man es nämlich einigermaßen geschickt anstellte, was Madlener geradezu meisterhaft beherrscht hatte, konnte man ganz nach seinem eigenen Gutdünken handeln. Aber nicht nur das – Madlener trauerte außerdem seinem abgelegenen Büro im Gebäude der Verkehrspolizei nach, wo er und seine Assistentin Harriet konzentriert ihrer Arbeit nachgehen und schalten und walten konnten, wie es ihnen passte, ohne sich ständig beaufsichtigt und beobachtet zu fühlen.
Diese Zeiten waren vorbei, seit Frau Schwanitz-Terstegen das Kommando im Polizeipräsidium übernommen hatte. Wichtig war ihr einzig und allein, dass sie alles unter Kontrolle hatte. Als erste Amtshandlung hatte sie deshalb die einzelnen Büros aufgelöst und alle Mitarbeiter der Kripo in ein neu geschaffenes Großraumbüro beordert. Dort hatte sie ihre vier Augen überall. Vier Augen deshalb, weil sie abwechselnde Designerbrillen mit dicken Gläsern trug, über deren Rand sie immer blickte, was ihr ein strenges Aussehen gab und ihre Autorität unterstrich. Wehe, sie ertappte jemanden bei einem Videospiel im Dienst (Götze) oder einem kurzen Einnicken am Arbeitsplatz (Binder). Da gab es nicht nur einen Rüffel, sondern gleich geharnischte Abmahnungen. Kriminaldirektorin Schwanitz-Terstegen führte ein strenges Regiment, und das ließ sie auch jeden spüren. »Jeder Mann und jede Frau handelt ohne Ausnahme strikt nach Dienstvorschrift!«, lautete ihre Devise. Ach was: ihr Glaubensgrundsatz, den sie regelmäßig vor versammelter Mannschaft verkündete – und das meinte sie genau so, wie sie es sagte.
Damit kam Madlener noch klar. Was er viel schlimmer fand, war, dass seine neue Chefin nicht den kleinsten Funken Humor besaß. Alles, was sie äußerte, war wie in Stein gemeißelt und musste Wort für Wort von allen Kripoleuten, für die sie zuständig war, akribisch befolgt und umgesetzt werden. Immerhin hatte Frau Schwanitz-Terstegen so etwas wie Effizienz und ein gewisses Arbeitsethos in den Laden gebracht, das musste Madlener ihr lassen. Alles das, was der ehemalige Kriminaldirektor Thielen jahrelang vergeblich versucht hatte.
Schlendrian war tot, es lebe die Disziplin!
Das galt natürlich nicht für ihn und Harriet Holtby.
Für Madlener nicht, weil er es in der relativ kurzen Zeit, seit er in Friedrichshafen tätig war, mit drei wirklich aufsehenerregenden und komplexen Fällen zu tun gehabt hatte, die er gegen alle Widrigkeiten und Widerstände erfolgreich abschließen konnte. Deshalb war sein Standing entsprechend groß, fast schon unantastbar. Man hatte ihm sogar nach Thielens Abgang die Stelle des Kriminaldirektors angeboten, aber Madlener hatte postwendend abgelehnt. In der Zwangsjacke des hohen Verwaltungsbeamten an den Schreibtisch gefesselt zu sein, war für ihn noch vor einer Bergwanderung oder den unaufhaltsam näher rückenden Weihnachtsfeiertagen die ultimative Horrorvorstellung. Seine berufliche Leidenschaft war die Ermittlungsarbeit auf der Straße und das damit verbundene Gefühl einer gewissen Unabhängigkeit.
Für Harriet Holtby galt das sture Abarbeiten des Schwanitz-Terstegen-Dienstplans ebenfalls nicht, weil sie für Madlener unersetzlich war und ihren nicht zu unterschätzenden Anteil daran hatte, dass alle drei großen Fälle letzten Endes als Erfolg der Kriminalpolizei Friedrichshafen in die Annalen eingegangen waren.
Äußerlich waren die beiden total gegensätzlich. Madlener war groß und breitschultrig, seine Anzüge sahen an ihm irgendwie immer aus, als habe er eine Nacht in ihnen geschlafen, er hatte zu lange Haare und war meistens schlecht rasiert. Harriet war schmächtig, zu stark geschminkt, je nach Laune entweder mit einer Amy-Winehouse-Gedächtnis-Frisur oder punkigen Igelstacheln und farblich stets wechselnden Fingernägeln. Normalerweise trug sie eine schwarze Lederjacke mit Silbernieten und Springerstiefel.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstanden sie sich inzwischen ohne große Worte. Auf Harriet konnte sich Madlener trotz ihres zuweilen eigenwilligen Verhaltens und ihrer Unerfahrenheit hundertprozentig verlassen, umgekehrt war es genauso. Keiner mischte sich in den privaten Lebensstil des anderen ein, aber beide wussten um die versteckten Empfindlichkeiten und Marotten ihres Partners und bemühten sich nach Möglichkeit, nicht daran zu rühren. Außer wenn sie sich gegenseitig auf den Arm nahmen, aber das nur, wenn sie unter sich waren. Das war, neben der grundsätzlichen professionellen Einstellung, die Basis für eine gute und erfolgversprechende Zusammenarbeit.
Falls sie einmal nicht einer Meinung waren, konnten durchaus auch die Fetzen fliegen. Madlener war, wie sein Spitzname »Mad« Max schon sagte, als aufbrausender Charakter bekannt und gefürchtet, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Und Harriet war überaus empfindsam, wenn man ihre Kompetenz auch nur im Geringsten anzweifelte, weil sie so gar nicht ins weibliche Polizistenschema passte und nach Kommissarsanwärterin aussah, oder gegen Regeln verstieß, die ihrem Gewissenskodex zuwiderliefen. Vor allem was Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltschutz angingen, war sie kämpferisch darum bemüht, ihre strenge Einstellung dazu mit allen Mitteln zu verteidigen.
Madlener ließ ihr mitunter mehr durchgehen, als er das bei anderen tat. Das Biest in Harriet wusste das und nutzte es bei Bedarf weidlich aus. Sie kannte seine Schwächen besser als er selbst, und nichts bereitete ihr mehr Spaß, als ihn mit todernster Miene damit aufzuziehen.
Warum Madlener bei Harriet gelegentlich ein, zuweilen sogar alle zwei Augen zudrückte, lag wohl – obwohl er das nie zugeben würde – darin begründet, dass er für seinen Schützling eine Art väterliche Verantwortung fühlte – und zwar in jeder Hinsicht. Das tat er aber so unauffällig und diskret wie möglich, weil Harriet mit ihrem übergroßen Ego das nicht für nötig hielt. Im Gegenteil – sie hätte sich eine Vorzugsbehandlung streng verbeten.
Obwohl sie es nie aussprachen: Sie wussten beide, was sie am jeweils anderen hatten.
»Ach, übrigens …«, sagte Harriet unvermittelt und sah von ihrem Bildschirm auf. »Bevor ich’s vergesse: Post von Frau Schwanitz.« Das »Terstegen« sparte sie sich, wenn die Chefin abwesend war.
»Post? Was für Post?«, fragte Madlener irritiert.
»Ein Fragebogen.«
»Wo?«
»In deiner Ablage. So eine Art psychologischer Test. Muss von allen im Hause ausgefüllt werden.«
Bei den Worten »psychologischer Test« und »muss« sträubten sich bei Madlener sofort sämtliche Nackenhaare, er konnte es förmlich fühlen.
»Wer sagt das?«
»Unsere neue Chefin.«
»Bis wann?«
»Bis gestern.«
Jetzt sah auch Madlener hoch, ob Harriet das wirklich ernst meinte. Sie schenkte ihm einen gespielt unschuldigen Blick, klimperte theatralisch mit ihren überlangen schwarzen Wimpern und blies dazu genüsslich eine Blase mit ihrem Kaugummi, die sie gekonnt platzen ließ.
Ja, seine Assistentin wusste genau, wie sie ihn auf die Palme bringen konnte.
Madlener übersah das geflissentlich und kramte in seiner Ablage herum. Er fand ein paar zusammengeheftete Seiten, zog sie heraus und blätterte sie kurz durch.
»Ist das ihr Ernst?«, fragte er schließlich ungläubig und zog ein Gesicht, als hätte er auf eine faule Zwiebel gebissen, wo er einen frischen Apfel erwartet hätte.
»Ich bin nicht in der Position, um Fragebogen unserer Chefin zu kritisieren oder in Zweifel zu ziehen«, antwortete Harriet scheinheilig.
»Heißt das, du hast diesen … diesen …«
»Unfug?«, warf sie ein. »Blödsinn? Bullshit? Brauchst du noch weitere Synonyme?«
»Das hast du gesagt! Hast du dieses Elaborat tatsächlich ausgefüllt?«
Sie nickte. »Sorgfältig durchgelesen, akribisch ausgefüllt, mit Datum und Unterschrift versehen und rechtzeitig abgegeben. Dienst ist Dienst.«
»Aha«, kommentierte er und kratzte sich mit einem Bleistift hinter dem Ohr. Er glaubte Harriet kein Wort.
»Nach bestem Wissen und Gewissen, Mr. Crawford«, fügte sie noch hinzu und legte die drei Schwurfinger treuherzig auf die Brust.
Madlener verstand endlich, wie sie das meinte, und ging darauf ein.
»Na schön, Agent Starling …«
Es war ein beliebtes Rollenspiel zwischen den beiden – wenn sie sicher waren, dass niemand zuhören konnte, verfielen sie gelegentlich in den Jargon von Jodie Foster und ihrem Chef beim FBI, Scott Glenn, aus ihrem gemeinsamen Lieblingsfilm »Das Schweigen der Lämmer«.
Erst räusperte er sich, dann las er vor.
»Frage sechs. ›Wem stehen Sie näher? Mutter oder Vater?‹«
Er sah Harriet fragend an. So lange, bis sie antwortete. Aber vorher schniefte sie, was ein untrügliches Zeichen dafür war, dass ihr etwas unangenehm war. Zu persönlich zum Beispiel. Das mochte sie schon gleich gar nicht.
»Da hab ich einen Strich gemacht«, gab sie schließlich zu.
»Was heißt das?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Dass ich mich nicht daran erinnern kann.«
Aha, dachte Madlener erneut, vermied es aber, seiner Skepsis auch Worte zu verleihen. Typische Reaktion. Wenn es zu privat wurde, klappte Harriet zu wie eine Auster, der man an die Perle wollte.
»Okay. Dann weiter zu Frage acht. ›Sie sind auf einer Party. Zu wem gesellen Sie sich lieber? Zu Leuten, die Ihnen völlig unbekannt sind, oder zu denjenigen, die Sie gut kennen?‹«
Da keine Antwort kam, sah er Harriet mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Was hast du da geschrieben?«
Sie feixte ihn an.
»Das darf ich nicht sagen. Das ist geheim. Fällt unter den Datenschutz. Lies doch mal das Vorwort.«
»Jaja, schon gut. Was hast du da geschrieben, Agent Starling?«
»›Ich gehe auf keine Partys.‹ Wortwörtlich.«
Er grinste. »Echt jetzt?«
Das war Originalton Harriet Holtby, damit konnte er sie normalerweise richtig ärgern. Aber diesmal verschränkte sie demonstrativ ihre Arme, bevor sie antwortete.
»Hey, im Ernst: Was geht das irgendjemanden an?«
»Vollkommen richtig, Agent Starling! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!«
Er hob die Blätter in die Höhe.
»Mit welcher Verbalinjurie hast du dieses Machwerk vorhin noch mal bezeichnet?«
Sie zog ihre Stirn in Falten, als würde sie nachdenken.
»Könnte es Bullshit gewesen sein, Mr. Crawford …?«
»Genau das ist es. Bullshit, nichts anderes. Wo haben wir gleich noch mal die Ablage für ›Bullshit‹, Agent Starling?«
»Hier«, sagte Harriet und hielt ihm den leeren Papierkorb hin.
Madlener zerknüllte die Fragebogen, setzte im Sitzen wie Dirk Nowitzki zu einem Freiwurf an und traf punktgenau.
6
Söderberg betrat das kirchenschiffgroße Gewächshaus. Bis auf einen Gärtner, der dabei war, die Pflanzen im Eingangsbereich zu wässern, war es menschenleer. Kein Wunder, er war früh dran, der Botanische Garten hatte erst seit zehn Minuten seine Pforten für Besucher geöffnet. Er schlenderte wie ein passionierter Blumenliebhaber mit Dauerkarte an den Palmen und exotischen Pflanzen vorbei in Richtung Tropenhaus, das wie immer der Treffpunkt mit seinem Auftraggeber war, wenn er sich in München aufhielt.
Söderberg hasste Treibhäuser und insbesondere das Tropenhaus und nahm sich ganz fest vor, obwohl sie nie über Privates sprachen, diesmal endlich zu fragen, warum Kowalski, so nannte er sich, ausgerechnet das ihm körperlich unangenehme Gewächshaus für geschäftliche Rendezvous auserkoren hatte, ein anonymes Café im Bahnhofsviertel hätte es seiner Meinung nach genauso getan.
Aber gut – wer zahlt, schafft an, dachte er grimmig, als er vor der beschlagenen Glastür ankam und noch einmal frei durchatmete, bevor er die Klinke zur Dschungelatmosphäre durchdrückte, die ihm sofort unbarmherzig entgegenschlug, als er eintrat. Es war dampfig schwül und stickig, die Luftfeuchtigkeit nahe hundert Prozent, das Licht schimmerte durch die dicht stehenden Pflanzenblätter und -tentakel dumpf-grünlich wie in einem Aquarium mit vermoosten Scheiben. Der widerlich süße Gestank von Orchideen kam ihm vor wie der aufkeimende Verwesungsgeruch scheintoter Witwen, die bei ihrem allwöchentlichen Bridgeabend zu viel billiges Parfüm aufgelegt hatten. Die Glasscheiben und das Dach waren beschlagen, und er hörte es überall tröpfeln und rieseln. Auf der Oberfläche des rechteckigen dunklen Wasserbeckens von den Ausmaßen eines halben Tennisplatzes, das hüfthoch im Zentrum des künstlichen Regenwalds stand, schwammen Seerosenblätter in der Größe eines Gullydeckels, die mit ihrem im Neunzig-Grad-Winkel hochgeklappten, leicht gezackten fingerhohen Rand aussahen wie gigantische umgedrehte Kronenkorken.
Am entfernten Ende des Beckens stand, mit den Händen auf dem Rücken, ein alter, hagerer Mann in einem schweren Lammfellmantel, mit silbernem Haarkranz und Goldbrille, der den Kopf nicht hob, als die im Kies knirschenden Schritte von Söderberg näher kamen. Er wartete, bis Söderberg neben ihm stand. Sein Blick blieb auf eine der faustdicken aufknospenden Blüten auf der schwarzen Wasseroberfläche gerichtet, als er unvermittelt mit einer leisen Stimme zu sprechen anfing.
»Ich liebe diese Seerosenblätter. Man könnte glatt annehmen, dass sie mich tragen könnten, wenn ich mich draufsetzte.«
»Probieren Sie’s doch aus«, antwortete Söderberg. »Aber glauben Sie nicht, dass ich da reinsteige und Ihnen das Leben rette.«
»Das wäre auch das Letzte, was ich von Ihnen erwarte. Apropos … womit wir gleich beim Thema wären«, sagte Kowalski humorlos und nahm seine Brille ab, die beschlagen war, um sie mit einem Stofftaschentuch abzuputzen, während er seine wässrigen grauen Augen auf Söderberg richtete. »Ich hätte da einen neuen Auftrag für Sie.«
»Ich habe nicht angenommen, dass wir uns hier treffen, um uns über neueste Pflanzenzüchtungen und den bestmöglichen Dünger auszutauschen«, entgegnete Söderberg.
Er vermied es, die Wahrheit zu sagen, nämlich dass dies sein letzter Auftrag war, den er annehmen oder – wenn er ihm nicht passte – ablehnen würde. Er kannte die Gesetze seiner Branche nur zu gut: Hatte sein Auftraggeber den Verdacht, dass er aussteigen wollte, konnte er unter Umständen Maßnahmen ergreifen, ihn auszuschalten, einfach weil er zu viel wusste. Also hielt er diesbezüglich lieber den Mund und wartete erst mal ab, was für ein Angebot er bekam.
Er spürte, wie ihm mehr und mehr der Schweiß aus allen Poren brach, aber er wollte vor Kowalski, der das tropische Gewächshausklima geradezu zu genießen schien, nicht die geringste Schwäche zeigen, also zog er sich Mantel und Schal nicht aus, obwohl er sich beides am liebsten vom Leib gerissen hätte, und kochte weiter in seinem eigenen Saft. Er musste sich zwingen, Kowalskis Blick standzuhalten, der seine Brille wieder umständlich aufgesetzt hatte und ihn mit seinen durch die Gläser grotesk verzerrten Fischaugen mit einer gewissen Boshaftigkeit anstarrte, als würde er Söderbergs zunehmende Unpässlichkeit geradezu auskosten. Er selbst zeigte nicht das geringste Anzeichen davon, dass es ihm vielleicht zu warm wäre in seinem dicken Lammfellmantel. Wahrscheinlich floss statt Blut Frostschutzmittel in seinen Adern.
»Sie sagen es«, meinte er schließlich und holte einen DIN-A4-Umschlag aus der Innentasche seines schweren Mantels, den er Söderberg überreichte.
»Übrigens – gute Arbeit. Steht in allen Zeitungen. Genau das, was wir wollten.«
Söderberg nickte nur und hielt den Umschlag hoch.
»Soll ich das jetzt und hier …?«, fragte er.
»Nein.« Kowalski schüttelte den Kopf. »Das behalten Sie nur, wenn Sie zusagen. Ich setze Sie kurz mündlich ins Bild, und Sie sagen Ja oder Nein.«
»Bedenkzeit?«
»Keine. Entscheidung hier und jetzt.«
»Ich höre.«
»Mann. Single. Mitte vierzig. Es muss wie ein Unfall aussehen.«
»Warum?«
»Er war bei einer Privatbank angestellt. In der Schweiz. Hat die Daten von ungefähr zweihundert Steuerhinterziehern an den Finanzminister von Baden-Württemberg verkauft. Ist seither spurlos verschwunden.«
»Wo ist er jetzt?«
»Am Bodensee. Wir haben Decknamen und Adresse. Beides ist in Ihren Unterlagen.«
»Wann soll die Transaktion ausgeführt werden?«
»So bald wie möglich.«
»Haken?«
»Ja, den gibt es.«
»Welchen?«
»Er besitzt etwas, das wir zurückhaben wollen.«
»Was?«
»Eine weitere Datei mit Namen drauf.«
»Wie viele?«
»Es sollen an die dreihundert sein.«
»Wo finde ich diese Datei?«
»Das ist der Haken. Wir wissen es nicht.«
Söderberg knöpfte nun doch seinen Mantel auf und nahm seinen Schal ab, mit dem er sich über die Stirn wischte. Er hatte das Gefühl, mit seinen Winterklamotten in einer überheizten Sauna zu stehen und jeden Moment einen Hitzschlag zu bekommen, weil die verdammte Tür nicht aufging.
»Wie in Teufels Namen soll ich die Datei finden? Das kann eine DVD sein, ein Stick, ein Chip …«
»So ist es. Dafür wären wir bereit, Ihr übliches Honorar entsprechend zu erhöhen. Vorausgesetzt, Sie finden die Liste.«
Söderbergs Gesicht war eine versteinerte Maske, Kowalski durfte auf keinen Fall merken, was in ihm vorging. Aber die Aussicht auf einen unbeschwerten, wenn nicht sogar luxuriösen Lebensabend ließ seine Vorbehalte dahinschmelzen wie Aprilschnee in der Frühlingssonne.
Er räusperte sich und fragte, dabei bemüht, möglichst normal zu klingen: »Irgendwelche Hinweise?«
Kowalski verzog das Gesicht, als ob ihm seine Antwort unangenehm wäre: »Sie werden ihn wohl fragen müssen. Aber ich befürchte, rhetorischen Argumenten allein wird er sich nicht aufgeschlossen genug zeigen. Ich gehe jedoch davon aus, dass Sie über Mittel und Wege verfügen, ihn überreden zu können …«
Er machte eine Geste, die andeutete, dass die Art der Vorgehensweise allein Söderbergs Sache sei.
Söderberg wog den Umschlag in seiner Hand. Er spürte, wie ihm ein Rinnsal die Wirbelsäule hinunterlief. Das war sein letztes großes Spiel. Der Jackpot war zum Greifen nah. Anstandshalber gab er sich zögerlich, obwohl er schon kaum noch Luft bekam, so heiß war ihm.
»Und wenn ich Nein sage?«
»Dann trennen sich unsere Wege, und wir sehen uns nie wieder.«
Söderberg beschloss, aufs Ganze zu gehen.
»Doppeltes Honorar?«
Kowalski überlegte zwei Herzschläge lang, dann zwinkerte er einmal überdeutlich, womit er sein Einverständnis signalisierte.
»Die Hälfte sofort?«
»Geht in Ordnung. Übliches Konto?«
»Übliches Konto. Wann bekomme ich den Rest?«
»Sobald Sie den Auftrag ausgeführt haben und wir im Besitz des Datensatzes sind.«
Kowalski nagelte Söderberg, dessen schweißnasses Gesicht allmählich eine dunkelrote Färbung annahm, nach wie vor mit seinen wässrigen Augen hinter seinem goldenen Brillengestell fest.
Söderberg nickte. »Ich mache den Job.«
Kowalski löste seinen Blick und griff wieder in die Innentasche seines Mantels. Er bemerkte, wie Söderberg kurz zuckte und nervös mit der freien Hand in die Tasche seines Mantels fuhr.
»Keine Sorge«, sagte er beruhigend und mit der Andeutung eines maliziösen Lächelns. »Ich habe da noch was für Sie.«
Er zog langsam eine zusammengefaltete Zeitung heraus und tippte mit dem manikürten Finger auf ein Bild, das den Moment zeigte, in dem sich zwei Ehepaare mit einem großen Blumenstrauß bei einem Mann bedankten, der in einem Krankenbett lag. Er lächelte nicht sehr glücklich in die Kamera.
»Das ist unser Mann«, sagte Kowalski. »Hat sich unter falschem Namen am Bodensee verkrochen. Wir suchen ihn seit zwei Jahren. Damit ist er jetzt aufgeflogen. Und wissen Sie, warum? Weil er das getan hat, was Sie unter keinen Umständen für mich tun würden.«
Er deutete mit einer Kopfbewegung auf das Wasserbecken mit den Seerosenblättern. »Nämlich ins Wasser steigen. Genau das hat er getan. Und das hat er nun davon.«
Söderberg hielt die Zeitung so, dass er die Bildunterschrift lesen konnte. Ein Schweißtropfen von seiner Nasenspitze fiel auf das Foto.
»Man sollte sich eben gut überlegen, wann es angebracht ist, den Helden zu spielen, und wann lieber nicht«, sagte er und wollte Kowalski die Zeitung zurückgeben.
»Können Sie behalten«, erwiderte Kowalski, klopfte ihm jovial an den Oberarm, wandte sich um und gab vor, eine Orchidee zu studieren, die ihre leichenfingrigen Luftwurzeln durch ein nestähnliches Gebilde streckte, das an einem Draht von der Decke baumelte.
Damit war das Gespräch beendet.
Söderberg war schweißgebadet. Er wollte nur noch ins Freie und frische Luft schnappen.
Die Tür zum Tropenhaus wurde aufgerissen, und eine lärmende Horde Schüler mit zwei Lehrkräften kam hereingestürmt.
Söderberg hatte Mühe, sich durch zwei Dutzend Grundschüler hindurchzukämpfen, und machte, dass er herauskam, bevor er noch kollabierte.
7
Durch die stille Nacht ta ram tam tam tam
Da ging ein kleiner Junge ram tam tam tam
Hielt seine Spielzeugtrommel in der Hand
Wollt zu dem Stalle wo die Krippe stand
Ram tam tam tam, ram tam tam tam
Ein lausig kalter Ostwind wehte über den grauen See.
Von links dudelte George Michael sein »Last Christmas« in einer gefühlten Dauerschleife aus den Lautsprechern, von rechts Heintje. Der Wind trug Gott sei Dank nur bruchstückhafte und doch unverkennbare Fetzen heran, aber das reichte, um Madleners Stimmungspegel vollends unter den absoluten Nullpunkt sacken zu lassen.
Er tastete nach seinem Herpes an der Unterlippe und starrte nachdenklich auf seine dampfende Bockwurstsemmel.
Harriet Holtby stocherte mit einer weißen Plastikgabel in ihrer Pappschale mit der aufgeschnittenen Currywurst herum und war darauf konzentriert, ein zu heißes Stück davon so zu kauen, dass sie sich nicht vollständig den Mund verbrannte. Sie standen im Windschatten einer Wurstbude an einem wackligen Stehtisch am Rand des Weihnachtsmarktes von Friedrichshafen und schauten dem Gedränge der Menschen zwischen den tannenzweiggeschmückten Holzhütten zu, die kitschigen Weihnachtskram, klebrige Lebkuchen, sündteuren Schmuck, geschmacklose Wurzelschnitzereien, übersüßten Glühwein und ökologisch korrekt verarbeitete Bio-Wollsocken im Dreierpack feilboten.
»Weißt du, was ich an Weihnachtsmärkten so hasse?«, fragte Madlener und biss endlich in seine Bockwurst.