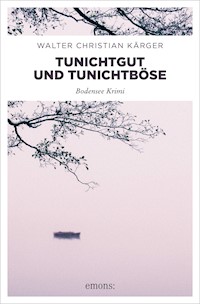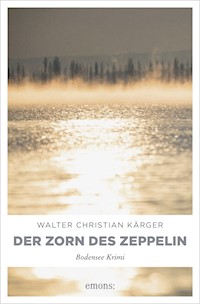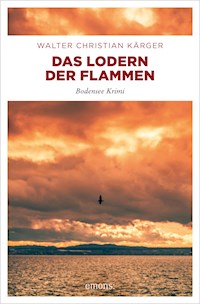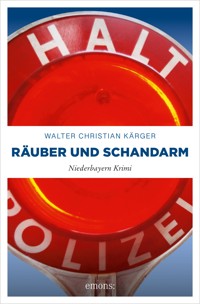Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Ein Ermittlerteam, das seinesgleichen sucht. Ein Toter mordet am Bodensee, kurze Zeit später werden die Kinder einer Adelsfamilie im Schwarzwald entführt. Es gibt keine Lösegeldforderung, aber umso mehr Druck von oben. Hauptkommissar Max Madlener und seine Kollegin Harriet Holtby stehen vor einem scheinbar unlösbaren Rätsel – bis ein mysteriöses Wappen eine heiße Spur liefert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Ingo Jakubke/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-617-3
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Ich bin in Hitze schon seit TagenSo werd ich mir ein Kahlwild jagenUnd bis zum Morgen sitz ich anDamit ich Blattschuss geben kannAuf dem Lande auf dem Meer, lauert das VerderbenDie Kreatur muss sterben!
1
Kurz bevor das todbringende Geschoss ihn einen Fingerbreit neben der Wirbelsäule in den Rücken traf, wo es zwischen die Rippen drang, das Herz zerfetzte und durch die Brust wieder austrat, erfreute sich Rechtsanwalt Heribert Döllinger noch bester Gesundheit und ebensolcher Laune.
Er war geradezu beschwingt und schwelgte in einer Blase aus Selbstzufriedenheit, Alkohol und Gewinnerhype, die ihn auf der Autofähre zurück von Konstanz nach Meersburg mit großem Genuss eine seiner Cohiba Espléndidos anstecken ließ, von denen er stets zwei in seinem teuren Lederetui mit sich führte, wenn ihn mal wieder das Zockerfieber packte und ihm nach einer heißen Nacht im Casino zumute war.
So ein kleines Amüsement gönnte er sich ein- bis zweimal im Monat. Döllinger war passionierter Roulettespieler. Nur gut, dass ihn die viele Arbeit in seiner Kanzlei davon abhielt, sich noch öfter in Spielcasinos herumzutreiben. Abwechselnd in Konstanz, Lindau oder Bregenz, der Bodenseeraum war gespickt damit, manchmal aber auch in Baden-Baden, je nach Lust und Laune. Er wusste genau, dass das eine gefährliche Schwäche von ihm war, die ihn schon viel Geld gekostet hatte.
Ein Spieler wie er sagte sich zwar, dass sich Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit aufwiegen würden, wenn er nur lange genug durchhielt, aber er war sich natürlich darüber im Klaren, dass dieser Glaube an die Wahrscheinlichkeitsrechnung zum typischen Verdrängungsmechanismus einer Spielernatur gehörte, die wie er süchtig nach dem Klackern der Kugel im Kessel war.
Doch Döllinger war ein starker Charakter, der sich fast immer im Griff hatte, und ein absoluter Vollprofi in seinem Business, sonst hätte er es in seiner Karriere als Strafverteidiger nicht so weit gebracht. Sein Name war in den relevanten Kreisen nicht nur bekannt, sondern sogar gefürchtet, was ihm die besten Mandanten bescherte, soll heißen: vor allem die prominentesten und zahlungskräftigsten.
Seine Erfolgsquote hatte sich längst herumgesprochen, seine Reputation als Rechtsanwalt hätte nicht besser sein können.
Am liebsten übernahm er die schwierigen Fälle und paukte seine Mandanten aus scheinbar aussichtslosen Kalamitäten heraus. Mit juristischen Manövern, die nicht selten die Grenzen des Erlaubten vor Gericht überschritten, aber sein Motto war: Der Zweck heiligt die Mittel. Lieber einen Anpfiff vom Richter kassieren, als die Chance auszulassen, ein klitzekleines Schlupfloch zu finden, durch das man trotz der eng geknüpften Maschen des Gesetzes entwischen konnte.
Einziger Sinn und Zweck seines Jobs war es nun einmal, den Schaden für den jeweiligen Mandanten möglichst zu minimieren und für ihn die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Ob der Mandant schuldig im Sinne der Anklage war, interessierte ihn dabei nicht die Bohne. Döllinger ging es nur und ausschließlich darum, das Optimum für sich zu erreichen. Moral hatte in seiner Welt der Gerichtssaalschlachten nichts verloren, so lautete sein Credo. Was zählte, waren allein juristische Raffinessen und der daraus resultierende Erfolg. Sein eigenes schlechtes Gewissen meldete sich nur, wenn er nach einem gewonnenen Prozess zu tief in sein Glas mit Single-Malt-Whisky schaute oder eine Cohiba zu viel rauchte und darüber sinnierte, was Schuld und Unschuld und Recht und Gerechtigkeit voneinander unterschied und wo die Grenzen bisweilen fließend waren.
Obwohl – wenn er es sich genau überlegte –, bei dem Brummschädel und der leichten Übelkeit am nächsten Morgen musste es sich wohl eher um einen veritablen Kater als um moralische Skrupel handeln.
Die hatte er nicht, wenn er wieder einmal einen Freispruch oder zumindest eine Bewährungsstrafe für einen Mandanten erwirkt hatte, der zweifelsohne für die Straftat, die ihm vom Staatsanwalt zur Last gelegt worden war, nach menschlichem Ermessen verantwortlich zeichnete.
Aber eben nicht nach juristischem.
Weil Döllinger es wie so oft mit Engelszungen verstanden hatte, den Spieß umzudrehen und kraft seiner Argumentation seinen Mandanten als das Unschuldslamm hinzustellen, das er noch nie gewesen war.
In dieser Hinsicht war Rechtsanwalt Heribert Döllinger schlichtweg brillant.
Seine rhetorischen Taschenspielertricks und juristischen Winkelzüge ließ er sich teuer bezahlen. Sein Stundenhonorar war exorbitant.
So exorbitant, dass er sich gelegentlich ein paar hübsche Extravaganzen leisten konnte.
Das Mercedes 220 SE W111 Cabriolet aus dem Jahr 1963 in Himmelblau etwa. Ein Oldtimer, der noch heute wegen seiner zeitlosen Eleganz, seines Top-Erhaltungszustands und seiner Exklusivität Aufsehen erregte.
Quasi ein Ebenbild seiner selbst, stellte er nach einem letzten Blick in den Spiegel in seiner exklusiven Penthousewohnung in Friedrichshafen nicht ohne einen guten Schuss Selbstironie fest, zu der er in Vorfreude auf einen Abend im Casino zuweilen durchaus fähig war, und zwinkerte seinem Alter Ego im Spiegel zu, während er den perfekten Sitz seiner Seidenkrawatte von Gucci noch einmal überprüfte.
Er war nicht rein zufällig vom selben Jahrgang wie sein bestens in Schuss gehaltener Mercedes. Wie sein standesgemäßer Wagen war sein Äußeres – Gestus und Habitus – stets makellos, wenn auch sein Haar ein wenig dünn und grau geworden war, aber im Großen und Ganzen hatte er sich gut gehalten, fand er. Und wenn etwas generalüberholt werden musste – was bei vielen Teilen des Mercedes und bei seinem Gebiss nötig geworden war –, so war das nun einmal dem unbarmherzigen Lauf der Zeit geschuldet und wurde von entsprechenden Spezialisten in Werkstatt und Zahnarztpraxis erledigt, sodass alles immer wie neu aussah und die glänzende Karosserie seines Cabrios mit seinen Jacketkronen um die Wette blitzte.
Obwohl Döllinger so tat, als würde ihn das völlig kaltlassen, sonnte er sich doch allzu gern im Neid und in der Bewunderung von Menschen, die es nicht so weit gebracht hatten wie er.
Er war Junggeselle und kinderlos und sein Zeitmanagement und sein Budget für außergewöhnliche Geldausgaben infolgedessen ganz allein seine Sache.
Genauso wie sein Umgang mit anderen Menschen. Freunde hatte er so gut wie keine. Er war sich schon seit Schulzeiten immer selbst genug gewesen. Ein Einzelgänger aus Überzeugung.
So hatte er am Abend nach einem besonderen Coup, in dem er es geschafft hatte, dass sein Mandant wegen eines nachgewiesenen Verfahrensfehlers und zurückgenommener Zeugenaussagen als freier Mann das Gericht verlassen konnte, beschlossen, die Einladung seines Mandanten zur Siegesfeier in einem angesagten und sündteuren Gourmettempel nicht anzunehmen und lieber wieder einmal ganz für sich am Spieltisch über die Stränge zu schlagen.
Der Grund dafür war eigentlich nicht, dass er den Klienten sowieso nicht ausstehen konnte, weil dieser so ziemlich jeden Dreck am Stecken hatte, dessen er angeklagt war, sondern dass er sich nichts Ätzenderes vorstellen konnte, als privat mit jemandem zu verkehren, dessen IQ höchstens als zweistellig und dessen Benehmen nur mit ganz viel gutem Willen als halbwegs gesellschaftsfähig einzustufen war.
Außer er war aus geschäftlichen Gründen dazu gezwungen.
Aber das war hier nicht mehr der Fall.
Der Prozess war gewonnen, die Geschäftsbeziehung somit abgeschlossen.
Außerdem war dieser Mandant ein waschechter Gangster mit Gangstermanieren und -attitüden, die er sich wohl in einschlägigen Mafiafilmen abgeschaut und zugelegt hatte. Er war Oberhaupt eines riesigen Familienclans, der sich seit einer Generation im Bodenseeraum ausgebreitet hatte wie Wasseralgen in einem überdüngten Aquarium und dort die Geschäfte mit Drogen und Prostitution kontrollierte.
Beim Gedanken an einen mehrstündigen quälenden Small Talk mit einer geistigen Amöbe, die ihre aufgepumpte Bodybuilderfigur in glitzernden Maßanzügen herumtrug und Goldketten um den Hals hängen hatte, mit denen man Güterzüge aneinanderkoppeln könnte, schüttelte sich Döllinger innerlich – das wäre wahrlich ein reizender und intellektuell anregender Abend geworden.
Ganz abgesehen davon, dass er eine strikte Trennung von Beruf und Privatleben auch öffentlich demonstrieren musste. Wenn irgendein Smartphone-Schnappschuss mit dieser bekannten und berüchtigten Kiezgröße beim Nobeldinner in trauter Zweisamkeit im Netz kursierte, wäre das für seinen Ruf nicht gerade förderlich.
Also sagte er die Einladung aus dringenden terminlichen Gründen freundlich, aber bestimmt ab, stockte sein Erfolgshonorar im Geiste noch einmal um zehn Prozent auf und freute sich darauf, im Casino den beruflichen Stress abbauen und seinen Sieg feiern zu können. Mit einem schönen Schuss zusätzlichen Adrenalins, weil er diesmal noch riskanter setzen konnte – Spielgeld genug hatte er.
Und heute lief es tatsächlich wie geschmiert. So eine lang anhaltende Glückssträhne wie in dieser Nacht – er ging grundsätzlich erst nach dreiundzwanzig Uhr ins Casino – hatte er noch nie gehabt.
Egal ob er mit der Bank oder gegen sie spielte – er gewann.
Bald versammelten sich neugierige und sensationslüsterne Zuschauer an seinem Tisch, weil es sich schnell herumgesprochen hatte, dass dort einer dabei war, die Bank gehörig zu rupfen, wenn nicht sogar zu sprengen. Er genoss die Aufmerksamkeit wie bei einem seiner Plädoyers vor Gericht, obwohl er scheinbar nur Augen und Ohren für die Zahlen auf dem grünen Filz und die Ansagen der Croupiers hatte.
Vereinzelt begannen die Zaungäste, die auf der Verliererstraße waren und nervös mit schwitzigen Händen mit ihren letzten Jetons in den Taschen herumspielten, sogar mit ihm zu setzen, weil sie merkten, dass er einen Lauf hatte und daran partizipieren wollten.
Als achtmal hintereinander Rot kam, platzierte er seine Jetons erst recht erneut auf Rot.
Jetzt traute sich niemand mehr, mit ihm mitzugehen.
Das Tischpersonal wechselte, das Glück blieb bei Döllinger.
Die Drei kam.
Ein Raunen ging durch die Zuschauerreihen, weil die Kugel tatsächlich ein neuntes Mal auf einer roten Zahl gelandet war.
Diesmal ließ Döllinger den Gewinn nicht auf Rot liegen wie die acht Male zuvor.
Mit traumwandlerischer Sicherheit schob er zur allgemeinen Verwunderung seine Jetonstapel auf Schwarz, der Croupier neben ihm musste mit seinem Rateau nachhelfen, so viele waren es.
Endlich setzte der Wurfcroupier die Roulettescheibe wieder in Bewegung und schnippte die Kugel routiniert gegen die Drehrichtung in den Zylinder.
Das Geräusch der rollenden Kugel versetzte Döllinger in eine Art Metazustand. Er glaubte in diesem Augenblick wirklich daran, dass sie das tat, was er ihr geistig vorgab.
Alles starrte gebannt in den Kessel, einige Spieler platzierten noch schnell im allerletzten Augenblick ebenfalls ihre Jetons auf Schwarz.
Dann sprach der Chefcroupier sein »Rien ne va plus«, und die Kugel fiel klappernd in ein Nummernfach.
Es war die Fünfzehn.
Schwarz.
Döllinger beschloss, von nun an seine Strategie zu ändern und primär auf Voisins zu setzen, das sogenannte Spiel mit Nachbarn, Zahlen, die im Kessel nebeneinanderlagen. Sein Einsatz auf den einfachen Chancen war nur eine Art Aufwärmprogramm gewesen.
Jetzt begann er, richtig Roulette zu spielen und wie besessen mehrere Einsätze gleichzeitig zu platzieren.
Voisins, Cheval, Transversale pleine, Transversale simple, Carré, Orphelins, Finale eins, zwei oder drei.
Eine Stunde lang wuchs sein Gewinn langsam, aber stetig an.
Doch dann gewann er fünfmal hintereinander mit seiner Lieblingskombination Einundzwanzig-Zwo-Zwo.
Inzwischen stapelte sich ein kleines Vermögen auf seinem Platz.
Es war an der Zeit, aufs Ganze zu gehen.
Als er das Maximum – er war natürlich am teuersten Tisch – auf Zero-Zwo-Zwo setzte und die Kugel im letzten Moment in das Fach mit der Null kullerte, wurde aus dem Raunen im Publikum ein regelrechtes kollektives Stöhnen.
Heribert Döllinger sah mit seinem üblichen undurchdringlichen Pokergesicht scheinbar gleichgültig zu, wie ihm sein Gewinn vom Wurfcroupier mit dem Rateau in schokoladentafelgroßen Jetons zugeschoben wurde, beschloss in diesem Augenblick des größten Triumphs, es für diesmal gut sein zu lassen, gab großzügig Trinkgeld für den Tronc und machte sich schließlich mit einem Angestellten, der die ganzen Jetons für ihn trug, auf zur Kasse, um sich seinen Gewinn – über neunzigtausend Euro – dort auszahlen zu lassen.
Wie alle richtigen Zocker wollte er keinen Scheck, sondern bevorzugte es, sich die Geldscheine vorzählen zu lassen und sich die Bündel in die Taschen zu stopfen, als wäre es Kleingeld.
Er lehnte jede Begleitung vom Sicherheitsdienst ab, die ihm angeboten wurde, nahm an der Bar noch einen Drink – einen doppelten Single Malt ohne Eis – und begab sich zu seinem Mercedes nach draußen.
Es war eine milde, sternklare Nacht, und Döllinger achtete darauf, dass ihm niemand folgte, bis er in seinem Auto saß und im Schritttempo vom Parkplatz rollte.
Auf der langen Fahrt durch die äußeren Bezirke von Konstanz zum Fährhafen im Stadtteil Staad kam er allmählich wieder herunter von seinem High, das er so schon lange nicht mehr verspürt hatte, nicht einmal vor zwei Jahren, als es ihm gelungen war, einen notorischen Raser, Spross einer schwerreichen Industriellenfamilie, der bei einem illegalen Autorennen im Stadtgebiet von Stuttgart einen schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten verursacht hatte, vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, obwohl es eigentlich aussichtslos war. Dafür hatte er das höchste Erfolgshonorar seiner Karriere eingestrichen.
Am Fährhafen hatte er wieder Glück – diesmal mit der Autofähre, die so spät nachts nur stündlich verkehrte. Er wurde gerade noch vom Lademeister auf das Fahrzeugdeck gewinkt, bevor sie auch schon ablegte.
Er stieg aus seinem Auto, um sich hinten im windabgewandten Heck die Füße zu vertreten und sich eine wohlverdiente Cohiba Espléndido anzustecken. Geistesabwesend sah er zu, wie die Rauchkringel seiner Zigarre sich in der Luft auflösten und die Lichter von Konstanz allmählich kleiner wurden.
Erst jetzt gelang es ihm, sich zu entspannen und sein unverschämtes Massel zum ersten Mal so richtig zu genießen.
Sein Temperament war nicht gerade heißblütig, aber diesmal stieß er mit einer Faust in die Luft und ein triumphierendes »Jaaaa!« kam aus seiner Kehle, das er sich erlaubte, weil das gleichmäßig kräftige Brummen des Schiffsmotors und das Rauschen des Kielwassers sowieso jedes Geräusch erstickten. Außerdem war er ganz für sich, die wenigen Leute, die mit ihm um diese Zeit auf der Fähre übersetzten, hatten es vorgezogen, entweder für ein Nickerchen in ihrem Auto sitzen zu bleiben oder sich in den Aufenthaltsraum ein Deck weiter oben zu begeben, wo es Automaten für Snacks und Getränke gab.
Er stellte sich waghalsig und verbotenerweise hinter die Absperrkette – was konnte ihm heute schon passieren! – an den äußersten Rand des Hecks, um das Gefühl besser auskosten zu können, einmal das Casino besiegt zu haben.
Irgendwie fühlte er sich an Leonardo DiCaprio erinnert, als der auf dem Bug der »Titanic« stand und im Überschwang der Gefühle sein »I’m the king of the world!« dem Himmel entgegenschmetterte, weil er glaubte, die Götter herausfordern und es mit ihnen aufnehmen zu können.
Aber das war kurz bevor die »Titanic« mit einem Eisberg zusammenstieß.
Genau in dem Augenblick, als Döllinger aus einer naheliegenden Assoziation heraus an dieses böse Omen dachte, spürte er einen heftigen Schlag gegen den Rücken.
Es war das Letzte, was er in diesem Leben spürte.
Der Schlag war so heftig, dass er gegen die Fahrtrichtung der Fähre vorwärtsstolperte und mitsamt seiner Cohiba Espléndido sang- und klanglos über Bord ging.
Sein Glückskonto war mit dem heutigen Abend endgültig aufgebraucht.
Knapp eine Viertelstunde später legte die Fähre in Meersburg an, und zwei Lastwagen und ein Dutzend Autos und Lieferwagen fuhren über die klappernde Metallrampe von Bord.
Der himmelblaue Mercedes war in Konstanz als letzter Wagen aufs Deck gekommen, deshalb stand er keinem im Weg.
Der zuständige Lademeister winkte ihm erfolglos zu und setzte sich schließlich in Bewegung, um nach dem Rechten zu sehen.
Er kam näher und warf einen Blick ins Wageninnere.
Es war niemand am Steuer, der Mercedes war nicht abgesperrt, und der Zündschlüssel steckte.
Vom Fahrer war weit und breit nichts zu erkennen.
Der Lademeister fluchte. Bevor er die auf der Wartespur für die Rückfahrt nach Konstanz-Staad bereitstehenden Fahrzeuge auf die Fähre lassen konnte, musste er den abwesenden Mercedes-Fahrer ausfindig machen. Das brachte den ganzen Zeitplan durcheinander.
Außerdem wollte er sich eigentlich eine Zigarettenpause gönnen.
Vielleicht war der Fahrer nur aufs WC gegangen und dort eingeschlafen. Das war bei Nachtfahrten schon mal vorgekommen.
Auf dem Weg zu den Steuerbordtoiletten zückte er sein Funkgerät und machte notgedrungen Meldung beim Kapitän.
2
There’s a killer on the roadHis brain is squirmin’ like a toadTake a long holidayLet your children playIf you give this man a rideSweet family will dieKiller on the road
The Doors, »Riders On The Storm«
Kommissar Max Madlener kochte.
Ausnahmsweise einmal nicht vor Wut, sondern am Herd seiner Küche in seiner erst vor Kurzem bezogenen Dachgeschosswohnung in der City von Friedrichshafen. Dort machte er sich noch eine Portion Linguini Bolognese, obwohl es fast fünf Uhr in der Nacht war.
Das war sogar für ihn ungewöhnlich, obwohl er normalerweise sowieso nicht das tat, was für den überwiegenden Teil der Bevölkerung unter der Rubrik »konventionell« einzuordnen war, aber er konnte wieder einmal nicht einschlafen, weil er unter Insomnie litt, was daran lag, dass ihm wie so oft zu viel irrlichternde Gedanken in seinem Kopf herumspukten. Außerdem verspürte er, als er nach dem vergeblichen zweistündigen Versuch, endlich in Morpheus’ Arme zu sinken, den aussichtslosen Kampf aufgegeben und sein Bett verlassen hatte, einen Mordskohldampf. Vielleicht war es doch sein knurrender Magen, der ein erfolgreiches Einschlummern verhindert hatte, was durchaus möglich war, weil er seit zwei Tagen rigoros Diät machte.
Was in seinem Fall hieß, dass er sich eines Morgens vor Dienstbeginn nach einem Blick auf die Waage felsenfest vorgenommen hatte, auf die harte und schnellstmögliche Tour fünf Kilo abzunehmen.
Eine Schnapsidee, zugegeben, aber es musste sein.
Schließlich hatte er in Simone Zoller, der Tochter seines verstorbenen Ex-Kollegen Wohlfahrt, eine Frau kennengelernt, für die es sich lohnte, einen guten Eindruck zu machen, sowohl von seiner Persönlichkeit her als auch physisch.
Und das hieß letzten Endes, so hart ihn das ankam, nachdem er alle Alternativen durchgegangen war: FdH – friss die Hälfte.
Und dazu noch irgendeine sinnvolle sportliche Betätigung. Das legten ihm sein Arzt nahe und sein gesunder Menschenverstand.
Tennis, seinem Alter und seinem Status angemessen, kam für ihn nicht in Frage, seit er sich vor geraumer Zeit von seiner damaligen Lebensgefährtin, der Pathologin Dr. Ellen Herzog, die schon seit ihrer ersten Ehe Mitglied im Friedrichshafener Tennisclub Blau-Weiß 74 war, hatte überreden lassen, das Ganze einmal auszuprobieren. Sie hatte ihn so lange damit gelöchert, dass er schließlich nachgab. Aber das, was er da an Vereinsmeierei erlebt hatte, war für ihn mehr als abschreckend gewesen. Ganz davon abgesehen, dass fast alle Tennispartner von Ellen aus dem medizinischen Bereich kamen und infolgedessen nur ein Gesprächsthema hatten, über das sie sich in allen Spielarten lustig machten: Patienten und ihre realen und eingebildeten Krankheiten.
Trotzdem absolvierte er Ellen zuliebe einen Schnupperkurs, den sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Der Teilzeittennistrainer, ein geradezu unverschämt fitter, offensichtlich sadistisch veranlagter Offizier der Bundeswehr, hatte ihn wohl mit einem unwilligen Wehrpflichtigen verwechselt, dem mal ordentlich die Hammelbeine lang gezogen werden mussten, wie er spaßeshalber angesichts von Madleners schlechter Kondition und Treffsicherheit sagte, was nur er lustig fand und Madlener überhaupt nicht. Erst recht ärgerte sich Madlener bis aufs Blut, weil er von ihm über den Platz gejagt wurde wie ein Rekrut bei der Grundausbildung, und das mit einem Anfeuerungsvokabular, das Madlener schon zu Jugendzeiten verhasst gewesen war.
Er erinnerte sich nur allzu gut daran.
Sie hatten an der Grundschule tatsächlich einen Sportlehrer gehabt, der anscheinend noch im Dritten Reich ausgebildet worden war und dessen Lieblingsfloskel beim Zirkeltraining aus der Drohung bestand: »Ich werde euch hetzen, bis euch das Arschwasser kocht!«
Nazijargon, Nachtmärsche, das gemeinsame Absingen von martialischen Kriegsliedern und Gruppenzwang waren der Grund dafür, dass er sämtlichen Jugendorganisationen ferngeblieben war, in die ihn Klassenkameraden und Freunde mitschleppen wollten. Egal, ob das die Pfadfinder, der CVJM oder die Naturfreundejugend waren.
Seiner Wehrpflicht bei der Bundeswehr war er ebenfalls nicht nachgekommen. Er war – wie sein älterer Bruder – Kriegsdienstverweigerer und hatte seinen Ersatzdienst in einem Heim für Behinderte abgeleistet.
Madlener war durch und durch Zivilist aus Überzeugung und brachte für alles Militärische nur Verachtung auf.
Deshalb beschloss er, dem Trainer sein Getue heimzuzahlen. Es gelang ihm, ihn einmal schmerzhaft mit dem Ball abzuschießen, und beim anschließenden gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte des Vereinsheims sagte er mehrfach wie aus Versehen »Wehrmacht« statt »Bundeswehr«, weil er merkte, dass er ihn damit zur Weißglut treiben konnte.
Danach gab er Ellen seinen sofortigen Rücktritt von einer sowieso nicht sehr vielversprechenden Karriere als Freizeittennisspieler bekannt. Als Ellen ihn daraufhin wenigstens zum Golfspielen überreden wollte – wobei im Golfclub genau dieselben üblichen Verdächtigen waren wie beim Tennis, nämlich die Kolleginnen und Kollegen Ellens von der medizinischen Fakultät –, führte das zu einer nicht unerheblichen Abkühlung ihrer Beziehung, weil er auch das ablehnte. Das Ende vom Lied kam schließlich, weil er sich nicht entschließen konnte, bei ihr einzuziehen, solange ihr Vater, der Psychiater Dr. Dr. h. c. Auerbach, im ersten Stock des gemeinsamen Hauses wohnte.
Tennis und Golf waren also fortan auf seiner schwarzen Liste der sportlichen Aktivitäten, neben allem, was mit Reiten zu tun hatte – auch ein Hobby von Ellen –, und im Grunde genommen alle Mannschaftssportarten.
Madlener hatte eine Menge Listen, die er ständig der Zeit und den Gegebenheiten anpasste. Die meisten davon waren allerdings nur in seinem Kopf. Angefangen von Dingen, die die Welt nicht brauchte, bis zu seinen geliebten Hitlisten der besten Popsongs aller Zeiten, an denen er ständig schriftlich herumbastelte, wenn er aus beruflichen Gründen einem stinklangweiligen Vortrag zuhören musste oder wieder einmal nicht einschlafen konnte.
»Gymnastik fürs Gehirn« nannte er das.
Für ihn war das ein geheimer und stiller Zeitvertreib, den er bisweilen exzessiv betreiben konnte.
Für den Psychiater Dr. Auerbach, den Vater seiner Ex-Lebensgefährtin, eine bedenkliche und dringend behandlungsbedürftige Zwangsneurose.
Wie dem auch sein mochte – irgendetwas musste Madlener tun, um seine überflüssigen Pfunde herunterzukochen, wie man im Boxerjargon sagte.
Boxen war ihm deshalb in den Sinn gekommen, weil seine junge Kollegin Harriet Holtby zwei- oder dreimal in der Woche Boxtraining in einem Studio machte. Er hatte sie dort einmal abgeholt und ihr zugesehen, wie sie sich bis zur völligen Erschöpfung verausgabte.
Das mochte für Harriet die richtige Art und Weise sein, überschüssige Energie und Wut – und davon hatte sie eine Menge – loszuwerden, aber für ihn kam das nicht mehr in Frage. Einen Rest von Würde wollte er sich schon noch bewahren.
Jetzt in seinem gesetzten Alter damit anzufangen, sich die Birne weichschlagen zu lassen, grenzte schon an Masochismus.
Nein, lächerlich machen wollte er sich auch nicht.
Was gab es also noch?
Krafttraining in einer Fitness- und Muckibude? Zwischen tattooübersäten Testosteron- und Steroidmonstern und Superfrauen wie aus Marvel-Comics mit Sixpacks und künstlicher Sonnenbankbräune?
Ausgeschlossen.
Was blieb dann noch übrig?
Radfahren? Joggen?
Er stellte sich vor, wie er mit einem lächerlichen Stirnband um den hochroten Kopf dem Herzinfarkt entgegenstrampelte, während er eigentlich vor ihm davonlaufen wollte.
Schwimmen?
Zwei Bahnen im Fünfzig-Meter-Becken des städtischen Hallenbads, einen Steinwurf vom Polizeipräsidium entfernt, und er war platt.
Ganz abgesehen davon, dass Duschen und Umkleidekabinen seiner Meinung nach Brutstätten für Fußpilzkolonien waren.
Ihn schauderte, wenn er nur daran dachte.
Je gründlicher er darüber sinnierte, desto mehr kristallisierte sich der Verdacht in ihm heraus, dass er einfach gegen jede Art von sportlicher Betätigung etwas einzuwenden hatte.
Um Ausreden war er nie verlegen.
Er war nun einmal eine einzige Fundgrube für jeden Analytiker.
Deshalb ging er ihnen auch strikt aus dem Weg.
Oder führte sie an der Nase herum wie seinen ehemaligen Schwiegervater in spe.
Der einzige Sport, dem er wirklich mit aller Leidenschaft nachging, war die Jagd auf Kriminelle. Davon verstand er etwas, und in der Beziehung hatte er auch die Kondition eines Marathonläufers, bildlich gesehen.
Aber damit konnte man keine überflüssigen Kalorien abbauen.
Also musste er sich, wenn er wirklich ernsthaft abnehmen wollte, wenigstens beim Essen zusammenreißen, eine radikale Hungerkur machen und sich in Zukunft bewusster ernähren, um nicht dem allseits publizierten Jo-Jo-Effekt anheimzufallen, dessen Opfer anscheinend jeder Zweite wurde – es musste sich dabei um eine Epidemie ungeahnten Ausmaßes handeln.
Alles andere kam für ihn einfach nicht in Frage: zu kompliziert, zu umständlich, zu zeitintensiv, zu abgehoben.
Zum ersten Mal hatte er sich ernsthaft mit diesem Problem auseinandergesetzt, als er neulich am Zeitschriftenregal im Supermarkt stehen geblieben war, nachdem er wie immer, seit er neuerdings nicht mehr im Hotel »Zum silbernen Zeppelin« wohnte und für sich selbst sorgen musste, mehr oder weniger bedenkenlos ordentlich Wurst, Fleisch, Tiefkühlpizzen und sonstige kalorien- und fettreiche Nahrungsmittel sowie Alkohol in Form von Weinflaschen in seinen Einkaufswagen geladen hatte. Als er die Schlagzeilen der unzähligen Zeitschriften überflog, die dort in endlosen Reihen ausgestellt waren, kam er auf die – wie sich hinterher herausstellte: schwachsinnige – Idee, sich in relevanten Artikeln in diversen Frauenzeitschriften Rat für seine eingebildete Übergewichtsproblematik zu holen. Nach geschlagenen zwanzig Minuten neben einer verhärmten Rentnerin mit Wollmütze, die sich wie er über die Illustrierten hermachte, wenn auch bevorzugt über solche mit den neuesten gefakten oder frei erfundenen und reichlich bebilderten Klatschgeschichten aus dem europäischen Hoch- und Niederadel, gelangte er schließlich verwirrt zu der Erkenntnis, dass Übergewicht neben Klimawandel, Terrorismus, Brexit, Flüchtlingsproblematik, Dieselskandal und Globalisierung anscheinend zu den sieben Urängsten der mitteleuropäischen menschlichen Spezies des 21. Jahrhunderts zählte.
Jedenfalls wenn er den Themen der unzähligen Printmedien Glauben schenken wollte.
Es gab aberwitzig viele verschiedene Arten, überflüssige Pfunde zu bekämpfen und loszuwerden, angefangen mit der Trennkost-, Blitz-, F.-X.-Mayr- oder Hollywood-Diät über Weight Watchers, Rohkostdiät bis zur Low-Carb- und 16:8-Methode, auch Intervallfasten genannt – acht Stunden essen, sechzehn Stunden fasten, Jesus! –, und der ayurvedischen oder ausschließlich basischen Ernährung, nicht zu vergessen die Wundermittel aus den Hexenküchen der Pharmaindustrie, mit denen man sein Gewicht binnen vier Wochen praktisch halbieren konnte – wenn man die Versprechungen der Hochglanzwerbung und die Vorher-Nachher-Fotos für bare Münze nehmen wollte.
Die Sehnsucht nach einzig richtiger und gesunder Ernährung hatte gewissermaßen die Züge einer Ersatzreligion angenommen.
Dabei hatte die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen eine kompromisslose Schärfe erreicht, die schon als Fanatismus zu bezeichnen war. Jede noch so absurde Methode hatte anscheinend die absolute Wahrheit für sich gepachtet.
Das, was die anderen machten, trug gewissermaßen zum Untergang der Menschheit bei.
Ihn schauderte.
Dort draußen in einer Art Paralleluniversum, von dem Madlener bisher nichts wahrgenommen hatte, tobte offenbar ein erbitterter Glaubenskrieg um die einzig richtige Daseinsform, in dem mit einer Vehemenz und Verbissenheit um jedes Gramm Körpergewicht gekämpft wurde, als ginge es um Leben und Tod.
Wahrscheinlich ging es wirklich darum, das jedenfalls hatte ihm sein Arzt nach dem letzten Gesundheitstest mit sorgenzerfurchter Stirn gesagt, als er die Zacken seines Belastungskardiogramms und seinen Body-Mass-Index interpretierte. Madleners Körpergewicht geteilt durch Größe zum Quadrat sorgte für eine ernste Miene seines Arztes, die noch viel besorgter wurde, als er die anderen Werte vom Laborbericht ablas und seinen medizinischen Senf dazugab. Madleners Blutdruck, seine Leberwerte sowie sein Cholesterinspiegel waren zu hoch, sein Lungenvolumen dagegen war zu niedrig.
Bei den Angaben zu seinen Trinkgewohnheiten schummelte Madlener lieber, weil er verhindern wollte, dass sein Doktor darüber nachdachte, ob er ihm Adresse und Telefonnummer der Anonymen Alkoholiker geben sollte. Und dass er mal wieder mit dem Rauchen angefangen hatte, traute er sich erst recht nicht zu sagen, um seinen Arzt nicht in die Verlegenheit zu bringen, nach Feierabend in seinen Schreibtischschubladen nach der Vorlage für den Totenschein zu suchen, der in Madleners Fall demnächst ausgefüllt werden musste.
Er wusste selbst, dass er fraglos etwas für seine Gesundheit und seine Gewichtsreduktion tun musste, so wollte er nicht weitermachen.
Wenn er an seine Kollegin Harriet Holtby dachte, die fit wie ein Turnschuh war, sagten ihm die Miene seines Arztes und eine innere Stimme, dass er zumindest den gedankenlosen Verzehr von Fast Food und Zimtschnecken aus seiner Lieblingsbäckerei nicht nur bremsen, sondern damit ganz Schluss machen musste. Ebenso mit spontanem Alkoholkonsum und dem unbewussten Griff zur Zigarettenschachtel.
Seit er sich von Ellen Herzog getrennt hatte, war sein halbwegs geordneter Lebens- und Ernährungsstil irgendwie den Jordan hinuntergegangen, beziehungsweise den Rhein, geografisch korrekt ausgedrückt.
Zu viel Büroarbeit, zu viel Fast Food, zu viele Softdrinks, zu viel Alkohol, zu viele Zigaretten.
Zu viel von allem.
Und was war der Grund dafür?
Wenn er ganz tief schürfte und sein innerstes Ich befragte, gab es nur eine einigermaßen plausible Antwort: weil ihm alles egal war.
Am besten wäre es gewesen, für sechs Wochen in ein Kloster zu gehen. Am allerbesten wäre ein Zen-Kloster, aber Japan war ihm doch zu weit weg und dummerweise sprach er kein Wort Japanisch. Ihm schwebte ein Kartäuserkloster irgendwo im hintersten Winkel der Alpen vor, abgeschieden von der Welt, weil man da schweigen konnte und ganz auf sich selbst zurückgeworfen wurde. Auf den Geschmack gekommen war er durch einen Film, Ellen hatte ihn deswegen ins Kino geschleppt. »Die große Stille« hieß er, soweit er sich erinnerte. Der Film hatte ihm seltsamerweise gefallen, obwohl eigentlich so gut wie nichts passierte, aber das war gerade das Besondere daran. Bei streng rationiertem Wasser und Brot, kontemplativer Arbeit und meditativen Spaziergängen sowie philosophischen Exerzitien in härenen Gewändern konnte sich vielleicht so etwas wie eine seelische und körperliche Runderneuerung einstellen, die dringend notwendig war, eine erlösende Katharsis.
Allein diese unrealistische Wunschvorstellung, die ihn immer wieder aus dem Nichts ansprang wie die Alienkreatur im Raumschiff »Nostromo«, sobald er die Augen schloss, um nachzudenken, oder versuchte einzuschlafen, und die natürlich ein Trugbild war, eine irrationale Flucht in Phantasiewelten, zeigte ihm, dass es an der Zeit war, sein Leben neu auszurichten.
Erst durch den vagen Hoffnungsschimmer auf etwas Neues und Aufregendes in seinem Dasein, nämlich eine vielversprechende Begegnung mit einer außerordentlich attraktiven, intelligenten, humorvollen und sympathischen Vertreterin des weiblichen Geschlechts, war er urplötzlich aufgewacht und auf die Idee gekommen, dass er wieder an sich selbst denken und arbeiten musste, wenn er sich und seine Lebenseinstellung nicht ganz dem Stress und dem Trott des Alltags opfern wollte.
Im ganzen Kuddelmuddel der letzten Zeit hatte er tatsächlich eine zentrale Frage komplett aus den Augen verloren.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Jeder musste sie für sich selbst beantworten.
Nicht von jetzt auf gleich, dafür war die Frage zu schwierig.
Womöglich war es auch nicht vorgesehen, darauf eine eindeutige Antwort geben zu können.
Weil es darauf keine Antwort gab oder geben konnte.
Aber vielleicht war der Weg das Ziel.
Man musste es wenigstens versuchen.
So wie er versuchte, ein guter Polizist zu sein, wenn es schon zu einem guten Menschen nicht ganz reichte.
Der Versuch zählte.
Und der Wille, es immer wieder zu probieren, auch wenn man scheiterte.
War es denn ein Wunder, dass er nicht einschlafen konnte?
Wenn er sich ständig mit solch essenziellen Fragen auseinandersetzte?
In diesem Augenblick am Zeitschriftenregal im Supermarkt zweifelte er wieder am Verstand der Menschheit, als er ein teures Männermagazin namens »Beef« zurücklegte, das zur Hälfte aus ganzseitigen Hochglanzfotos von rohen Fleischstücken bestand.
Ein neuer Beitrag für seine Dauerbrennerliste von Dingen, welche die Welt nicht brauchte.
Ganz weit oben angesiedelt.
Noch vor der Duravit-Fernbedienung für Klospülungen.
Geistesabwesend wandte er sich um und sah direkt in die Augen der gebeugten alten Frau neben sich, die seinen resignierten Blick ebenso resigniert erwiderte und dann ihr Heft über die neuesten Skandale des englischen Königshauses ins Regal zurücksteckte.
Hatte sie auch ein Leben mit der Sinnfrage vergeudet und war ersatzweise stattdessen schließlich bei der grundsätzlichen Frage gelandet, wann Prinz Charles Mountbatten-Windsor endlich König anstelle der Queen sein würde?
»Das erleben wir beide nicht mehr«, wollte er der alten Dame ehrlichkeitshalber sagen, ließ es aber dann lieber, weil es unhöflich gewesen wäre, und lud seinen Einkauf auf das Band an der Kasse.
Queen Mom, also die Mutter der gegenwärtigen englischen Königin, war stolze einhunderteins Jahre alt geworden. Obwohl sie offensichtlich ganz gern einen zur Brust genommen hatte – »a few decent drinks every day!« –, wie ihr Butler zu berichten wusste. Die Royals hatten eben ihr Leben lang andere für sich arbeiten lassen und außerdem gute Gene. Alter deutscher Adel, Sachsen-Coburg und Gotha.
Nachdem er mit seinem Einkaufswagen beim Bäcker anstand, um doch noch ein paar Zimtschnecken zu kaufen, bekam er mit, wie die alte Dame, die nur sechs Päckchen mit billigstem Katzenfutter in ihrem Einkaufswagen hatte, mühsam ihr letztes Kleingeld an der Kasse zusammenklaubte, um bezahlen zu können.
Er schob seinen mit Lebensmitteln vollgepackten Wagen auf den Parkplatz hinaus und beobachtete die Rentnerin weiter, er wusste eigentlich nicht so recht warum. Wie sie die Heckklappe eines uralten, von Rostpickeln übersäten Ford Fiesta öffnete und ihren spärlichen Einkauf im Kofferraum unterbrachte. Dann schob sie den leeren Einkaufswagen zurück zum weiter entfernten Sammeldepot, um ihn dort abzustellen.
In einem spontanen Entschluss packte Madlener alles, was er eingekauft hatte – bis auf die Zimtschnecken –, in den nicht abgeschlossenen Kofferraum des Fiesta und drückte rechtzeitig den Kofferraumdeckel wieder zu, bevor die alte Dame zurückkam und mit ihrer TÜV-überfälligen Klapperkiste vom Parkplatz fuhr.
Warum er das getan hatte, hätte Madlener nicht rational erklären können.
Aber irgendwie war er erleichtert.
In jeder Beziehung.
Als hätte er mit dem äußeren Ballast auch gleichzeitig den inneren abgegeben.
Und jetzt stand er um fünf Uhr in der Früh an seinem Herd, dachte über all das nach und achtete nebenbei darauf, dass er seine Linguini nicht zu lange im kochenden Wasser ließ. Als er eine Nudel herausfischte und überprüfte, ob sie al dente war, wurde ihm klar, dass er nicht gerade zur Selbstkasteiung taugte.
Es war das alte Lied: Die Halbwertszeit seiner guten Vorsätze betrug gerade mal höchstens ein oder zwei Tage.
Ein Leben im Kloster war doch nichts für ihn, nicht einmal in seiner Einbildung.
Er goss die Nudeln rechtzeitig in das Sieb über der Spüle und richtete sie auf seinem Teller mit der Fertigbolognesesoße an, die er gleichzeitig warm gemacht hatte. Er hobelte Parmesan darüber und hörte beim Essen seinen Lieblingssongs aus seiner Jukebox zu, eine Kombination, die sein schlechtes Gewissen beruhigte und seine melancholische Stimmung deutlich verbesserte, zumal er noch eine Flasche Rèmole gefunden und entkorkt hatte. Als der Titel »Riders On The Storm« von den Doors lief, nahm er einen Schluck Chianti und überprüfte das kräftige Rubinrot seines Weins, indem er das Glas gegen das Licht hielt und dabei dem unvergleichlichen Keyboard von Ray Manzarek zuhörte, das so sanft rieselte wie ein leichter Sommerregen.
Er merkte, dass er auf einmal angenehm müde geworden war.
Heute war Sonntag, da konnte er ausschlafen. Außerdem kam Simone Zoller aus Berlin zurück, wo sie noch einige geschäftliche und private Dinge abzuwickeln hatte, bevor sie endgültig das Haus in Friedrichshafen bezog, das sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatte, Kommissar im Ruhestand Roland Wohlfahrt, der Madleners Freund gewesen war.
Madlener freute sich auf ein Wiedersehen. Ihr letztes Zusammentreffen war jetzt schon einige Wochen her. Er war bei ihrer Hauseinweihungsparty gewesen und hatte erfreut festgestellt, dass er sich wunderbar mit ihr verstand. Sie hatte alles, was er mochte, sie sah gut aus, war schlagfertig, hatte Humor und keinen Vater wie Ellen, der ihn ständig analysieren wollte. Außerdem war sie alleinstehend. Er hatte sie im Gegenzug auf seine Housewarmingparty eine Woche später eingeladen, und sie sagte zu.
Madlener hatte ihr wohlweislich verschwiegen, dass er die Party exklusiv für sie veranstaltete. Sie war also der einzige Gast gewesen, er hatte Involtini mit Tagliatelle gemacht, das konnte er gut, und die Zeit war wie im Flug vergangen. Es war spät geworden, und er hatte ihr angeboten, in seinem Gästezimmer zu übernachten, weil sie zu viel getrunken hatte, um noch heimfahren zu können. Sie hatte nicht Nein gesagt, und das Gästezimmer blieb in dieser Nacht unbenutzt.
Damals war er auch nicht zum Schlafen gekommen, aber das hatte andere Gründe gehabt als seine Insomnie.
Ganz andere Gründe.
Beim Gedanken daran lächelte er.
Bisweilen hatte das Leben doch auch seine schönen Seiten.
Die Terrassentür stand offen, und er merkte, dass es auf einmal zog.
Wind war aufgekommen, der schnell böig wurde und um die Häuserschluchten pfiff.
Als er fertig war mit dem Essen und die Doors auf ihrem musikalischen Sturm davongeritten waren, räumte er ab und ging mit seinem Glas Wein auf die Terrasse hinaus.
Es dämmerte schon leicht.
Ihn fröstelte.
Es war merklich kühler geworden. Der Wetterbericht hatte mit seiner Voraussage recht gehabt. Das milde Spätsommerwetter, das diesmal bis in den Oktober hinein unnatürlich lange andauerte, ging schlagartig zu Ende.
Das, was sich da draußen am Firmament zusammenbraute, verhieß nichts Gutes.
Es war seltsam, aber ihn beschlich bei diesem Anblick ein unheilvolles Gefühl. Eine vage Ahnung davon, dass da draußen etwas vorging, etwas Größeres, Schlimmeres, etwas Böses, das sich lange Zeit angestaut hatte und sich nun Bahn brach.
Etwas, mit dem er sich notgedrungen beruflich auseinandersetzen musste.
Dafür hatte er einen sechsten Sinn, immer schon gehabt.
Erklären konnte er sich das nicht.
Und anderen erst recht nicht.
Vielleicht bildete er sich das alles auch nur ein, wer wusste schon, wozu jemand mit seinen psychischen Macken fähig war.
Die Einzige, die sich über seinen abstrusen Bulleninstinkt nicht lustig machen würde, war Harriet, seine Kollegin.
Aber deswegen konnte er sie in Gottes Namen auch nicht anrufen, nicht um halb sechs Uhr am Sonntagmorgen.
Wenn wirklich etwas passiert war, das ihren Einsatz erforderlich machte, würden sie das noch früh genug erfahren.
Er war mit Leib und Seele Polizist. Aber das Heimtückische an seinem Job in der Mordkommission war, dass er erst eingreifen konnte, wenn schon etwas passiert war. Er und Harriet waren gewissermaßen das Aufräumkommando und sollten im Nachhinein dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen wurden und so der Gerechtigkeit wieder halbwegs Genüge getan war. Für die Opfer kamen sie zu spät. Sie konnten nichts rückgängig machen. Wenn sie mit der Ermittlungsarbeit begannen, war das sprichwörtliche Kind schon in den Brunnen gefallen. Im besten Fall konnten sie wenigstens verhindern, dass der oder die Täter in ihrem Tun fortfuhren.
Madlener merkte, dass er schon wieder in gefährliche kriminalphilosophische Gefilde abzudriften drohte.
Um auf andere Gedanken zu kommen, wollte er sich eine Zigarette anzünden.
Wenn er schon wieder einmal gegen sämtliche guten Vorsätze verstieß, dann kam es nun auch nicht mehr darauf an.
Er suchte und fand keine Schachtel. Weder in seinen Taschen noch auf seinem Schreibtisch noch in irgendwelchen Schubladen.
Er erinnerte sich, dass er nach dem Frühstück eine halb angerauchte Kippe ausgemacht und in den Abfalleimer geworfen hatte, weil er nicht wieder mit dem Rauchen anfangen wollte.
Jetzt fischte er sie heraus und kam sich auf einmal vor wie ein Penner, der in Mülltonnen herumwühlte auf der Suche nach Pfandflaschen.
Auch schon egal.
Er zündete sich die Kippe an und nahm einen tiefen Zug.
Dabei sah er den tief hängenden, dunklen Wolken zu, die von Westen über den Bodensee heranfluteten wie ein himmlischer Tsunami und die Sterne und die Mondsichel verdeckten.
Er drückte die Kippe in die Blumenerde eines halb vollen Blumentopfs, der noch vom Vormieter übrig geblieben war und den er irgendwann mal, vielleicht im nächsten Frühjahr, bepflanzen wollte. Ihm war kalt geworden, und er flüchtete zurück in seine Wohnung und schloss die Terrassentür hinter sich, um endlich ins Bett zu gehen.
3
Das Jagdschloss Adelheid lag am Rand eines gewaltigen Privatwaldgebiets im Südwesten von Baden-Württemberg, das sich von den Ausläufern des Schwarzwalds fast bis zum Bodensee erstreckte und sich seit Generationen im Besitz einer Familie befand, dem Adelsclan von Waldegg-Haunstetten. Es war das drittgrößte zusammenhängende Waldgebiet Baden-Württembergs in privater Hand.
Das Schloss stammte aus dem späten 19. Jahrhundert, ein zweistöckiger Bau wie eine Trutzburg im historistischen Stil der Neugotik mit Türmchen und Erkern, ganz im Geschmack von König Ludwig II. von Bayern, eine Kulisse wie geschaffen für eine Wagner-Oper.
Es tauchte im herbstlichen Morgennebel als unwirkliche Schimäre am Horizont auf, sobald man sich auf dem lang gezogenen Zufahrtsweg näherte, der kilometerlang zunächst durch die dunklen Ausläufer des Schwarzwalds führte und sich dann urplötzlich auf einer freien Anhöhe als das präsentierte, was es war: die Stein gewordene Manifestation des Kindheitstraums einer Prinzessin.
Was es auch sein sollte.
Freifrau Adelheid Stella von Biederstein hatte das Schloss 1879 als Hochzeitsgeschenk von ihrem zukünftigen Gemahl Alfried von Waldegg-Haunstetten bekommen, das dieser nach eigenen Entwürfen als Jagd- und Lustschloss hatte erbauen lassen. Deshalb trug es auch ihren Namen.
Inzwischen stand es die meiste Zeit des Jahres leer, was der Bausubstanz nicht unbedingt gutgetan hatte. Ohne wirkliche Funktion war es allmählich dem Verfall preisgegeben. Aber es hatte einen gewissen morbiden Charme. Auf Wanderer, die gezielt oder zufällig daran vorbeikamen, wirkte es wie ein verwunschenes Dornröschenschloss.
So abgelegen es war, so unnütz war es auch.
Außerdem hatte der Clan der Waldeggs, wie sich die jüngeren Familienmitglieder der heutigen Zeit angepasst nannten, schließlich gaben sie sich modern und der Gegenwart verpflichtet, auf seinen Latifundien so viele, zum größten Teil historische Immobilien in Schuss zu halten und dementsprechend Personal und Mitarbeiter zu beschäftigen, dass ein Jagdschloss wie dieses im Laufe der Jahrzehnte schon aus ökonomischen Gründen ein wenig vernachlässigt worden war.
Als repräsentativer Ausgangspunkt für eine illustre Jagdgesellschaft, bestehend aus der Schickeria des Länderdreiecks Karlsruhe-Stuttgart-Bodensee, war Schloss Adelheid jedoch allemal noch gut genug.
Der erste Stock war komplett unbewohnbar, aber im Erdgeschoss befand sich ein großer Saal, der als zünftige Wirtsstube diente, deren Wände mit Aberdutzenden Jagdtrophäen bepflastert waren. Das ging vom ausgestopften Eberkopf mit furchterregenden Hauern über allerlei präpariertes Niederwild bis zu kleinen und großen Hirschgeweihen. Sogar ein inzwischen ziemlich räudiger Bärenkopf aus dem vorletzten Jahrhundert war an zentraler Stelle angebracht.
Es war nach wie vor eine Ehre und ein Pflichttermin, an der alljährlichen Drückjagd der Waldeggs teilnehmen zu dürfen. Ein Relikt und ein Ritual aus den Tagen, als noch Hof gehalten wurde.
Alle, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wichtig waren oder sich für wichtig hielten und einen Jagdschein besaßen, waren erpicht darauf, sich dort mit ihren teuren wasserdichten Schnürstiefeln, exklusiven Jagdgewehren, rustikalen Lodenmänteln und urigen Trachtenhüten sehen zu lassen.
Egal, wie widrig die äußeren witterungsbedingten Umstände auch waren.
Hier trafen sich Gleichgesinnte, hier wurden Allianzen geschmiedet, Netzwerke gepflegt, Verträge verhandelt und Geschäfte verabredet, hier wurde auch mal unverblümt geredet, obwohl es vordergründig nicht danach aussah. Kurz: Es wurde in geschlossenen Zirkeln außerparlamentarische Politik gemacht. Aber nicht in dem Sinn, wie sich das die 68er-Generation vorgestellt hatte.
Das war nicht gerade demokratisch, aber man war ja unter sich.
Echter oder eingebildeter Landadel verpflichtete eben.
Das war nicht nur Standesdünkel, das war elitäres Klassenbewusstsein, obwohl dieses Wort von niemandem ausgesprochen wurde, weil es per definitionem des Teufels war.
Das einzige äußere Zugeständnis an heutige Zeiten waren die orangefarbenen reflektierenden Überjacken und Westen, die sicherstellen sollten, dass es keine Unglücksfälle gab. Vulgo: dass man sich vor lauter Zielwasserkonsum und Übereifer nicht aus Versehen gegenseitig abknallte im irrigen Glauben, eine Wildsau hinter dem nächsten Gebüsch gesehen zu haben.
Nichts konnte man in diesen Kreisen weniger brauchen als einen öffentlichen Skandal. Man wollte schließlich unter seinesgleichen bleiben, und eine Einmischung von Außenstehenden war dem nicht gerade zuträglich.
So eine Großveranstaltung wie eine Drückjagd musste selbstverständlich generalstabsmäßig vorbereitet werden.
Für dieses Mal hatten sich gut fünfzig Schützen angesagt, dazu kamen dreißig Hundeführer mit ihren Hunden und eine Handvoll Treiber.
Ein Range Rover rollte langsam den langen Zufahrtsweg zum Schloss Adelheid entlang, der durch dicht bewachsenen Wald führte. Am Steuer die zwanzigjährige Elise von Waldegg, neben ihr Eduard, ihr Bruder, ein Jahr jünger. Sie bildeten das Vorauskommando für die anstehende Jagd, die in einer Woche stattfinden sollte. Die beiden waren – wie nahezu alle Familienmitglieder – begeisterte Jäger und hatten die Aufgabe übernommen, das Schloss, die Zufahrtswege und die gesamte Umgebung zu inspizieren und etwaige Sturmschäden festzuhalten und zu melden, damit sie noch rechtzeitig beseitigt werden konnten.
Die diesjährige Jagd musste eine Woche später als vorgesehen abgehalten werden. Eine solche Traditionsveranstaltung konnte man normalerweise nicht einfach wegen widriger Wetterverhältnisse absagen. Aber der Herbststurm »Isidor« mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu hundertzwanzig Stundenkilometern hatte im Südwesten Deutschlands so gewütet, dass es einfach zu gefährlich gewesen war, die Jagd am eigentlich vorgesehenen Termin abzuhalten. Das prognostizierte Sturmtief hatte sich binnen vierundzwanzig Stunden zu einem veritablen Orkan gemausert, mit dem nicht zu spaßen war. Entwurzelte oder wie Streichhölzer abgeknickte Bäume waren auf Wege, Straßen und Bahntrassen gestürzt, zwei Waldarbeiter waren verletzt worden. Ein Zug war gezwungen, auf offener Strecke anzuhalten, und die Passagiere mussten stundenlang in den Waggons ausharren, bis sie vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr befreit und in Sicherheit gebracht werden konnten.
Elise und Eduard stellten bei ihrer Fahrt durch den Wald zu ihrer großen Erleichterung jedoch fest, dass zwar im Jagdgebiet eine Menge Kleinholz heruntergekommen war, aber insgesamt waren die Sturmschäden weniger schlimm, als sie ursprünglich befürchtet hatten.
Sie bogen auf die Anhöhe zum Schloss ab und konnten endgültig aufatmen.
Schloss Adelheid lag imposant und beeindruckend im Gegenlicht der aufgehenden Sonne. Immer noch ein Juwel mitten im Wald, wenn man nicht allzu genau hinschaute.
Sie waren sehr früh unterwegs, für begeisterte Jäger und stolze Waldbesitzer in der nächsten Generation gehörte sich das so. Und Disziplin lag den Waldeggs schon immer im blauen Blut.
Elise studierte Forstwirtschaft und Geschichte, Eduard hatte sich der Rechtswissenschaft – sprich: Jura – verschrieben. Sie hatten eine gemeinsame Studentenbude, wenn man eine schicke Drei-Zimmer-Eigentumswohnung mit Stuck und Parkett mitten in der Altstadt von Konstanz so nennen konnte.
Ihnen war bewusst, dass sie mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen waren, aber das stellten sie nicht zur Schau. Schließlich waren sie Schwaben, die nicht mit ihrer Herkunft und ihrem finanziellen Hintergrund hausieren gingen, ganz im Gegenteil. Offiziell nannten sie sich Elise und Eduard Waldegg, ohne »von«, und nur engste Freunde wussten über ihren wahren familiären Hintergrund Bescheid. Ihren Kommilitonen gegenüber behaupteten sie, dass sie nur weitläufig mit den von Waldegg-Haunstettens verwandt seien. Diese Tatsache war nicht nur ihrer natürlichen Bescheidenheit geschuldet, sondern auch dem dringenden Ratschlag der zuständigen Polizeibehörden. Die Gefahr einer Entführung mit entsprechender Lösegeldforderung sollte so gering wie möglich gehalten werden.
Der Fall Oetker war Warnung genug.
Eigentlich war der Familie sogar Personenschutz ans Herz gelegt worden, aber da hatten die Geschwister nicht mitgespielt. Sie wollten ausdrücklich keine Extrawurst und erst recht nicht auf Schritt und Tritt unter Beobachtung stehen.
Die Auffahrt zum Jagdschloss weitete sich zu einem ausgedehnten gekiesten Vorplatz, auf dem Elise den Range Rover schließlich anhielt.
Sie und ihr Bruder stiegen aus und warfen einen Blick auf die Fassade. Die Fenster waren alle intakt, sie konnten keine äußeren Schäden feststellen.
Eduard holte den Schlüssel aus seiner Tasche und sperrte die schwere doppelflügelige Eingangstür aus Eichenholz auf. Sie betraten das Vestibül und sahen sich um.
Eine Putzkolonne würde noch in dieser Woche alles in einen Zustand bringen, der dem Besuch einer illustren Jagdgesellschaft angemessen war.
Die große eichenvertäfelte und trophäengeschmückte Wirtsstube, die eher einem Tanzsaal glich, und die anschließende Küche mussten auch noch auf Vordermann gebracht werden, aber das war alles kein Problem.
Elise hatte mit ihrem Handy den Zustand von Eingang, Wirtsstube und Küche aufgenommen, um ihn ihrem Vater zeigen zu können, und schwenkte gerade damit über die Fensterfront, als sie draußen ein Fahrzeug im Kies knirschen hörten.
Eduard trat ans Fenster und sah hinaus, Elise gesellte sich zu ihm.
Ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift »Flower-Power. Gärtnerei Denzel« mit Sigmaringer Kennzeichen hatte neben ihrem Range Rover angehalten. Der Fahrer stieg aber nicht aus, sondern kramte anscheinend in seinem Handschuhfach herum, sie konnten sein Gesicht nicht erkennen.
»Hat unser Vater einen Gärtner hierherbestellt?«, fragte Eduard seine Schwester irritiert.
»Kann ich mir nicht vorstellen«, antwortete sie und schaltete ihr Handy aus.
Sie gingen ins Vestibül zurück und zum Eingang, wo sie die schwere Tür öffneten.
4
Ein Mann mit schwarzen Lederhandschuhen in einem graublauen Arbeitsoverall und einer Faschingsmaske über dem Kopf, die Donald Trump darstellen sollte, erwartete sie. Er hatte unmissverständlich eine große gespannte Profiarmbrust auf sie gerichtet und sagte erst einmal kein Wort.
Die Geschwister erstarrten vor Schreck.
Elise fand als Erste ihre Stimme wieder und fragte: »Was soll das? Was wollen Sie?«
Noch immer blieb der Mann mit der Trump-Maske stumm und zielte unbeirrt auf sie.
Erst als Elise einen Schritt nach vorne machte, kamen ein paar dumpfe Worte aus der Mundöffnung der zugleich lächerlichen und doch wegen ihrer starren Gleichgültigkeit unheimlichen Maske.
»Stehen bleiben! Hände nach oben!«
Elise ließ sich nicht so schnell einschüchtern.
»Soll das ein Scherz sein? Wenn ja, dann ist das bei Gott nicht witzig!«
»Verstehst du kein Deutsch?«, herrschte der Mann sie an. »Ihr sollt die Hände hochnehmen! Auf der Stelle!«
Elise gehorchte zögernd, Eduard ebenfalls.
»Wer sind Sie und was wollen Sie?«, fragte Elise noch einmal. »Wollen Sie Geld?«
»Halt endlich deine verdammte Klappe!«, war die Antwort. Sie kam in einer Lautstärke und mit einer Vehemenz, die Elise zum Verstummen brachte.
Der Maskenmann streckte die freie Hand aus. »Eure Handys. Her damit!«
Elise und ihr Bruder griffen in ihre Taschen und überreichten ihm ihre Smartphones. Er steckte sie weg.
»Jetzt eure Uhren. Na los! Gebt sie mir!«
Widerstrebend nahmen sie ihre Uhren ab, die der Mann kurz überprüfte und ebenfalls wegsteckte. Dann zeigte er auf seine Waffe.
»Das hier ist eine Assassin-Hightech-Armbrust. Sie ist mit einem Sechzehn-Zoll-Pfeil geladen und hat eine Durchschlagskraft von acht Kilonewton. Ihr seid Jäger, könnt mit Waffen umgehen und wisst, was das bedeutet. Wenn ich aus dieser Entfernung abdrücke, geht der Bolzen glatt durch euren Brustkorb wie durch ein Stück Butter. Habt ihr das verstanden?«
Elise und Eduard warfen sich einen verstörten Blick zu, dann nickten beide.
»Wenn ihr pariert, wird euch nichts passieren. Also, ab zum Lieferwagen, alle beide!«, befahl er und winkte mit seiner Armbrust.
»Sie haben nur einen Schuss«, wagte Elise einzuwerfen. »Und wir sind zu zweit.«
Der Mann mit der Donald-Trump-Maske machte einen bedrohlichen Schritt nach vorne und zielte mit seiner Armbrust mitten in Elises Gesicht.
»Da haben wir ja einen richtigen kleinen Klugscheißer. Na los – willst du’s ausprobieren? Wem von euch beiden soll ich als Erstes ein Loch in den Pelz brennen? Ha? Wem? Sag’s mir!«
Er war wieder laut geworden und schwenkte seine Waffe zwischen Elise und Eduard hin und her.
Elise sah ein, dass es besser war, vorerst den Mund zu halten.
»Los jetzt!«, befahl der Mann ungeduldig und zeigte mit der Armbrust auffordernd in Richtung Lieferwagen. »Abmarsch!«
Elise und ihr Bruder warfen sich einen kurzen Blick zu, dann setzten sie sich doch über den knirschenden Kies zur Rückseite des Lieferwagens in Bewegung, dessen Heckflügeltüren offen standen. Der Mann mit der Armbrust im Anschlag folgte ihnen mit einem angemessenen Sicherheitsabstand.
Als sie hinter dem Fahrzeug stehen blieben, sagte er: »Da hinein!«
Sie kletterten in den Laderaum. Dort lag eine Matratze. Eine stabile Metallstange war zwischen Wagendach und Boden angeschraubt, sie sah aus wie eine Poledancestange.
Der Mann zog mit seiner freien Hand zwei Paar Handschellen aus seiner Tasche und warf sie Elise zu.
»Mach dich und deinen Bruder damit an der Stange fest. Ich will die Handschellen dabei einrasten hören.«
Elise zögerte.
»Na mach schon. Wir haben nicht ewig Zeit.«
Sie befolgte schließlich seine Anweisungen und fesselte sich und ihren Bruder mit dem Handgelenk an die Stange.
»Und jetzt auf die Matratze. Gesicht nach unten.«
Elise und Eduard ließen sich an der Stange nieder und befolgten die Anweisung.
Der Mann legte die Armbrust in den Kies und kam in den Laderaum. Er überprüfte die Handschellen und verpasste Elise mit der Faust einen Schlag ins Gesicht, als sie sich plötzlich umdrehte und mit der freien Hand nach der Maske über seinem Kopf griff.
Sie schrie vor Schmerz und Wut und blutete aus der Nase.
Der Mann packte sie an ihren langen Haaren und zog ihr Gesicht dicht an seine Donald-Trump-Maske heran.
»Versuch das noch mal, und ich töte deinen Bruder vor deinen Augen«, zischte er sie an, bevor er sie wieder wegstieß.
Er fischte Textilklebeband aus seiner Tasche, riss ein Stück ab und überklebte ihren Mund. Sie wehrte sich nicht mehr.
Jetzt konnte der Mann die Panik in ihren Augen sehen. Es schien ihm gleichgültig zu sein.
»Hey, hören Sie, hey …«, sagte ihr Bruder, aber der Mann reagierte nicht und überklebte auch ihm den Mund.
Dann sprang er wieder ins Freie, hob die Armbrust auf und schlug die Hecktüren des Lieferwagens zu.
Die Fenster waren mit schwarzer Folie zutapeziert.
Er nahm die Gummimaske ab und stopfte sie sich in die Tasche. Mit dem Ärmel wischte er sich den Schweiß aus dem Gesicht, bevor er sich breitbeinig vor die Fassade stellte und mit der Armbrust auf das Wappenschild der Familie Waldegg-Haunstetten zielte, das groß als Metallemblem über dem Eingang prangte.
Es war ein gespaltenes Wappen, gehalten von zwei schwarzen Stauferlöwen, das in der linken Hälfte eine Tanne vor weißem Hintergrund zeigte, auf der rechten eine Armbrust. Auf dem gewundenen Spruchband unter dem Wappenbild stand das Familienmotto in Großbuchstaben: »SUUM CUIQUE«.
»Jedem das Seine«, murmelte er. »Das sollt ihr kriegen!«
Und dann drückte er ab.
Mit einem Scheppern traf der Bolzen auf die abgebildete Armbrust und blieb stecken.
Der Mann spuckte verächtlich aus, ging um seinen Lieferwagen herum und legte die Waffe auf dem Beifahrersitz ab.
Anschließend stapfte er zum Eingang, nahm die Handys der Geschwister aus seiner Tasche, ließ sie auf den Boden fallen und zertrat sie mit seinen Stiefelabsätzen. Er fischte noch die Uhren aus seiner Tasche und warf sie daneben.
Dann begab er sich hinter das Steuer des Lieferwagens, startete den Motor und gab Vollgas.
Die Antriebsräder drehten durch und schleuderten Kieselsteine in die Luft. Endlich griffen sie, der Lieferwagen fuhr davon und bog in hohem Tempo in den Zufahrtsweg, der durch den Wald führte, ein.
Zwei Krähen feierten die Stille, die plötzlich eingetreten war, mit höhnischem Gekrächze.
5
Das Smartphone von Madlener auf dem Thonet-Tischchen neben dem Bett schnurrte leise und vibrierte.
Sein Besitzer brauchte eine ganze Weile, bis er halbwegs aufwachte und merkte, dass das Geräusch nicht in seinem Kopf war, sondern banale Realität. Dabei hatte er zum ersten Mal seit langer Zeit einen Traum gehabt, der nicht durchsetzt war von surrealen Geschehnissen und Begegnungen mit Personen, die bereits das Zeitliche gesegnet hatten oder längst aus seinem Leben verschwunden waren, sondern ihm ein warmes, diffuses Glücksgefühl bescherte, obwohl er in diesem Augenblick nicht hätte sagen können, was genau der Grund dafür war.
Er lag benommen auf dem Bauch und tastete im Halbschlaf mit der rechten Hand nach dem verfluchten Telefon, das ihn aus seinem angenehmen Dämmerzustand herausgerissen hatte. Erst ganz allmählich wurde ihm bewusst, dass er nicht in seinem gewohnten Hotelzimmer lag, das jahrelang sein Zuhause gewesen war, sondern in seinem eigenen Schlafzimmer. Das irritierte ihn immer noch jeden Morgen, sobald er die Augen aufmachte.
Ihm fiel ein, dass er sein Handy aus reiner Rücksichtnahme extra von seinem üblichen durchdringenden amerikanischen Klingelton – der Tote wecken konnte, also sogar ihn, wenn er sich ausnahmsweise in einer seltenen Tiefschlafphase befand – auf Vibrationsalarm geschaltet hatte.
Seine linke Hand fühlte unter der Bettdecke die angenehm samtige Rückenlinie von Simone Zoller, die neben ihm im Bett lag und schlief. Diese beruhigende Gegenwart war wenigstens Realität und kein Vorgaukeln eines eingebildeten Zustands durch eine dieser Hirnregionen, die für Träume zuständig war. Er spürte Simones regelmäßigen Atem und wollte sich, einem ersten Impuls folgend, zu ihr umdrehen.
Aber dann griff er doch zu seinem nervigen Handy, das keine Ruhe gab, weil er Simone nicht unnötig aufwecken wollte.
Er rollte sich so sanft wie möglich aus dem Bett und verzog sich mit dem Smartphone ins Bad, wo er erst die Tür hinter sich zumachte, auf seine Uhr sah – es war sieben Uhr zehn am Montagmorgen – und die artistische Leistung vollbrachte, gleichzeitig in seinen Bademantel zu schlüpfen und den Anruf entgegenzunehmen.
»Ja?«, sagte er ziemlich ungnädig, obwohl er an der Nummer sah, dass es Frau Gallmann war, die Sekretärin des Kriminaldirektors im Präsidium, neuerdings First Office Management Female Assistant genannt, daran würde er sich nie gewöhnen können, aber ihr gefiel es.
»Rufe ich arg ungelegen an, Herr Madlener?«, flötete sie heuchlerisch.
»Kann man wohl sagen«, knurrte Madlener. »Habe ich wirklich Bereitschaft heute?«
»Allerdings. Tut mir leid. Ich komme mir schon vor wie Miss Moneypenny, die auch immer im falschen Moment bei James Bond anruft. Aber wat mutt, dat mutt, wie man im hohen Norden sagt.«
Dass sie jetzt statt Schwäbisch Plattdeutsch sprach, machte die Angelegenheit auch nicht viel besser, dachte Madlener. Weil er wusste, dass nun sein Einsatz gefragt war.
»Wenn Sie damit andeuten wollen, dass Sie mich in einer verfänglichen Situation stören, muss ich Sie enttäuschen«, log er. »Ich bin nicht 007. Und überhaupt – seit wann sprechen Sie Plattdeutsch? Haben Sie Ihr Schwäbisch über Nacht verlernt?«
»Nichts für ungut, Herr Madlener, aber Sie sind ja heute ausgesprochen gesprächig für diese frühe Stunde. Das isch doch sonscht gar nicht Ihre Art, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Was isch denn los mit Ihnen?«
»Machen Sie sich mal keine Sorgen um mich. Ich habe alles im Griff. Was gibt’s denn so Dringendes?«
»Was wohl? Einmal dürfet Sie raten! Högschtens.«
»Das ist nicht schwer. Kann sich nur um eine Leiche handeln.«
»Gratuliere! Mitten ins Schwarze getroffen.«
»Männlich, weiblich, divers?«
»Männlich. Vor einer Stunde aufgefunden. Angeschwemmt am Bodenseeufer.«
»Jung? Alt?«
»Nach erster Schätzung circa fünfzig bis sechzig.«
»Wo?«
»Zwischen Meersburg-Fährhafen und Unteruhldingen, die Nebenstrecke, die am Ufer entlangführt.«
»Ein Unfall? Ist der Mann ertrunken?«
»Dann hätte ich Sie nicht anrufen müssen. Der gute Mann hat nach erschtem Augenschein durch die Polizeistreife ein Loch in der Brust. Es scheint ein glatter Durchschuss zu sein. Weitere Nachfragen Ihrerseits erübrigen sich. Mehr wissen wir nämlich noch nicht. Die Kollegen haben alles abgesperrt und so gelassen, wie sie’s vorgefunden haben. Sie warten jetzt auf die Gerichtsmedizin und die Spurensicherung. Und auf Sie natürlich.«
»Okay, okay. Bin schon so gut wie unterwegs. Ist Harriet informiert?«
»Isch die Nummer zwei auf meiner Liste. Zuerscht kommet Sie. Sie sind der Chef.«
»Danke, dass Sie mich daran erinnern.«
Er wollte schon auflegen, als ihm noch etwas einfiel. Kurz nach dem Aufstehen und ganz ohne Kaffee kamen seine Synapsen nur allmählich so richtig auf Betriebstemperatur. Erst recht nach einer langen und ereignisreichen Nacht.
»Frau Gallmann …«
»Ja, Herr Madlener?«
»Haben wir zurzeit vermisste Personen?«
»Ich dachte schon, Sie fragen nie. Ja, haben wir. Augenblick … Ein Mädchen, fünfzehn Jahre alt, aus Bodman. Seit drei Tagen abgängig. Schon mehrfach von zu Hause ausgerissen. Hoffentlich auch diesmal nur …«
Madlener seufzte vernehmlich. Das machte sie absichtlich.
»Frau Gallmann – bitte nur Personen, die auch in Frage kommen.«
»Natürlich, Sie haben recht. Da wären ein zweiundsiebzig Jahre alter Mann aus einem Altersheim in Überlingen, dement. Ist seit gestern verschwunden. Wird noch gesucht. Und ein siebenundfünfzigjähriger Mann, Rechtsanwalt, wird seit fünf Tagen vermisst, vermutlich von der Autofähre Konstanz–Meersburg gefallen.«
Madlener kratzte sich am Kopf. »Hab davon gelesen. Ich erinnere mich. Da war doch eine große Suchaktion …«
»Ja. Wasserwacht, Taucher, Hubschrauber. Das volle Programm. Die Suche musste aber wegen des Sturms ergebnislos abgebrochen werden.«
»Alles?«
»Ja. Jedenfalls, was unsere Zuständigkeit betrifft.«
»Das könnte er sein. Der Anwalt.«
»Gut möglich.«
»Wie heißt er denn?«
»Ein gewisser Heribert Döllinger.«
»Okay, danke. Alsdann – bis später, Miss Moneypenny.«
Als er auflegte, staunte er über sich selbst. Dass er, der notorische Morgenmuffel, heute schon so gut drauf war, um ein Scherzchen zustande zu bringen.
Frau Gallmann war das sicher aufgefallen. Aber er fand, dass ein Vergleich mit Miss Moneypenny gar nicht so weit hergeholt war. Jedenfalls wenn er an die Miss Moneypenny aus den ersten 007-Filmen dachte.
Ein bisschen altmodisch, alterslos, stets wie aus dem Ei gepellt, immer da, wenn man sie brauchte. Familienstand unbekannt, wie bei Frau Gallmann. Dass ihm diese Kongruenz erst jetzt aufgefallen war …
Er warf einen Blick in den Spiegel.
Taufrisch wie der junge Tag sah anders aus.
Und James Bond ebenfalls.
Wenigstens hatte er kein Toupet nötig wie Sean Connery.
Im Gegenteil, er musste dringend wieder zum Friseur.
Aber erst mal rasierte er sich.
Eine weitere Stunde am Kissen zu horchen, hätte seinem Äußeren gewiss gutgetan. Oder was auch immer ihm sonst noch eingefallen wäre, sobald er bemerkt hätte, dass Simone Zoller nackt neben ihm im Bett lag und sich an ihn kuschelte.
Beim Gedanken daran seufzte er unwillkürlich.
Mist, Mist, Doppelmist!
Aber Dienst war nun einmal Dienst.
Simone würde Verständnis haben, schließlich war sie die Tochter eines Polizisten.
Er schlich sich in die Küche und machte schon einmal die Kaffeemaschine startklar. Dann schälte er sich wieder aus seinem Bademantel und stellte sich unter die kalte Dusche, um endgültig wach zu werden und für den Tag und eine Leiche gerüstet zu sein.