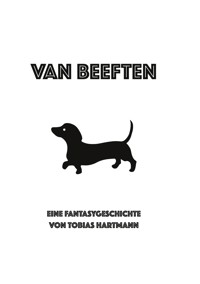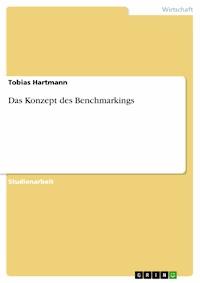
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: 1,3, Studienseminar für Lehrämter an Schulen Arnsberg, Sprache: Deutsch, Abstract: „Wenn du deinen Feind kennst und dich selbst, brauchst du den Ausgang von hunderten Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst und den Feind nicht, wirst du für jeden Sieg auch eine Niederlage einstecken. Wenn du weder den Feind kennst noch dich selbst, wirst du jedes Mal unterliegen.“ Den Nutzen von der Analyse des Feindes erkannte schon vor mehr als 2500 Jahren der chinesische Kriegsgeneral Wu Sunzi. Doch was hat ein 2500 Jahre altes Zitat mit modernen Managementtechniken zu tun und was bedeutet eigentlich der Begriff „Benchmarking“, der zurzeit als Schlagwort in aller Munde ist? Oder handelt es sich hierbei nur um einen in der deutschen Sprache so gern genutzten Anglizismus? Mit diesen Fragen und dem eigentlichen Sinn und Zweck des Benchmarkings befasst sich diese Arbeit, denn Benchmarking ist weit mehr als ein Anglizismus für einen Betriebsvergleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Hausarbeit
Das Konzept des BenchmarkingThema:
Fachgebiet:Betriebswirtschaftslehre Fertigungswirtschaft/Produktion
Vorgelegt von:Tobias Hartmann
Ausgabetermin:01.06.2007
Rückgabetermin:01.07.2007
Page 3
Abbildungsverzeichnis Seite Abbildung 1: Traditionelle vs. moderne Marktanforderungen......................................... 2 Abbildung 2: Historische Entwicklung des Benchmarkings............................................ 6 Abbildung 3: Elemente des Strategie-Benchmarkings................................................... 11 Abbildung 4: Arten des Benchmarkings ........................................................................ 12 Abbildung 5: Das Fünf-Phasen-Modell des prozessorientierten Benchmarkings.......... 19 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Die 10 wichtigsten Erfolgsfaktoren des Benchmarking................................ 25 IIIPage 4
Abkürzungsverzeichnis
APQC American Productivity and Quality Center BDE Betriebsdatenerfassung BIC Best in class bspw. beispielsweise bzw. beziehungsweise c.p. ceteris paribus d.h. das heißt evtl. eventuell(e) F&E Forschung und Entwicklung GBN Global Benchmarking Network i.d.R in der Regel IBC International Benchmarking Clearinghouse inkl. inklusive IPK Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik in Berlin IZB Informationszentrum Benchmarking, Berlin max. maximal Min. Minuten min. mindestens o.g. oben genannt(en) S. Seite sog. sogenannte SPI Strategic Planning Institute TQM total quality management u.a. unter anderem USA United States of America vgl. vergleich vs. versus z.T. zum Teil
Page 1
1. Einleitung
„Wenn du deinen Feind kennst und dich selbst, brauchst du den Ausgang von hunderten Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst und den Feind nicht, wirst du für jeden Sieg auch eine Niederlage einstecken. Wenn du weder den Feind kennst noch dich selbst, wirst du jedes Mal unterliegen.“1
Den Nutzen von der Analyse des Feindes erkannte schon vor mehr als 2500 Jahren der chinesische Kriegsgeneral Wu Sunzi.
Doch was hat ein 2500 Jahre altes Zitat mit modernen Managementtechniken zu tun und was bedeutet eigentlich der Begriff „Benchmarking“, der zurzeit als Schlagwort in aller Munde ist?2Oder handelt es sich hierbei nur um einen in der deutschen Sprache so gern genutzten Anglizismus?
Mit diesen Fragen und dem eigentlichen Sinn und Zweck des Benchmarkings befasst sich diese Arbeit, denn Benchmarking ist weit mehr als ein Anglizismus für einen Betriebsvergleich.
In der heutigen Zeit müssen sich die Unternehmen stärker als in der Vergangenheit den verschärften Marktbedingungen anpassen, so werden beispielsweise die Produkte immer homogener und die Kunden fordern in wesentlich kürzeren Abständen Produktinnovationen, so dass sich die Amortisationszeit eines Produktes ebenfalls verkürzen muss.3Verschärft werden diese Anforderungen durch einen stetig steigenden Druck zur Kostenminimierung bei gleichzeitig steigender Qualität.4Unter diesen Marktbedingungen kann ein Unternehmen folglich langfristig nur am Markt überleben, wenn es -wie in Abb.1 dargestellt- die Durchlaufzeiten- und Innovationszeiten bei verbesserter Qualität verringert und die Kosten senkt.5Das Erkennen von Verbesserungspotential im Bereich der Prozessorganisation ist daher von unschätzbarem Wert, um diesen Marktanforderungen gerecht werden zu können.6Häufig taucht in diesem Zusammenhang, sowohl in der Literatur, als auch in der Unternehmenspraxis der Begriff des Benchmarkings auf.
1Sunzi (2001), S. 12
2vgl. Förster, A./ Kreuz, P. (2007), S. 125
3vgl. Jung, B. (2002), S. 19
4vgl. Weber, J./ Wertz, B. (1999), S. 7
5vgl. Töpfer, A. (1997), S. 32f.
6vgl. Sabisch, H./ Tintelnot, C. (1997), S. 11ff.