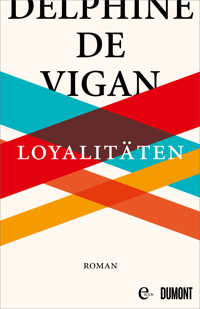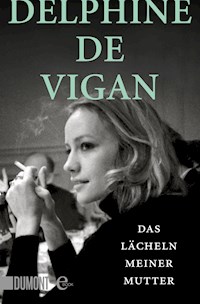
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Lucile starb, wie sie es sich wünschte: lebendig. Jetzt bin ich in der Lage, ihren Mut zu bewundern.« Schon als Kind fand Delphine ihre Mutter Lucile schöner, talentierter, unkonventioneller als andere Mütter – aber auch immer kühl und distanziert. Aber warum hat Lucile sich für den Freitod entschieden? Diese Frage treibt Delphine de Vigan seit dem Tag um, an dem sie ihre Mutter tot aufgefunden hat. Sie trägt Bilder, Fotoalben, Briefe, Tonbandaufnahmen und vor allem Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten der gesamten Familie zusammen. Es entsteht das Porträt einer widersprüchlichen und geheimnisvollen Frau, die ihr ganzes Leben auf der Suche war - nach Liebe, Glück und nicht zuletzt nach sich selbst. Gleichzeitig zeichnet de Vigan das lebendige Bild einer französischen Großfamilie der Fünfziger- und Sechzigerjahre, geprägt von großen Abendgesellschaften, langen unbeschwerten Sommerurlauben, aber auch den Ängsten der einzelnen Familienmitglieder. So lernt die Autorin Erinnerung um Erinnerung ihre Mutter und schließlich auch sich selbst zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Warum hat Lucile sich für den Freitod entschieden? Diese Frage treibt Delphine de Vigan seit dem Tag um, an dem sie ihre Mutter tot aufgefunden hat. Sie trägt Bilder, Fotoalben, Briefe, Tonbandaufnahmen und vor allem Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten der gesamten Familie zusammen. Sie spricht mit den Geschwistern ihrer Mutter, mit alten Freunden und Bekannten der Familie. Es entsteht das Porträt einer widersprüchlichen und geheimnisvollen Frau, die ihr ganzes Leben auf der Suche war - nach Liebe, Glück und nicht zuletzt nach sich selbst.
© Delphine Jouandeau
Delphine de Vigan, geboren 1966, erreichte ihren endgültigen Durchbruch als Schriftstellerin mit dem Roman ›No & ich‹ (2007), für den sie mit dem Prix des Libraires und dem Prix Rotary International 2008 ausgezeichnet wurde. Ihr Roman ›Nach einer wahren Geschichte‹ (DuMont 2016) stand wochenlang auf der Bestsellerliste in Frankreich und erhielt 2015 den Prix Renaudot. Bei DuMont erschienen 2018 und 2020 die Romane ›Loyalitäten‹ und ›Dankbarkeiten‹, 2021 ›Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin‹. Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.
Delphine de Vigan
Das Lächeln meiner Mutter
Roman
Aus dem Französischenvon Doris Heinemann
Von Delphine de Vigan sind bei DuMont außerdem erschienen:
Nach einer wahren Geschichte
Tage ohne Hunger
Loyalitäten
Dankbarkeiten
Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2011Éditions Jean-Claude Lattès
Die französische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel ›Rien ne s’oppose à la nuit‹ bei Éditions Jean-Claude Lattès, Paris.
›Rien ne s’oppose à la nuit‹ erschien auf Deutsch erstmals 2013 unter dem Titel ›Das Lächeln meiner Mutter‹ bei Droemer, München.
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Doris Heinemann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Frédéric Pierret
Satz: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
eBook-Konvertierungg: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7107-0
www.dumont-buchverlag.de
Für Margot
Einmal hatte das Schwarz beim Malen die gesamte Oberfläche der Leinwand eingenommen, ohne Formen, Kontraste oder Transparenzen.
In diesem Extrem sah ich in gewisser Weise die Negation von Schwarz.
Die unterschiedlichen Texturen reflektierten das Licht mehr oder weniger schwach, und aus dem Dunkel leuchtete eine Helligkeit, ein pikturales Licht, dessen besondere emotionale Kraft meinen Wunsch zu malen beflügelte.
ERSTER TEIL
Meine Mutter war blau, blassblau mit Aschetönen, die Hände seltsamerweise dunkler als das Gesicht, als ich sie an jenem Januarmorgen in ihrer Wohnung fand. Die Beugen ihrer Fingerknöchel sahen aus, als seien sie voller Tintenflecken.
Meine Mutter war schon seit mehreren Tagen tot.
Ich weiß nicht, wie viele Sekunden oder sogar Minuten ich brauchte, um es zu begreifen, dabei war die Situation eindeutig (meine Mutter lag auf dem Bett und reagierte nicht auf meine Fragen und Bitten), es dauerte eine lange unbeholfene, fiebrige Zeit, bis der Schrei aus meiner Lunge brach wie nach einem minutenlangen Atemstillstand. Noch heute, zwei Jahre danach, ist mir rätselhaft, durch welchen Mechanismus sich mein Hirn derart lange weigern konnte, die Leiche meiner Mutter wahrzunehmen, vor allem ihren Geruch.
Wieso brauchte es derart viel Zeit, um die Information anzunehmen, die da vor ihm lag? Das ist nicht die einzige Frage, die ihr Tod bei mir hinterlassen hat.
Vier oder fünf Wochen später nahm ich in einem Zustand ausgeprägter Nichtansprechbarkeit den Prix des Libraires entgegen, für einen Roman, in dem neben anderen Figuren auch eine Mutter vorkommt, die sich ganz von der Welt und in sich selbst zurückgezogen hat und doch nach jahrelangem Schweigen zum Gebrauch der Wörter zurückfindet.
Meiner Mutter hatte ich dieses Buch vor seinem Erscheinen gegeben, vermutlich voller Stolz darauf, einen weiteren Roman abgeschlossen zu haben, aber auch in dem Bewusstsein, dass ich, wenn auch mittelbar durch die Fiktion, das Messer in der Wunde herumdrehte.
Weder an den Ort der Preisverleihung noch an die Zeremonie habe ich die geringste Erinnerung. Ich glaube, ich hatte den Schrecken noch nicht überwunden, doch ich lächelte. Einige Jahre zuvor hatte ich dem Vater meiner Kinder, der mir vorwarf, ich sei immer auf der Flucht nach vorn (er meinte damit meine nervtötende Angewohnheit, unter allen Umständen Haltung zu bewahren), pompös erwidert, ich sei im Leben.
Auch bei dem Abendessen zu meinen Ehren lächelte ich, immer nur darauf bedacht, mich erst im Stehen und dann im Sitzen aufrecht zu halten und nicht plötzlich über meinem Teller zusammenzubrechen, in einer Kopfsprungbewegung ähnlich der Bewegung, mit der ich als Zwölfjährige einmal mit dem Kopf voran in ein leeres Schwimmbecken gesprungen war.
Ich erinnere mich noch an das Physische, fast Athletische dieses angestrengten Durchhaltens, mit dem ich ohnehin niemanden täuschen konnte. Es erschien mir besser, den Kummer zusammenzuhalten, ihn zu verschnüren, zu ersticken, zum Schweigen zu bringen, bis ich endlich allein sein würde, statt mich dem zu ergeben, was nur ein langes Brüllen oder, schlimmer noch, ein Röcheln werden konnte und mich ganz sicher zu Boden gestreckt hätte. In den Monaten zuvor hatten sich die Ereignisse, die mich etwas angingen, ganz außergewöhnlich überschlagen, das Leben legte die Latte wieder einmal zu hoch. Daher schien mir, es bleibe einem für die Dauer des Sturzes nichts anderes übrig, als Haltung zu bewahren beziehungsweise den Dingen ins Auge zu sehen (oder es notfalls vorzutäuschen).
Eben deshalb weiß ich schon lange, dass man sich besser aufrecht hält, statt zu liegen, und dass man auch nicht nach unten schauen sollte.
In den Monaten danach schrieb ich ein anderes Buch, für das ich mehrere Monate lang Notizen gemacht hatte. Jetzt, aus der Distanz, weiß ich nicht, wie das möglich war, vielleicht weil es sonst nichts gab, sobald meine Kinder zur Schule aufgebrochen waren und rings um mich Leere herrschte, nichts als diesen Stuhl vor dem eingeschalteten Computer, ich meine, keinen anderen Ort, an den ich mich setzen, an dem ich mich hätte niederlassen können. Nach elf Jahren im selben Unternehmen – und einem Kräftemessen, das mich bis zum Äußersten erschöpft hatte – war ich gerade entlassen worden, ich spürte, dass mir davon gewissermaßen schwindelig geworden war, und als ich Lucile in ihrer Wohnung fand, so blau und so reglos, da verwandelte sich das Schwindelgefühl in Grauen und das Grauen in Nebel.
Ich habe jeden Tag geschrieben, und nur ich weiß, wie sehr dieses Buch, das nichts mit meiner Mutter zu tun hat, dennoch von ihrem Tod und von der Stimmung, die er bei mir hinterlassen hat, geprägt ist. Und dann erschien das Buch, ohne meine Mutter, die auf meinem Anrufbeantworter, wie sonst immer, die witzigsten Kommentare zu meinen Leistungen vor der Fernsehkamera hinterlassen hätte.
Eines Abends im selben Winter kamen mein Sohn und ich von einem Zahnarztbesuch zurück und gingen nebeneinander auf dem schmalen Bürgersteig der Rue de la Folie-Méricourt. Und da fragte er mich ohne jede Vorwarnung und ohne dass irgendetwas im vorangegangenen Gespräch ihn auf diese Frage hätte bringen können:
»Großmutter … hat sie sich gewissermaßen umgebracht?«
Noch heute verstört mich diese Frage, wenn ich daran denke, nicht des Inhalts, sondern der Form wegen, dieses gewissermaßen aus dem Mund eines Neunjährigen, eine Rücksichtnahme auf mich, eine Art, das Terrain zu sondieren, behutsam und auf Zehenspitzen. Doch vielleicht war es für ihn auch eine echte Frage: War Luciles Tod in Anbetracht der Umstände als Suizid zu betrachten?
An dem Tag, als ich meine Mutter in ihrer Wohnung fand, konnte ich meine Kinder nicht abholen. Sie blieben bei ihrem Vater. Am nächsten Tag teilte ich ihnen den Tod ihrer Großmutter mit, ich glaube, ich sagte etwas wie: »Großmutter ist tot«, und, als Antwort auf ihre Fragen: »Sie hat beschlossen einzuschlafen.« (Dabei habe ich doch Françoise Dolto gelesen.) Einige Wochen darauf rief mich mein Sohn zur Ordnung: Man musste die Dinge beim Namen nennen. Großmutter hatte sich umgebracht, ja, sie war freiwillig hopsgegangen, sie hatte bewusst den Löffel abgegeben, den Bankrott erklärt, sie hatte gesagt: Stopp, aus, basta, terminado, und sie hatte gute Gründe, so weit gegangen zu sein.
Ich weiß nicht mehr, wann mir der Gedanke kam, über meine Mutter zu schreiben, um sie herum oder von ihr aus, doch ich weiß, wie sehr ich den Gedanken ablehnte, ihn möglichst lange auf Abstand hielt und mir dabei die Liste der unzähligen Autoren vor Augen führte, die im Laufe der Jahrhunderte bis in die jüngste Gegenwart über ihre Mutter geschrieben hatten, um mir zu beweisen, wie vermint das Gelände war und wie abgegriffen das Thema. Ich verscheuchte die Sätze, die am frühen Morgen oder am Rande einer Erinnerung aufstiegen, lauter Anfänge von allen möglichen Romanen unterschiedlichster Form, deren erstes Wort ich nicht hören wollte, ich stellte die Liste der Hindernisse auf, die sich mir ganz sicher in den Weg stellen würden, und die der unwägbaren Gefahren, die ich einging, wenn ich eine solche Baustelle aufmachte.
Meine Mutter war ein zu weites, zu dunkles, zu verzweifeltes Feld: Kurzum, es war zu halsbrecherisch.
Ich überließ es meiner Schwester, Luciles Briefe, Papiere und Texte zu holen und sie in einen besonderen Koffer zu packen, den sie bald in ihren Keller bringen würde.
Ich hatte weder den nötigen Platz noch die nötige Kraft.
Und dann lernte ich, an Lucile zu denken, ohne dass mir der Atem stockte: an die Art, wie sie ging, den Oberkörper nach vorn geneigt und die Umhängetasche an die Hüfte gepresst, wie sie die Zigarette fest eingeklemmt zwischen den Fingern hielt, wie sie mit gesenktem Kopf in die Metro drängte, an das Zittern ihrer Hände, an ihren präzisen Wortgebrauch, an ihr kurzes Lachen, über das sie selbst überrascht zu sein schien, an die Veränderungen ihrer Stimme durch ein Gefühl, von dem auf ihrem Gesicht manchmal keine Spur zu entdecken war.
Ich dachte, dass ich nichts vergessen durfte von ihrem trockenen, eigenwilligen Humor und ihrem einzigartigen Einfallsreichtum.
Ich dachte daran, dass Lucile sich nacheinander verliebte in Marcello Mastroianni (»Davon bitte ein halbes Dutzend«, pflegte sie zu präzisieren), Joshka Schidlow (einen Theaterkritiker von Télérama, den sie zwar nie gesehen hatte, dessen Schreibstil und Intelligenz sie jedoch rühmte), einen Geschäftsmann mit dem Vornamen Édouard, dessen wahre Identität wir nie herausfinden konnten, und in Graham, einen echten Clochard des 14. Arrondissements, Geiger, wenn ihm danach war, und schließlich Mordopfer. Ich spreche nicht von den Männern, die ihr Leben wirklich geteilt haben. Ich dachte daran, dass meine Mutter eines Abends in einer entlegenen Vorstadt gemeinsam mit Claude Monet und Immanuel Kant einen Hühnertopf gegessen hatte, danach mit dem Vorortzug heimgefahren war und jahrelang keine Schecks mehr ausstellen durfte, weil sie ihr Geld auf der Straße verteilt hatte. Ich dachte daran, dass meine Mutter das Informatiksystem ihrer Firma sowie die gesamten Pariser Verkehrsbetriebe kontrolliert und auf Kneipentischen getanzt hat.
Ich weiß nicht mehr, wann genau ich kapitulierte, vielleicht an dem Tag, an dem ich verstand, wie sehr das Schreiben, mein Schreiben, mit ihr verknüpft ist, mit ihren Fiktionen, ihren Momenten des Wahnsinns, in denen ihr das Leben so schwer geworden war, dass sie ihm entfliehen musste, in denen ihr Schmerz sich nur noch durch die Fabel ausdrücken konnte.
Also bat ich ihre Geschwister, mir von ihr zu erzählen, über sie zu sprechen. Ich habe sie aufgenommen, sie und die anderen, die Lucile gekannt haben und diese vergnügte, vernichtete Familie, die wir bilden. Ich habe auf meinem Computer Stunden numerischer Worte gespeichert, Stunden, die schwer sind von Erinnerungen, Verstummen, Tränen und Seufzern, Lachen und vertraulichen Mitteilungen.
Ich bat meine Schwester, die Briefe, die Texte, die Zeichnungen wieder aus ihrem Keller zu holen, ich suchte, wühlte, kratzte, grub und exhumierte. Ich verbrachte Stunden damit, zu lesen und noch einmal zu lesen, Filme und Fotos anzusehen, ich stellte immer wieder dieselben und noch viele andere Fragen.
Und dann habe ich, wie Dutzende von Autoren vor mir, versucht, meine Mutter zu beschreiben.
Seit mehr als einer Stunde beobachtete Lucile ihre Brüder, wie sie in einem immer wieder unterbrochenen Ballett, das zu verfolgen ihr schwerfiel, vom Boden auf den Stein, vom Stein auf den Baum und vom Baum auf den Boden sprangen. Jetzt versammelten sie sich um etwas, das sie für ein Insekt hielt, aber nicht sehen konnte, und gleich kamen auch die Schwestern angerannt und versuchten aufgeregt, sich in die Mitte der Gruppe zu drängen. Beim Anblick des Tierchens kreischten die Mädchen, als schnitte man ihnen die Kehle durch, dachte Lucile, so schrill kreischten sie, vor allem Lisbeth, die aufgeregt herumhopste, während Justine Lucile mit ihrer durchdringendsten Stimme zurief, sie solle sofort gucken kommen. Lucile, die Beine so übereinandergeschlagen, dass ihr Kleid aus hellem Seidenkrepp nicht verknittern konnte, und die Söckchen tadellos glatt über die Knöchel gezogen, war absolut nicht geneigt, sich von der Stelle zu bewegen. Von ihrer Bank aus verfolgte sie jede Sekunde der Szene, die sich vor ihr abspielte, doch um nichts in der Welt hätte sie den Abstand zwischen sich und ihren Geschwistern verringert, zu denen sich inzwischen, von den Schreien angelockt, weitere Kinder gesellt hatten. Jeden Donnerstag schickte ihre Mutter Liane ihre gesamte Brut, ohne jede Ausnahme, in den kleinen Park, wo die Älteren die Jüngeren beaufsichtigen sollten, und zwar mit der strikten Anweisung, dort mindestens zwei Stunden zu bleiben. Die Geschwisterschar verließ also unter großem Getöse die Wohnung in der Rue de Maubeuge, lief die fünf Treppen hinab, überquerte erst die Rue Lamartine, dann die Rue de Rochechouart, um schließlich triumphierend und unter allgemeinem Aufsehen die kleine Grünfläche zu betreten. Es war unmöglich, diese im Alter jeweils nur wenige Monate voneinander entfernten Kinder nicht zu bemerken, ihr ins Weißliche spielendes Blond, ihre hellen Augen und ihre lärmenden Spiele. Unterdessen legte sich Liane auf das nächstbeste Bett und fiel für zwei Stunden in bleiernen Schlaf, um sich von der langen Reihe der Schwangerschaften zu erholen, von den Geburten, dem Stillen, den von Weinen und Alpträumen zerhackten Nächten, den Waschtrögen und vollen Windeln und von den unerbittlich wiederkehrenden Mahlzeiten.
Lucile setzte sich immer auf dieselbe Bank, die ein wenig abseits, doch immer noch in strategisch günstiger Nähe zu den Schaukeln und Trapezen stand und einen idealen Gesamtüberblick bot. Manchmal war sie bereit, mit den anderen zu spielen, manchmal blieb sie auf dieser Bank, um im Kopf zu sortieren, wie sie sagte, aber sie sagte nie, was genau, und zeigte nur manchmal vage in die Umgebung. Lucile sortierte das Geschrei, das Lachen, das Weinen, das Kommen und Gehen, den ständigen Lärm und die ständige Bewegung, in der sie lebte. Wie auch immer, Liane war wieder schwanger, bald wären sie zu siebt, danach wahrscheinlich zu acht oder zu noch mehr. Manchmal fragte sich Lucile, ob die Fruchtbarkeit ihrer Mutter eine Grenze hatte, ob sich ihr Bauch immer weiter so füllen und leeren und rosige, glatthäutige Babys produzieren konnte, die Liane mit ihrem Lachen und ihren Küssen überschüttete. Doch vielleicht unterlagen Frauen einer bestimmten Höchstkinderzahl, die Liane bald erreicht haben würde, so dass ihr Körper schließlich nicht mehr besetzt wäre. Mit in der Luft hängenden Füßen saß Lucile exakt mitten auf der Bank und dachte an das Baby, das im November zur Welt kommen sollte. Ein schwarzes Baby. Denn jeden Abend, bevor sie in dem Mädchenschlafzimmer, in dem schon drei Betten standen, einschlief, erträumte sich Lucile eine vollkommen und unabänderlich schwarze kleine Schwester, pummelig und glänzend wie eine Blutwurst, an die sich ihre Geschwister nicht heranwagen würden, eine kleine Schwester, deren Weinen niemand verstünde, die unablässig brüllen würde und die ihre Eltern schließlich ihr, Lucile, überlassen würden. Sie nähme das Baby dann unter ihre Fittiche und mit in ihr Bett, und obwohl sie doch Puppen hasste, wäre sie die Einzige, die mit dem Kind zurechtkäme. Das schwarze Baby würde Max heißen, wie der Mann von Madame Estoquet, ihrer Lehrerin, der Fernfahrer war. Das schwarze Baby würde ganz und gar ihr gehören, es würde ihr unter allen Umständen gehorchen und sie beschützen.
Justines Geschrei riss Lucile aus ihren Gedanken. Milo hatte das Insekt angezündet, in weniger als einer Sekunde war es verbrannt. Justine, deren kleiner Körper von Schluchzen geschüttelt wurde, flüchtete sich zwischen Luciles Beine und legte ihr den Kopf in den Schoß. Während Lucile ihrer Schwester über das Haar streichelte, bemerkte sie den grünen Rotz, der in einem Faden auf ihr Kleid lief. Nicht heute. Mit einer energischen Bewegung hob sie Justines Kopf hoch und befahl ihr, sich die Nase zu putzen. Die Kleine wollte ihr die Leiche zeigen, und Lucile stand schließlich auf. Es waren nur noch ein wenig Asche und ein Stückchen verschrumpelter Panzer von dem Tier übrig. Lucile schob mit dem Fuß Sand darüber, dann hob sie das Bein an, spuckte sich in die Hand und rieb die Sandale sauber. Danach holte sie ein Taschentuch heraus, wischte Justines Tränen weg und putzte ihr noch einmal die Nase, um ihr Gesicht dann in beide Hände zu nehmen und sie lautstark zu küssen, so wie Liane immer küsste, die Lippen fest auf die Wangenrundung gedrückt.
Justine, deren Windel sich gelöst hatte, lief zu den anderen zurück. Die hatten sich bereits in ein neues Spiel gestürzt und umstanden jetzt Barthélémy, der laut Anweisungen gab. Lucile setzte sich wieder auf ihre Bank. Sie sah, wie ihre Geschwister auseinanderliefen und dann zu einer dichten Traube zusammenkamen, um danach wieder auseinanderzurennen. Sie hatte das Gefühl, eine Krake oder eine Qualle zu beobachten, oder, bei genauerer Überlegung, ein schleimiges vielköpfiges Tier, das es nicht gab. An diesem vielgestaltigen Wesen, das sie nicht zu benennen wusste – obwohl sie sicher war, zu ihm zu gehören, wie jeder einzelne, selbst ein abgetrennter, Ring zu einem Wurm gehört –, war etwas, das sie ganz überdeckte, das sie unter sich begrub.
Lucile war immer die Schweigsamste von allen gewesen. Und wenn Barthélémy oder Lisbeth an die Tür der Toilette klopften, in die sie sich geflüchtet hatte, um zu lesen oder um dem Lärm zu entkommen, befahl sie mit fester Stimme, die alles weitere Drängen unterband: Ruhe.
Luciles Mutter tauchte am Eingang der Anlage auf; mit erhobenem Arm, leuchtend und schön stand sie auf dem Sandweg. Auf unerklärliche Weise fing Liane das Licht ein. Vielleicht lag es daran, dass ihr Haar so hell war und ihr Lächeln so strahlend. Vielleicht auch an ihrem Vertrauen zum Leben, ihrer Art, alles zu setzen, nichts zurückzuhalten. Die Kinder rannten auf sie zu, Milo warf sich ihr in die Arme und klammerte sich an ihre Kleider. Liane brach in Lachen aus, »Meine kleinen Könige«, sagte sie mehrmals mit ihrer singenden Stimme.
Sie kam, um Lucile abzuholen und zum Fotostudio zu begleiten. Diese Ankündigung wurde mit Begeisterungs-, aber auch Protestschreien aufgenommen – dabei stand der Fototermin schon seit mehreren Tagen fest –, einem lauten Getöse, in dem es Liane jedoch gelang, Lucile für ihr sauber gebliebenes Kleid zu loben und ihrer ältesten Tochter noch einige Anweisungen zu geben. Lisbeth sollte die vier Kleinen baden, die Kartoffeln aufsetzen und den Vater erwarten.
Lucile griff nach der Hand ihrer Mutter, und sie gingen Richtung Metro. Lucile war seit einigen Monaten Fotomodell. Sie hatte schon die Kollektionen von Virginie und von L’Empereur vorgeführt, zwei hochwertigen Kinderbekleidungs-Marken, und für mehrere Werbungen sowie die Modeseiten verschiedener Zeitungen posiert. Im Jahr vorher hatte Liane Lisbeth im Vertrauen gesagt, das Weihnachtsessen und sämtliche Geschenke seien aus dem Erlös der Fotoserien in Marie-Claire und Mon Tricot bezahlt worden, in denen Lucile der Star gewesen war. Auch ihre Geschwister machten hin und wieder Werbefotos, doch Lucile war von allen die Gefragteste. Lucile mochte das Fotografiertwerden. Einige Monate zuvor waren an den Metrowänden riesige Fotos zu sehen gewesen: ihr Gesicht in Großaufnahme, aus der Stirn gekämmtes Haar, roter Pulli, hochgereckter Daumen und dazu der Slogan: »Intexa ist klasse!« Gleichzeitig waren an alle Kinder ihrer Klasse und alle Schulen in Paris Löschblätter verteilt worden, auf denen Luciles Gesicht zu sehen war.
Lucile liebte das Fotografiertwerden, doch was sie mehr als alles andere liebte, war die Zeit mit ihrer Mutter. Die Hin- und Rückfahrt mit der Metro, das Warten zwischen den Aufnahmen, das Schoko-Croissant, das sie danach in der ersten Bäckerei am Wege kauften – diese gestohlene Zeit, die nur ihr gewidmet war und in der keines der anderen Kinder Anspruch auf Lianes Hand erheben konnte.
Lucile wusste, dass es diese Momente nicht mehr lange geben würde, denn Liane meinte, nach den nächsten Sommerferien sei Lisbeth alt genug, um Lucile zu den Terminen zu begleiten, oder Lucile könne dann sogar allein gehen.
Lucile hatte das erste Kleidungsstück angezogen, ein tailliertes Kleid mit schmalen weißen und blauen Streifen, unter dessen Saum ein mehrere Zentimeter breiter weißer Volant hervorlugte. Wenn sie sich drehte, öffnete sich das Kleid wie eine Blume und ließ ihre Knie sehen. Die Friseuse hatte ihr das Haar sorgfältig gekämmt und seitlich mit einer großen herzförmigen Spange zusammengenommen. Lucile betrachtete die schwarzen Lacksandalen, die sie gerade angezogen hatte, sie strahlten in vollkommenem kratzerlosem Glanz, Sandalen, wie sie sie selbst gern hätte und um die ihre Schwestern sie heiß beneiden würden. Mit ein wenig Glück würde sie sie behalten dürfen. Für das erste Foto sollte Lucile sitzen und einen kleinen Vogelkäfig auf dem Schoß halten. Nachdem sich Lucile in Pose gesetzt hatte, breitete die Assistentin den Volant rings um sie aus. Lucile konnte den Blick nicht vom Käfiginsassen lösen.
»Wie lange ist er schon tot?«, fragte sie.
Der Fotograf, der mit seinen Einstellungen beschäftigt war, schien sie nicht gehört zu haben. Lucile sah sich um, sie war entschlossen, den Blick eines Menschen aufzufangen, der ihr Auskunft geben konnte. Ein etwa zwanzig Jahre alter Praktikant trat auf sie zu.
»Sicher schon sehr lange.«
»Wie lange?«
»Ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Jahre …«
»Ist er in dieser Haltung gestorben?«
»Nein, nicht unbedingt. Der Mann, der sich darum kümmert, überlegt sich auch die Pose für ihn.«
»Der Mann, der ihn ausstopft?«
»Ja, genau.«
»Was tut er rein?«
»Stroh, glaube ich, und wahrscheinlich auch noch andere Sachen.«
Der Fotograf bat um Stille, er wollte anfangen. Doch Lucile betrachtete den Vogel immer noch, jetzt von unten, sie suchte nach einer Öffnung.
»Wie bekommt man die Sachen rein?«
Liane befahl Lucile, still zu sein.
Den Anweisungen der Stylistin entsprechend zog Lucile anschließend einen Skianzug aus Wollstrick an (sie posierte mit Skistöcken vor einem hellen Hintergrund aus dickem Papier), einen Tennisdress, dessen weißes Faltenröckchen jede ihrer Freundinnen in Entzücken versetzt hätte, und schließlich einen Badeanzug, der aus einem Oberteil, einem hochgeschnittenen Höschen und einer Badekappe aus dickem Plastik bestand, die Lucile albern fand. Doch Luciles Schönheit war durch nichts zu beeinträchtigen. Wo immer sie war, zog Lucile Blicke und Bewunderung auf sich. Man rühmte ihre ebenmäßigen Züge, ihre langen Wimpern, ihre Augen, die zwischen Grün und Blau changierten und dazwischen jede metallische Nuance widerspiegeln konnten, ihr schüchternes oder ungezwungenes Lächeln und ihr ach so helles Haar. Diese Aufmerksamkeit war Lucile lange unangenehm gewesen, wie irgendetwas Klebriges an ihrem Körper, doch mit sieben Jahren zog Lucile die Mauern eines Refugiums um sich, eines Territoriums, das nur ihr gehörte und in das weder der Lärm noch die Blicke der anderen drangen.
Die Aufnahmen liefen in konzentriertem Schweigen ab, nur unterbrochen von der Veränderung der Kulisse und der Beleuchtung.
Lucile ging vom Umkleideraum auf das Podest und vom Podest in den Umkleideraum, sie nahm eine bestimmte Haltung ein, ahmte eine Bewegung nach, wiederholte dieselben Gesten zehn-, zwanzigmal ohne das geringste Zeichen von Ermüdung oder Ungeduld. Lucile war brav, vorbildlich brav.
Als der Fototermin beendet war und sie sich umzog, bot die Stylistin Liane eine für den Herbst geplante neue Fotoserie für Jardin des Modes an. Liane nahm an.
»Und der Kleine, der einmal mit Lucile mitgekommen ist und ein wenig jünger ist als sie?«
»Antonin? Er ist gerade sechs geworden.«
»Er ist ihr sehr ähnlich, oder?«
»Ja, das wird oft behauptet.«
»Dann bringen Sie ihn bitte mit, wir machen eine Serie mit den beiden.«
In der Metro nahm Lucile die Hand ihrer Mutter und ließ sie während der ganzen Fahrt nicht los.
Als sie ins Zimmer traten, war der Tisch schon gedeckt. Luciles Vater, Georges, war gerade nach Hause gekommen und las die Zeitung. Die Kinder erschienen auf einen Schlag, Lisbeth, Barthélémy, Antonin, Milo und Justine, alle im gleichen Frotteeschlafanzug, den Liane zu Beginn des Winters im Sonderangebot und in sechsfacher Ausführung erstanden hatte, und in den gleichen Luxuspantoffeln mit dreifach gepolsterter Sohle, die ihnen Doktor Baramian geschenkt hatte. Einige Monate zuvor hatte Doktor Baramian, völlig erschöpft von dem Lärm, der während seiner Sprechstunden aus dem Stockwerk über ihm drang, und im festen Glauben, Lianes und Georges’ Kinder trügen zu Hause Holzschuhe, seine Sekretärin hinaufgeschickt, um sich nach den Schuhgrößen zu erkundigen. Dann ließ er jedem Einzelnen umgehend ein Paar Pantoffeln zukommen. Dabei hatte sich ungeachtet der allgemeinen Aufregung erwiesen, dass Milo, der sich äußerst behende auf seinem Nachttopf fortbewegte – Topf, Beinchen, Topf, Beinchen –, der Lauteste von allen war. Liane war von der Freundlichkeit des Arztes so gerührt, dass sie ihren Sohn zu entschärfen versuchte, indem sie ihn mitsamt seinem Töpfchen auf eine Kommode setzte. Milo brach sich das Schlüsselbein, und der Radau ging weiter.
Liane schickte Lucile unter die Dusche, während die anderen sich an den Tisch setzten.
Neuerdings verzichtete Liane darauf, ihre Kinder vor dem Abendessen beten zu lassen. Barthélémys dumme Witze – er wiederholte das Gebet seiner Mutter mit einer Stimme aus dem Off, die jeden Abend mit einem »Gegrüßet scheißt du, Maria« begann und allgemeine Heiterkeit auslöste – hatten den Sieg über ihre Geduld davongetragen.
Sie waren gerade mit der Suppe fertig, als Lucile barfuß und mit feuchtem Haar an den Tisch kam.
»Na, meine Schöne, du hast dich also fotografieren lassen?«
Georges sah seine Tochter mit einem Blick an, in dem etwas wie Staunen lag. Lucile hatte etwas Dunkles, das ihm selbst glich. Schon seit frühester Kindheit weckte Lucile seine Neugier. Ihre Art, sich abzusondern, sich zurückzuziehen, mit Worten zu geizen, nur halb auf dem Stuhl zu sitzen, als erwarte sie noch jemanden, diese Art, wie er manchmal dachte, sich nichts zu vergeben. Doch er wusste, dass Lucile nichts entging, kein Ton, kein Bild. Sie fing alles auf. Sog es in sich auf. Wie seine übrigen Kinder wollte auch Lucile ihm gefallen, lauerte sie auf sein Lächeln, seine Zustimmung, sein Lob. Wie die anderen wartete sie auf das Heimkommen des Vaters und erzählte ihm manchmal, wenn Liane sie dazu ermunterte, was sie am Tag erlebt hatte. Doch Lucile war stärker mit ihm verbunden als alle anderen.
Und Georges, fasziniert, wie er war, konnte den Blick nicht von ihr wenden.
Jahre später würde Liane von dieser Anziehung erzählen, die Lucile auf die Leute ausübte, von dieser Mischung aus Schönheit und Ferne, von ihrer Art, gedankenverloren den Blicken standzuhalten.
Jahre später, als Lucile selbst schon gestorben war, lange bevor sie eine alte Dame hätte werden können, würde man in ihren Sachen die Werbebilder eines natürlichen, fröhlichen kleinen Mädchens finden.
Jahre später, beim Ausräumen von Luciles Wohnung, würde man in einer Schublade einen ganzen Film mit Fotos vom Leichnam ihres Vaters finden, den sie selbst aus allen Winkeln fotografiert hatte, in seinem Anzug, der beige oder ocker war, in der Farbe von Erbrochenem.
Die Möglichkeit des Todes (oder vielmehr das Bewusstsein, dass der Tod jeden Augenblick eintreten kann) trat im Sommer 1954 in Luciles Leben, kurz bevor sie acht wurde. Von da an war die Vorstellung vom Tod ein Teil von Lucile, eine Bruchlinie oder vielmehr eine unauslöschliche Spur – wie die runde Uhr mit den dicken Stundenstrichen, die sie sich später auf das Handgelenk tätowieren ließ.
Ende Juli waren Liane und die Kinder nach L. gefahren, in ein Dorf im Ardèche, wo Georges’ Eltern lebten. Dorthin waren auch einige Vettern und Kusinen gekommen, nur Barthélémy fehlte, er war in den Wochen vor den Ferien so wild gewesen, dass seine Eltern beschlossen hatten, ihn in eine Ferienkolonie zu schicken. Liane war im siebten Monat schwanger. Lucile vermisste ihren Bruder, der seit je die Zeit mit seinem Wirbel, seinen Neckereien und seinen unberechenbaren Heldentaten gefüllt hatte. Barthélémy, dachte sie, konnte zwar sehr lästig sein, aber er sorgte für Unterhaltung.
Sanft und erfüllt vergingen die Tage in der Augusthitze, die Kinder spielten im Garten, badeten im Auzon und formten Dinge aus dem Flussschlamm. Liane hatte Hilfe von ihren Schwiegereltern und konnte sich in dem großen Lehrerhaus mitten im Dorf ausruhen. Georges war in Paris geblieben, um zu arbeiten.
Eines Nachmittags, als Lucile Klavier übte, war der Garten plötzlich voller Schreie. Es war nicht das Geschrei des Spielens oder Zankens, das sie schon gar nicht mehr hörte, nein, es waren schrillere Schreie, Schreie des Entsetzens, die sie nicht kannte. Lucile stockte, die Hände über den Tasten, und horchte auf die Worte, konnte sie jedoch nicht verstehen, doch die dünne Stimme Milos – oder war es die eines anderen Kindes? – drang schließlich deutlich zu ihr: »Sie sind gefallen, sie sind gefallen!« Lucile fühlte ihr Herz im Bauch schlagen, dann in den Handflächen, sie wartete noch einige Augenblicke, bevor sie aufstand. Es war etwas passiert, das wusste sie, etwas, das nicht wiedergutzumachen war. Dann hörte sie Liane schreien und stürzte aus dem Haus. Die Kinder umringten den Brunnen, Justine klammerte sich an Lianes Rock, und Liane beugte sich über das dunkle Loch, dessen Grund sie nicht erkennen konnte, und brüllte den Vornamen ihres Sohnes.
Antonin und sein Vetter Tommy hatten auf den Brettern gespielt, mit denen der Brunnen abgedeckt war, als diese plötzlich nachgegeben hatten. Vor den Augen der anderen Kinder waren die beiden Jungen hineingefallen. Tommy war sofort wieder aufgetaucht, man konnte ihn erkennen, mit ihm sprechen, das Wasser war eiskalt, doch er schien es auszuhalten. Antonin war nicht wieder an die Oberfläche gekommen. Bis die Feuerwehr kam, musste man Liane daran hindern, in den Brunnen zu springen, ihre Schwiegereltern hielten sie zu zweit fest. Nach einigen Minuten begann Tommy zu weinen, seine Stimme hatte einen seltsamen Hall, sie wirkte fern und nah zugleich, und Lucile dachte, er werde vielleicht von unten von einem Ungeheuer belauert, das an seinen Füßen nage und ihn gleich in die Tiefen des Nichts ziehen werde.
Während der ganzen Zeit stand sie weiter hinten, einen Meter hinter ihrer Mutter, die mit einer Kraft kämpfte, die Lucile noch nie an ihr erlebt hatte. Zum ersten Mal sagte Lucile still ihre Gebete auf, alle, die sie kannte, das Vaterunser und das Gegrüßet seist du, Maria, ohne zu stocken und ohne jeden Fehler. Die Feuerwehrleute kamen mit ihrer Ausrüstung, die Kinder wurden zu den Nachbarn geschickt. Sie mussten lange nach Antonins Leiche suchen. Der Brunnen hatte einen Ausgang zu einer Zisterne. Antonin war im kalten Wasser bewusstlos geworden und ertrunken.
Georges kam in aller Eile aus Paris. Antonin wurde in Weiß gekleidet und im Schlafzimmer des obersten Stocks aufgebahrt, Liane hatte den Kindern erklärt, Antonin sei zu einem Engel geworden. Er lebe jetzt im Himmel, weit oben, und könne sie sehen.
Bei der Totenwache durften ihn nur die Ältesten sehen. Während der Gebete streichelte Lucile die pummeligen Hände des toten Jungen, sie waren kalt und geschmeidig, doch im Laufe der Stunden wurden Antonins Hände steif, und Lucile begann, an seiner baldigen Wiederauferstehung zu zweifeln. Sie betrachtete sein glattes Gesicht, die seitlich am Körper ausgestreckten Arme, den Mund, der leicht geöffnet war, als sei er gerade eingeschlafen und atme noch.
Die Beerdigung fand einige Tage darauf statt. Lisbeth und Lucile trugen das gleiche Kleid (man hatte aus dem, was sich in den Koffern fand, etwas Passendes zusammengebastelt) und zeigten, eng aneinandergedrängt, den Ausdruck von Bedeutung, der ihnen als den Älteren zukam. Nachdem der Sarg ins Grab hinabgelassen worden war, standen sie kerzengerade neben den Eltern, während diese die Beileidsbekundungen entgegennahmen. Die Verwandten und Nachbarn zogen in ihren dunklen Kleidern an ihnen vorüber, und Lisbeth und Lucile beobachteten das Ritual: die Hände, die geschüttelt oder auf die Schulter gelegt wurden, die Umarmungen, die unterdrückten Schluchzer, das Flüstern ins Ohr, tröstende oder ermutigende Worte, von denen sie nur Zischen oder mitfühlendes Schnaufen mitbekamen, und das zehn-, zwanzigmal. Bald hörten sie nur noch das und sahen sich dabei jedes Mal an, so dass langsam und nicht zu unterdrücken ein Lachanfall in ihnen aufstieg. Georges schickte sie weg, damit sie sich anderswo beruhigen konnten.
Antonin war jetzt ein Engel und sah ihnen zu. Lucile stellte sich vor, wie sein kleiner Körper mit ausgebreiteten Armen schwerelos in der Luft hing.
Einige Tage lang glaubte sie noch, er werde zurückkehren und sie würden gemeinsam oberhalb des Dorfes Ziegen hüten, die Kaninchenjungen bei Madame Lethac anschauen oder am ausgetrockneten Flussbett entlanggehen, um nach Tonerde zu suchen.
Am Monatsende fuhr eine Freundin der Familie in den Süden und holte Barthélémy ab. Als Barthélémy aus der Ferienkolonie zurückkam, war sein Bruder tot und begraben. Drei Tage lang weinte er und war durch nichts zu beruhigen. Er weinte sehr laut und bis zur Erschöpfung.
Von da an würde Antonins Tod nur noch eine unterirdische, seismische Welle sein, die lautlos immer weiterwirken würde.
Lucile und Lisbeth spähten vorgebeugt durch das Fenster des rosa Mädchenzimmers und stellten sich jedes Mal auf die Zehenspitzen, wenn sie es an der Hauseingangstür schnarren hörten. Trotz der Kälte war es Lucile warm. Erstickend warm sogar. Als sie aus der Schule gekommen war, hatte Liane sich sogar gefragt, ob ihre Tochter nicht vielleicht Fieber habe. Doch gerade, als sie nach dem Thermometer suchen wollte, fing das Baby an zu weinen.
Einige Wochen zuvor war ein kleines Mädchen namens Violette aus Lianes Bauch gekommen, rund und schön wie ein Schwimmer, das laut lachte, wenn man es kitzelte. Anfangs war Lucile enttäuscht gewesen, das Baby sah aus wie alle anderen auch. Doch Violettes Lächeln, ihr Interesse an ihren älteren Geschwistern (sobald eines von ihnen das Zimmer betrat, ruderte sie mit den Armen) und ihr feines Haar, in das Lucile gern blies, damit es um ihren Kopf wehte, hatten die Enttäuschung schließlich überwunden. Violette war zwar nicht schwarz und auch nicht ausschließlich ihr überantwortet, aber wenigstens saß Liane, die mit dem Baby alle Hände voll zu tun hatte, nicht mehr stundenlang in der Küche und starrte ins Leere. Violette verlangte Arme, Fläschchen und Aufmerksamkeit. Mit ihr waren der süßliche Geruch des Puders und der säuerlichere der Wundcreme für den Po zurückgekehrt. Dennoch war die Luft der Wohnung nach wie vor voller Bitterkeit, wie von ihr gesättigt. Wenn Georges abends nach Hause kam, setzte er sich manchmal wortlos hin, erschöpft und mit starren Zügen.
Weder Lucile noch ihre Brüder und Schwestern hatten ihre Eltern weinen sehen.
Lucile stieß die Luft aus und sah zu, wie die Scheibe von ihrem Atem beschlug. Im Hof war alles ruhig. Lisbeth trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Hinter ihnen spielte Justine auf dem Bett mit einer alten Puppe, die sie zum zehnten Mal neu wickelte. Die Jungs hatten sich in ihr Zimmer verzogen, Barthélémy hatte einen abwartenden Rückzug befohlen und Milo ihm, wenn auch verdrossen und schmollend, aufs Wort gehorcht.
Er würde ankommen. Jeden Augenblick. Man würde die Schritte im Treppenhaus hören, den Schlüssel im Schloss, und dann wäre er da, im Wohnzimmer, dann wäre er für das ganze Leben da. Wie er wohl aussah? Ob er Kleider und Schuhe hatte, oder ob er ganz nackt ging unter einem groben Gewand, wie es die Bettler trugen? Ob er Verstecken oder Fangen mit Versteinern spielen und sich mit den Knien kopfüber an eine Stange hängen konnte?
Lisbeth hielt es nicht mehr aus und verließ das Schlafzimmer, um draußen Informationen zu sammeln. Sie kam mit leeren Händen zurück. Liane wusste auch nicht mehr, sie mussten warten. Ihr Vater holte ihn ab, es war nicht gleich um die Ecke, vielleicht gab es Staus.
Er würde kommen. Jeden Augenblick. Ob er groß war, größer als Antonin, oder ganz im Gegenteil ganz klein und mager? Ob er Spinat mochte und Weißwurst? Ob er Narben am Körper oder im Gesicht hatte? Ob er eine Tasche oder einen Koffer hatte, oder ein Bündel an einem Stock, wie in Andersens Märchen?
Es war wenig über ihn bekannt. Er hieß Jean-Marc, er war sieben Jahre alt, er war von seiner Mutter geschlagen und ihr dann weggenommen worden. Er hieß Jean-Marc, und man musste nett zu ihm sein. Dieses Kind war ein Märtyrer. Dieses Wort hatten sich die Geschwister in den Nachtstunden zugeflüstert, ein Märtyrer wie Jesus Christus und Oliver Twist, ein Märtyrer wie die Heiligen Stephanus, Laurentius und Paulus. Von nun an sollte Jean-Marc mit ihnen unter einem Dach leben, in Antonins Bett schlafen und wahrscheinlich auch dessen Kleidung tragen, er sollte mit ihnen zur Messe und zur Schule gehen und ins Auto steigen, um in die Ferien zu fahren, er sollte ihr Bruder sein. Als ihr dieses Wort in den Sinn kam, spürte Lucile, wie sich ihr Herzschlag vor Wut beschleunigte. In diesem Augenblick klingelte es an der Tür.
Die Mädchen stürzten ihrem Vater entgegen. Lucile sah Georges’ Gesicht, seine angespannten, müden Züge, es war wohl ein weiter Weg gewesen. Für eine Sekunde, nein, nicht einmal eine Sekunde lang, hatte Lucile das Gefühl, ihrem Vater seien Zweifel gekommen. Und wenn Georges es bereute, dass er das Kind geholt hatte? Und wenn ihr Vater, der seit Wochen von der Ankunft des Jungen sprach und betonte, man müsse ihn wie ein Familienmitglied aufnehmen, Jean-Marc nicht mehr wollte?
Jean-Marc hielt sich hinter Georges und wurde von dem großen Körper, dem er zögernd folgte, verdeckt. Georges griff nach dem Jungen und ermunterte ihn, sich zu zeigen. Lucile betrachtete Jean-Marc, erst nur mit einem raschen Blick von oben nach unten und von unten nach oben, dann suchte sie seinen Blick. Der Junge war blass im Gesicht, außergewöhnlich blass, er hatte schwarzes Haar und einen zu kurzen, verschlissenen Pullover. Er zitterte. Sein Blick bohrte sich in den Boden, der Körper bog sich zurück, als drohe eine Ohrfeige. Eine nach der anderen traten Lisbeth, Lucile und Justine vor, um ihn zu küssen. Barthélémy und Milo kamen endlich auch aus ihrem Zimmer, beide mit einem sehr zweifelnden Gesichtsausdruck, und musterten Jean-Marc. Milo konnte nicht anders, er lächelte ihm zu. Jean-Marc war genauso groß wie er. Seine Tasche schien fast leer zu sein, Milo dachte, er könne ihm ein paar Sachen geben, zum Beispiel die Bleisoldaten, die er doppelt hatte, oder das Kartenspiel, mit dem er nicht mehr spielte. Milo hatte Lust, Jean-Marc an der Hand zu nehmen und ihn mit sich zu ziehen, doch als er Barthélémys feindselige Haltung sah, gab er den Gedanken auf.
Lucile konnte den Blick genauso wenig von dem Jungen lösen wie die anderen. Sie suchte auf seinem Gesicht nach den Spuren der Schläge, nach eitrigen Wunden, frischen Narben. So märtyrerhaft sah Jean-Marc gar nicht aus. Übrigens gab es an ihm weder einen Gips noch Verbände oder Krücken zu sehen, er humpelte nicht und blutete nicht aus der Nase. War er womöglich nur ein Simulant? Ein Gauner, wie man ihnen in den Büchern oder auf Landstraßen begegnete, die, grau und schmutzig im Gesicht, Obdach bei einer Familie suchten, um sie danach umso leichter berauben zu können? Das Kind hob endlich den Blick, der, wie verblüfft, auf Lucile verharrte. Die schwarzen, geweiteten Augen wurden sofort wieder niedergeschlagen, der Blick auf den Boden gerichtet. Jetzt bemerkte Lucile seine schmutzigen Fingernägel, die unbehaarten weißlichen Bereiche, die das kurz gestutzte Haar sehen ließ, und die dunklen, wie von Tränen gegrabenen Augenringe. Eine große Traurigkeit überfiel sie, mit einem Mal war sie hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, diesen Jungen zu verjagen, und dem, ihn in die Arme zu schließen.
Liane fragte Jean-Marc, ob er eine gute Reise gehabt habe, ob er müde sei oder Hunger habe. Aus seinem Mund kam kein Laut, er schien die größte Mühe zu haben, den Kopf in die eine oder die andere Richtung zu bewegen. Georges schlug Lisbeth vor, ihm die Wohnung zu zeigen. Lisbeth lud Jean-Marc ein, ihr zu folgen. Sie begann mit dem blauen Schlafzimmer der Jungen, die übrigen Kinder folgten ihnen, sie stießen sich mit den Ellbogen an, man hörte sie tuscheln und lachen, Jean-Marcs Socken hatten eine komische Farbe. Barthélémy hielt sich im Hintergrund. Von ferne beobachtete er den Jungen, und es gab an ihm nichts, rein gar nichts, was einem Vergleich standhielt. Jean-Marc war klein, dunkel und schmutzig und mit ein wenig Glück auch noch stumm. Wie hatte sein Vater glauben können, er könne Antonin durch einen solchen Tölpel ersetzen? Ja, einen Tölpel, wie Georges selbst es nannte, wenn er die Tölpel der ganzen Welt geißelte, und nun hatte er, ohne es zu merken, einen Tölpel in sein eigenes Haus geholt. In Barthélémy breitete sich heftiger Schmerz aus, als hätte er einen Fremdkörper verschluckt, einen erdverkrusteten Stein oder ein Stück Glas. Er würde Jean-Marc nie lieben können, er würde nicht einmal sein Freund sein können, er würde nie mit ihm auf die Straße hinuntergehen und schon gar nicht mit ihm im Park oder am Strand spielen können, er würde ihm nie ein Geheimnis anvertrauen oder einen Pakt mit ihm schließen können. Mochte der andere ihn ruhig anschauen wie ein geschlagener Hund, der mit seinen dünnen Ärmchen, er würde nicht nachgeben. Sein Bruder war tot, und sein Bruder war unersetzlich.
An dieser Stelle habe ich aufgehört. Eine Woche verging und dann noch eine, ohne dass ich dem Text eine Zeile oder auch nur ein Wort hätte hinzufügen können, es war, als hätte er sich in einem vorübergehenden Stadium verfestigt, als sollte er für immer ein Entwurf, ein abgebrochener Versuch bleiben. Jeden Tag setzte ich mich an den Computer, ich öffnete die Datei Rien1, ich las den Text, löschte ein oder zwei Sätze, änderte einige Kommata, und dann eben nichts, absolut nichts. Es funktionierte nicht, es war nicht das Richtige, es hatte nichts mit dem zu tun, was ich wollte, was ich mir vorstellte, ich hatte den Schwung verloren.
Und doch war die Besessenheit da, sie weckte mich mitten in der Nacht, wie immer, wenn ich ein Buch anfange, so dass ich mehrere Monate lang innerlich schreibe, ständig, unter der Dusche, in der Metro, auf der Straße. Ich hatte das schon erlebt, diesen Besatzungszustand. Doch zum ersten Mal gab es in dem Augenblick, in dem ich etwas notieren oder tippen wollte, nur diese immense Müdigkeit, eine grenzenlose Mutlosigkeit.
Ich gestaltete meinen Arbeitsplatz um, kaufte einen neuen Stuhl, zündete Kerzen und Räucherstäbchen an, ich ging aus, lief durch die Straßen, ich las noch einmal die Notizen durch, die ich mir im Laufe der vergangenen Monate gemacht hatte. Die Kinderfotos von Lucile lagen ausgebreitet auf meinem Tisch, vergilbte Illustriertenseiten, Kontaktabzüge von Werbeserien und das berühmte Löschblatt, das an den Schulen verteilt worden war.
Um mir das Gefühl zu geben, ich käme voran, beschloss ich, die Gespräche, die ich geführt hatte, noch einmal niederzuschreiben, sie Wort für Wort aufzuschreiben. So macht man es in dem Metier, in dem ich lange tätig war, um den Inhalt zu analysieren, und zwar entsprechend einem gewöhnlich vorher festgelegten Lektüreraster, zu dem die von den Interviewten spontan angesprochenen Themen noch hinzugefügt werden. Ich fing also damit an und verbrachte ganze Tage mit dem Kopfhörer auf den Ohren, die brennenden Augen auf den Bildschirm gerichtet und von dem verrückten Wunsch beseelt, nichts zu verlieren, alles festzuhalten.
Ich horchte auf die Veränderungen in der Stimme, auf das Klicken der Feuerzeuge, das Ausstoßen des Zigarettenrauchs, auf die Papiertaschentücher, die man vergeblich sucht oder in die man sich geräuschvoll schneuzt, auf das Schweigen und auf die Worte, die herausrutschen oder sich ungewollt aufdrängen. Lisbeth, Barthélémy, Justine, Violette, die Geschwister meiner Mutter, und Manon, meine eigene Schwester, und all jene, die ich in den Wochen zuvor getroffen hatte, hatten mir ihr Vertrauen geschenkt. Sie hatten mir ihre Erinnerungen geschenkt, ihre Erzählung, die Vorstellung, die sie sich heute von ihrer Geschichte machen, sie hatten sich ausgeliefert, soweit es nur ging, bis an die Grenzen des ihnen Erträglichen. Und jetzt warteten sie, sie fragten sich wahrscheinlich, was ich aus alldem machen würde, welche Form es annehmen, welchen Schlag es bedeuten würde.
Und das schien mir mit einem Mal nicht zu bewältigen.
In dieser Flut von Wörtern und Schweigen gab es diesen Satz von Barthélémy zu Antonins Tod, diesen Satz, der mich aus dem Munde eines heute Fünfundsechzigjährigen getroffen hat:
»Wenn ich da gewesen wäre, wäre er nicht gestorben.«
Und weitere Sätze, hier und da, die ich gelb hervorgehoben habe und aus denen Trauer spricht, Angst, Unverständnis, Schmerz, Schuldgefühle, Zorn und manchmal Besänftigung.
Und dann Justines Worte, als ich sie nach dem Nachmittag, den sie bei mir verbracht hatte, um mir von Lucile zu erzählen, zur Metro begleitete:
»Du wirst deinen Roman in einem positiven Ton ausklingen lassen, du verstehst doch, daher stammen wir alle.«
Einer Freundin, mit der ich in der Zeit, als ich diese Niederschriften abschloss und immer noch nicht schreiben konnte, zu Mittag aß, erklärte ich: Meine Mutter ist tot, aber ich gehe mit lebendem Material um.
Ich hatte über Antonins Tod geschrieben – der in der Familienmythologie als die am Anfang stehende Tragödie (es sollte noch weitere geben) betrachtet wird. Deshalb musste ich unter den mir angebotenen Versionen diejenige auswählen, die mir am wahrscheinlichsten erschien oder jedenfalls dem am ähnlichsten war, was mir meine Großmutter Liane erzählte, auf einem Hocker in dieser unglaublichen senfgelben Küche sitzend, die meine Kindheit geprägt hat und die es heute nicht mehr gibt. In einer anderen Version machen beide Großeltern, Liane und Georges, mit den Kindern Ferien in L. und lassen sie für kurze Zeit allein, um bei dreihundert Meter entfernt wohnenden Nachbarn zu Mittag zu essen. Antonin und Tommy fallen in den Brunnen, sie rennen herbei, es ist zu spät. In noch einer anderen alarmieren die Kinder meine Großmutter, die mit ihrem dicken Bauch in den Brunnen taucht und von Zeit zu Zeit wieder nach oben kommt, um Luft zu holen. Die einen behaupten, die beiden Jungen seien auf den Brettern herumgesprungen, bis sie brachen, die anderen, sie hätten friedlich Figuren aus Tonschlamm geformt, als die morschen und von Tieren angenagten Bretter unten ihrem Gewicht nachgaben. In wieder einer anderen Version ist nur Antonin hineingefallen, und Tommy konnte den Sturz vermeiden.
Was hatte ich mir gedacht? Dass ich Luciles Kindheit allwissend und allmächtig in einer objektiven Geschichte erzählen könnte? Dass es genügen würde, aus dem mir anvertrauten Material zu schöpfen und meine Wahl zu treffen wie im Selbstbedienungsladen? Aber mit welchem Recht?
Wahrscheinlich hatte ich gehofft, aus diesem seltsamen Material würde sich eine Wahrheit herausschälen. Aber es gab keine Wahrheit. Ich hatte nur verstreute Bruchstücke, und schon das Ordnen dieser Bruchstücke war eine Fiktion. Was immer ich schriebe, ich wäre im Reich der Fabel. Wie hatte ich mir auch nur einen Augenblick lang vorstellen können, ich würde über Luciles Leben Rechenschaft ablegen können? Was versuchte ich eigentlich, wenn nicht dem Schmerz meiner Mutter näherzukommen, seinen Umfang, seine versteckten Winkel und den Schatten, den er warf, zu erkunden?
Luciles Schmerz war Teil unserer Kindheit und später unseres Erwachsenenlebens, vermutlich ist Luciles Schmerz für mich und meine Schwester persönlichkeitskonstituierend. Dennoch ist jeder Erklärungsversuch zum Scheitern verurteilt. Daher werde ich mich damit begnügen müssen, Bruchstücke, Fragmente, Hypothesen aufzuschreiben.
Das Schreiben vermag nichts. Es ermöglicht es einem höchstens, Fragen zu stellen und die Erinnerung zu befragen.
Luciles Familie, und damit auch unsere, hat im gesamten Verlauf ihrer Geschichte zahlreiche Fragen und Hypothesen hervorgerufen. Die Menschen, die ich im Laufe meiner Recherchen traf, sprechen von Faszination; das habe ich auch oft in meiner Kindheit gehört. Meine Familie verkörpert das Lärmendste, das Spektakulärste der Freude, den unermüdlichen Nachhall der Toten und den Widerhall des Unheils. Heute weiß ich, dass sie außerdem, wie so viele andere Familien auch, ein Beispiel für das Zerstörungspotenzial der Worte und das des Schweigens ist.
Heute sind Luciles Geschwister (diejenigen, die noch leben) über ganz Frankreich verteilt. Liane ist anderthalb Monate vor meiner Mutter gestorben, und ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich sage, dass der Tod Lianes, die schon drei Kinder verloren hatte, Lucile das lang erwartete grüne Licht dafür gab, ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Jeder hat seine eigene Sicht der Ereignisse, die die Familiengeschichte begründen. Diese unterschiedlichen, manchmal widersprüchlichen Sichten sind zerstreute Splitter, deren Zusammensetzen oder -tragen zu nichts nütze wäre.
Eines Morgens stand ich auf und dachte, ich müsse schreiben, selbst wenn ich mich dazu am Stuhl festbinden müsste, und ich müsse weitersuchen, selbst in der Gewissheit, dass ich nie eine Antwort finden würde. Dieses Buch wäre vielleicht genau das, der Bericht über diese Suche, der sein eigenes Entstehen enthält, seine erzählerischen Irrwege, seine steckengebliebenen Versuche. Aber es wäre dieser zögernde, unvollendete Impuls von mir hin zu ihr.
Meine Großmutter Liane konnte wunderbar erzählen. Wenn ich an sie denke, und ihren legendären Spagat und ihre zahlreichen sportlichen Leistungen außer Acht lasse, dann sehe ich sie wieder in ihrer Küche sitzen, wie ein verschmitzter Kobold oder ein ins Haus gezogener Waldgeist in einen verrückten selbstgestrickten Schlafanzug aus roter Wolle gekuschelt (bis zu ihrem achtzigsten Lebensjahr trug Liane verschiedene Nachtbekleidungsmodelle eigener Herstellung, teils mit, teils ohne Kapuze und immer in lebhaften Farben), und mit blitzenden Augen und melodiösem Lachen zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte erzählen.
Sie erzählte mit Begeisterung. Zum Beispiel davon, wie sie mit zweiundzwanzig ihre Verlobung löste, nachdem ihre Mutter ihr wenige Tage vor dem schicksalsträchtigen Ereignis erklärt hatte, worin ihre künftige Rolle einer Ehefrau bestand. Liane wusste wie viele Mädchen ihres Alters und ihrer Herkunft so ziemlich nichts über Sex. Einige Monate zuvor hatte sie in die Verlobung mit einem jungen Mann aus guter Familie eingewilligt, der ihr dem zu entsprechen schien, was sie sich unter einem guten Ehemann vorstellte. Liane freute sich darauf, eine Dame zu werden. Doch das hieß nicht unbedingt, dass sie sich nackt neben diesen Mann legen und ertragen würde, dass er mit ihr die Dinge machte, die ihre Mutter erst recht spät zur Sprache gebracht hatte. Wenn sie es genauer bedachte, kam es überhaupt nicht in Frage. Liane erzählte gern von der strengen bürgerlichen Erziehung, die sie genossen hatte, vom Schweigegebot bei Tisch, von den Ansprüchen ihres Vaters und wie dieser, ein angesehener Anwalt in Gien, schließlich hinnahm, dass sie die Verlobung löste, obwohl das Hochzeitsessen schon bestellt und bezahlt war. Einige Monate später besuchte Liane eine ihrer älteren Schwestern, die in Paris lebte, und lernte auf einer Party meinen Großvater kennen. Damals war Liane Turnlehrerin an der Mädchenschule, an der sie auch Schülerin gewesen war. Georges erklärte Liane, sie sei eine bezaubernde kleine blaue Fee; Liane trug ein grünes Kleid. Georges war nicht farbenblind, aber er wusste, wie man Frauen überrascht. Liane verliebte sich unverzüglich in ihn. Dieses Mal erschien es ihr nicht nur möglich, mit diesem Mann nackt in einem Bett zu liegen, es erschien ihr sogar wünschenswert.
Georges stammte aus einer Fabrikantenfamilie, die ein dem Glücksspiel verfallener Vorfahre ruiniert hatte. Georges’ Vater arbeitete zunächst lange als Eisenbahner und wurde dann Journalist bei La Croix du Nord. Da die Zeitung ihr Erscheinen unter der deutschen Besatzung einstellte, geriet Georges’ Familie in große Schwierigkeiten. Obwohl Georges aus weit weniger bürgerlichem Milieu stammte als Liane, akzeptierten ihn die Eltern meiner Großmutter, und die beiden heirateten 1943. Einige Monate darauf kam Lisbeth zur Welt.
Es steht für mich außer Frage, dass meine Großeltern sich geliebt haben. Liane bewunderte Georges’ Intelligenz, seinen Humor und seine natürliche Autorität. Georges liebte Liane wegen ihrer außergewöhnlichen Vitalität, ihres melodiösen Lachens und ihrer unerschütterlichen Arglosigkeit. Sie waren ein seltsames Paar: er, allem Anschein nach ein Verstandesmensch, jedoch völlig von seinen Affekten gelenkt, und sie, nach außen hin so gefühlsbestimmt, doch solide wie ein Felsblock und zutiefst davon überzeugt, sie sei dumm.