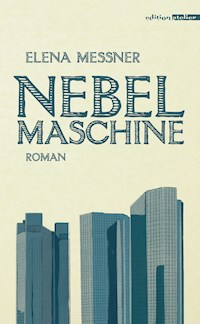Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elena Messner richtet in ihrem klug konstruierten und vielschichtig-spannenden Roman die Scheinwerfer auf das schmutzige Geschäft der Fleischindustrie. Jana Dolenc ist frustriert von ihrer Arbeit in der Umweltbehörde. Die unzähligen Vergehen, die sie tagtäglich in die Datenbank klopft, führen ja doch zu nichts. Bis eines Tages die Kommissarin Nivia in der Lobby steht: Die Schwester des berüchtigten Unternehmers Mark Schulze, den die Behörde schon lange auf dem Zettel stehen hat, wurde ermordet, und Schulze ist verschwunden. Jana soll der Polizei bei den Ermittlungen helfen und arbeitet eng mit Nivia zusammen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der Jana tief in die dunklen Machenschaften der Fleischindustrie zieht und ihre Freundschaft zu Nivia auf die Probe stellt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELENA MESSNER
DIE ABLENKUNG
ROMAN
Euphorie
Wurde ich langsamer oder die Maschine? Jedes Mal, wenn ich einen Eintrag aktualisierte, zählte das System mit, wie lange ein Datensatz aktiv blieb. Als lautes Elektromurmeln tönte eine Uhr zwischen Öffnen und Schließen, begleitete mein Wegklicken, Warten, Drüberlesen, Warten, Weiterscrollen, Warten. Täglich. Weiter warten. Während du nichts tust. Und zwar nicht nur nichts tust. Nicht nur so. Sondern richtig nichts: Keine Gedanken. Keine Bewegung. Keine Gefühle. Im Grunde nicht einmal richtiges Warten, denn selbst das wäre etwas, was man tut. Aber dieses Absitzen im Ticktack, bis man den nächsten Datensatz anlegt, das ist sogar als Warten unnütz, weil man ja nicht auf etwas Neues wartet, sondern nur darauf, etwas zu wiederholen, das man schon tausendmal getan hat, ohne dass sich etwas dadurch geändert hätte. Alles Wissen in unseren Datenspeichern trieb nur dahin, und ich akzeptierte dieses Dahintreiben, während ich längst nicht mehr damit rechnete, dass auch nur eine unserer Untersuchungen zu einer Anklage führen würde. Ich hatte in den vergangenen Jahren Dutzende Berichte darüber verfasst, die uns helfen sollten, zu entscheiden, ob die Indizien gegen Mark Schulze für eine Anklage ausreichen könnten. Im vergangenen Jahr war uns zweimal mitgeteilt worden, dass man die Untersuchung einstellen würde, immer mit einer anderen Begründung: Ressourcenmangel, Legitimitätsproblem, Überlastung. Es ging irgendwie weiter, aber zu einer Entscheidung kam es nicht. Zwar war der Schulze-Fall nur ein Projekt von vielen, er schimmerte aber aufgrund seiner Größe ständig durch andere Aufgaben hindurch, machte sich unerwartet bemerkbar, verschwand vorübergehend, tauchte willkürlich in einem anderen Zusammenhang auf, ohne sich vollständig in meinem Alltag zu verfestigen, blieb als Bericht zum Bericht, als Fußnote zur Fußnote sichtbar und nistete sich hartnäckig in meinem Hinterkopf ein. Und jeder neue Eintrag, bei dem der Name Schulze auftauchte, erinnerte mich erneut daran, wie nutzlos unsere Tausenden Datenbankeinträge waren, solange wir keine Anklage daraus bauen konnten. Ich hatte so viele Schulze-Vorfälle und dazugehörige Sonderfälle dokumentiert, dass ich kaum noch die passenden Recherchesysteme inklusive der Unzahl an Passwörtern und Zugangsberechtigungen auseinanderhalten konnte. Ich wusste alles über ihn. Wenn ich Rind nicht essen wollte, dann seines. Er produzierte, er verpackte, er transportierte. Machte ständig etwas, das er nicht durfte, nur: Wie ihn davon abhalten? Ich wollte eigentlich nichts mehr von ihm hören.
Man hatte mir das Projekt ohne zu fragen und ohne Zeit für Vorbereitung übergeben, ich war alleine mit der Sache und konnte fast nichts mit dem Wissen machen, das mir zufiel. Die Berliner Abteilung, von der ich es übernehmen musste, hatte im Vergleich zu uns in München dreimal so viel Personal zur Verfügung gehabt. Klar, ich hatte schon früher erlebt, dass etwas zu groß für mich wurde. Aber dieses Projekt war derart überdimensioniert, dass ich keine Vorstellung mehr davon hatte, wie es zu verwalten wäre. Schon die notwendigen Verschlüsselungen der Datenbanken bedeuteten regelmäßiges tagelanges Training.
Natürlich erfand ich Ausreden: Andere seien schlimmer, ihre Abteilungen noch ineffizienter, die Kolleginnen ebenso langsam. In dieser Art von Gedanken verirrte ich mich immer häufiger, auch wenn ich sie nie zu Ende dachte oder irgendetwas daraus ableitete, nur breitete sich in mir zunehmend das Gefühl aus, dass ich nur noch eine Enttäuschung nach der anderen aufrollte und abspulte. Diese Enttäuschungen kamen ja von überall her, von innen, von außen, von den Zeitungen und Fernsehberichten, von den Leuten, mit denen man auf der Straße sprach, als wäre die gesamte Welt schon zu träge und zu müde, als wäre sie erstarrt, dabei ständig in Bewegung, weswegen man ihre Erstarrung nicht richtig einordnen konnte. Ich würde das alles gerne besser beschreiben können. Überall diese Ohnmacht, das Gefühl, nur noch aus letzter Kraft weiterzutun. Überall nur die Kämpfe gegen sich selbst. Die Ohnmacht entsteht schließlich nicht einfach so, sie wird über uns gebracht.
Erschöpfung
Um zu verstehen, warum ich so erschöpft war, muss man wissen, worin meine tägliche Arbeit bestand. Sie lag nicht im Aufdecken von Verbrechen, sondern in deren Dokumentation. Ich stellte Informationen sicher, die für Anklagen und Untersuchungen genutzt werden könnten. Kurz gesagt: Ich fütterte meine Datenbanken, Hunderte. Den ganzen Tag nämlich. Ich überprüfte Belege, fasste sie in monatlichen Berichten zusammen, gab sie für andere Behörden als Quellen frei, fürs Umweltamt, fürs Ministerium, für welche Häuser auch immer. Dinge, die viele Kräfte auf der Welt seit Jahrzehnten als unwichtig abtaten, die sie als falsch oder unwichtig anfochten, als angebliche Lügen, versah ich mit Argument, mit Autorität und mit Archivierung. Ich organisierte Einträge, beschlagwortete und klassifizierte sie, behaftete sie über und über mit dem nötigen Ballast beglaubwürdigter Realität:
Das ist passiert –
Dafür gibt es Beweise –
Es ist wirklich geschehen –
Dort und dort, zu dem und dem Zeitpunkt –
Kein Einzelfall –
Gesetzesbruch nach Paragraf soundso –
Untersuchungen der Ozeanologischen Abteilung der Universität eingelangt –
Präsentation der Forschungsergebnisse auf der Tagung der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung –
Die Tierärztliche Hochschule legt eine weitere Studie vor –
Untersuchungen der Veterinärmedizinischen Universität bestätigen Vorwürfe –
Ich war die verbeamtete Bürgin, jene Instanz, die gewährleistete, dass unsere Behörde nur Bewiesenes und für Gerichte ausreichend Gewichtiges weitergab, eine Sammlerin elektronischer Stichworte und Meisterin der Textausschnitte und Tabellen. Ich übersetzte Berichte aus aller Welt, ins Englische oder aus dem Englischen, zerstückelte sie in Zitate und Rechnungen, machte Buchstaben zu Zahlen, später diese Zahlen wieder zu Buchstaben. Nur selten riss mich dabei etwas aus meinem Trott, wie etwa die Meldung, dass die Zahl getöteter Umweltaktivisten weltweit jene der verhafteten überstieg, eine Nachricht, die mitsamt einer händisch angefertigten Namensliste bei mir einlangte, auf der ich dann die Namen von vier ermordeten Kolleginnen entdeckte, die mir vor ein paar Wochen noch selbst ihre Berichte aus Kolumbien und Mexiko geschickt hatten. Meine Güte, all die internationalen Kooperationen, auf die ich in meinen ersten Arbeitsjahren so stolz gewesen war, in die ich meine Hoffnung gesetzt hatte. Wer glaubte daran, dass das half? Was hatte ich mit diesen Ermordeten gemein? Wir arbeiteten mittlerweile mit allen zusammen, die bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten, ohne Unterschied: dem Internationalen Institut für Nahrungsmittelpflanzen der halbtrockenen Tropen, der dänischen Arbeitsgemeinschaft für internationale Agrarforschung, dem Internationalen Institut für Fleischforschung in Brasilien, dem Rindergesundheits-Institut in Peru, einem für Tropische Viehhaltung in Kenia, der Norwegischen Agribusiness Innovationsplattform, dem Internationalen Mais- und Weizenzentrum in Mexiko, zwei Instituten für Tropische Landwirtschaft in Afrika, dem Internationalen Food Policy Forschungsinstitut in Washington, der Vereinigung indigener brasilianischer Anwältinnen gegen den Umweltrassismus, dem Zentrum für die Ernährungssicherheit präkolumbianischer Völker in Kolumbien, der Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika, dem Europäischen Ernährungsgipfel und der Deutschen Welthungerhilfe, dem Komitee für globale Ernährungssicherheit, der Gewerkschaft der Arbeiterinnen in der Nahrungsmittelindustrie in Rumänien, und so weiter. Das waren aber leider lauter Partner, die sich gegenseitig nicht mochten und bekriegten, weil die einen um jeden Preis für Effizienzsteigerung in der Nahrungsmittelherstellung kämpften – und die anderen dagegen. Von gemeinsamem Engagement keine Spur.
Ich schrieb Beileidsnachrichten an die Institutionen, die Kolleginnen verloren hatten, und legte dann deren Namen als weitere Einträge an, trug ein: Alter, Geschlecht, Beruf. Ich rechnete, transformierte, und schon waren auch diese Buchstaben zu Zahlen geworden. Kein Wunder, dass man da müde wird. Das Auge hält dem Bildschirm nicht stand. Und kein Gedanke an sich selbst.
Dabei ging es nicht darum, dass man die Daten, die bei uns eintrafen, nicht auch ohne mein Zutun hätte auffinden können, im Netz, auf Plattformen und Blogs, in Zeitungen. Sondern es ging darum, dass ein zu großer Teil der Menschen diesen Berichten buchstäblich nicht glauben wollte. Es gehörte zu meinem Geschäft, die Hässlichkeit, mit der ich zu tun hatte, wieder und wieder zu benennen, um gegen diesen Unwillen anzuarbeiten. Ich beglaubigte die Berichte, indem ich sie in unsere Datenbanken und Rechner einspeiste, sie hochlud, umrechnete, statistisch und inhaltlich auswertete, dann in Textpakete, die man bei uns bestellen konnte, weiterverarbeitete. Die Kür war meine Arbeit an Abkürzungen und Abkürzungsdatenbanken, so viele Institutionen mussten zitiert werden in geringer Zeichenanzahl in den Datensätzen. Verständlich musste es bleiben, nachvollziehbar, recherchetauglich. An dieser Transformation von Wissen war nichts Schlechtes. Sie war wichtig. Aber: Da gab es kein Vorwärts. Nur Repetition. Technische und sprachliche Wiederholung. Ich baute nichts auf, ich entwickelte nichts, ich bezog mich nur auf bereits Bekanntes. Ich tat das immer Gleiche und zwar immer wieder.
Ich steckte fest.
Auch rein technisch. Denn durch die Fülle an Daten dauerte das Speichern mittlerweile mehrere Minuten lang. So saß ich vor den geöffneten Feldern und wartete ab, bis der Sicherungsprozess beendet war. In dieser Regungslosigkeit, in diesem Warten, ödete ich mich selbst ganz besonders an. Danach füllte ich wieder einige Tabellenkästchen aus, stoppte erneut, wartete weiter, fühlte mich wie ein verstopfter Trichter, in dem mehr und mehr hängen blieb. Dieser Zwang des ständigen Belegen- und Immer-wieder-abspeichern-Müssens! Wozu, wenn alles bekannt war und es doch zumeist nicht zur Anklage kam?
Ja, es ist einzugestehen: Nichts war schlimmer für mich als diese Langeweile.
Dazu kam der schmerzende Rücken.
Vielleicht ist Langeweile das falsche Wort. Ich fühlte mich einer so großen Zermürbung ausgesetzt, dass sich gegenüber allem, was wir taten, ein Widerstand in mir entwickelte. Ich erlebte das nicht nur an mir selbst, ich sah es auch bei den anderen. Euphorie in meinem Büro zu verbreiten schien unmöglich. Die Erfolglosigkeit und die langen Gesichter, die tippenden Hände, begleitet vom Ticken der Computeruhren, waren schwer auszuhalten, ticktack – seit fünf Minuten keine Aktivität, wir sperren in einer Minute den Zugang, wenn Sie noch nicht abschließen wollen, aktivieren Sie einen neuen Datensatz, ticktack, die Zeit wird knapp, aber es lässt sich nichts beschleunigen, die technisch bedingte äußere Lähmung und das abwartende Stilldasitzen dominieren. So wird man eben gefühllos und verliert den Mut.
Nur selten, wenn ich mich im Ticken und Klicken verloren hatte, schreckten mich die Aufnahmen eines Bauern oder Arbeiters auf, ließen mich einen Schrei unterdrücken. Eine Kleinigkeit in einem Film oder auf einem Foto, und ich wurde aus meiner Lähmung, aus diesem Stillsitzen gerissen. Zum Beispiel Aufnahmen vom Haar des Bauern, des Arbeiters, der im Film nur von hinten zu sehen ist, während er das schwache Miniferkel mehrmals gegen eine Wand wirft, um es zu töten, eine Tat, die verboten ist, nicht »fachgerecht«, wie es genannt wird, weil der Eintritt des Todes dabei unsicher bleibt. Es war nicht diese Tat, die mich aufrüttelte, sondern die klebrig wirkenden Haare am Kopf des Arbeiters oder Bauern, die ihn greifbar zu machen schienen, die mich über das Gesicht nachdenken ließen, das zu diesem Haar gehörte.
Der blitzartige Gedanke an Ardian, mit jenem schweren Ziehen in der Brust, das sich aus Mitleid, Schuldgefühl und Wut zusammensetzt. Da war noch etwas in mir, das sich regte.
Aber das ging vorbei, diese Ansätze von Gefühlen, wenn auch negativen, die aber zumindest etwas Lebendiges waren, verschwanden nach wenigen Sekunden.
Und dann wieder nur:
Die Langeweile.
Hoffnung
Ja, so muss man sich mich zu dem Zeitpunkt vorstellen, als die Polizei in unserer Lobby auftauchte: gegen jede Hoffnung gewappnet, erschöpft, überdrüssig. Und darum gänzlich unvorbereitet auf die Gruppe, zu der ich stieß, nachdem der Portier mich benachrichtigt hatte. Neben den Stehtischen mit unseren Broschüren lungerten sie herum: drei Männer in Zivil und eine Frau in Uniform.
Mordkommission?
Die unvorhergesehenen Gäste mussten sofort empfangen werden. Sofort! Roland als Abteilungsleiter war schon da, auch unsere Assistentinnen Lisa, Senada und Pia. Wie kleine Kinder scharwenzelten sie um die Truppe herum. Man schien nur noch auf mich zu warten: Was geschieht da?, jemand in Lebensgefahr? –
Noch mal, jetzt in echt: Mordkommission?
Ja –
So ein Wort rüttelt dich wach, egal wie egal dir schon alles ist.
Die Frau in Uniform hatte eine strenge Stimme:
Vor Wochen sei das Verschwinden der Schulze-Schwester gemeldet worden, ob wir davon gehört hätten?
»Welche der Schwestern?«
»Anastasia?«
»Cornelia!«
»Vermisst?«
»Ruhe, bitte.«
Wir waren zwar höflich, aber die Aufregung war uns anzusehen. Die Uniformierte redete erst weiter, als wir schwiegen, und danach verlief alles recht förmlich. Das Gespräch dauerte ohnehin nur kurz. Wir erfuhren, dass wegen der verschwundenen Schwester gegen Mark Schulze ermittelt wurde und dass man von uns volle Kooperation und Weitergabe aller Informationen in Bezug auf seinen Konzern erwarte.
»Und ob –
Selbstverständlich –
Jana Dolenc ist hier die Ansprechpartnerin Nummer eins –
Wir haben eine Datenbank zum Schulze-Konzern –
Allerdings nur in Fragen der Umweltkriminalität –
Trotzdem –
Sie können auf uns zählen!«
Noch in der Lobby wurde ich mit ein paar Klicks, Anrufen und vielem Händeschütteln der Mordkommission als Auskunftsperson zur Seite gestellt. Das verwunderte mich nicht, wir hatten ja Informationspflicht für polizeiliche Einrichtungen, sodass sich die Sache nicht auffällig oder gar daneben anfühlte. Ganz im Gegenteil. Gut für uns, gut für sie! Wer sollte bei uns im Haus dagegen sein, wenn unsere Forschungsergebnisse auch einmal zum Einsatz kamen? Da wäre man endlich irgendwo einbezogen, nicht nur klägliches Nebenbei, Hintennach, Drumherum –
Wie schnell man sich Hoffnungen macht.
Aber noch entwickelte sich nicht wirklich etwas in mir. Ich war weiterhin bloß funktionell, nach wie vor überarbeitet und skeptisch. In der Woche, die auf dieses erste Treffen folgte, arbeitete ich vorbildlich, gehorsam und gleichmütig weiter, wenn auch etwas irritiert von den vielen Anfragen. Was sollte ich auch sonst sein? Ich tat meine Arbeit, teilte unser Material mit den Beamten, berichtspflichtig und zurückhaltend, wie es in der Hierarchie zwischen unseren Behörden vorgesehen war, immer noch auf Sparflamme, die innere Aufregung, die der Besuch in der Lobby in mir ausgelöst hatte, verbergend.
Dann der Schock.
Doch … Schock, das ist schon das richtige Wort.
Eine Reanimation.
Denn eine Woche später standen schon wieder Menschen in Zivil samt der Frau in Uniform in unserer Lobby, diesmal eine noch größere Gruppe, darunter eine athletische Frau, die man uns als Kommissarin vorstellte.
»Wir haben die Leiche der Schwester gefunden«, hieß es.
»Sie wurde ermordet.«
»Im Wald, in der Nähe einer Jagdhütte der Familie.«
Ich erinnere die Details, mit denen sie uns überschwemmten, der Bericht über die Leiche auf der Lichtung, die Erwähnung von Stichverletzungen an Bauch und Brust, die Beschreibung der Jagdhütte, die ausgeräumt worden war. Das alles prallte an mir ab, schon weil uns alles zu rasch und wie nebenbei mitgeteilt wurde. Erst der Satz, den einer der Beamten fallen ließ, war es, der mich in Aufregung versetzte:
»Mark Schulze ist auch verschwunden.«
Ich musste mich zurückhalten, um nicht aufzuschreien. Meine Brust fühlte sich von einer Sekunde auf die andere ungewohnt heiß und aktiv an, aber ich unterdrückte dieses energetische Gefühl sofort. Einerseits aus Angst, es trüge zu viele kommende Enttäuschungen in sich, aber auch, weil ich nicht wollte, dass die Beamten es bemerkten.
Hatte ich auch alles richtig verstanden?
Die Schwester tot und Schulze verschwunden?
»Er zählt zu den Hauptverdächtigen.«
»Ihre Abteilung führt seit Jahren Ermittlungen gegen ihn?«
»Von jetzt an führen wir die Untersuchung gemeinsam.«
»Absolut!«
Man übergab uns Papiere.
Roland unterschrieb sie alle. Seine Eifrigkeit nervte.
Schon wurden Vereinbarungen besprochen, es fielen jede Menge bekenntnishafte Versprechen. Ich hörte mich mehrfach wiederholen: »Wir helfen, wo wir können.«
Die Mordkommissarin, die die Zusammenarbeit mit mir koordinieren sollte, drückte mir die Hand: »Nivia«, und darauf reagierte ich mit mechanischer Höflichkeit: »Schöner Name, spanisch?«
Sie schüttelte den Kopf – »Portugiesisch« – und lächelte. Den Fall habe man ihr unter anderem wegen ihrer Sprachkenntnisse übertragen. Ja, ja, die Brasiliengeschäfte. Mark Schulze habe Punkt für Punkt alle Klischees erfüllt, um die Wahrheit zu sagen, aber nicht blöd, immerhin sei das Land einer der größten Fleischimporteure nach Europa, da musste man wohl investieren.
Vermutlich sei er in den Norden geflohen, wo er viel Grund besitze.
»Könnte auch sein, dass ihn jemand entführt hat.«
»Oder er ist längst tot.«
Wir reichten den Leuten aus der Mordkommission Kaffee und Dinkelkekse. Das Ganze strahlte eine aufgeregte Feiertagsstimmung aus, nur die Alltagskleidung der Gäste passte nicht zu dem Gefühl des so ernsthaften Anlasses, sie waren geradezu bunt angezogen, von der Uniformierten einmal abgesehen, die sich diesmal abseits hielt und wohl nur zur Abschreckung mitgekommen war. Sie schien nicht wirklich involviert. Nivia dagegen, die leitende Kommissarin, wirkte fröhlich, fast kindlich, um nicht zu sagen unseriös in ihrem lila Shirt. Sie ging reihum von Person zu Person, stellte sich vor, schüttelte allen die Hände, lachte:
»Das wird eine gute Zusammenarbeit.«
»Ich freue mich sehr.«
»Darf man sich duzen?«
Zuneigung
Sie war fordernd und freundlich, von Minute zu Minute den Raum mit ihrem Lächeln erobernd. Die Geschwindigkeit, mit der sie Optimismus verbreitete, war beeindruckend. Ich hörte mit halbem Ohr zu, wie sie im Kreis laufend immer weiter Vereinbarungen traf und Informationen mit allen im Raum austauschte, leichtfüßig, als ginge es um das Kennenlernen bei einer Party. Als sie wieder neben mir zu stehen kam, erklärte sie mir beschwingt, sie habe nur zwei Monate, um das Hauptverfahren einzuleiten – oder eben nicht. Danach würde der Fall ad acta gelegt.
Ich grunzte, während ich in meiner Kaffeetasse rührte, und merkte, wie etwas in mir aufzog, Neid vielleicht, oder Frustration: In zwei Monaten hätte unsere Behörde gerade mal einen international verschickbaren Bericht aufgestellt, gewiss aber keinen Grund für oder wider eine Verhaftung finden können.
»Wir werden schnell sein müssen«, lächelte mein Gegenüber.
Schon übergab sie mir eine der Mappen, die sie in einem koffergroßen Rucksack verstaut hatte: »Die Kooperationsvereinbarung.«
Noch mehr Papier?
Gleich ermüdete mich der Blick auf die mir entgegengehaltenen Akte, die ich sofort aufklappte. Texte über Texte waren darin, voll mit Randbemerkungen, Linien und Zahlen, die jemand hinzugefügt hatte. Neben dem Vertrag seien da die bisherigen Untersuchungsergebnisse gesammelt, erklärte mir die Kommissarin, als sie meinen müden Blick sah. Zumindest das, was sie mit mir teilen durfte, in Kopie und nach Datum zusammengestellt. Sie habe begonnen, die ersten Ergebnisse zu systematisieren. Das handschriftlich Vermerkte seien ihre für alle mitkopierten bisherigen Notizen, die helfen sollten, sich zurechtzufinden.
Ich klappte die Mappe wieder zu.
Auf deren Vorderseite hatte sie das Unternehmenswappen des Schulze-Konzerns geklebt: den Stierkopf in Schwarz auf rotem Hintergrund, die Hörner überspitzt und zu groß im Verhältnis zu den grafisch nur angedeuteten Nüstern, Kopf und Ohren. Ein disproportionaler Bullenschädel, den ich so oft auf Papier gedruckt gesehen hatte, auf Flyern, in Werbekatalogen, als Wanddekoration und Website-Header, als Logo auf Briefköpfen, Pressemitteilungen oder auf Bannern.
»Ein spannender Fall, oder?«
Schon ging sie noch einmal im Kreis, ließ sich von den Assistentinnen etwas erzählen, verteilte weitere Kooperationsvereinbarungen, notierte mehrere Adressen, an die diese in Kopie ergehen sollten. Sie klatschte laut in die Hände, als Roland ihr erzählte, wie unsere Datenbank strukturiert war. Er suhlte sich in ihrer Begeisterung. Kein Wunder, dass der Fall für sie aufregend und vielversprechend war, es musste ihr bisher größter Auftrag sein. Sie wirkte jung, konnte höchstens ein paar Jahre bei der Mordkommission gearbeitet haben. Aber es war vor allem der Unterschied in unseren Handlungsmöglichkeiten, der sie so lebhaft wirken ließ, schnell, proaktiv, provokant, derart gut gelaunt, leichtfüßig und bei Kräften.
Das glatte Gegenteil von mir.
Ich mochte sie sofort.
Sehnsucht
Jede Sehnsucht hat ein Rückgrat, das sie trägt. Als Kind musste ich, um an Fleisch zu kommen, weite Strecken hinter mich bringen, zumeist zu Fuß, oder auch mit dem Fahrrad. Meine Mutter und ich lebten am Land, in einem kleinen Grenzort zwischen Österreich und Slowenien, aus dem die meisten Menschen abgewandert und in dem die Gaststätten geschlossen worden waren. Nur eine Fleischerei hatte überlebt. Dort konnte man außer Fleisch auch alles andere kaufen: Brot, Milch und Kaugummis. Von unserem Haus aus brauchte ich zur Fleischerei etwa zwanzig Minuten zu Fuß, und halb so lang mit dem Fahrrad. Die Strecke führte über die leere Hauptstraße, vorbei an mit Holz verbretterten Eingängen der einstigen Läden oder Cafés, an beschmierten Fassaden verlassener Einfamilienhäuser, an Stadtmauern mit abblätternden Plakaten, auf denen nicht mehr stattfindende Volksfeste und Landwirtschaftsmessen angekündigt waren. Ein absolutes Einsamkeitsgefühl, für ein Kind kaum erträglich: Da war niemand, der an einer Ecke gestanden, aus einem Fenster gewunken hätte, geschweige denn ein paar Worte mit mir gewechselt hätte. In der Fleischerei aber, in der ich schwer atmend und hungrig ankam, im Sommer mit schweißnassen Haaren im Nacken, im Winter mit von der Kälte geröteten Wangen, da wurde getratscht, geflucht, umhergelaufen, und zwar in mehreren Sprachen der Arbeiter und Arbeiterinnen, die hier wegen der Fabriken in der Grenzgegend zwischendurch hängen blieben, Kauderwelsch-Deutsch mischte sich mit für mich schwer verständlichem Slowenisch, das nichts mit jenem meiner Mutter zu tun hatte, oder einem Gemisch aus Serbokroatisch, Rumänisch und Ungarisch. Vor allem aber wurde in einem durch gegessen. Zum Geschäft gehörte auch der Gasthof, und bei Schlechtwetter drängten sich die Leute im engen Speisesaal, bei Sonne saßen sie auf der Veranda vor dem Haus, die sich auf die Hauptstraße hin öffnete. Von den dort im Schatten der Kastanienbäume aufgestellten Plastikstühlen aus konnte man den vorbeifahrenden LKWs oder Autos zuwinken, die zur Medikamentenfabrik fuhren, in der auch meine Mutter arbeitete.
»Gerti, ich hätte gerne Würstel.«
»Herr Kampl, ein Speckbrot bitte.«
»Gibt es heute wieder Schnitzel?«
Ich sehnte mich nach Kontakt, richtete meine Sehnsucht aber auf das Essen, das diesen ermöglichte. Das Rückgrat meiner Sehnsucht war mit keiner besonderen Geschmackserfahrung verbunden, sondern mit dem intensiven Gefühl, nach dem Gerenne oder Geradele jeden Muskel im Leib zu spüren, erschöpft, aber aufgekratzt in eine Extrawurstsemmel oder eine Hühnerkeule beißen zu können, Menschen anzustarren dabei, ihnen zuzuhören, zu beobachten, wie sie selbst zubissen, eine Leberpastete aufstrichen, einen Leberknödel schluckten, eine gebackene Leber zerschnitten und zwischen ihren Zähnen zerrieben. Dieses Zusehen war das Lustvollste, das sich in diesen Jahren meiner Jugend ereignete. Ich fühlte mich, noch kaum bei Atem, sofort allen zugehörig. Als wären die gummiartigen Sehnen im Fleisch ein Gewebeband, das mich und die sich über die Tische hinweg etwas zurufenden Menschen zusammenhielt. Ich verwechselte schlichtweg das Fleisch mit den Menschen, die es aßen.
Das gilt auch in Bezug auf Ardian, natürlich. Er war damals der Aushilfsjunge im Geschäft, arbeitete anfangs im Kühlhaus, später war er für die regionalen Lieferungen mit dem Kühl-LKW zuständig. Ein Fleischtransporteur, seit er