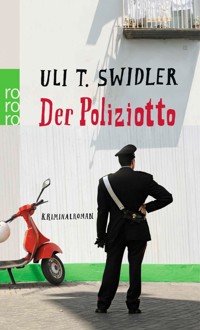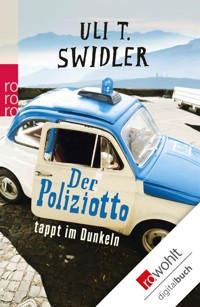8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Das Leben ist eine Nudel, Max. Ist es zu hart, ist es unverdaulich; ist es zu weich und wabbelig, macht es keinen Spaß. Al dente, Max. Nichts schmeckt besser als al dente.» Dies ist eine der vielen Lebensweisheiten von Gino, dem kleinen Maurer und Max' bestem Freund in Italien. Max hat da seine Zweifel: Ist das nicht ein bisschen wenig Weisheit für die gesamte Strecke zwischen Geburt und Tod? Für die anstehenden Probleme reicht sie jedenfalls nicht. Gino droht pleitezugehen, weil Horst «Spaccone» seine Rechnungen nicht bezahlt. Die neapolitanischen Cousins, von Gino um Hilfe gebeten, nehmen die Sache todernst, schließlich geht es auch um «bella figura». Zu allem Überfluss lässt sich Gino dann noch auf den örtlichen Mafioso Volpini ein, der eine fette EU-Subvention in die eigene Tasche umleiten will. Kurzum: Es herrscht Chaos. Und vor diesem Hintergrund soll Anna sich entscheiden, zu Max auf den Monte Dolciano zu ziehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Uli T. Swidler
Das Leben ist eine Nudel
Neues vom Monte Dolciano
Für
Nicole
Käte
Triestina
Prolog
Ginos Attacke auf Spaccone war der Hammer, niemand hätte ihm je so etwas zugetraut, ich am allerwenigsten.
«Ou, Spaccone!», brüllte er und trat aus der Dunkelheit ins grelle Scheinwerferlicht vor Spaccones rustico, seine Machete in den dunklen Nachthimmel gereckt.
Spaccone tollte gerade mit seiner neuen Gespielin Tamara im Swimmingpool herum. Die beiden spielten Ringelpiez mit Anfassen, so hieß es in Spaccones Generation, wenn ein Sexualakt erwünscht war, aber weiblicherseits alle körperlichen Annäherungsversuche des Mannes mit albernem Quieken beantwortet wurden.
«Guck an», formulierte Spaccone mit etwas Mühe, wahrscheinlich war da neben den Hormonen auch Alkohol im Spiel. «Gino, der Zwergmaurer. Was willst du denn hier?»
Gino wedelte drohend mit der Machete. «Komm raus! Ich will mit dir reden.»
«Komm du doch rein», antwortete Spaccone erstaunlich gelassen und dümpelte wie eine feiste Robbe in der Mitte des Beckens. Weil sein sonnenbrandgeröteter Rotweinbauch einen gewaltigen Auftrieb erzeugte, konnte er nicht untergehen und sogar noch Tamara mit über Wasser halten. Oder war es umgekehrt? Tamara wog locker hundertvierzig Kilo und hatte ihren eigenen Auftrieb.
«Faccia di merda!»1,brüllte Gino.
«Testa di minchia!»2,schrie Spaccone zurück.
«Betrüger!»
«Du italienisches Stinktier!»
«Fanfarone!»3 Gino vollführte jetzt bedrohlich aussehende Bewegungen mit seiner Machete.
«Imbecillone!»4 Spaccone strich sich mehrfach mit dem Zeigefinger das Kinn hoch, wahrhaftig keine entspannungsfördernde Geste einem Mann wie Gino gegenüber, der mütterlicherseits neapolitanischer Abstammung war.
Um es an dieser Stelle einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Eigentlich verabscheute Gino Gewalt. Er glaubte an die Kraft des Geistes und der Worte, und wann immer sich Gelegenheit bot, zitierte er aus Dantes «Göttlicher Komödie». Sogar bei seiner Arbeit als Maurer ging er einfühlsam und vorsichtig, ja, fast buddhistisch zu Werk. «Ich gebe einem Stein, den ich vermaure, die Gelegenheit, Teil eines großen Ganzen zu werden», hatte er mir einmal gesagt. Natürlich hatte ich gelacht, aber er hatte es ernst gemeint. Und dann hatte ich selbst einmal gehört, wie er beim Arbeiten zu seinen Steinen sprach, so etwas wie: «Und du, du wirst deinen Platz an dieser Stelle finden, du siehst schön aus, deshalb darfst du etwas weiter aus der Wand herausragen. Jetzt ein wenig Mörtel, track! Siehst du? Da sitzt du nun für die Ewigkeit.»
So kannte ich Gino bisher: als Maurer und Philosophen, Sozialisten und Humanisten, Romantiker und eben als halben Neapolitaner. Und genau dieser gewann in jener Sekunde die Oberhand.
«Tira la cuoia!»5,schrie Gino, rasend vor Wut, und plötzlich beschleunigte er seinen kompakten Körper wie einen Testarossa auf der Überholspur, die Machete vorgereckt wie eine Lanze. Weder Tamara noch ich zweifelten daran, dass er sich gleich voll angekleidet mit der Machete ins Wasser und auf Spaccone stürzen würde. Was bei Tamara dazu führte, dass sie quiekend die Flucht ergriff, und bei mir, dass ich Gino hinterherjagte, um vielleicht noch das Schlimmste zu verhindern.
Dabei hatte der Tag gar nicht so schlecht angefangen. Obwohl… na ja.
1.
«Du willst doch jetzt nicht etwa diesen Benzinstinker anmachen?», pflaumte mich Gino an und deutete auf meine Motorsense.
«Was denn sonst? Soll ich mich mit der Nagelschere durch die Brombeeren nagen?»
Va bene, es gibt bessere Scherze, und ein mitleidiges Lächeln wäre in Ordnung gewesen. Gino jedoch führte sich auf wie eine schwer beleidigte Leberwurst. «Habe ich etwas von Nagelschere gesagt?», legte er los. «Habe ich nicht. Nagelschere, che stupidaggine! Was glaubst du eigentlich, wie Generationen von Bauern vor dir Brombeeren geschnitten haben? Eine handgeschmiedete Machete haben sie benutzt. So wie diese.» Er holte ein respekteinflößendes Teil aus dem Kofferraum seines Fiat Panda, das aussah wie eine mittelalterliche Hellebarde und einen sehr scharfen Eindruck machte. Mir reichte er eine zweite, die allerdings in erbärmlichem Zustand vor sich hin rostete.
«Ist ja gut, Gino, mein Gott», versuchte ich ihn zu beschwichtigen. «Ist doch nicht wichtig.»
«Wenn ich dir helfen soll, ist es wichtig!»
«Ich habe dich nicht gefragt, ob du mir hilfst», ereiferte ich mich. «Du hast dich angeboten.»
«Ragazzi!»,ging Anna dazwischen. «Jetzt beruhigt euch mal.»
«Ich bin ganz ruhig», tat Gino scheinheilig.
«Vor allen Dingen», maulte ich. «Du verbreitest hier eine ziemlich üble Stimmung.»
«Ah!», rief Gino, klatschte in die Hände und schoss eine Salve von raumgreifenden Gesten ab, derentwegen er erst einmal einen Schritt zurücktreten und Platz schaffen musste. «Ich? Nein, nein, compagno, ich habe eher den Eindruck, dass du hier wie eine Trauerweide herumstehst und dich beschwerst. Ich bin Italiener, wir nehmen die Dinge nicht so», er rührte mit seinen Händen herum, als würde er mit fünf frischgefangenen Seeigeln jonglieren, «nicht so wichtig!»
«Was soll das denn jetzt», stöhnte ich matt. Wenn man, wie ich, seit Jahren über angeblich fundamentale Unterschiede zwischen Deutsch und Italienisch diskutieren musste, also zwischen dem Schweren und dem Leichten und dem Dunklen und dem Hellen und dem Kühlen und Heißen, dann wurde man es tatsächlich irgendwann leid. Dieses Themenfeld war unendlich und mit Steinen, Landminen und gebrauchten Babywindeln übersät, die Italiener einfach in die Landschaft pfefferten und Deutsche ordnungsgemäß entsorgten. Oder etwa nicht?
Gino zwinkerte Anna zu. «Max hat diesen Hang zum Melancholischen.»
Anna lächelte und kraulte Uilly. Der hatte, seit Anna hier vor einigen Wochen aufgetaucht war, vollkommen vergessen, wer sein Herrchen war, und nur noch Augen, Ohren und Nase für sie. Ich sah den Hund eindringlich an, um ihn daran zu erinnern, dass er ohne mich längst zu Seife verarbeitet worden wäre. Uilly schloss entspannt die Augen und leckte hingebungsvoll an Annas Hand, was so viel bedeutete wie: Ich würde auch als Seife eine gute Figur abgeben.
«Danke für deine Unterstützung, Anna», meckerte ich.
Anna legte ihren Arm um mich. «Gino, kann es sein, dass du heute schlecht gelaunt bist?»
«Keine Spur», entgegnete Gino und zog probeweise die blitzscharfe Machete einmal durch das äußerst widerstandsfähige Brombeergestrüpp. Zapp, Donnerwetter! «Gar nicht.»
Das war schlicht und einfach gelogen. Schon die Art, wie er sich jetzt über das Gestrüpp hermachte, sagte alles.
«Italiener sind nie schlecht gelaunt», sagte ich spöttisch.
«Eben», entgegnete Gino.
«Und Deutsche kapieren einfach überhaupt nichts, richtig?»
«Ohne mich, lieber Max, hättest du in der Tat keinen Schimmer, wie die Welt hier auf dem Monte Dolciano funktioniert.»
Anna klatschte in ihre Hände. «Forza, i miei cari!1 Ich glaube, ein bisschen Bewegung tut euch beiden gut.» Sie klopfte Uilly mit dem Knöchel ihres Zeigefingers auf die Nase, was ein hohles Geräusch verursachte, keine Ahnung, warum sie das tat. «Seit wann hast du den Kleinen hier eigentlich, Max?»
Uilly wedelte begeistert wie ein Welpe mit dem Schwanz und lehnte sich mit seinem gesamten Körper gegen Annas Beine. Den Kleinen? Dieser Hund kapierte einfach nicht, dass er kein Schoßhündchen, sondern ein ausgewachsener, fünfzig Kilo schwerer Pastore Maremmano war, ein Hütehund, dafür geschaffen, allein auf sich gestellt eine ganze Schafherde Tag und Nacht gegen Wölfe, Wildschweine und nervige Touristen zu verteidigen.
«Schwer zu sagen», antwortete ich. «Er war von Anfang an da und gehörte irgendwie allen auf dem Berg. Erst seit ich seine Haftpflichtversicherung bezahle–»
«Porco Guida!»2,fluchte Gino. Ein dicker grüner, elastischer Brombeerzweig hatte zurückgeschlagen und seine Dornen in Ginos Unterarm gekrallt.
«Motorsense, sag ich doch», bemerkte ich und bemühte mich überhaupt nicht, den leisen Unterton von Schadenfreude zu verbergen.
Gino beachtete mich gar nicht und entfernte die Ranke mit einem beiläufigen Ruck. Rambo hätte es genauso gemacht. Wieder ließ er die Machete dramatisch durch die Luft wirbeln. Von da an werkelten wir über eine Stunde schweigend vor uns hin, während Anna mit Uilly herumtollte – oder es zumindest versuchte. Uilly war, was Spielen betrifft, eher der rationale Typ mit einem klaren Standpunkt: kostet Energie, macht müde, erzeugt Hunger – ist nichts für mich. Anna versuchte mit großer Hingabe, ihn umzustimmen, vergeblich. Was seinen Dickkopf betraf, war Uilly ein echter Maremmano, denen man nachsagt, nicht nur schwer, sondern prinzipiell überhaupt nicht erziehbar zu sein. Ein Maremmano hörte sich immer freundlich an, was man zu sagen hatte, um sich dann erst einmal entspannt zum Schlafen hinzulegen; wenn er wieder erwachte, konnte doch wohl niemand erwarten, dass er sich an irgendetwas erinnerte.
Anna gab auf und holte ihr Zeichenbuch hervor, das sie ständig mit sich herumtrug, und begann sich der Landschaft zu widmen, die jetzt, Ende September, vor allem von Brauntönen in allen Schattierungen geprägt war. Der Sommer war ungewöhnlich heiß gewesen, und die macchia bestand, abgesehen von Steineichen, Hainbuchen und Ginsterbüschen, kaum noch aus Grünem. Die Felder waren abgeerntet und zeigten ihre lehmige, umbrafarbene Seele, durchsetzt mit sehr vielen Steinen. Heuballen warteten, in schöner Regelmäßigkeit über die Äcker verteilt, auf ihren Abtransport, und da, wo dieses Jahr Sonnenblumen geerntet worden waren, wirkte der Boden verklebt und leblos. Was hauptsächlich mit den trostlosen, dreißig Zentimeter hohen Stängeln zu tun hatte, die die Erntemaschinen zurückließen und die erst untergepflügt wurden, wenn es galt, die Wintersaat auszubringen.
«Ich wusste, dass keiner kommen würde. Nicht, bevor wir mit der Arbeit fertig sind», grummelte Gino vor sich hin.
Die Arbeit bestand darin, die fast zugewucherte Bocciabahn unterhalb der Chiesa del Monte Dolciano von ihrem Gestrüpp zu befreien und schadhafte Stellen an der Betonumrandung auszubessern. Vor ein paar Tagen hatte ich Sestina, Giuseppes Frau, auf einen caffè besucht. Giuseppe hatte sich entgegen seinen sonstigen Gepflogenheiten nicht sofort verdrückt, um in Ruhe ein Schläfchen zu halten, sondern hatte sich zu uns an den Küchentisch gesetzt und mich einige Minuten schweigend angesehen, wobei er mir jedes Mal, wenn sich unsere Blicke kreuzten, lächelnd zunickte. Ein Vorspiel, ganz klar.
«Die Bocciabahn, Max», sagte er unvermittelt, als Sestina aufstand, um den winzigen Fernseher anzuschalten, am Nachmittag sah sie sich immer die Wetterkarte auf dem canale verde an. «Man müsste einen finden, der sie von all dem robace befreit.»
Damit meinte er das inzwischen wieder wildwuchernde Grünzeug auf der Bahn. Vor allem die pestartig sich verbreitenden Paradiesbäume, guarda cielo, hatten erneut eifrig für Nachwuchs gesorgt.
«Wer soll das denn sein, Giuseppe, der all das robace wegmacht?», fragte ich ihn. «Du etwa?»
Giuseppe nahm einen Schluck aus seiner Espressotasse und schnalzte mit der Zunge.
«Also gut, ich mach’s, keine Sorge», fügte ich mich ins Unvermeidliche. Seit ich, ebenfalls nur mit Ginos Hilfe, vor einem Jahr die Bahn nach ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf freigelegt und repariert hatte, war ich so etwas wie ein Platzwart, und der hatte eben ein paar Pflichten. Auch wenn Giuseppe derjenige war, der die Bahn mit Abstand am häufigsten benutzte.
«Warte nicht zu lange», warnte er mich. «Du weißt, wie schnell das Zeug hier wächst.»
«Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal anfangen», sagte ich, worauf Giuseppe freundlich lachte und mir herzlich zunickte, was in der unmissverständlichen italienischen Gebärdensprache so viel heißt wie: Netter Versuch, compagno, aber weißt du überhaupt, mit wem du es hier zu tun hast? Nicht? Das dachte ich mir.
«Außerdem muss endlich das Holzbrett an der Kopfseite angebracht werden. Alles andere verstößt gegen die internationalen Spielregeln.» Er tippte auf einen Stapel von losen Zetteln, die seit einigen Wochen auf dem Küchentisch lagen und die Sestina nicht wegräumen durfte. Es handelte sich um die offiziellen Spielregeln der Federazione Italiana Bocce, deren Präsident Romolo Rizzoli Giuseppe direkt angeschrieben hatte, bzw. er hatte Nardini gebeten, den Brief nach seinen Vorgaben zu Papier zu bringen, und die Vorgaben waren simpel: Hier lebt ein talentierter Kerl auf dem Monte Dolciano, ein Naturtalent, und der will bei euch mitmischen.
«Bei einem Volo-Wurf mag das noch hinkommen ohne Brett, aber wenn ich einen Raffa-Wurf ansage…» Giuseppe schaufelte mit beiden Händen in Höhe seines Herzens Luft, was in der unmissverständlichen italienischen Gebärdensprache so viel heißt wie: Es gibt Schlimmes, es gibt Entsetzliches, aber das wäre schlimmer und entsetzlicher.
Giuseppe spielte fast jeden Tag auf der Bahn, meistens gegen sich selbst und besessen von dem Gedanken, irgendwann so gut zu sein, dass er zusammen mit seinem großen Vorbild Pasquino, dem Vizemeister der regionalen Boccia-Liga, ein Turnier wagen konnte. Zuerst hatte er mit buntlackierten Holzkügelchen gespielt, die er billig auf dem Wochenmarkt in Cagli erstanden hatte, den er jeden Mittwoch mit seiner Ape und schräg in die Stirn geschobenem Strohhütchen besuchte. Seit er sich zu den Bocciaspielern zählte, hatte der Markttag für ihn neben dem Herumflanieren eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Vicecampione Pasquino verkaufte dort nämlich Obst und Gemüse am Stand seines Schwagers Italo. Pasquino hatte Giuseppe seinerzeit bei der Einweihung unserer Bahn erklärt, dass Profis wie er von Zeit zu Zeit ihre professionellen Wettkampfkugeln abstoßen mussten, die exakt 857Gramm das Stück wogen und nur aus synthetischem Material hergestellt sein durften. Denn durch die harten Profi-Wettkampfbedingungen wurde bei jedem Spiel eine Winzigkeit an Material abgerieben, und irgendwann wog so eine Kugel eben nicht mehr 857Gramm und genügte damit nicht mehr den professionellen Anforderungen, was zur Disqualifikation führen konnte. Giuseppe hatte an seinen Lippen gehangen. So viel Professionalität imponierte ihm, und zugleich wartete er geduldig, bis Pasquino mit seiner Abhandlung «Ein Profi und sein Arbeitsgerät» fertig war, um die entscheidende Frage zu stellen:
«Pasquino, sag mir eins: Was passiert eigentlich mit so einer Kugel, wenn sie nur noch, diciamo, 856Gramm wiegt?»
«Ich könnte sie nach Afrika verkaufen», sagte Pasquino mit einem unbestreitbar überheblichen Unterton. «Da nehmen sie es nicht so genau mit dem professionellen Wettkampfgewicht.»
«Oh», hatte Giuseppe enttäuscht geantwortet.
«Solo scherzo!», lachte Pasquino. «Da wäre ja der Transport teurer als alles andere.» Er machte eine Pause, die etwas Gönnerhaftes hatte, immerhin war er ein Cagliese, also ein Teil der modernen Welt, und Giuseppe war nur ein einfacher Bauer, also ein Fossil, ein Relikt aus längst überholten und mehrfach überrundeten Zeiten. «Wenn du willst, kannst du sie haben.»
«Oh», sagte Giuseppe, dieses Mal erfreut.
«Ich weiß natürlich nicht, wann es so weit ist. Du musst also immer wieder mal nachfragen.»
Genau das tat Giuseppe von da an jeden Mittwoch. Dass Pasquino sich jedes Mal wie eine Diva gebärdete, bevor er mit seinem Zustandsbericht, immer noch 856,5Gramm!, oder gar mit einer Kugel herausrückte, störte Giuseppe nicht. Früher oder später würde er sein Ziel erreichen, nämlich acht Kugeln zusammenzubekommen, um sein kleines privates, semiprofessionelles Spielchen auf dem Monte Dolciano abzuhalten. Seine Traumgegner waren Piccarini, Franco, Nardini und ich, weil er dann weitgehend sicher sein konnte zu gewinnen. Anna hätte er auch gerne wenigstens einmal dabeigehabt, um herauszufinden, ob sie eine gefährliche Gegnerin war. Wenn ja, konnte er sie ja wieder ausladen, sie war ja nur eine Frau.
Eine Stunde später, in der Gino und ich konzentriert weitergewerkelt hatten, war alles Grünzeug beseitigt.
«Pause, ragazzi!», rief Anna. «Ich habe ein paar Oliven, einen Pecorino und eine Flasche Falerio3 im Auto.»
«Oh, gut», sagte Gino und hängte die Machete in eine Lederschlaufe an seinem Gürtel.
«Und hoffentlich etwas Leitungswasser für Gino», fügte ich hinzu. Ich war jetzt richtig sauer auf den kleinen, kompakten Maurer, weil er jeden meiner Versuche, mit ihm zu reden, einfach ignoriert oder allerhöchstens mit einem schlechtgelaunten Grunzen beantwortet hatte.
«Du trinkst keinen Wein?», fragte Anna. Schließlich kannte sie Gino noch nicht so lange und wusste nichts von dessen Ablehnung aller berauschenden Substanzen, also Alkohol, Tabak, italienisches Fernsehen, die Lega Nord und sogar Kaffee, sofern es sich um mehr als eine Tasse –
«Durchaus, hin und wieder», entgegnete Gino.
«Wie bitte?», erregte ich mich. «Bis zu dieser Sekunde warst du immer gegen alles Berauschende», ich zählte auf: «Alkohol, Tabak, italienisches Fernsehen, die Lega Nord und sogar Kaffee, wenn es sich um mehr als eine Tasse–!»
«Finde ich gut, wenn einer nicht stur an seinen Prinzipien festhält», unterbrach mich Anna und lächelte Gino an.
Gino grinste so breit, wie selbst Mick Jagger es nicht hinbekommen würde.
«Du Schleimer! Das gibt es doch gar nicht!», schnaubte ich aufgebracht, während Anna zum Auto ging.
«Alles relativ, Max.»
«Was ist denn daran relativ?»
«Du willst wissen, was Relativität ist?»
«Nein, das will ich nicht.»
«Kann ich dir erklären.» Gino nahm eine breitbeinige Haltung ein, als würde ihn seine eigene Erklärung möglicherweise umwerfen, und holte tief Luft.
«Ich weiß, was Relativität ist», versuchte ich ihn zu stoppen. Natürlich vergeblich.
«Wenn man zwei Stunden lang mit einem schönen Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute vergangen. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.»
Was war denn nur mit diesem kleinen Maurer los, der sich gerne seiner besonderen Sensibilität rühmte und männliches Balzgehabe und Machosprüche als Beleidigungen des weiblichen Geschlechts ansah? «Machst du jetzt auf Gigolo, oder wie?»
Gino warf mir einen tadelnden Blick zu. «Das war ein Zitat. Albert Einstein hat das gesagt. Ein Intellektueller. Kein, wie sagt ihr immer, Latin Lover.»
Ich verkniff mir die Bemerkung, dass Einstein seinerzeit mit nicht gerade unerheblichem Eifer Frauen umgarnt und etliche parallele Liebschaften gehabt hatte.
Anna hatte inzwischen eine Decke auf der Wiese vor der Brombeerhecke ausgebreitet und einen meiner Weidenkörbe daraufgestellt, aus dem eine Weinflasche herausragte. Pasquino, der Vize-Bocciameister, flocht die Körbe in seiner Freizeit, allerdings nur, wie er immer wieder betonte, um sich seine ruhige Hand zu bewahren, schließlich wollte er endlich einmal den Meistertitel gewinnen, den Fausto Monachi, sein Widersacher, seit elf Jahren hielt. Pasquinos größte Angst war, dass man ihm seine bäuerliche Herkunft unter die Nase reiben würde, deshalb legte er betont Wert auf eine moderne Lebensgestaltung, und Weidenkörbe flechten gehörte definitiv nicht dazu. In der Beziehung war er wie die Mehrheit der Cagliesi, der Bewohner der marchigianischen Kleinstadt Cagli, die bösen Zungen zufolge seit dem 26.Januar 1994 vor allem fortschrittlich sein wollten, dem Tag, als Berlusconi verkündete, in die Politik zu gehen, und seine Partei Forza Italia gründete. Bauern hatten in diesem Weltbild keinen Platz mehr, sie waren traditionell nicht sehr gebildet und taten jedes Jahr dasselbe, nämlich säen und ernten – was sollte denn daran bitte schön fortschrittlich sein? Witzigerweise führte die Bewunderung für den steinreichen Cavaliere nie zu einer politisch rechten Kommunalregierung in Cagli, obwohl die Mehrheit der Verachteten, also eben die Bauern, rechts wählten. Warum sie das taten, obwohl sie am härtesten von der rechtspopulistischen Regierung in Rom gebeutelt wurden, wird kein Soziologe je ergründen können.
Gino hockte sich auf die Decke. Uilly ließ sich schwer und mit einem demonstrativen Seufzer neben ihn fallen, als hätte er die gesamte Brombeerhecke im Alleingang flach gesenst.
«Vai via!», knurrte Gino ihn an und fuchtelte mit seiner Rechten vor Uillys Nase herum, was der für eine Geste der Zuneigung hielt und deshalb versuchte, an der Hand zu lecken.
«Was ist?», fragte Anna erstaunt.
«Ich mag keine Hunde.» Gino verschränkte die Arme hinter dem Kopf und kaute auf einer Olive herum. «Kennt ihr den? Treffen sich zwei Jäger, sagt der eine: Es gibt Hunde, die bedeutend klüger sind als ihre Besitzer. Sagt der andere begeistert: Ja, genau, ich hab so einen!»
«Das ist kein Hund, das ist Uilly», sagte ich, um mir wieder ein wenig von Uillys Sympathie zurückzuerobern, aber der Maremmano stand wie immer über den Dingen und schloss seine Augen für ein kleines Schläfchen. Uilly regelte die Dinge auf seine Weise, und die war meiner in jeder Hinsicht überlegen.
«Tu parli coi piedi»4,brummelte Gino.
«Verdammt, Gino, jetzt rück endlich raus! Was ist mit dir los?»
«Niente. Rede ruhig weiter, was immer du reden willst.» Seine offene Rechte kreiste mit elastischen Fingerbewegungen im engeren Raum neben seinem rechten Auge, was in der unmissverständlichen italienischen Gebärdensprache in etwa so viel bedeutete wie: Ich werde vor Langeweile sterben, du bist dran schuld, und demzufolge musst du für die Kosten des Begräbnisses aufkommen.
«Heißt das, du willst es mir nicht sagen?»
«Das Leben ist so nicht, Max.»
Oje, wenn Gino schon beim Leben im Allgemeinen angelangt war, dann sah es düster aus. Ich stellte mich schon auf weitere Stunden mit einem widerborstigen Kerl ein, der in seinen besten Momenten von herzerwärmender Liebenswürdigkeit, in seinen schlechtesten jedoch schlimmer als eine biblische Plage sein konnte, als Anna sich neben ihm auf dem Rücken ausstreckte, die Arme so wie er hinter ihrem Kopf verschränkte und beiläufig fragte: «Also, was ist los?»
Plötzlich zeigte Gino freudige Begeisterung. Er wackelte mit seinem Kopf zur rechten Seite hin, während er mit der linken Hand wie eine Kaulquappe schwänzelte, was nichts anderes bedeutete als: Ich bin ja in keiner Weise wichtig, aber sollte man nicht auch mich armen Wicht gelegentlich fragen, was los ist?
«Die Bank. Sie will meinen Bagger und meinen Laster pfänden.»
Anna stöhnte auf. «Wieso das denn?»
«Wegen der 94Millionen Lire, die Spaccone dir noch schuldet?», fragte ich.
Gino lachte zwar und versuchte weiterhin, freudig und begeistert zu tun, aber ein Anflug von Verzweiflung war nicht zu überhören. «Die Phönizier haben das Geld erfunden; fragt sich nur, warum so wenig.» Er stupste mir in die Rippen. «Was, Max?»
Das war kein Anflug, das war pure Verzweiflung, einen solchen Satz würde Gino im Normalfall niemals von sich geben.
«Und jetzt?», fragte Anna bestürzt.
«Irgendwie schaffe ich es schon.»
«Ja, aber wie?»
Gino sprang auf und massierte sich den Unterarm. «Zum Beispiel, indem ich das Geld von Spaccone eintreibe!»
«Du weißt, dass er nicht zahlt», sagte ich mit leicht genervtem Unterton, das Thema hatten wir in den letzten Wochen schon so oft. «Außerdem ist er in Deutschland.»
«Er wird schon wieder zurückkommen.»
Ich winkte ab. «Das nützt dir nichts. Er hat doch schon klargemacht, wie er seine Schulden begleichen will: Er wartet, bis du tot bist.»
«Wenn er sich da mal nicht täuscht.»
«Komm, Gino, du weißt, wie das hier in Italien läuft. Du hast jetzt Klage eingereicht, aber die Verhandlung wird frühestens in zehn oder fünfzehn Jahren sein.»
«Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.»
«Ich sag’s ja nicht gerne, Gino, aber deine Chance, dann noch zu leben, ist–»
«Max! Was redest du denn da!», unterbrach Anna mich entrüstet.
«Er tut nur immer so nett», sagte Gino mit überzeugendem Ernst. «In Wahrheit ist er eiskalt.»
«Ich verstehe das nicht. Ich denke, ihr seid Freunde?»
Gino formte mit den Fingern der Rechten eine Pyramide, indem er die Fingerspitzen zusammenpresste, und ließ diese vor und zurück pendeln. «Der und ich? Das ist doch wohl ein Witz!»
«Ein schlechter Witz», ergänzte ich. «Italiener und Deutsche können niemals Freunde sein.»
Anna sah empört von einem zum anderen.
«Die Deutschen lieben die Italiener, aber respektieren sie nicht», erklärte ich. «Die Italiener respektieren die Deutschen, lieben sie aber nicht.»
«Wer sagt denn, dass ich dich respektiere», sagte Gino und senkte seine Stimme in düstere Tiefen. «Ich werde mir diesen Mistkerl vorknöpfen.»
«Und was dann, Gino? Willst du ihn foltern? Mit der Gartenschere zuerst den kleinen Finger abschneiden und dann nach und nach die anderen?»
«Igitt, Max!» Anna sah mich bestürzt an, so, als wäre ich der mit der Gartenschere und schon beim Zeigefinger angekommen.
Gino wandte sich Anna zu. «Max sieht zu viele Mafiafilme mit Al Pacino und Robert De Niro.»
«Er wollte seine Verwandten in Neapel um Hilfe bitten», erklärte ich Anna und sagte zu Gino: «Hast du mir nicht immer gesagt: Die sind hart drauf, mit denen legt man sich besser nicht an, und wenn, dann garantiere ich für nichts?»
«Sind die bei der Mafia?», fragte Anna. Für sie war es undenkbar, dass Gino irgendeine dunkle Seite haben konnte.
«Mafia?», fragte Gino, als hätte er dieses Wort noch nie gehört.
«Mafia, Cosa Nostra, so heißt die doch, oder?», blieb Anna am Ball.
«Cosa Nostra wird die Mafia in Sizilien und nicht die in Neapel genannt.»
«Na, dann eben ’Ndrangheta.»
«Die sind in Kalabrien aktiv», fachsimpelte Gino selbstgefällig wie ein Super-Spezial-Experte fürs Bandenwesen.
«Mensch, Gino, du weißt doch, was ich meine. Sind die jetzt Mafiosi oder nicht?»
«Sei matto? Nur weil wer in Neapel wohnt, ist er nicht gleich ein Mafioso.» Irgendwie schaffte Gino es, diesem Satz eine Melodie zu geben, die einen gedanklich ergänzen ließ: Aber meine Verwandten, die gehören ganz klar zum harten Kern. «Außerdem habe ich sie gar nicht angetroffen, weil sie nicht da waren. Die waren auf einer Hochzeit. Meine Cousine dritten Grades hat geheiratet. Oder ist die jetzt vierten Grades? Mhm. Aber eingeladen hat mich keiner.»
«Du wärst doch sowieso nicht hingegangen», warf ich ein. Für Gino gab es weder Weihnachten noch Geburtstage, noch Taufen und am allerwenigsten Hochzeiten.
«Dieser Spaccone», fragte Anna, «ist das der Deutsche, dessen Frau vor ein paar Monaten gestorben ist?»
«Weil es da nur um die Geldgeschenke geht und um nichts anderes», antwortete Gino mir, ohne sich um Annas Frage zu kümmern.
«Hallo?», brachte sich Anna in Erinnerung.
«So ein Blödsinn!», ereiferte ich mich.
«Ach was!», tönte Gino genervt.
«Hochzeiten sind ein wichtiges Symbol und–»
«Ach was», unterbrach er mich, «du mit deinem Halbwissen über italienische Sitten und–»
«Und die Gastgeber sind ja auch sehr großzügig», unterbrach ich ihn meinerseits. «Neun-Gänge-Menü, dann eine Liveband und–»
«Auf einer italienischen Hochzeit sind sechs von neun Gängen ungenießbar.»
«Essen! Darum geht es auch nicht, da geht es um zwei Menschen, die–»
«Ach was! Eine italienische Hochzeit ist eine Leistungsschau des Brautvaters, nichts anderes, und wenn du was anderes–»
«Verdammt nochmal!» Anna sprang auf, böse wie ein Tasmanischer Teufel. «Jetzt reicht’s mir aber! Kann ich vielleicht mal erfahren, was hier los ist? Habt ihr jetzt Streit oder nicht?»
«Ich streite nicht mit Max. Weil der sowieso immer den Kürzeren zieht. Das verstößt gegen die Menschenrechte.»
«Man darf Gino nicht so ernst nehmen, Anna. Ich zum Beispiel tu das nie.»
Anna sah von einem zum anderen und wieder zurück. Die Wut verschwand aus ihrem Gesicht und wich einer Coolness, die für mich völlig neu an ihr war.
«Okay, ihr Komiker, ich verstehe.» Sie setzte sich wieder, zog die Weinflasche aus dem Korb und werkelte an dem halb eingesteckten Korken herum. «Die Sache ist im Grunde ernst und bedrohlich, aber, typisch Männer, ihr wollt so tun, als hättet ihr alles im Griff. Deshalb scherzt ihr lässig herum und findet euch ganz toll.»
Gino riss erstaunt seine Augen auf.
«Also, ich habe alles im Griff», nörgelte ich empfindlich, ich konnte Sätze nicht leiden, in denen Formulierungen wie «typisch Mann» vorkamen und «Männer sind so und so». «Bei mir will keine Bank irgendwas pfänden.»
Anna goss sich ein Glas Falerio ein und roch konzentriert daran. «Du bist wegen 94Millionen Lire pleite?»
«Also, nicht direkt», wand Gino sich, peinlich berührt.
Anna verdrehte die Augen: Diese umständlichen Männer, und jetzt auch noch unpräzise.
«Insgesamt sind es wohl an die 150Millionen.» Gino war regelrecht eingeschüchtert.
«Dieser Spaccone – wie heißt der eigentlich richtig?»
«Ors-o.»
«Horst», verbesserte ich Gino. Es gibt zwei Dinge, die für einen Italiener unannehmbar sind: zum einen ein Wort, das mit einem Konsonanten und nicht einem Vokal endet. Zum anderen ein Wort, das mit einem H beginnt. Kommt beides zusammen, verfallen sie vorübergehend in eine Art Totenstarre und hoffen, dass andere sich die Zunge brechen.
«Orst-e, meinetwegen», bot Gino einen Kompromiss an.
Ich wollte noch einmal «Horst» sagen, aber Annas drohender Blick hielt mich davon ab. «Alle nennen ihn eben Spaccone.»
«Dieser Horst schuldet dir also 150Millionen?»
«Weißt du, Anna, das Leben ist eine merkwürdige Sache», begann Gino. Ganz eindeutig handelte es sich hier um den Versuch eines Befreiungsschlags: plötzlicher Wechsel vom Faktischen ins Philosophische, und zwar am besten in einem la-a-a-ngen Monolog. «Das Leben, da passieren Dinge, die entziehen sich der Logik und der Sachlichkeit. Da sind Kräfte am Werke, die–» Er zuckte erschrocken zusammen, als Anna ihre Hand mit Entschiedenheit auf seinen Arm fallen ließ.
«Weißt du, Gino», sagte sie mit einem ironischen Lächeln, «wenn du um den heißen Brei herumreden willst, dann kannst du das mit Max machen. Mir ist meine Zeit dafür zu schade. Da sehe ich mir lieber in Ruhe die Landschaft an, trinke einen Falerio und esse ein bis zwei Oliven.»
Das warf Gino endgültig aus der Bahn. Ich war mir sicher, er hatte schon längst im Sinn gehabt, seine heißgeliebte Geschichte vom Lehrer aus Florenz5 zum Besten zu geben. Wahrscheinlich war er innerlich schon ganz aufgeregt, schließlich würde das eine Premiere mit einer uralten Nummer werden, denn Anna kannte die Geschichte ja noch nicht, als Einzige auf dem gesamten Monte Dolciano. Doch Gino erholte sich erstaunlich schnell. Schon nach wenigen Schrecksekunden zwinkerte er mir zu.
«Wie Luciana», trällerte er. «Die bringt auch immer alles auf den Punkt. Ist sie nicht wie Luciana? Wie Luciana!»
Ich lächelte stolz. Was für ein Kompliment, wenn man bedachte, dass Luciana, die Inhaberin der Bar Furlo, die mit Abstand attraktivste und begehrteste Frau hier auf und rund um den Monte Dolciano war.
Unbeeindruckt spuckte Anna einen Olivenkern im hohen Bogen ins Brombeergestrüpp. Uilly öffnete ein Auge, um die Lage zu sondieren, und schloss es sofort wieder, Oliven taugten für ihn nicht einmal zur Dekoration.
«Was ist jetzt, Gino?», fragte Anna, holte den Pecorino hervor und brach ein Stück heraus. Zwei Sekunden später war Uilly im Bilde, hob seinen Kopf und starrte Anna an, oder besser gesagt ihre Hand mit dem Käsestück. Anna zeigte erstaunliche Härte und aß es einfach auf. Ohne Uilly vermenschlichen zu wollen, aber er schien mir etwas enttäuscht zu sein von seiner neuen Freundin.
«Ich habe zum Beispiel für Angelo Visconti einige Arbeiten gemacht, oben, noch hinter Ripidello», begann Gino. «Das Dach gerichtet, einen Kamin gebaut, so was. In der Zwischenzeit hat Angelo aber sehr viel Pech gehabt. Bei einem Schneesturm im letzten Winter hat er sich verletzt. Schwer verletzt. Fast zwei Meter Schnee in eineinhalb Tagen. Das Dach von seinem Stall ist über ihm zusammengekracht. Rums! Ein Wirbel war gebrochen, ein paar Rippen und das Hüftgelenk. Und kein Krankenwagen kam nach da oben durch.»
«O Gott! Wie ist er denn gerettet worden?»
«Enrico hat sich mit seiner Raupe auf den Weg gemacht. Kannst du dir das vorstellen? An manchen Stellen lag der Schnee so hoch, dass er unter der Schneedecke gefahren ist, wie ein U-Boot.»
«Wahnsinn. Kaum zu glauben.»
«So war es. Ich schwöre», bekräftigte Gino mit großem Ernst.
«Natürlich glaube ich dir, Gino.»
«Auch das mit dem U-Boot unter der Schneedecke?», fragte ich.
«Na ja», sagte Anna, «ich nehme es als Symbol dafür, wie dramatisch die Lage war.»
Gino sah mich mitleidig an: Die weiß, wie wir Italiener ticken, im Gegensatz zu dir, du Teutone! «Sein Rücken jedenfalls ist hin», fuhr er fort. «Seine Schafe und Ziegen musste er verkaufen.» Gino rotierte mit der Rechten, ganz eindeutig mit der universellen Botschaft: Alle kapieren es, nur der Teutone an sich nicht. «Also habe ich ihm gesagt: Angelo, hör zu, bezahl mich, wenn du wieder Geld hast.»
«Immerhin sechsunddreißig Millionen Lire», ergänzte ich.
Annas Blick wurde weich. «Wie großherzig von dir.»
Gino fühlte sich geschmeichelt, wollte es sich jedoch nicht anmerken lassen. «Ich bin Sozialist. Ich finde, die Menschen müssen zusammenhalten und Lasten gleichmäßig auf allen Schultern verteilen.»
«Du bist echt süß», sagte Anna gerührt.
«Angelo hat sich inzwischen ein neues Auto, eine Digitalkamera und einen PC gekauft», warf ich ein, weil ich mich schon lange darüber ärgerte, dass Gino sich darüber nie aufregte.
«Sei doch nicht so negativ, Max!» Anna deutete heftig mit dem Weinglas auf mich, und ein guter Teil des Falerio schwappte heraus.
«Bin ich nicht. Ich finde eben, wenn von zweien nur einer Sozialist ist, funktioniert die Sache nicht.»
«Wir sind Freunde. Wir sind Nachbarn.» Gino ruderte etwas unbeholfen mit beiden Armen, was in der unmissverständlichen italienischen Gebärdensprache so viel heißt wie: Mir fällt gerade die passende Geste nicht ein, porcheria!
«Und wenn du jetzt zu Angelo gingest», fragte Anna, «und du sagtest: Ich brauche das Geld, könnte der dann bezahlen?»
Gino riss die Augen auf und warf die Arme seitlich von sich, als wollte er sie loswerden. «Perfekt! Dieser condizionalis!» Gino sah mich tadelnd an. «Hast du das gehört, Max? D a s ist gutes Italienisch.»
«Ich weiß auch, wie man das condizionale bildet», warf ich ein.
«Vielleicht. Aber bis du die Verben richtig konjugiert hast, sind deine Gesprächspartner schon essen gegangen, haben das Tiramisù vertilgt und fragen nach einem caffè.»
«Gino», mahnte Anna. «Könnte Angelo bezahlen?»
Gino ließ die Arme schwer herunterfallen, man wird sie eben doch nicht so leicht los. «Ich weiß es nicht.» Die Angelegenheit war ihm äußerst unangenehm.
«Einen Teil bestimmt», sagte ich.
Anna füllte ihr Glas wieder auf. Bei der Gelegenheit bemerkte sie, dass sie die Einzige war, die Wein trank.
«Dann frag ihn doch mal, Gino», sagte sie und goss auch mir Wein ein.
«So funktioniert das hier nicht. Nicht hier auf dem Monte Dolciano», erwiderte Gino verärgert. «Wenn Angelo das Geld hätte, würde er auch bezahlen. Ich bin nicht der einzige Handwerker, der Außenstände hat. Auf lange Sicht hat noch jeder sein Geld gekriegt. Oder es haben sich andere Möglichkeiten ergeben. Nimm Nardini, dem habe ich ein Fundament für seinen Wohnwagen zementiert. Dafür hat er mir ein paar Briefe geschrieben.»
«Was für Briefe?», fragte ich, was Gino mit einer unwilligen Geste beantwortete.
«Mhm», sagte Anna, «nur eines verstehe ich nicht: Wieso bist du sauer, dass Horst nicht zahlt, aber nicht sauer, dass Angelo nicht zahlt?»
«Das ist etwas anderes.»
«Wieso?»
«Das ist etwas anderes», wiederholte der kleine Maurer trotzig, sprang auf und stürmte wieder auf die Bocciabahn.
Anna sah mich erstaunt an. «Was hat er denn auf einmal?»
«Da kommt einiges zusammen. Gino hat ein Jahr praktisch ausschließlich für Spaccone gearbeitet, ein komplett neues Dach gebaut, einen Swimmingpool, dann innen das Haus verputzt, Wände neu hochgezogen. Als er fertig war und sein Geld haben wollte, hat Spaccone ihm aufgezählt, womit er nicht zufrieden ist. Eine sehr lange Liste. Und er will erst zahlen, wenn Gino all das wieder geändert hat.»
«Während der ganzen Zeit vorher hat dieser Horst nichts gesagt?»
«Kein Wort.»
«Und Gino hat nie zwischendurch nach Geld verlangt?»
«Das ist die andere Seite der Geschichte, die kompliziertere. Gino wollte Valerie so nah wie möglich sein, und das konnte er am besten, indem er in dem Haus arbeitete, in dem Valerie wohnte. Über Geld und Bezahlen hat er einfach gar nicht nachgedacht. Gino wollte ihr geben, was die anderen ihr verweigerten: Anerkennung, sie auf Händen tragen, ja, sogar Liebe. Spaccone hat genau gemerkt, wie beseelt Gino von seinen Gefühlen für Valerie war, und hat ihn gnadenlos ausgenutzt.»
«So ein Mistkerl! Und danach? Wäre es schwer gewesen, die Änderungen durchzuführen?»
«Unter anderem wollte Spaccone den Swimmingpool dreiundneunzig Zentimeter näher am Haus haben.»
«Oh.» Anna schüttelte den Kopf.
Ich brach mir auch ein Stück aus dem Pecorino heraus, teilte es in zwei Hälften und hielt Uilly eine hin. Der schnappte sogleich zu und schluckte ohne zu kauen, zeigte aber keinerlei Anzeichen von Dankbarkeit. Bastardo!
«Ich habe Gino sogar davor gewarnt, den Auftrag anzunehmen. Ich war mir sicher, dass Spaccone nicht zahlen würde.»
Anna nickte und sah dem kleinen Maurer zu, wie er sich an einer entlegenen Stelle, die nun wirklich nicht gerodet werden musste, wütend mit den Brombeeren herumschlug. Währenddessen kraulte sie Uilly rund um die Ohren, wofür der sich mit merkwürdigen Geräuschen bedankte, hin und wieder das Maul öffnete und es mit spastischem Zucken wieder schloss. Das war seine Art zu sagen: Besser geht’s nicht, und morgen um dieselbe Zeit bitte dasselbe nochmal.
«Gino hält grundsätzlich jeden Menschen im Kern für anständig. Das klingt naiv, aber hier auf dem Monte Dolciano ist er damit immer gut gefahren. Mal kommt er, mal kommt der andere besser weg. Hier kennen sich alle untereinander, jeder ist ein bisschen schlitzohrig und auf seinen Vorteil bedacht, aber am Ende hält sich alles in etwa die Waage, weil keiner riskiert, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Spaccone ist der Erste, der rücksichtslos nur an seinen eigenen Vorteil denkt.»
«Aber warum hat denn keiner etwas gesagt? Die Frau von Spacc… von Horst zum Beispiel, wie hieß sie noch?»
«Luise. Die war klasse. Die hat immer genau gewusst, was richtig und was falsch ist. Glasklar. Und sie hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Außer bei ihrem Ehemann, da hat ihr Urteilsvermögen völlig versagt.»
«Wahrscheinlich ist er mal ihre große Liebe gewesen», sagte Anna leise. «Der großen Liebe verzeiht man manches.»
Ich lächelte sie an und nahm ihre Hand. Sie legte ihren Kopf an meine Schulter und schloss die Augen. Uilly hob den Kopf, wahrscheinlich fand er das sentimental und kitschig. Möglicherweise war es das, na und? Wir hätten jedenfalls noch ewig so sitzen bleiben können. Zumindest bis zum Wintereinbruch.
Es war Ende September, die Sonne schien kräftig, und die Temperaturen waren fast sommerlich. Um uns herum herrschte die Stille der Natur: keine Autos, keine Säge, kein Geräusch von Menschenhand, kein Gedröhne, keine Klimaanlage. Nur wenn man seine Ohren anstrengte, war da ein vielfältiges Geraschel, Gezirpe und Singen zu vernehmen. Bienen mit Torschlusspanik summten herum, um noch schnell die letzten Tröpfchen Nektar einzusammeln. Glückliche Eidechsen tobten zwischen den trockenen Gräsern umher, als Wechselwarmblüter wussten sie warme Tage sehr zu schätzen, schon der nächste Kälteeinbruch konnte sie lahmlegen. Und selbst Ginos Wüten im Gestrüpp klang irgendwie natürlich, wie eine Kohorte von Wildschweinen, die sich durchs Unterholz fräste auf der Suche nach liebevoll angelegten Gärten, die sie ihrem miesen Charakter entsprechend verwüsten konnten.
«Du musst dein Leben hier sehr lieben, Max», flüsterte Anna in mein Ohr, und es klang für mich, als wollte sie eigentlich sagen: Aber ich gehöre hier nicht hin. Mir wurde kalt ums Herz. Was, wenn Anna dem Leben hier tatsächlich nichts abgewinnen konnte?
2.
Gerade wollte sich der schwermütige Teil meiner Seele dieser erschreckenden Vorstellung hingeben, da schnitt ein Ton wie vom Bohrer beim Zahnarzt in unsere Ohren.
«Was ist das?», fragte Anna erschrocken.
Mit der Hand, die eben noch Annas gehalten hatte, schirmte ich meine Augen gegen das Sonnenlicht ab. «Giuseppe mit seiner neuen Ape.» Giuseppe hatte das Dreirad oben an seinem rustico in Ripidello gestartet und heizte nun im ersten Gang mit viel zu hochdrehendem Motor den Hang herunter auf die Madonnina zu. Irgendwie wirkte sein Gefährt instabil, warum, konnte ich aus unserer Perspektive nicht erkennen.
«Völlig überladen, diese kleine Ape, das sieht doch jeder», brummte Gino, der unvermittelt hinter uns stand und jetzt noch schlechter gelaunt war. Er kippte sich etwas Wasser über die von blutigen Kratzspuren übersäten Unterarme. Die Brombeeren hatten sich also nicht kampflos ergeben.
Plötzlich zuckte er zusammen, als hätte ihn eine Viper erwischt. Er reckte sich und deutete links hoch, wo die Straße zum Friedhof und hinab ins Tal führt. Von dort kam ein silberner Mercedes Geländewagen mit großer Geschwindigkeit herangeprescht und näherte sich der Madonnina.
«Spaccone!», grollte er. «Da kommt Spaccone, porca madosca! Che sfacciataggine!»1
Giuseppe erreichte die Madonnina vor Spaccone. Mit viel zu hohem Tempo bog er um die Kurve, ein Hinterrad hob sich taumelnd in die Luft, und die Ape rasierte knapp am Straßenrand entlang, wo es senkrecht vier Meter in die Tiefe ging.
«Nein!», schrie Anna auf.
Giuseppe schien sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein und winkte uns gut gelaunt zu. Der Geländewagen holte jetzt mächtig auf.
«Leg bitte die Hand an den Lenker», flüsterte Anna entsetzt.
Wie in Zeitlupe senkte sich endlich das dritte Rad zu Boden. Augenblicklich begann die Ape heftig zu schlingern, was mit der langen Holzbank zu tun hatte, die hinten weit über die Ladefläche hinausragte. Obwohl der Teufelsfahrer sein Gefährt nur mit großer Mühe auf Kurs halten konnte, verringerte er sein Tempo kein bisschen. Spaccone setzte zum Überholen an und drückte mit wildem Staccato auf die Hupe, eine monströse Fanfare, die eine eindeutige Sprache sprach: Ich bin der Größte, weg da!
Giuseppe zuckte zusammen, die Ape geriet gefährlich ins Schleudern, trotzdem zog Spaccone an ihr vorbei, ohne Rücksicht zu nehmen, und nebelte sie mit einer riesigen Staubwolke ein.
«Faccia da merda!»2,ächzte Gino, die Linke zur Faust geballt, mit der Rechten die Machete schwingend. Seine fast schwarzen Augen blitzten Spaccone entgegen, doch der machte keine Anstalten, bei uns anzuhalten. Winkend und noch einmal hupend zog er vorbei und jagte wie ein junger Hirsch bergauf zu seinem Haus. Giuseppe wurde endlich langsamer, nicht, weil er das Gas wegnahm, sondern weil die Straße bis zur Bocciabahn ziemlich steil wieder anstieg. Er schaffte es nicht, herunterzuschalten, und die Drehzahl des Motors sank bedrohlich ab. Bis er absoff. Mit ein paar Bocksprüngen kam die Ape zum Stehen.
«Er hat die Ape erst seit ein paar Tagen», erklärte ich Anna.
«Neu ist die aber nicht», bemerkte sie.
«Neuer als die vorige», antwortete ich. «Die war Baujahr 1968.»
Giuseppe stieß die Fahrertür auf und tropfte förmlich heraus. Er war ein dünner, zäher Kerl, der selbst im heißesten Sommer fünf Stunden am Stück über den Wochenmarkt in Cagli schlendern konnte, aber mit Geschwindigkeit und schnell aufeinanderfolgenden Ereignissen hatte er es nicht so. Seine ersten Worte waren komplett unverständlich, ich vermutete jedoch, dass sie viel mit Hölle, Teufel, Untoten und Viechern zu tun hatten, die vorrangig in gutgefüllten Sickergruben leben. Doch mit jeder Sekunde erholte er sich mehr von seinem Schrecken und begann mit wachsender Energie herumzuhüpfen und gegen die Reifen seiner ungeliebten neuen Ape zu treten, wobei er mit seinen Ärmchen Spaccone würzige Beleidigungen hinterhergestikulierte.
Anna beobachtete ihn eine Weile interessiert, dann zog sie ihr Skizzenbuch hervor und begann zu zeichnen. Sie würde ohnehin nichts verstehen, Giuseppes Dialekt kam einem unknackbaren Geheimcode sehr nah, und man brauchte schon viel Übung, um den Sinn seiner Worte wenigstens zu erahnen.
Oben an seinem rustico mit dem Namen Ca’Piero sah man Spaccone aus dem Auto springen, trotz seines beachtlichen Rotweinbauchs flitzte er beschwingt auf die Beifahrerseite und riss die Tür auf. Heraus tasteten sich zwei im Prinzip nackte, nicht gerade superschlanke Beine, irgendwo weiter oben musste sich auch ein Rock befinden, der war aber auf die Entfernung nicht zu erkennen, und dann stand sie da: Tamara, Spaccones neue Flamme, die, wie wir später erfuhren, Luises Platz einnehmen wollte, zumindest hatte Spaccone ihr eine baldige Hochzeit in Aussicht gestellt.
«Ich werde ihm einen kleinen Besuch abstatten», knurrte Gino und packte seine Machete fester.
«Mach keinen Mist, Gino», sagte ich.
«Die Würfel sind gefallen», zitierte Gino mit einem gewissen Pathos den römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar.
«Warum Krieg führen, es ist ja nichts passiert», versuchte ich ihn zu beruhigen.
«Eatur quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat»,erwiderte Gino, schob die Machete in die Lederschlaufe an seinem Gürtel und marschierte los in Richtung Spaccones Haus.
Ich war sprachlos. Mittlerweile hatte ich mich ja daran gewöhnt, dass Gino ganze Passagen aus Dantes «Göttlicher Komödie» zitieren konnte, aber jetzt auch noch Latein? Hilfesuchend sah ich Anna an, die im Gegensatz zu mir ihr Abitur mit einer hervorragenden Durchschnittsnote bestanden hatte.
«Dorthin führt der Weg, wohin die Zeichen der Götter und die Schandtaten der Feinde rufen», übersetzte sie, ohne von ihrer Zeichnung aufzublicken.
Oje. «Warte, ich komme mit!», rief ich Gino hinterher und wollte aufspringen. Dummerweise war mein rechtes Bein eingeschlafen, und ich kam nicht hoch.
«Die Sache mit Spaccone geht nur mich und ihn etwas an», rief Gino mir drohend zu, ohne anzuhalten.
«Lass ihn», sagte Anna. «Die werden sich ein bisschen anbrüllen, und das war’s dann.»
Ich streckte mein Bein aus, in dem inzwischen ein Ameisenstaat im großen Stil Brennnesseln züchtete. Das Schlimme war, dass ich eine eindeutige Intuition hatte. Da war ein kleines, eindringliches Stimmchen, das sagte: Pfeif auf dein eingeschlafenes Bein, zieh es zur Not hinterher, auch Störtebeker hatte ein Holzbein, und trotzdem hat er als Pirat einiges zustande gebracht.
«Ich weiß nicht», sagte ich stattdessen lahm. «Wieso bist du dir da so sicher?»
«Männer», sagte Anna.
«Was soll das denn schon wieder heißen?», entgegnete ich. Wenn wir Männer einmal einfach nur «Frauen» sagten, wurden wir sofort des Biologismus verdächtigt und augenblicklich in die geistige Nähe von Feuchtnasenaffen, Büschelohrmakis und anderen Lemuren gerückt.
«Männergetue. Schwanzmessen. Wer hat den größeren. So was.»
«Gino ist nicht so ein Typ», warf ich ein. «Er verabscheut Gewalt. Er glaubt an die Kraft des Geistes und der Worte.»
«Pass mal auf, Max.» Anna legte sanft ihre Hand auf meinen Arm. «Ich weiß, die Welt hier ist dein persönliches Paradies. Du willst nicht, dass hier die gleichen Regeln gelten wie im Rest der Welt, du willst, dass der Monte Dolciano ein idealer Ort bleibt. Aber das geht nicht. Außerdem war er das mit Sicherheit nie, du hast es nur nicht sehen wollen.»
Annas Worte zischten wie kleine Blitze durch meinen Körper. Am liebsten hätte ich jetzt hundert Gegenargumente angeführt, doch sie hatte ja recht: Ein Gino, der sich wie ein Rächer aufführte und mit tätlicher Gewalt drohte, und ein Spaccone, der sich unehrenhaft und zynisch verhielt, waren in meinem Paradies nicht vorgesehen.
***
Während ich Anna zusah, wie sie die Szenerie in einer sehr plastischen Bleistiftzeichnung einfing, lauschte ich Giuseppes Tirade, aus der sich langsam ein Sinn herauskristallisierte. Vor allem bejammerte er den Tod seiner 1968er Ape und schimpfte auf alles, was nach 1968 erschaffen wurde – für Spaccone setzte er das Zeitfenster sogar noch auf 1952 herunter, dem Jahr von dessen Geburt. Meinen Hinweis, dass seine verstorbene Ape zum Schluss weder einen funktionierenden Rückwärtsgang noch intakte Bremsen gehabt hatte und mit ihren schräg nach innen stehenden Hinterrädern leichte Beute für jede Windböe gewesen war, ignorierte er einfach.
Eine Zeitlang registrierte Giuseppe Annas Zeichnen nur aus dem Augenwinkel, sein Wüten war ihm wichtiger. Als er jedoch sah, wie exakt ihre Skizze seine Ape abbildete, deutete er auf die weiße Fläche neben dem Dreirad. «Mi piant’ ma lì?»
Anna sah mich fragend an.
«Pflanzt du mich da ein?», übersetzte ich.
«Poss’gelarmi.» Giuseppe grinste. «Ich kann mich einfrieren» war wahrscheinlich witzig gemeint für: Ich könnte kurzfristig aufhören, wie ein gedoptes Wiesel durch die Gegend zu springen.
«Er könnte vorübergehend stillhalten», dolmetschte ich etwas freier.
Anna lächelte und nickte. Giuseppes Ärger verflog sofort. Er stellte sich in Positur, Seitenprofil, schob seinen Strohhut zurecht, noch ein wenig kecker in die Stirn, legte seine Hand auf das Dreirad, als wäre es ein Nashorn, das er gerade mit der bloßen Hand erlegt hatte, und rührte sich nicht, bis Anna das Buch drehte und ihm das Ergebnis zeigte.
Lange Zeit sagte Giuseppe nichts. Dann tippte er auf seine Nase und wandte sich an mich: «Die ist doch im Leben nicht so spitz.»
Anna verzog keine Miene und radierte und korrigierte so lange, bis er zufrieden war und die Nase auf dem Papier gar nichts mehr mit dem Original in Giuseppes Gesicht zu tun hatte.
«Wäre es möglich, dass ich die Zeichnung haben kann?», fragte Giuseppe.
«Ich kann dir eine Kopie machen», antwortete Anna.
Giuseppe neigte seinen Kopf respektvoll. «Vi ringrazio, Signorina.»
«Bitte», sagte Anna und nickte Giuseppe höflich zu.
«Das Brett ist ja noch nicht angebracht», wandte sich Giuseppe jetzt an mich und deutete kopfschüttelnd auf die Stirnseite der Bocciabahn.
«Ein andermal, Giuseppe», antwortete ich, «es ist ja ein Jahr lang auch so gegangen.»
«Ich will Pasquino, den Vizemeister, zu einem Spielchen einladen. Dem kann ich doch nicht mit einer Bahn ohne Holzplatte kommen! Hast du noch nie einen Blick in die Spielregeln geworfen?»
«Habe ich nicht. Wenn ich Boccia spiele, mach ich das aus Spaß und sonst nichts.»
«Spaß», grummelte Giuseppe, «hier geht es doch nicht um Spaß. Weißt du, wie viele Mitglieder die FIB hat?»
«Was für eine FIB?»
Giuseppe verdrehte die Augen. «Il Signore mi aiuta! Die Federazione Italiana Bocce! Wie oft muss ich das eigentlich noch erklären?»
«Und die Mitglieder der FIB haben alle keinen Spaß beim Bocciaspielen, oder was?»
«Einhundertdreißigtausend sind es. Stell dir das mal vor!»
«Ich sehe eine Armee von mit großen Kugeln bewaffneten Männern, die ernst ihrem grausamen Handwerk nachgehen», sagte ich lächelnd, ich konnte einfach nicht anders.
Giuseppe schüttelte fassungslos den Kopf. «Hilf mir wenigstens, die Bank abzuladen.»
«Was willst du denn mit diesem Riesenteil?»
Giuseppe schwang sein dürres rechtes Ärmchen und knetete seinen sensiblen semiprofessionellen Finger. «Pasquino ist ein durchtrainierter Profi, so viel ist mal sicher. Aber vielleicht ist er ja zwischendurch für einige Momente müde. Dann kann er sich hinsetzen und ein wenig ausruhen. Und siehst du hier?» Er ging zu der Bank und klappte die Sitzfläche hoch. «Hier stelle ich eine Flasche von meinem Wein rein. Zur Stärkung.»
O Gott, armer Pasquino, dachte ich, sagte aber nichts. Wenn es um seinen selbstgekelterten Säuerling ging, hörte bei Giuseppe jeder Spaß auf, und ich schätzte, selbst Pasquino würde sich in der Beziehung keine Frechheiten erlauben dürfen.
Nachdem wir die Bank am Kopfende jenseits der Bahnumrandung platziert und mit einer Plane aus zusammengeklebten Düngemittelsäcken abgedeckt hatten, fuhren wir hoch zu Giuseppes Haus in Ripidello. Sestina wollte wissen, was denn da unten vorgefallen sei, sie hatte beobachtet, wie ihr marito fast von der Straße hinuntergestürzt war. Giuseppe jedoch beantwortete jeden ihrer Versuche, etwas herauszubekommen, mit seinem ewig gleichen stai zitta. Wie immer legte ich mich deswegen mit ihm an: Wieso er seiner Frau den Mund verbat, sich so herrisch und unfreundlich verhielt etc. Und wie immer wiederholte er sein einziges Argument: Wie soll ich sie denn sonst zum Schweigen bringen? Anna hatte nur meine Worte verstanden, erspürte aber genau, worum es hier ging, und machte sich sofort zu Sestinas Komplizin. Sestina selber begehrte nie wirklich gegen ihren Ehemann auf, auch wenn es sie sehr ärgerte, wie er sie behandelte.
Anna hielt ihr die Zeichnung hin und fragte sie, was sie darüber dachte. Giuseppe reckte sich stolz, er fand auf dem Bild eindeutig sich interessanter als die Ape, Sestina jedoch bemängelte sofort, seine Nase sei in Wirklichkeit viel spitzer. Sie wusste ihrerseits genau, wie sie ihren missgelaunten Gatten ärgern konnte. Giuseppe war sofort auf hundertachtzig, wiederholte zum zigsten Mal sein stai zitta und ging wütend zum armadio3, um sich ein Glas Wein einzuschenken, während Sestina hinter seinem Rücken sehr leise, aber doch verständlich murmelte: Sieht doch jeder, wie spitz sie in Wirklichkeit ist.
Während Giuseppe mir auch einen eingoss und weiter die Vorzüge seiner verstorbenen 68er Ape pries, sah ich, wie sich Anna erneut Giuseppes Nase widmete, daran radierte und zeichnete, bis Sestina zufrieden nickte, Annas Unterarm tätschelte und ihr zuflüsterte: Früher haben wir ihn Pinocchio genannt. Die beiden lachten verschwörerisch, und Giuseppe fragte mich: Was heißt eigentlich stai zitta auf Deutsch? Anna sah mich warnend an, was überflüssig war, denn mir war auch so klar, dass ich ihr weder mit «Halt den Mund!» noch «stai zitta!» kommen konnte. Sestina, die Ruhelose, war inzwischen aufgesprungen, holte einen 5-kg-Sack Mehl tipo 00 aus dem armadio, pflanzte ihn mit Schwung auf den Küchentisch unter die 25-Watt-Birne und forderte Anna auf, mir ihr zusammen die Tagliatelle fürs Abendessen zu machen. Das war Sestinas Art, ihre Sympathie auszudrücken. Anna war sofort begeistert, und ich ergab mich meinem Schicksal, noch das eine oder andere Gläschen von dem Säuerling trinken zu müssen, was ich mit absoluter Sicherheit noch in der Nacht bereuen würde. Zum Glück jedoch erinnerte Anna mich an den Korb im Auto. Ich holte ihn und bot Giuseppe meinerseits ein Gläschen von dem Falerio an. Giuseppe lehnte erst einmal kategorisch ab, dann fragte er, was so eine Flasche koste, dann entschied er sich, heute eine Ausnahme zu machen und ein Konkurrenzprodukt zu testen. Er schnupperte an dem Falerio, hielt ihn gegen das Licht, schwenkte ihn im Glas herum, studierte die Spuren, die er auf dem Glas hinterließ, schnupperte wieder, bis er endlich den ersten Schluck nahm und sofort stöhnte und jammerte: «Zu süß! Und dieser Schwefel! Wer macht denn so was? Gib lieber mir das Geld, bevor du es für solchen Schund ausgibst!»
Porco mondo, was für ein Getue von einem, dessen Säuerling schon nach wenigen Schlucken die Darmflora gründlich durcheinanderbrachte und den nächsten Tag noch mit üblen Kopfschmerzen abrundete. Aber mir war es recht, so blieb er bei seinem Wein, und ich konnte meinen alleine trinken, wobei Giuseppe jeden meiner Schlucke mit einem mitleidigen Kopfschütteln kommentierte.
Gino hatte ich erstaunlicherweise komplett vergessen, und das, nachdem ich mir eben noch so viele Gedanken gemacht hatte. Vermutlich hatte Anna recht gehabt, die beiden würden sich ein wenig anbrüllen, und fertig. Erst als Giuseppe über die kalten, arroganten Deutschen im Allgemeinen und Spaccone im Besonderen zu schimpfen begann, tauchte das Bild von Gino wieder vor meinem inneren Auge auf, wie er sich auf den Weg zu seinem Peiniger gemacht hatte, die Machete unheilvoll hin und her schwingend.