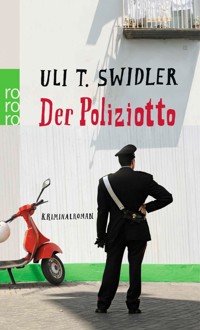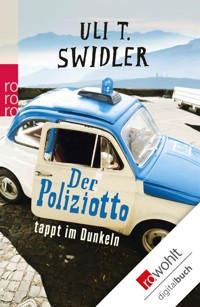3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: Bei dem Einsatz im Kölner Zeusstraßenviertel, einer türkisch-islamischen No-Go-Area, wird dem Streifenpolizisten Carl Gruber der Mord an einem türkischen Jungen in die Schuhe geschoben. Er verliert seinen Job, seine Frau verlässt ihn, sein Leben ist ein Scherbenhaufen. Die Mörder sind Handlanger des islamistischen Predigers Meti Arslan. Warum musste der Junge sterben? Der achtzehnjährigen Sara gelingt die Flucht aus einem von drakonischen Erniedrigungen und Missbrauch geprägtem Klosterinternat in den Bayerischen Alpen. Sie schlägt sich nach Köln durch. In North Carolina bereitet der Ex-CIA-Agent Newt Andersen, ein besonders radikales Mitglied der ultra-konservativen evangelikalen Gruppierung "Caring Christians", einen Anschlag auf den Papst vor. Basis für die Durchführung des Anschlags ist das Alpenkloster, aus dem Sara entkommen konnte. Sara weiß nicht, dass ihre Flucht Newt Andersens Plan zum Scheitern bringen kann. Carl Gruber, der den Ruf hat, ein rassistischer Hardliner zu sein, wird ohne es zu ahnen Teil dieses perfiden, aberwitzigen Plans. Unterstützung, wenn auch widerstrebend, bekommt er lediglich von Lena Gülec, einer früheren Kollegin bei der Polizei. Stück für Stück entblättern die beiden die Hintergründe dieser Verschwörung, die zum Ziel hat, einen weltweiten Flächenbrand zu entfachen, eine Art neuzeitlicher Kreuzzug. Wird es Carl Gruber und Lena Gülec gelingen, das Attentat im Vatikan zu vereiteln?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Uli T. Swidler
ROH
Thriller
Dieser Roman ist ein fiktionales Werk, auch wenn er reale Gegebenheiten aufgreift. Die Personen und die Handlung sind frei erfunden, sodass etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig wären. Das gilt auch, wenn die Namen der fiktiven Personen und Institutionen den Namen realer Personen und Institutionen ähnlich sein oder mit diesen übereinstimmen sollten.
Copyright © 2022 Uli T. Swidler, Berlin
Umschlaggestaltung: Dorothee MendenAlle Rechte vorbehalten
ISBN 9789403677910
Eine gute Verschwörung
ist unmöglich zu beweisen -
sie kann höchstens auffliegen
FLETCHER’S VISIONEN
Mein Name ist Carl. Ich bin ein Mörder. Mein Verteidiger hält mich für schuldig, und ich könnte leicht fünfzig Menschen aufzählen, die derselben Ansicht sind. Ehemalige Kollegen bei der Polizei, fast alle Türken in der Zeusstraße in Köln, die Journalisten, die über meinen Fall geschrieben haben, und meine Frau Johanna. Ex-Frau. Nur meine siebenjährige Tochter Anna hält uneingeschränkt zu mir. Gäbe es nicht das richterliche Kontaktverbot, würde ich sie so oft wie möglich in die Arme nehmen und ihr sagen: Papi hat dich sehr lieb. Wenn sie alt genug ist, werde ich ihr die wahre Geschichte erzählen. Sie wird mir glauben, dass ich kein Mörder bin.
1.
Carl machte sich nicht die Mühe, den Sitz seiner Schirmmütze im Spiegel zu korrigieren. Nach zehn Dienstjahren hatte sich rund um seinen Kopf eine sanfte Kerbe gebildet, die die Mütze wie von alleine fand. Im Vorbeigehen warf er einen Blick in das Zimmer seiner Tochter, die noch im Hort war. Wieder ein Tag, an dem er sie nur schlafend erleben würde. Gestern Nacht, als er vom Spätdienst zurückgekehrt war, hatte er sie auf die Stirn geküsst. Sie war kurz aufgewacht, hatte ihn angelächelt und sich mit einer schnellen Handbewegung übers Gesicht gewischt, so als müsste sie eine Fliege verjagen.
"Hallo, Gülla." Carl warf sich auf den Fahrersitz des Streifenwagens, seine neue Kollegin Lena Gülec war schon auf den Beifahrersitz gewechselt. Zu Beginn einer Schicht wollte Carl fahren. Immer. Das hatte er gleich bei seiner ersten gemeinsamen Tour vor drei Tagen klargemacht.
"Lass den Gülla-Scheiß, okay?" Lena reichte ihm einen Becher Kaffee − zwei Becher ineinandergeschoben, weil einer zu heiß gewesen wäre.
"Du musst mir nicht jedes Mal Kaffee bringen."
Lena zuckte mit den Schultern. "Nimm ihn oder lass es."
Carl nahm den Pappbecher und griff zum Mikrofon des Funkgeräts. "Arnold 14 an Zentrale, bitte kommen."
"Hier Zentrale an Arnold 14. Du bist zu spät, Carl. Hast du keinen Wecker?" Kollege Georg Amhorst von der Einsatzleitung.
"Gülla sollte mich wecken. Hat sie aber nicht."
"Ich kenn keine Gülla."
Lena lächelte. Ihr Vater war Türke, ihre Mutter Deutsche. Als sie vor einem Monat nach dem Ende ihrer Ausbildung im Schutzbereich 4 Köln-Mülheim zum regulären Dienst angetreten war, hatten ihre neuen Kollegen sie alle Gülla genannt. Mittlerweile war Carl der letzte, der diesen Spitznamen witzig fand.
"Wo geht's hin, Arnold 14?"
"Clevischer Ring und Stegerwaldsiedlung. Ende."
Carl schob das Mikro zurück in die Halterung, nahm einen Schluck Kaffee und gab Gas. Lena lächelte entspannt, wie meistens. Manche Kollegen hatten Probleme damit und vermuteten dahinter Überheblichkeit und Arroganz. Carl nicht. Er hatte ein ganz anderes Problem mit ihr. Nicht, dass sie eine Frau war, Polizistinnen waren schon lange nichts Besonderes mehr. Ihn störte, dass sie auch in Brennpunkt-Gegenden eingesetzt wurden, da, wo eine Uniform nichts galt, wo es darauf ankam, mit unmissverständlicher Dominanz aufzutreten, und unmissverständlich waren nun mal nur Muskeln und Größe. Natürlich taten alle Vorgesetzten bis hinauf zum Innenminister so, als wäre das die völlig veraltete Sicht von unverbesserliclichen Chauvis. Interessanterweise allerdings wurden Streifenwagennie ausschließlich mit Polizistinnen besetzt, da musste immer ein männlicher Kollege dabei sein.
Der Funkspruch kam um 16 Uhr 53.
"Zentrale an alle. Bewaffneter Raubüberfall in der Zeusstraße. Wer ist in der Nähe?"
"Wir, Arnold 14", antwortete Lena, im fahrenden Streifenwagen war der Sprechfunk Sache des Beifahrers.
"Saladim Markt heißt der Laden. Der Täter ist etwa vierzehn bis sechzehn Jahre alt, schwarze Haare, weiß-gelb kariertes Hemd, unkelgrüne Daunenjacke, schwarze Jeans. Er ist bewaffnet, eine Schusswaffe. Keine Verletzten bisher."
"Verstanden."
"Ihr unternehmt nichts alleine. Wartet vor Ort auf Verstärkung."
"Verstanden. Wer hat angerufen?"
Ein Lachen. "Anonym. Was sonst? Ende."
"Warum hat der gelacht?", fragte Lena, neugierig, nicht beleidigt.
Carl verzog sein Gesicht. "Warum wohl?" Er schaltete das Blaulicht und die Sirene ein und gab Gas.
"Weil Türken zu blöd sind, die Polizei zu rufen, oder was?" Lena klang jetzt nicht mehr ganz so freundlich.
"Du weißt genau, was ich meine", erwiderte Carl.
"Nein, weiß ich nicht."
"In der Zeusstraße riskiert keiner, die Polizei zu rufen. Weil er dann Ärger mit eurem Obermufti Meti Arslan bekommt."
Lena stöhnte auf. "Er ist nicht mein Obermufti. Ich habe mit Meti genauso wenig zu tun wie du."
Eine rote Ampel. Carl verringerte das Tempo und überquerte die Kreuzung vorsichtig. "Ihr könnt nicht gleichzeitig Demokraten und Muslime sein. Was glaubst du, wer das gesagt hat?"
Lena stöhnte demonstrativ auf. "Auch damit habe ich nichts zu tun."
"Ein kleiner Ausschnitt aus einer typischen Meti-Predigt."
"Und das weißt du, weil du regelmäßig in die Moschee gehst."
"Würde ich, wenn die mich rein ließen."
Im Rückspiegel sah Carl die Scheinwerfer eines Autos, das die Gelegenheit nutzte und ebenfalls bei Rot die Kreuzung überquerte. Ein schwarzer Opel.
"Die Zeusstraße ist Metis Regierungsviertel. Der Regierungssitz seiner Parallelgesellschaft."
"Lass mich raten: Weil da die meisten Bewohner Muslime sind?"
"Weil da nicht unser Gesetz gilt, sondern die Scharia."
"Ach, komm schon, Carl, das ist nur Gerede."
"Gerede? Sieh dich um. Überall abgeschottete Parallelwelten. Da findest du Türken, Araber, Afrikaner, die kein Wort Deutsch sprechen. Auch wenn sie schon zig Jahre hier sind."
"Mein Deutsch hat noch keiner bemängelt."
"Die tanzen uns auf der Nase herum. Und wir? Wir reagieren mit political correctness. Mit …", Carl zeichnete Anführungszeichen in die Luft, "… 'Toleranz'. Alles Blödsinn. In Wahrheit ist es Gleichgültigkeit. Und Angst, für die eigenen Werte zu kämpfen. Man könnte ja irgendwem auf die Füße treten."
"Das", Lena lächelte übertrieben, "würde ich dir nie unterstellen."
"Sehr witzig." Carl schaltete die Automatik herunter auf Stufe 3. Das tat er immer, wenn er sich einem Einsatzort näherte, um, wenn nötig, schneller durchstarten zu können.
"Seit die Welt sich dreht, hat sie sich noch nie im Gleichgewicht befunden. Und ausgerechnet jetzt soll das Abendland vom Untergang bedroht sein?"
"Gülla, Gülla, wenn's drauf ankommt, guckst du lieber weg, hm?"
"Ach, Quatsch!" Auf Lenas Stirn hatten sich zwei steile Falten gebildet. "Ich seh nur was anderes als du."
"Noch nie was von No-go-Areas gehört?"
"Doch, hab ich gelesen. In der Bild-Zeitung."
"Was meinst du, warum wir auf Verstärkung warten sollen?"
Lena antwortete nicht.
"Deine Glaubensbrüder in der Zeusstraße wollen keine Polizei. Die wollen die Dinge selber regeln."
"Und warum hat dann irgendwer die Polizei gerufen?"
"Der Anruf war anonym. Schon vergessen?"
Lena verdrehte die Augen. "Wen würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? AfD? Oder lieber gleich die NPD?"
"Was ich wähle, geht dich einen Scheißdreck an."
Lena lachte, als hätte Carl einen guten Witz gemacht. "Ich habe zuletzt grün gewählt. Wie findest du das? Eine grüne Muslima. Da ist die Welt doch in Ordnung, oder?"
"Neun Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, aber ihr Anteil an verurteilten Straftätern beträgt über vierzig Prozent. Das ist Statistik, liebe Lena. Das ist objektiv so."
Lena lehnte sich in ihren Sitz zurück und sah demonstrativ hinaus in die Dunkelheit. "Echt, Carl, du bist so was von old school."
Klar bin ich old school, dachte Carl. Weil ich euren weichgespülten political-correctness-Scheiß nicht mitmache. Weil ich sage, was Sache ist.
Noch zweihundert Meter bis zur Zeusstraße. Carl schaltete die Sirene aus und bog vorsichtig gegen die Fahrtrichtung in die Einbahnstraße ein. Aus dem Augenwinkel sah er den Opel am Straßenrand halten. Wahrscheinlich ein Reporter vom Express, der den Polizeifunk abgehört hatte und eine Story witterte.
Carl sah sich erstaunt um. "Ist jetzt Gebetszeit?"
"Noch nicht. Wieso?"
"Kein Mensch auf der Straße." Normalerweise ging es hier sehr lebhaft zu. Irgendetwas war faul. Intuition. Die hat man, wenn man den Job schon so viele Jahre macht wie Carl. Aber Intuition sagt nur: Pass auf! Sie sagt einem nicht, was passieren wird.
Carl schaltete jetzt auch das Blaulicht aus und rollte weiter. Einen Häuserblock vor dem Saladim Markt hielt er an. Er zeigte auf die Toreinfahrt neben dem Laden.
"Geh hinten herum und versuch, in den Laden reinzukommen. Ich warte eine Minute. Dann geh ich vorne rein."
"Moment mal, wir sollen auf Verstärkung warten."
"Na, klar." Carl zog seine Waffe. "Los jetzt."
Lena zögerte. "Der Täter soll erst vierzehn sein."
Das ist genau das, was ich meine, dachte Carl. Leo, sein letzter Partner, würde einfach seine Waffe ziehen und losmarschieren.
"Der Täter ist bewaffnet. Das zählt. Sonst nichts", erwiderte er.
Widerstrebend zog Lena ihre Walther PPS, ihr Gesicht sagte: Was für eine Macho-Scheiße. Sie sprang raus und verschwand im Dunkel der Hofeinfahrt.
Carl stieg aus. Mit ein paar Schritten war er an der Hauswand und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Noch vierzig Sekunden. Seine Pistole hielt er mit beiden Händen gegen den Boden gerichtet. Dreimal, dachte er. Nur dreimal hatte er in seinen zehn Dienstjahren schießen müssen. Einen Warnschuss in die Luft, zweimal auf einen Menschen. Gut gezielte Schüsse. Einen in die Schulter eines wild um sich schießenden Verrückten, der seine Frau mit dem Schwanz eines anderen in ihrem Arsch erwischt hatte. Einen in den Unterarm eines Geiselnehmers, der seine Pistole gegen die Schläfe einer jungen Frau gedrückt und so unkontrolliert gezittert hatte, dass es nur noch eine Frage von Sekunden war, bis sich ein Schuss lösen würde. Als die Sanitäter die Frau zum Krankenwagen bringen wollten, sie war unverletzt, riss sie sich los, um sich bei ihm zu bedanken. Er hatte ihr das Leben gerettet, das wusste sie genau. Die internen Ermittler sahen das allerdings anders und pflanzten einen Vermerk in seine Personalakte, weil er ein "deutlich zu hohes Risiko eingegangen war, auch wenn die Geiselnahme glücklich endete".
Noch zehn Sekunden. Carl konzentrierte sich. Nicht nervös werden. Sobald er den hell erleuchteten Laden betrat, würde er eine perfekte Zielscheibe abgeben.
In dem Moment sprang die Ladentür auf. Carl reißt die Pistole hoch. Ein Junge stürzt heraus. Schwarze Haare, weiß-gelb kariertes Hemd, dunkelgrüne Jacke, schwarze Jeans. Seine Hände sind leer, keine Waffe. Als er Carl sieht, rennt er los.
"Stehen bleiben! Polizei!"
Der Junge dreht sich um, lacht, macht Faxen. Carl sprintet hinterher. Der Junge stolpert. So wie der stolpert, stolpert niemand, außer er tut so, als ob. Was soll das Spielchen? Carl sieht sich um. Hat der Kerl einen Komplizen? Niemand zu sehen. Auch Lena nicht.
Ein paar Meter weiter biegt der Junge in eine Hausdurchfahrt ab, die zu einem Hinterhof führt. Dort brennt nur eine armselige Lampe. Immerhin hell genug, um zu sehen: hier gibt es keinen anderen Weg hinaus. Der Junge steckt in der Falle. Kennt der sich hier nicht aus?
Carl bleibt stehen und tastet nach seiner MagLite. Nichts übereilen. Vielleicht hat der Junge die Waffe im Gürtel unter seiner Jacke stecken.
Plötzlich ist ein Schatten neben Carl. Etwas Schweres trifft seinen Kopf. Ein Telefonbuch: Absurd, er erkennt die Werbung einer Kölner Rohrreinigungsfirma auf dem Buchdeckel. Noch ein Schlag. Carl will sich an der Hauswand abstützen. Ein zweiter Schatten taucht auf, packt ihn, zerrt ihn in den Hof hinein. Zwei Männer, nicht sehr groß, aber kräftig, die Kapuzen ihrer Hoodies haben sie tief ins Gesicht gezogen. Wieder ein Schlag mit dem Telefonbuch. Carl geht zu Boden. Ein reißender, dumpfer Schmerz in der rechten Schulter. Er versucht hoch zu kommen, aber seine Beine machen nicht, was er will.
Der Junge steht ein paar Meter vor ihm und lacht. Angst hat er keine, im Gegenteil. Das war inszeniert, denkt Carl, und du bist wie ein Blöder in die Falle getappt.
Die beiden Männer hocken sich rechts und links neben ihn. Eine Hand greift nach Carls Rechten, in der er seine Pistole hält. Eine Stimme ruft dem Jungen etwas zu, auf Türkisch. Der dreht sich um und wendet ihnen den Rücken zu.
Die sagen dem Jungen, er soll weggucken, damit er nicht zusehen muss, wie sie mich mit meiner eigenen Waffe erschießen. Verdammte Intuition, warum konntest du nicht etwas präziser sein?
Carl sieht, wie seine Hand hochwandert. Er wehrt sich. Todesangst, ein Scheißgefühl. Er bäumt sich auf, versucht, sich loszureißen. Der zweite Mann rammt ihm sein Knie in den Rücken, er kriegt keine Luft mehr, kippt nach vorne. Wieder wandert seine Hand hoch, er hat keine Kraft mehr, das zu verhindern. Der Lauf der Pistole richtet sich – nicht auf ihn, sondern zeigt auf den Jungen. Carl spürt, wie der Druck auf seinen Zeigefinger größer wird. Und dann – der Schuss geht los. Der Junge sackt in sich zusammen, wie in diesen Filmausschnitten von Exekutionen am Rande eines Massengrabs. Von einer Sekunde zur nächsten verschwindet die Stabilität aus seinem Körper, als hätten sich alle Knochen in Luft aufgelöst. Carl dreht seinen Kopf, so weit es geht. Jetzt sieht er die Gesichter der beiden. Unbekannte Gesichter. Sie grinsen. Warum geben die sich keine Mühe, unerkannt zu bleiben?
Alles Show, der Junge ist nicht tot. Eine Scheinexekution, wie in Guantánamo.
Einer packt Carls Kopf. "Jetzt bist du dran", sagt er.
Carl weiß, was jetzt kommen muss. Sie können ihn nicht am Leben lassen.
"Carl! Alles in Ordnung bei dir?" Lenas Stimme.
"Ich bin hier!"
Die beiden Männer fluchen. Sie versuchen, die Pistole gegen ihn zu drehen, Carls letzte Kräfte sind größer als ihre. Einer tritt ihm gegen die Schläfe.
Als er wieder zu sich kommt, sieht er jemanden neben sich knien. Es dauert einige Sekunden, bis er Lena erkennt.
"Gülla, wo warst du so lange?" Er hat das Gefühl, ewig für die paar Worte zu brauchen.
"Du hast den Jungen erschossen."
"Nein …" Carl spürt das Gewicht seiner Pistole in der Hand, sie zeigt immer noch auf den Jungen.
"In den Rücken. Er ist tot."
"Zwei Männer." Carl weiß nicht, ob die Worte so klingen, wie er sie zu sagen glaubt. "Die haben ihn erschossen."
"Hier ist niemand. Nur du, deine Dienstwaffe und der tote Junge. Und der ist unbewaffnet."
2.
"Warum wurden Sie nicht verurteilt?" Die Fernsehproducerin sah Carl mit diesem Blick an, den er zu Genüge kannte, eine Mischung aus Abscheu und Faszination.
Carl nahm einen Schluck Bier. In den letzten sechs Monaten hatte er zwölf Kilo abgenommen und die Lachfältchen in seinen Augenwinkeln wirkten inzwischen wie Fremdkörper in seinem Gesicht.
"Es war Ihre Waffe, mit Ihren Fingerabdrücken, mit Schmauchspuren an Ihrer Hand, es gab keine Tatzeugen."
Was sollte er sagen? Sie hatte ja recht. Gegen ihn hatten sehr viele Indizien gesprochen. Für ihn nur wenige. Das Telefonbuch, es lag noch am Tatort. Kann man sich selbst damit eine Gehirnerschütterung zufügen? Nein, sagte der medizinische Gutachter. Und die Verletzung an der Schläfe? Eindeutig von einem stumpfen, runden Gegenstand. Eine Schuhspitze? Möglich. Oder ein großer Stein. Aber da lag weit und breit keiner. Zwei Indizien, dass er tatsächlich von jemandem angegriffen worden war. Von dem fünfzehnjährigen, schmächtigen Jugendlichen? Wohl kaum, aber nicht mit Sicherheit auszuschließen. Die Öffentlichkeit, ein Teil der Medien und vor allem die türkische Gemeinde in Köln wollte seine Verurteilung. Der Richter allerdings wertete die Indizien als möglicherweise nicht zwingend genug für eine Verurteilung wegen Mordes, auch wenn er deutlich zu verstehen gab, dass er Carl für schuldig hielt. So kam es zu einem Deal, zumindest glaubte Carl das, zwischen dem Richter, dem Staatsanwalt und dem Innenminister: Freispruch, wenn im Gegenzug die Abteilung für Innere Angelegenheiten dafür sorgte, dass Carl aus dem Polizeidienst entlassen wurde. In der Tat fuhr die Innere daraufhin schwere Geschütze auf: Missachtung eines Einsatzbefehls, erhebliche Gefährdung der dienstjüngeren Kollegin, grobe Missachtung der Dienstpflicht. Am schwersten wog Carls Ruf, ein harter, fremdenfeindlicher Hund zu sein, in der Vergangenheit hatte es wiederholt Beschwerden von Türken und Nordafrikanern gegen ihn gegeben, auch wenn keines der daraufhin eingeleiteten Disziplinarverfahren ergeben hatte, dass er das Recht tatsächlich gebrochen hätte. Und auch die Aussagen einiger seiner Kollegen hatten "das Bild eines Menschen gezeichnet, dessen Weltbild", so stand es in dem Abschlussbericht, "nicht mit der von Polizisten einzufordernden Objektivität in Einklang steht."
Die Producerin ärgerte sich über sein Schweigen. "Für die Öffentlichkeit sah die Sache damals verdammt nach Rechtsbeugung aus. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus."
"Das habe ich zu spüren bekommen."
"Warum sind Sie nicht weggegangen? Haben woanders ein neues Leben angefangen? Ich an Ihrer Stelle hätte das getan."
"Das wäre klug gewesen, ja."
Die Producerin wollte mehr von ihm wissen, das war klar. Er spürte ihren scharfen Blick. Sie räusperte sich und tippte die Spitzen ihrer Finger gegeneinander, schnell und mit immer kürzer werdenden Abständen. Ihre Augen wanderten über die schmuddelige Theke, als würde sie erst jetzt realisieren, an was für einem abgewarzten Ort er sich mit ihr verabredet hatte. Ihr Blick streifte ihre Armbanduhr. Kurz nach 19 Uhr. Unvermittelt und als hätte sie es plötzlich eilig, griff sie in ihre lederne Umhängetasche − dickes, duftendes Leder, wertvoll, dachte Carl −, die vor ihr auf der Theke lag, zog einige zusammengeheftete Papiere heraus und schob sie ihm hinüber.
"Kommen wir zu unserem Deal."
"Muss ich das durchlesen?", fragte er.
"In dem Vertrag steht alles genauso drin, wie Sie es mit uns besprochen haben."
Carl blätterte zur letzten Seite, auf der der Geschäftsführer der Firma concept films schon unterschrieben hatte.
"Nur eine kleine Veränderung: Sie arbeiten unter einem Pseudonym für uns, nicht unter Ihrem eigenen Namen. Der Sender besteht darauf."
Er nickte. Seit dem 3. Januar hatte sein Namen einen Untertitel: der Kindermörder, der von einer bullenfreundlichen Justiz freigesprochen wurde.
"Und wie heiße ich?"
"Hans Müller, Hauptwachtmeister a.D."
Warum nicht Hans Schmitz? In Köln gab es mehr Schmitz als Müller. Er unterschrieb.
"Willkommen an Bord." Die Producerin zog einen dicken Umschlag aus ihrer Tasche. "Das sind die Drehbücher der ersten zehn Folgen. Die dürfen Sie niemanden zu lesen geben, okay?"
Was für ein Getue. Concept films produzierte eine neue Polizeiserie für einen privaten Fernsehsender, eine Bullen-Soap, wie sie es nannten, pro Sendung zwei Fälle aus dem Polizeialltag. Carls Aufgabe war es, die Drehbücher auf Fehler zu durchleuchten, damit alles zumindest halbwegs authentisch wirkte. Für achthundert Euro plus 19 Prozent Umsatzsteuer im Monat.
"Wann kommt das erste Geld?" Carl hoffte, dass die Frage beiläufig klang. Sein Konto leuchtete tiefrot, und bei seinem letzten Versuch, Geld aus einem Automaten abzuheben, hatte dieser nicht nur die Auszahlung verweigert, sondern auch seine Girokarte eingezogen.
"Wenn Sie ihre Anmerkungen abgegeben haben, dauert es in der Regel noch vier Wochen."
Carl tastete mit der Zunge seine Mundhöhle ab, als gäbe es da etwas zu suchen. Kann ich einen Vorschuss haben? Warum brachte er es nicht fertig, diese einfache Frage zu stellen? Er war schon dermaßen tief gesunken. Wahrscheinlich genau deshalb. Je tiefer man sinkt, umso wichtiger ist jeder Zentimeter, den man sich noch oben halten kann.
"Ich geh dann mal." Die Producerin zog ihre Tasche über die Schulter. Zögerte.
Was denn jetzt noch?
"Die beiden Türken, die den Jungen … wissen Sie, wer die sind?"
Carl nickte.
"Sie kennen die Mörder?"
"Ja."
Sie sah ihn sprachlos an.
"Es war nicht besonders schwer, ihre Identität zu ermitteln."
"Und wieso wurden sie nicht …"
"Sie hatten sich perfekte Alibis verschafft." Sechs Männer hatten bezeugt, dass sie den ganzen Nachmittag bis spät in die Nacht hinein beim Okey, einem türkischen Legespiel, zusammengesessen hätten.
"Aber warum sollen die …" Die Producerin nagte an ihrer Oberlippe. "Warum haben die den Jungen getötet?"
Carls Augen folgten dem Barkeeper, der ans Ende der Theke schlenderte, um einen neuen Gast nach seinen Wünschen zu fragen.
"Wenn das alles, wie Sie sagen, inszeniert war", bohrte die sie weiter: "Warum das Ganze? Der Junge musste sterben, nur um Sie zum Sündenbock zu machen?"
"Ich weiß es nicht."
Das stimmte nicht, zumindest nicht ganz. Der Mord an dem Jungen war klug inszeniert gewesen, eindeutig mit dem Ziel, ihn Carl anzuhängen. Da war sich Carl sicher. Die beiden Täter, das hatte er später herausgefunden, waren Handlanger von dem türkischen Imam Meti Arslan, Kalif von Mülheim, wie er sich selber nannte. Meti hatte vor drei Jahren in seiner Moschee entgegen dem deutschen Recht ein minderjähriges Mädchen gegen deren Willen mit einem dreimal so alten Mann verheiratet. Carl hatte einen Hinweis bekommen und sich der Sache angenommen, er hatte Zeugen aufgetrieben und sie überzeugen können, gegen Meti auszusagen. Der wurde daraufhin zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung verurteilt mit der Androhung, ausgewiesen zu werden, falls er sich in den nächsten zwei Jahren etwas zuschulden kommen ließ. Die zwei Jahre waren längst vorbei und einer wie Meti vergisst nicht. Alles passte zusammen, Meti hatte ihm Rache geschworen. Er hatte sich Zeit damit gelassen, Meti war ein schlauer Mann, ein Hassprediger, dem Carl jede noch so grausame Schandtat zutraute, solange sie sich gegen Nicht-Muslime richtete. Aber genau der Punkt passte einfach nicht ins Bild: Der Junge war das Kind muslimischer Eltern. Kein Kurde, kein Schiit, sondern Sunnit, wie Meti Arslan und die meisten Türken. Ein junges, muslimisches Leben weggeworfen für einen kleinen Schachzug? Nur, um Rache an ihm zu nehmen? Natürlich hatte niemand Carl geglaubt.
"Dann werden die Mörder also niemals vor Gericht gestellt."
Carl zuckte mit den Schultern, nein, werden sie nicht. Die Producerin verschränkte ihre Arme, fast als fror sie.
"Ohne Zeugen kein Ankläger und kein Richter, richtig?"
"So sieht es aus."
Carl sah ihr hinterher, wie sie die Theke entlangging, dem Wirt zuwinkte und die Kneipe verließ. Vielleicht war es nicht ihre Absicht gewesen, doch sie hatte diese Wunde wieder aufgerissen. Seit Wochen bemühte er sich, die Wut und das elende Gefühl von Ohnmacht loszuwerden. Und das Bild von dem Jungen, wie der vor ihm hergerannt war, mit schlaksigen Sprüngen, auf eine Art ausgelassen, fröhlich, arglos wie ein kleines Kind. Jemand musste ihm gesagt haben: Hey, das alles ist nur ein Spiel, das wird lustig, dir passiert nichts. Und dann die Schüsse in seinen Rücken, kalt und berechnend. Wo war das kleine Mosaiksteinchen, mit dem das Gesamtbild erst einen Sinn ergab?
Die Producerin hatte recht, das Beste für ihn wäre es, wegzugehen und woanders neu anzufangen, schlechter als in Köln konnte es kaum noch werden. Aber er brauchte eine Antwort. Wie konnte er die beiden Mörder und Meti Arslan, ihren Auftraggeber, zur Rechenschaft ziehen?
3.
Das Kloster St. Gregor lag am Ende eines schmalen Tals in den deutschen Alpen an der österreichischen Grenze, 932 Metern über dem Meeresspiegel, umringt von schroffen Bergen, keiner unter dreitausend Meter, die die Sonne viel früher vom Himmel verschwinden ließen als in dem weiter unten am Taleingang gelegenen Dorf Klein Aichbach. Nachts konnte es hier selbst im Sommer ungemütlich kalt werden. So wie heute. Am späten Nachmittag hatte es noch geregnet, ein warmer Sommerregen, aber seit die Sonne untergegangen war, kühlte die Luft stetig ab. Vor einer halben Stunde hatte dünner Nebel begonnen, aus den Wiesen ringsherum aufzusteigen. Aus dem Fenster seiner Klause im ersten Stock beobachtete Sebastian, wie Nebelschwaden die mit Granitplatten gepflasterte Zufahrt erreichten, durch das schmiedeeiserne Tor in den Klosterhof hineinwaberten, um sich kurz darauf an der Klostermauer emporzuschieben.
Die Mönchsklause war ein quadratischer Raum, die Wände waren fast vollständig mit Buchen- und Kirschholz vertäfelt, der Boden bestand aus Tannenbohlen mit breiten Spalten dazwischen. In der Mitte gab es einen runden, einfachen, gusseisernen Ofen, das Ofenrohr führte gerade nach oben, machte unter der Zimmerdecke einen Knick und führte durch die Wand nach außen. Eine Seite des Zimmers wurde vollkommen von einer Sitzbank eingenommen, ihr gegenüber stand eine Gebetsbank, die vor Jahrhunderten Teil einer Kirchenausstattung gewesen sein musste. Neben dem Fenster stand ein schwerer Holztisch, den Sebastian selbst geschreinert hatte, darauf eine Kerze und ein aufgeschlagenes Buch. Dahinter sein Bett, aus Eisen, mit grauem Bettzeug, am Fußende lag eine akkurat zusammengelegte schwere Wolldecke.
Sebastian zog frierend die Schultern hoch und verschränkte die Arme vor der Brust. Trotz der Kälte von draußen wartete er noch eine ganze Weile, bis er das Fenster schloss und sich eine Wolljacke aus seinem Schrank holte. Ohne in die Ärmel zu schlüpfen warf er sie sich über die Schultern. Unentschlossen stand er da und lauschte. Kaum wahrnehmbar drang Gesang aus den Tiefen des Klosters, ein gregorianischer Choral. Unwillig schüttelte er den Kopf. Eigentlich sollte er mit den Mönchen gemeinsam singen. Alles sollte er mit ihnen gemeinsam machen, ora et labora, beten, arbeiten, essen, früh zu Bett gehen, früh aufstehen. Am Anfang war ihm das leichtgefallen. Er war froh gewesen, einen sicheren Ort gefunden zu haben. Die Mönche waren alt, sie bekamen nicht mehr allzu viel mit, sie zu täuschen war nicht schwer.
Er begann seinerseits zu singen, eine andere, kraftvollere Melodie, ein Popsong, den er vor einer Ewigkeit öfter im Radio gehört hatte. Sein Oberkörper wiegte vor und zurück, er schloss die Augen und überließ sich dem Rhythmus der Bewegung. Die Langeweile war kaum noch auszuhalten. Kein Fernsehen, kein Internet, keine Musik, nicht einmal ein eigenes Handy, nichts. Und mit den beiden anderen etwa Gleichaltrigen, Petros und Bertrand, konnte er kaum mehr als mit den uralten Mönchen anfangen. Die beiden gingen im Gegensatz zu ihm völlig im geistlichen Klosterleben auf und hielten alle Regeln peinlich genau ein. Ganz zu schweigen von Vinzent, dem jüngsten, der vom Singen und Beten gar nicht genug kriegen konnte.
Das Gute war, dass die Kamaldulensermönche einen Großteil der Gebete nicht gemeinsam, sondern jeder für sich in seinem Kämmerlein absolvierten. In dieser Zeit konnte Sebastian sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Zweifel hatten sich in der letzten Zeit immer häufiger gemeldet. Sich in diesem Kloster zu verstecken, war klug. Andererseits bekam er nichts von der Welt draußen mit. Nichts vom Stand der polizeilichen Ermittlungen. Hatten sie ihn überhaupt in Verdacht? Natürlich waren solche Überlegungen Unsinn. Selbst wenn er alle Zeitungen las und jede Nachrichtensendung guckte, würde er nicht wissen, wen die Polizei verdächtigte. Aber selbst wenn er zum Kreis der Verdächtigen gehörte: In diesem Kloster würden sie ihn niemals finden, niemand außer Abt Albertus kannte seine Identität, und die einzige Spur hierher führte über den Priester, dem er seine Tat gebeichtet hatte. Beichtgeheimnis, der würde nicht die Polizei informieren.
Wie jedes Mal, wenn er an diesen Punkt seiner Überlegungen kam, spürte er ein unangenehmes Kribbeln: Der Priester hatte das Beichtgeheimnis gebrochen, er hatte Abt Albertus informiert. Das ist etwas anderes, hatte der zwar geantwortet, als er ihn darauf angesprochen hatte. Wenn zwei Seelsorger sich austauschen, bleibt das Beichtgeheimnis gewahrt. Aber konnte er sich wirklich darauf verlassen?
Sebastian ließ sich auf den Boden sinken. Zuerst einhändige Liegestütze, fünf rechts, fünf links, dann so viele beidhändige, wie er schaffte, zuletzt waren es achtundzwanzig gewesen.
Plötzlich hielt er inne. War da ein Geräusch gewesen? An der Tür?
Doch mehr als der Gesang der Mönche war nicht zu vernehmen. Sie hatten inzwischen einen anderen Choral angestimmt, der sich allerdings so gut wie gar nicht von dem vorigen unterschied: dieselbe Melancholie, dieselbe Innerlichkeit, fast so etwas wie Todessehnsucht. Diese Glückseligkeit in ihren Gesichtern, wenn sie singen … Er konnte nicht hinsehen und schloss die Augen, wenn sich seine Teilnahme nicht irgendwie verhindern ließ. Und wenn er sie wieder öffnete, trafen ihn warme, anerkennende Blicke, die ihm Ergriffenheit und spirituelle Sensibilität unterstellten. Lächerlich.
Nach der dreiundzwanzigsten Liegestütze erhob er sich, mehr war heute nicht drin, ging zum Schreibtisch und kramte seine Uhr aus der Schublade hervor, auch ein im Kloster unerwünschtes Utensil. 21 Uhr 32, ungefähr eine Stunde musste er sich noch gedulden. Er nahm eine Schachtel Streichhölzer und entzündete die Kerze. Der Docht fing nur schwer Feuer und kaum brannte er, begann die Flamme zu flackern und zu rußen. Sebastian pustete das Streichholz aus und schob die Streichholzschachtel in die Tasche seiner Kutte. Mit einer Schere schnitt er den oberen Teil des Dochtes ab. Für einen Moment sackte die Flamme in sich zusammen und drohte zu erlöschen. Dann erholte sie sich und brannte kraftvoll auf, ohne zu rußen. Mit einem Papiertaschentuch reinigte Sebastian die Schere, legte sie neben die Kerze, faltete seine Hände und konzentrierte sich auf die Flamme. In seinem früheren Leben wäre er nie auf die Idee gekommen zu meditieren, hier im Kloster jedoch …
Da, ein Kratzen. Er zuckte zusammen und starrte die Tür an. Eine Stimme flüsterte einige Worte, zu leise, um sie zu verstehen. Eine Frauenstimme. Ein erstauntes Lächeln zog über sein Gesicht. Jetzt schon? Er sprang auf, ließ die Wolljacke zu Boden gleiten und öffnete die Tür. Niemand zu sehen. Im Gang flackerte das Licht der Kerzen, die in schmiedeeisernen Halterungen steckten, eine alle fünf Meter. Weiter hinten, dort, wo die Treppe hinunter ins Kellergewölbe abzweigte, zeichnete sich für einen Moment ein Schatten ab − und verschwand.
Sebastian schloss die Tür hinter sich und folgte dem Schatten. Schnelle, vorsichtige Schritte waren zu hören. Der Mönch nahm jeweils zwei Stufen auf einmal. Die Treppe war lang und führte tief hinunter in die Kellergewölbe des Klosters. Mit jedem Meter wurde die Luft kühler und der Geruch moderiger Feuchtigkeit nahm zu. Hier brannten an den Wänden keine Kerzen, sondern nackte Energiesparlampen, gerade hell genug, um die Stufen zu erkennen. Am Ende der Treppe zweigte ein Gang ab. Hier war es noch dunkler. Rechts und links reihten sich mit Eisen beschlagene Eichentüren aneinander und der geringe Abstand zwischen ihnen ließ erahnen, wie eng die Kammern dahinter waren. Die letzte Tür, deutlich größer als die anderen, war nur angelehnt. Er schob sie auf.
"Warum hast du kein Licht gemacht, Sara?" Er tastete nach dem Schalter, aber das Licht funktionierte nicht. "Dann eben mit Kerzenlicht. Ist auch schöner."
Er wollte nach den Streichhölzern in der Tasche seiner Kutte greifen. Ein Geräusch von der Seite und ein Stoß. Er stolperte und stürzte. Hastige Schritte. Die Tür wurde von außen zugezogen. Jemand versuchte, den Riegel zuzuschieben. Sebastian sprang auf. Wenn ihr das gelang, war das sein Todesurteil, niemand kam je hier herunter, und schreien konnte er, so laut er wollte, niemand würde ihn hören. Zu Zeiten der Inquisition war dies die Folterkammer gewesen, in der Menschen so lange gequält wurden, bis sie starben oder jedes gewünschte "Geständnis" ablegten, und es war nicht erwünscht gewesen, die Mönche oben im Kloster durch fortwährendes Geschrei von ihren christlichen Pflichten abzulenken.
Sebastian zog an der Tür, der Widerstand war nicht sehr groß. Sie hatte es also nicht geschafft, den rostigen Riegel zu bewegen …
Er lachte. "Dafür wirst du büßen, das weißt du."
Draußen stand Sara, die Augen vor Entsetzen geweitet und unfähig zu fliehen. Er packte sie am Kleid und zerrte sie in die Folterkammer. Mit einer Hand tastete er nach der Wandlampe. Die Glühbirne war gelockert, und schon nach einer Umdrehung leuchtete sie wieder. Er stieß Sara in den Raum hinein.
"Das wird ein großes Vergnügen, mein Kätzchen. Geh da rüber."
Er deutete auf zwei Ketten, die von der Decke herunterhingen, an deren Enden rostige Handschellen befestigt waren und die man über eine Umlenkrolle hochziehen konnte.
"Die Hände auf den Rücken."
Sara wehrte sich. Er schubste sie roh nach vorne. Zwischen den Ketten und einer Eisernen Jungfrau lehnte eine Holzkeule an der Wand, damit hatten die Folterknechte früher ihren Opfern die Gliedmaßen zerschmettert. Sebastian folgte ihrem Blick.
"Versuch's doch."
Er lachte, als Sara die Keule mit beiden Händen packte. Sie starrte ihn an.
"Oh, was ist das denn! Richtige Wut in deinen Augen. Und ich dachte immer, die hat man euch Mädels gründlich ausgetrieben."
Er ging auf Sara zu, sicher, dass sie keine Gefahr darstellte. Doch sie tat das einzig Richtige. Statt abzuwarten, warf sie sich ihm entgegen und schlug zu. Sebastian riss seinen Arm hoch, zu spät, die Keule traf ihn am Hals, er ging zu Boden. Sara sprang zur Tür hinaus. Dieses Mal versuchte sie gar nicht erst, sie zu verriegeln. Sie rannte den Gang entlang, zwanzig Meter weiter bog er rechtwinkelig ab. Hier brannte keine Lampe mehr. Sie hastete weiter, rutschte auf den feuchten Granitsteinplatten aus.
Sebastian folgte ihr, er humpelte, mit jedem Schritt fuhr ein stechender Schmerz in sein linkes Bein. Ein paar Meter weiter verschwand Sara durch eine Öffnung in der Wand. Sebastian hinkte hinterher. Hier war es stockfinster. Er blieb stehen und lauschte. Nichts zu hören, keine Schritte, kein Rascheln. War sie stehen geblieben? Wartete sie auf ihn? Um ihn tatsächlich erneut anzugreifen, anstatt zu fliehen?
Er tastete nach der Streichholzschachtel, langsam, öffnete sie, ohne ein Geräusch zu machen, und zog ein Streichholz heraus. Vorsichtig drückt er den Schwefelkopf gegen die Reibefläche. Sobald das Holz brannte, würde er sich auf sie werfen. Und dieses Mal würde er besser aufpassen.
Er riss es an. Das plötzliche Licht blendet ihn. Er starrt in den Gang. Vor ihm ist sie nicht. Er dreht sich um, zu schnell, die Flamme erlischt. Er springt zur Seite. Wenn sie hinter ihm steht, kennt sie jetzt seine Position. Hektisch zerrt er ein neues Streichholz hervor. Es ist gleich ein ganzes Bündel, vier oder fünf.
Die Flamme ist viel größer. Der schwefelige Qualm brennt in seinen Augen. Er kämpft gegen Tränen an, fährt sich mit dem Ärmel seiner Kutte über die Augen.
Saras Gesicht, plötzlich ganz nah vor ihm. Aus dem Augenwinkel sieht er eine Bewegung. Er versucht auszuweichen. Zu spät. Ein titanischer Schlag trifft seine Stirn. Er tastet, warmes Blut schießt aus einer Platzwunde. Du verdammtes Miststück, will er sagen, aber nur ein Gurgeln kommt aus seinem Mund. Er sackt zu Boden.
Sara wartet ab. Lauscht. Ist er tot? Sie will weglaufen. Aber die Geheimtür steht noch offen … vielleicht findet dann irgendjemand diesen Herrn Sebastian, bevor sie weit genug fort ist von hier. Und dann ist ihre Flucht zu Ende und dann … Sie muss die Tür schließen.
Sie geht zurück, ihr Körper zittert, immer wieder lauscht sie in die Dunkelheit des Ganges. Sie schiebt die Tür zu, ein eiserner Rahmen, in den die Wandsteine eingepasst sind und der auf bronzenen Rädern auf einer mondsichelrunden Schiene bewegt wird. Das Rumpeln der Räder ist so furchtbar laut. Endlich verhallt es. Jetzt herrscht absolute Dunkelheit. Sie ertastet die Wand und bewegt sich so leise wie möglich in den Gang hinein. Sie muss an dem Herrn Sebastian vorbei, um hinaus in die Freiheit zu gelangen.
4.
Die lange Tafel im Refektorium war leergeräumt. Nur ein leichter Duft von frisch gebackenem Brot erinnerte an das Abendessen, das die Mönche drei Stunden zuvor hier eingenommen hatten. Der Saal wirkte trotz der dunklen, fast schwarzen Eichenholzvertäfelung freundlich, was an den zwischen Ocker und Terrakotta changierenden Bodenfliesen und den vielen Fenstern lag, die an drei Seiten des Raumes eingelassen waren. Da sie nach Osten, Süden und Westen ausgerichtet waren, ließen sie zu jeder Tageszeit Sonnenlicht ein. Jetzt, in der Dunkelheit, lockerten sie die ansonsten kahlen Wände mit ihren ornamentalen Fensterbänken und den bleigefassten Butzenscheiben auf. Ein gewaltiger gusseiserner Ofen, hinter dessen verglaster Klappe ein Feuer aus dicken Buchenscheiten träge loderte, sorgte für angenehme Wärme. In der Etage oberhalb des Refektoriums befand sich der Schreib- und Lesesaal, und damit es dort warm genug war, musste auch hier unten und selbst im Sommer gut geheizt werden.
Die wohlige Wärme war auch der Grund, warum das Nachtgebet, das Komplet, hier und nicht wie die anderen Stundengebete in der Kapelle abgehalten wurde. Die alteingesessenen Mönche waren betagt, keiner unter siebzig, die meisten weit darüber, und das Leben in den feuchten Gemäuern des Klosters hatte sie ausnahmslos mit heftigem Rheuma und Gicht geschlagen. Tagsüber ging es noch mit den Schmerzen, doch abends wurde es schlimm, da half nur Wärme.
Abt Albertus saß am Kopfende der Tafel, in Gedanken vertieft, nur hin und wieder ging sein Blick zu den beiden leeren Plätzen. Die versammelten Mönche schwiegen, eine gewisse Unruhe war ihnen anzumerken. Pünktlichkeit gehörte zu den wichtigsten Klosterregeln, und vor allem, wenn es um das letzte Gebet des Tages ging, dem sich die ersehnte Nachtruhe anschloss, wurde sie von allen eingehalten.
Die Tür öffnete sich, ein Mönch trat ein und verbeugte sich in Richtung des Abts.
"Und, Bruder Petros?", fragte der Abt.
"Ich konnte Bruder Sebastian nicht finden. In seiner Klause brennt eine Kerze, als wäre er nur kurz hinausgegangen."
Abt Albertus zögerte einen Moment, dann erhob er sich.
"Ihr führt das Nachtgebet ohne mich aus. Bruder Domenikus, du nimmst meine Stelle ein." Er klatschte in die Hände. "Bruder Vinzent und Bruder Bertrand, ihr sucht Bruder Sebastian."
Albertus verließ das Refektorium und eilte durch den langen, von Arkadenfenstern gesäumten Gang zu einer Tür an dessen Ende. Aus seiner Kutte zog er eine Magnetkarte und hielt sie gegen das Lesegerät, das derart unauffällig im Türrahmen eingelassen war, dass man es auf den ersten Blick leicht übersah. Eine LED leuchtete auf, zuerst rot, dann grün, ein metallisches Geräusch signalisierte das Entriegeln der Tür und sie sprang auf. Albertus betrat den dahinterliegenden Raum, die Tür schloss sich automatisch hinter ihm.
Auf einem Holztisch stand ein großer Monitor, sein Display war in acht Zonen aufgeteilt, die Bilder von Überwachungskameras zeigten: die Zufahrt zum Kloster und das Tor, den Klosterinnenhof, den äußeren und den inneren Eingangsbereich des Klosters und die drei Hauptgänge, die das Kloster in seiner gesamten Länge durchzogen. Im ersten und zweiten Stock gingen von ihnen die Stuben der Mönche und der Lesesaal ab und im Erdgeschoss die Küche, das Refektorium und die Waschräume. Albertus zog die Tatstatur und die Maus zu sich heran. Er isolierte eines der acht Bilder und brachte es großformatig aufs Display. Es zeigte den Klosterhof. Im Schnelllauf spulte er die Videoaufnahme zurück. Jedes Mal wenn jemand dort auftauchte, der im Begriff war, das Kloster zu verlassen, verlangsamte er das Tempo und zoomte auf dessen Kopf. Sebastian war nicht dabei.
Danach nahm er sich die Aufzeichnung des Klostergangs vor, von dem Sebastians Klause abging. Wieder spulte er im Schnelllauf zurück, sah, wie zwei Menschen überdreht und ruckelig durch den Gang huschten, stoppte den Rücklauf und ließ die Aufzeichnung im normalen Tempo vorwärtslaufen. Jemand in einem weiten Umhang und mit über den Kopf gezogener Kapuze tauchte aus dem Gang auf, der hinunter zu den Kellergewölben führte, und schlich zu Sebastians Tür.
Abt Albertus zoomte auf das Gesicht heran, das trotz des geringen Lichts gut zu erkennen war.
"Sara? Wie ist die hier hereingekommen?"
Er ließ die Aufzeichnung weiterlaufen, bis Sara und kurz darauf Sebastian in dem Gang nach unten verschwanden. Der Abt sprang auf und wollte den Raum schon verlassen, doch dann kehrte er ans Pult zurück. Um sicherzugehen, ob die beiden wiederauftauchten, musste er die Aufzeichnung bis zur Realzeit weiterlaufen lassen.
5.
Saras Knie schmerzten. Wie oft war sie in dem lichtlosen Stollen gestürzt? Auf dem Hinweg nicht ein einziges Mal, doch auf dem Rückweg war sie viel zu schnell durch die Dunkelheit gerannt. Jede Sekunde meinte sie, den Atem des Herrn Sebastian in ihrem Nacken zu spüren.
Die Wut, die sich viele Jahre in ihr aufgestaut hatte, und der Hass, der erst wenige Monate alt war, beides hatte sich wie in einer Explosion entladen. Jetzt fühlte sie sich leer. War er tot, der Herr Sebastian? Sie und die anderen Mädchen waren gedrillt, das Alte Testament als einzige Wahrheit anzusehen, und stand da nicht geschrieben: Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das war ein Irrtum, sie spürte es ganz genau. Sein Tod würde ihr keine Erlösung bringen, sondern nur einen weiteren Schatten auf ihre Seele legen. Sie wollte nicht seinen Tod, sondern nur ihn nie wiedersehen müssen.
Endlich kündigte ein grauer Schimmer das Ende des Stollens an. Sie trat hinaus. Dort lag ihr Felleisen.
"Rucksack!", korrigierte sie sich und erschrak über die Lautheit ihrer Stimme. Es ist ein Rucksack. Sie musste das Wort mehrmals wiederholen, diesmal leise geflüstert, um das andere aus ihrem Kopf zu vertreiben. Wer statt Felleisen Rucksack sagte, bekam zehn Schläge. Wer nachfragte, warum man Rucksack nicht sagen durfte, bekam fünfzehn weitere. Nachfragen war eine Versündigung, Nachfragen bedeutete Infragestellen, Infragestellen bedeutete, den Glauben in Zweifel zu ziehen. Wenn man nicht aufpasste, hatte man schnell eine der größten aller Sünden begangen: Zweifel statt Demut und Unterwerfung.
"Rucksack. Rucksack."
Untereinander hatten sie das Wort wie ein geheimes Zeichen benutzt. Genauso wie Essen statt Mahl oder Kleid statt Gewand. Natürlich nur Esther, Hanna und sie selbst. Die anderen Mädchen hätten sie sofort verraten. Die anderen Mädchen waren im Alter von fünf und sechs Jahren ins Schwesternhaus gekommen und ihre kleinen Seelen hatten nie gespürt, wie es sich anfühlt, einen eigenen Willen zu haben. Sara selbst war zehn Jahre alt gewesen, Hanna und Esther sogar dreizehn, als sie von ihren Eltern bei den Schwestern abgegeben wurden.
Hanna, oh, Hanna! Ihr Tod hatte sie unvorbereitet getroffen. Ein Unfalltod, sagten die Schwestern. Aber sie und Esther glaubten ihnen nicht. Schon als der Mönch, Bruder Sebastian, mit Hanna zum Holzmachen losgezogen war, hatte sie dieses Gefühl gehabt, ein Schwindel im Bauch, ein Taumeln. Er hatte Hanna sehr böse behandelt, der Herr Sebastian, ohne dass zu verstehen war, warum. Fast vom ersten Tag an, als er vor elf Monaten ins Kloster eingezogen war. Und dann war sie tot. Ein fallender Baum hat ihr den Schädel eingeschlagen, hatte der Mönch behauptet. Aber wie sollte ein dicker Baum eine solch schmale Wunde verursachen? Sie hatte sie gesehen, als sie die Leiche mit drei anderen Mädchen holen mussten. Und wieso lag Hanna neben und nicht unter dem Baum? Fragen, die sie nicht stellen durften. Nachfragen bedeutete Infragestellen und Infragestellen bedeutete, den Glauben in Zweifel zu ziehen.
Gleich nach Hannas Tod hatte der Mönch begonnen, seinen Dienst an Esther zu verrichten, auch an ihr, aber nicht so häufig. Die Freundschaft zwischen Esther und ihr wurde tiefer, viel tiefer als sie es je mit Hanna gewesen war. Sie hatten ja nur sich. Die Schwestern, der Bruder Sebastian, die anderen Mädchen − das waren die, vor denen man sich hüten musste. Gefahr. Oft schliefen sie schlecht, aus Angst, im Schlaf zu reden und Dinge auszusprechen, die unweigerlich furchtbare Strafen nach sich ziehen würden. Manchmal, wenn die Angst besonders groß war, wachten sie abwechselnd über den Schlaf der anderen, Esther und sie.
Vorsichtig tastete Sara sich durch das Brombeergestrüpp weiter vor. Die dornigen Äste wurden rechts und links von einer Plastikschnur zusammengehalten. Der Mönch hatte die Schnur so angebracht, dass man nur an einem Ende ziehen musste, um einen Durchgang zu schaffen. Wie stolz war er auf diese einfache Konstruktion gewesen, und was hatte er damit geprahlt, dass Schlauheit sich vor allem in Einfachheit äußerte! Einmal hatte sie gekichert. Als Antwort hatte er sie gleich hier von hinten genommen und sie mit jedem Stoß seiner Lenden tiefer in die Brombeeren gedrückt. Später, zurück im Schwesternhaus, musste sie eine Nacht in die Bußkammer, wegen der Risse in ihrem Kleid und die vielen Blutflecke.
Kammer … was für ein großzügiges Wort für diesen winzigen Wandschrank, in dem man kaum Luft bekam, in dem man sich fühlte, als wäre man bei lebendigem Leib begraben. Alle Mädchen, fünfzehn an der Zahl, waren sich einig darin, jede Prügelstrafe der Bußkammer vorzuziehen. Der Schmerz der Prügel verging schnell, und wenn man sich konzentrierte, fühlte man ihn sogar kaum. Die Bußkammer hielt einen fest im Griff und man spürte jede Sekunde, weil man hoffte, dass es endlich die letzte sein würde.
Die Erinnerung nahm ihr für einen Moment die Kraft und mit der Schwäche kam die Angst zurück. Sie warf einen Blick hinter sich und war sich sicher, dass der Mönch sich in der nächsten Sekunde aus dem Dunkeln auf sie stürzen würde, mit diesem Gesichtsausdruck, den Esther und sie zu fürchten gelernt hatten und der besagte, dass ihn nichts aufhalten konnte. Die Holzkeule, hatte sie sie noch …? Nein, die hatte sie im Stollen fallen gelassen.
Sie zerrte sich das Fellei− den Rucksack vom Rücken, zog das Wechselkleid und ihre Puppe heraus ... Puppen waren nicht erlaubt. Sie hatte sie aus Stoffresten genäht. Dass sie nie von den Erzieherinnen gefunden worden war, war ein kleines Wunder … Ganz unten fand sie die Taschenlampe, eine, für die man keine Batterien brauchte, Dynamotaschenlampe hatte auf der Verpackung gestanden. Vor ein paar Wochen hatte sie sie unter dem Tisch der Leiterin gefunden, als sie das Refektorium im Schwesternhaus schrubbte. Ein Geschenk Gottes, hatte sie gedacht, und die Lampe mitgenommen. Ein Zeichen, dass sie endlich die Flucht wagen sollte. Und ein weiteres Zeichen war, dass die Leiterin die Lampe nie vermisst hatte.
Hektisch drehte sie die Handkurbel. Das schrille Geräusch schnitt durch die Stille. Lieber Gott, jetzt weiß er, wo ich bin … Er braucht nur Anlauf zu nehmen, seinen Körper in meinen zu rammen, und ich stürze in die Tiefe …
Endlich flammte das Licht auf. Besonders hell war es nicht, es reichte gerade, um den Boden vor ihr zu beleuchten. Fünfzehn Sekunden kurbeln, zwei Minuten leuchten. Sie lauschte. Nichts, da war gar nichts. Oder doch? Ein Stöhnen?
Plötzlich überwältigte sie das Gefühl, dass ihr die Flucht nicht gelingen würde. Die Kräfte, die sie in den letzten Monaten zusammengescharrt und gehortet hatte, immer in der Angst, dass man ihr ihre Absicht zu fliehen ansah, dass ein unkontrollierter Blick sie verriet, waren verpufft.
Nicht einschlafen, nicht einschlafen …
Wie lange hatte es gedauert, bis sie es endlich gewagt hat! Jedes Mal, wenn der Herr Sebastian seinen Dienst an ihr verrichten wollte, bekam sie einen Schlüssel, um sich heimlich aus dem Schwesternhaus hinauszuschleichen. Ohne Licht musste sie den Weg bis in die Folterkammer finden. Dort wartete er nach dem letzten Nachtgebet, dem Komplet, auf sie; manchmal hatte er sie sogar mit in seine Klause genommen, was ihn auf für sie unverständliche Weise noch mehr erregte. Nach dem Dienst an ihr brachte er sie ins Schwesternhaus zurück und nahm ihr den Schlüssel wieder ab. Heute hatte sie sich früher als von ihm angeordnet auf den Weg gemacht, um mehr Zeit für ihre Flucht zu haben.
Entschlossen stopfte sie das Kleid und die Puppe zurück in den Rucksack. Wenn sie es heute nicht schaffte, würde es für sie keine zweite Gelegenheit mehr geben. Sie machte sich an den Abstieg. Im Licht der Taschenlampe kam sie viel schneller voran. Die Felswand unterhalb der Klostermauer fiel senkrecht ab. Von Weitem wirkte sie wie eine glatte Wand. Erst wenn man unmittelbar davorstand, konnte man den schmalen Steig erkennen, den die Mönche im Mittelalter angelegt hatten. Der geheime Zugang zum Kloster sollte es ihnen ermöglichen, im Falle einer Belagerung durch Räuber oder brandschatzende Soldaten unbemerkt Wasser und Lebensmittel von draußen herbeizuschaffen. "Es wird hiermit vermerkt und verfügt, dies sei kein Weg, um davonzufliehen aus dem Kloster", besagte eine Zeile im Klosterbuch, die ein gewisser Abt Hubertus im Jahr 1372 dort hineingeschrieben hatte. Sebastian, der Mönch, hatte diesen Satz ihr gegenüber unendlich oft rezitiert. Warum er das tat, dieselben Sätze immer wieder zu sagen, hatte Sara nie verstanden. Er hatte ohnehin ständig geredet, wenn er sie im Schwesternhaus für Arbeiten abholte: über die Welt draußen, über Menschen, die man nicht am Leben lassen durfte, über sein ferngesteuertes Fluggerät, er nannte es Quadrocopter, mit dem er jeden Tag übte. Nur wenn er seinen Dienst an ihr verrichtete, redete er nicht, da grunzte er und stöhnte.
Als Sara endlich auf dem weichen Waldboden stand, suchte sie den Himmel ab. Da, der Große Wagen. Wenn man den Abstand der beiden hinteren Sterne ums Vierfache verlängert, stieß man auf den Polarstern. Norden. Das wusste sie noch aus der Zeit, als sie in eine normale Schule gehen musste, die Polizei hatte sie anfangs zu Hause abgeholt und dorthin gebracht, weil ihr Vater dagegen gewesen war, eine furchtbare Zeit, sie war das Gespött aller anderen Kinder gewesen. Und ihr Vater …
Lass die Erinnerungen sein, beschwor sie sich, "lass sie sein, kümmer dich nur um das, was jetzt wichtig ist, Sara!" Oh, Gott, hatte sie tatsächlich angefangen, mit sich selber zu reden, wie die alten Schwestern im Schwesternhaus, die, die zum Erziehen zu alt waren und nur noch auf den Tod warteten?
Der Große Wagen. Der Polarstern. Sie hatte keine Ahnung, welche Wege und Straßen aus dem Tal herausführten, sie wusste nur, dass das Tal im Süden an einem Gletscher endete und im Osten und Westen von schroffen Dreitausendern begrenzt wurde, die man allenfalls im Tageslicht und auf keinen Fall mit Sandalen überwinden konnte. Wenn sie doch nur ihre robusten Wanderschuhe hätte! Aber die wurden nur ausgegeben, um draußen zu arbeiten, und wenn man zurückkehrte, musste man sie wieder abgeben. Nach Norden, das war ihr Fluchtweg, und sie musste so schnell laufen, wie sie konnte. In spätestens sieben Stunden würde ihr Verschwinden entdeckt werden und falls man auch noch den Herrn Sebastian fand …
Lieber barmherziger Herr im Himmel, lass ihn tot sein!
Oh, Gott, was hatte sie für schlechte Gedanken …
Nein, er soll tot sein, für das, was er ihrer Esther angetan hat!
Sieben Stunden. Bis dahin müsste sie den Ort Klein Aichbach erreicht haben, dort gab es einen Bahnhof, das wusste sie aus Gesprächen der Schwestern. Und dann würde das größte Wagnis beginnen. Sie hatte weder Geld noch war sie je mit einem Zug gefahren, sie wusste nicht, wie man Sachen einkaufte, wie man mit Menschen redete, die man nicht kannte, sie wusste nicht, wie es in der Welt da draußen zuging. Im Wald, da könnte sie sich durchschlagen, doch dort würde man am intensivsten nach ihr suchen, Tag und Nacht, die Schwestern hatten zwei Hunde. Alle Mädchen, die es in der Vergangenheit geschafft hatten, aus dem Schwesternhaus zu fliehen, hatten sich aus Angst vor der großen, unbekannten Welt im Wald versteckt. Alle waren sie sehr schnell gefunden worden. Und alle wurden sie hernach von der Gnade der Strafe derart gezeichnet, dass man es ihnen bis an ihr Lebensende ansehen würde. Als Abschreckung für die anderen.
6.
Abt Albertus eilte mit Bruder Petros die Treppen hinunter zu den Gewölben. Im kalten Licht der Energiesparlampen traten die wulstigen Narben in Petros Gesicht deutlich hervor. Schergen des Islamischen Staats hatten ihn vor ein paar Jahren in seinem syrischen Heimatdorf Sednaya im Norden von Damaskus zusammen mit anderen christlichen Männern gefangen genommen. Tod durch Kopfabschneiden lautete das Urteil. Sie boten ihnen an, sie zu verschonen, wenn sie ihren christlichen Glauben aufgaben und sich zum Islam bekannten. Keiner von ihnen wollte sterben, alle hatten sie ihre Familien, also sprachen sie die konvertierenden Worte: "Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist." Auch Petros hatte dieses Satz gesagt in der Überzeugung, dass sein Gott größer war als Allah und dass er seine Notlage verstehen würde.
Die IS-Schergen hatten gelacht und gesagt: Jetzt wird alles gut, aber bevor wir euch von euren Fesseln erlösen, zeigen wir euch noch einen Film. Sie bauten eine Leinwand und einen Beamer auf. Es dauerte fast eine Stunde, bis ein IS-Kämpfer mit einer Videokamera herbeieilte, die SD-Card entnahm und in den Beamer schob. Petros und die anderen erwarteten so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für die ihnen fremde Religion. Doch dann zeigte das Video, wie die IS-Schlächter ihre Familien massakrierten, wie sie lachend und jubelnd ihre Frauen erschossen und erstachen, und zum Schluss Babys so lange gegen Wände warfen, bis auch sie tot waren. Es war so unendlich grauenhaft, und doch konnte keiner der Männer seine Augen schließen, als hofften sie, dass es sich nur um ein perfides Videospiel handelte.
Als das Video zu Ende war, marschierten junge Islamisten vor den gefangenen Männern auf, fast die Hälfte waren weißhäutige Europäer, die kaum Arabisch sprachen, junge Männer, einige vielleicht gerade erst achtzehn Jahre alt, jeder mit einer Sammlung von Messern versehen. Ein Gefangener nach dem anderen starb. Ihre Henker schnitten ihnen nicht einfach die Kehle durch, sondern probierten zuerst in ihren Gesichtern aus, welches das jeweils stumpfeste Messer war, um genau dieses dann für die Hinrichtung zu benutzen. Petros war das letzte Opfer. Das Entsetzen hatte ihn stumm werden lassen, weder konnte er schreien, noch spürte er die Schnitte durch sein Gesicht. Seine Augen blickten in den Himmel, wo sich während der gesamten grausamen Prozedur ein Gewitter zusammenbraute und der Sonne das Licht wegnahm. Als sein Henker, ein Junge mit Milchgesicht und dünnem Bärtchen, endlich das stumpfeste Messer gefunden hatte und es an seinen Hals setzte, brach das Gewitter mit biblischer Urgewalt los. Gleich der erste Blitz fuhr in einen Panzer. Granaten explodierten und setzten Treibstofftanks in Brand. In dem Chaos gelang Petros die Flucht. In seinem Überleben sah er keinen Zufall, sondern eine Fügung Gottes verbunden mit dem Auftrag, sein Leben fortan dem Kampf gegen den IS und gegen den Islam, der solche Bestien hervorbrachte, zu widmen.
Mit ihren Taschenlampen leuchteten der Abt und Petros in jede der Bußkammern, winzige, leere Räume mit kahlen Wänden und Böden aus gestampftem Lehm. Die letzte Kammer war deutlich größer, hier war der Boden mit Steinplatten ausgelegt. An den Wänden hingen etliche mittelalterliche Folterinstrumente, Zangen, Daumenschrauben und verschiedene Werkzeuge, deren Funktion sich nicht ohne Weiteres erschloss, Überbleibsel aus der Zeit der Inquisition. Eine halb geöffnete, von Rost zerfressene Eiserne Jungfrau lehnte an der Wand. In der Mitte des Raums stand ein Streckbrett, das in einem erstaunlich guten Zustand war. Auf der hölzernen Liegefläche waren mehrere Lagen weicher Decken übereinandergelegt ausgebreitet, daneben lagen einige Streifen Kondome, die teilweise geöffnet worden waren. Petros sah irritiert zum Abt hinüber. Der zeigte keine Reaktion, fast als wollte er die Existenz dieses in einem Klosterbetrieb vollkommen überflüssigen Utensils durch Ignorieren zum Verschwinden bringen.
Albertus schickte Bruder Petros zurück ins Refektorium und wartete, bis dessen Schritte verklungen waren. Dann folgte er dem Gang, bog zwanzig Meter weiter in den nächsten Gang ab, der nach einigen Metern endete. Er tastete die Wand ab, bis er den Mechanismus fand, der die geheime Tür öffnete. Er leuchtete in den Tunnel hinein. Das Licht verlor sich in der Ferne.
Einige Meter vor ihm auf dem Boden lag ein sackartiges Bündel. Vorsichtig trat er näher heran. Sebastian, das Gesicht voller Blut.
7.
Der Wirt schob die Tür hinter Carl zu und drehte die Schlüssel im Schloss. Kurz nach Mitternacht. Seit einer halben Stunde schon hatte sich kein neuer Gast mehr in der Kalker Stube blicken lassen und Carls sparsame Art, stundenlang vor einem einzigen Bier zu sitzen, hatte ihn sauer gemacht.
Draußen wurde Carl vom malzigen Geruch der nahen Brauerei empfangen, schwer, süßlich, eklig, er versuchte, so flach wie möglich zu atmen. Er zog die Schultern hoch, als wäre es kalt. Was es nicht war, im Gegenteil. Seit Tagen schon bewegte sich in der Stadt kein Lüftchen und es wurde immer schwüler. Typisches Kölner Sommerwetter. Seine rechte Schulter schmerzte immer noch. Oder schon wieder. Der Muskelbündelriss war längst verheilt, trotzdem schwoll sein Oberarm in schöner Regelmäßigkeit an. Die Faszien und das Lymphsystem vergessen eine solche Verletzung nicht so schnell, hatte sein Physiotherapeut gesagt. Schrubben Sie den Arm jeden Tag mit einer Wurzelbürste, sorgen Sie für Durchblutung, dann wird es besser. Natürlich tat er das nicht und nichts wurde besser. Weil er die Erinnerung aufrechterhalten wollte? Als Ermahnung, nicht aufzugeben?
Als ob das nötig wäre …
Carl ging die Kalker Hauptstraße entlang und seine Schritte wurden immer langsamer, je näher er seinem Wohnhaus kam, das letzte, bevor das Schienennetz des Güterbahnhofs begann. Der Lärm rangierender Loks, das Rumpeln und Quietschen der Waggons wurde immer lauter, ein Lärm ohne regelmäßige Muster, nichts, woran man sich gewöhnen könnte. Kein Wunder, dass die Wohnungen hier so billig waren. Seine war besonders billig. Das Haus stammte aus den 1950er-Jahren und hatte schon lange keinen Handwerker mehr gesehen. Der graue Rauputz der Fassade löste sich in großen Stücken, das Holz der Fenster wurde an manchen Stellen nur noch von den Lackresten zusammengehalten, überall zeigten sich Spuren schimmeliger Feuchtigkeit. Der Besitzer schien entschlossen zu sein, die Mieten bis zum letzten Tag, bevor das Haus in sich zusammenfiel, einzustreichen. Die ganze Gegend war eine einzige Sackgasse, bevölkert von einer Hartz-IV-Schattenarmee, von ein paar Studenten und von Rentnern, denen mit ihren Altmietverträgen nicht so leicht gekündigt werden konnte.
Vor der Eingangstür verharrte er. Starrte auf sein Messingschild: "Private Ermittlungen − Carl Gruber". Als er es hatte machen lassen, war er sich noch sicher gewesen, die zweihundert Euro dafür leicht verschmerzen zu können, weil sein Geschäft sehr bald Fahrt aufnehmen würde. Ein fundamentaler Irrtum, wie sich herausstellte.
Rechts und links neben der Tür war die Wand von zahllosen Dübellöchern übersät. Immerhin ließen sie vermuten, dass hier früher einmal andere Schilder montiert gewesen waren, von Steuerberatern, Heilpraktikern oder vielleicht sogar einer Arztpraxis; oder auch nur von einem Nagelstudio und einem Massagesalon.
Trotzdem musste Carl froh sein, die Wohnung überhaupt bekommen zu haben. Zuvor hatte er nichts als Absagen erhalten, weniger, weil er ein arbeitsloser Ex-Polizist war, nein, aber es war wie verhext gewesen, jeder Vermieter schien ihn zu kennen, ihn, den Bullen, der einen Jungen hinterrücks erschossen hatte, und so einen wollte keiner in seinem Haus haben. Das Allerschlimmste jedoch war, dass er diese verdammte Wohnung letztlich genau deshalb bekommen hatte: Der Vermieter hatte seinen Fall mit großer Begeisterung verfolgt und gratulierte ihm überschwänglich: Ein Scheiß-Moslem weniger, Herr Gruber, super! Wenn nur alle Polizisten so wären wie Sie. Weg mit denen, die müsste man alle an die Wand stellen, von wegen 'der Islam gehört zu Deutschland' … Am liebsten hätte Carl sofort wieder das Weite gesucht, doch er hatte keine Wahl. Er wohnte zu der Zeit noch in einer Pension, billig zwar, aber immer noch viel teurer als die Miete für diese Wohnung.
Carl zog seine Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche. Was erwartete ihn, wenn er jetzt hinaufging? Zehn Drehbücher einer Bullen-Soap, die er auf Fehler in der Darstellung der Polizeiarbeit durchleuchten sollte … Absurd. Seine Kollegen und die Mordkommission hatten Fehler gemacht, sie hatten sich von den Alibis der beiden Mörder blenden lassen, sie hatten sie laufen lassen und ihn um seinen Job gebracht! Und da war niemand gewesen, der die Polizeiarbeit durchleuchtet hatte.
Das erste Geld würde in vier, fünf Wochen kommen. Und dann würde es doch nicht reichen, um davon zu leben. Warum sollte er sich das antun? Eine weitere Stufe auf einer Treppe nach unten … Plötzlich war da dieser glasklare Gedanke: Es war lächerlich, sich mit irgendwelchen dämlichen Jobs einzurichten, er hatte hier keine Zukunft mehr. Es galt, eine einzige Aufgabe zu erledigen. Und danach? Weg von hier.
Er steckte den Schlüssel wieder ein. Der Umschlag mit den Drehbüchern klemmte noch unter seinem Arm. Langsam ließ er ihn hinunterrutschen, bis er ihn in der Hand hielt. Schwer war er nicht, etwa wie ein Sportdiskus. Auf der Polizeischule hatte er mit großem Vergnügen Leichtathletik gemacht, im Diskuswerfen war er einer der besten gewesen.
Er nahm Schwung, drehte sich zweimal um seine Achse und schleuderte den Umschlag hinüber zu den Bahngleisen. Ein perfekter Wurf mit Spin. Auf den ersten Metern gewann der Umschlag an Höhe, bevor er in einem weiten Bogen in die Tiefe segelte, auf die Schienen knallte, zerplatzte und seinen Inhalt über den Schotter verteilte.
Er steckte fest, Stillstand. Seine Frau würde nicht zu ihm zurückkehren, das Gericht würde das Kontaktverbot zu seiner Tochter nicht aufheben, in Köln würde er immer der Kindsmörder bleiben, freigesprochen von einer bullenfreundlichen Justiz. Trotzdem konnte er nicht weggehen. Weil da immer noch die Hoffnung war, diesen letzten Mosaikstein zu finden. Plötzlich pulste Wut in ihm hoch. Er musste etwas tun, jetzt.
Sein Motorroller stand auf dem Bürgersteig neben einem Laternenpfahl, gesichert mit einer schweren Kette. Carl öffnete das Schloss. Der Sturzhelm steckte in dem Hohlraum unter dem Sitz. Der Motor sprang sofort an. Zehn Minuten später bog er in die Zeusstraße ein. Sein altes Revier, die Hochburg islamistischer Hassprediger, die No-go-Area für deutsche Polizisten. Alle wissen es − außer Lena Gülec, dachte er − aber laut sagen durfte man es nicht, das war nicht political correct und es brachte einem den Ruf ein, ein Rassist zu sein.