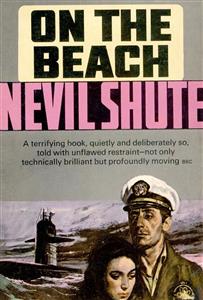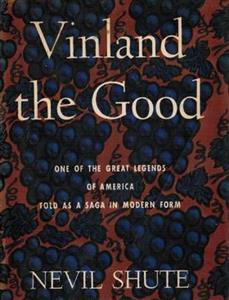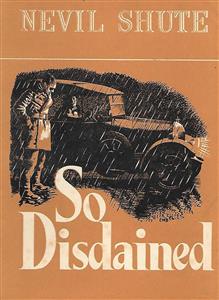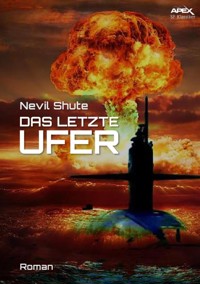
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein nuklearer Blitzkrieg zwischen den Supermächten hat die nördliche Hemisphäre vernichtet. Die radioaktiv verseuchten Wolken treiben langsam auf den einzigen noch unversehrten Erdteil, Australien, zu. Viele Menschen verbringen ihre letzten Monate in Saus und Braus. Einige gehen endlich in sich. Und andere bestellen ihre Felder, kaufen Geschenke und planen immer weiter, als ob das Ende der Zukunft nicht schon absehbar wäre.
Vor diesem Hintergrund kommt es zwischen dem jungen Kommandanten des amerikanischen U-Boots Scorpion und der lebenshungrigen und trunksüchtig gewordenen Moira Davidson zu einer ergreifenden Liebesgeschichte...
Das letzte Ufer von Nevil Shute (1957 erstmals veröffentlicht) ist eine aufrüttelnde Vision von den letzten Tagen der Menschheit und ein mitreißendes literarisches Meisterwerk. Im Jahr 1959 verfilmte Stanley Kramer den Roman mit Gregory Peck als Lionel Towers, Ava Gardner als Moira Davidson, Fred Astaire als Julian Osborne und Anthony Perkins als Peter Holmes.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Das letzte Ufer in seiner Reihe APEX SF-KLASSIKER als durchgesehene Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
NEVIL SHUTE
Das letzte Ufer
Roman
Apex Science-Fiction-Klassiker, Band 45
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DAS LETZTE UFER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Das Buch
Ein nuklearer Blitzkrieg zwischen den Supermächten hat die nördliche Hemisphäre vernichtet. Die radioaktiv verseuchten Wolken treiben langsam auf den einzigen noch unversehrten Erdteil, Australien, zu. Viele Menschen verbringen ihre letzten Monate in Saus und Braus. Einige gehen endlich in sich. Und andere bestellen ihre Felder, kaufen Geschenke und planen immer weiter, als ob das Ende der Zukunft nicht schon absehbar wäre.
Vor diesem Hintergrund kommt es zwischen dem jungen Kommandanten des amerikanischen U-Boots Scorpion und der lebenshungrigen und trunksüchtig gewordenen Moira Davidson zu einer ergreifenden Liebesgeschichte...
Das letzte Ufer von Nevil Shute (1957 erstmals veröffentlicht) ist eine aufrüttelnde Vision von den letzten Tagen der Menschheit und ein mitreißendes literarisches Meisterwerk. Im Jahr 1959 verfilmte Stanley Kramer den Roman mit Gregory Peck als Lionel Towers, Ava Gardner als Moira Davidson, Fred Astaire als Julian Osborne und Anthony Perkins als Peter Holmes.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Das letzte Ufer in seiner Reihe APEX SF-KLASSIKER als durchgesehene Neuausgabe.
DAS LETZTE UFER
An diesem letzten Zufluchtsort
ertasten wir einander
und bleiben stumm,
gelagert am Strand des schwellenden Stroms...
Auf diese Weise endet die Welt.
Auf diese Weise endet die Welt.
Auf diese Weise endet die Welt.
Nicht mit einem Knall, sondern einem Wimmern...
- T. S. Eliot
Erstes Kapitel
Peter Holmes, Lieutenant Commander der Königlichen Australischen Kriegsmarine, erwachte kurz nach Tagesanbruch. Schlaftrunken und von Marys Körperwärme leicht betäubt blieb er noch liegen und beobachtete die ersten Sonnenstrahlen, die durch die Kreton-Vorhänge ins Schlafzimmer drangen. Sie verrieten ihm, dass es ungefähr fünf Uhr sein musste; schon bald würden sie seine kleine Tochter Jennifer in ihrem Bettchen aufwecken, dann mussten er und Mary aufstehen und ihren Beschäftigungen nachgehen. Bis es soweit war, konnte er noch liegenbleiben.
Er war in glücklicher Stimmung aufgewacht, wurde sich aber erst nach einiger Zeit des Anlasses bewusst und begann darüber nachzudenken. Weihnachten war vorüber, das hatte nichts damit zu tun. Für das Fest hatte er die kleine Fichte im Garten mit bunten Lichtern geschmückt und einen langen elektrischen Draht bis zum Stecker neben dem Kamin geführt; so war sie zu einem Ebenbild der großen erleuchteten Fichte geworden, die eine Meile entfernt auf dem Rathausplatz von Falmouth stand. Am Weihnachtsabend hatten sie mit einigen Freunden im Garten auf offenem Feuer den Festbraten gebraten. Weihnachten war vorüber, es musste - er rechnete langsam -, es musste heute Donnerstag, der 27. Dezember sein. Sein Rücken schmerzte noch ein wenig vom Sonnenbrand, den er sich gestern am Strand und beim Wettsegeln zugezogen hatte. Es war ratsam, heute nicht ohne Hemd ins Freie zu gehen. Völlig wach geworden, wurde er sich dann bewusst, dass er heute jedenfalls ein Hemd tragen werde. Um elf Uhr musste er sich im Büro des Zweiten Seelords im Marine-Ministerium melden. Nach siebenmonatiger Untätigkeit gab man ihm eine neue Bestallung. Wenn er Glück hatte, schickte man ihn auf hohe See; er sehnte sich danach, wieder auf einem Schiff zu sein.
Jedenfalls aber würde er arbeiten. Der Gedanke daran hatte ihn beim Einschlafen glücklich gemacht, und dieses Glücksgefühl hatte die Nacht überdauert. Seit er im August zum Lieutenant Commander befördert worden war, war er unbeschäftigt, und unter den gegebenen Umständen hatte er beinahe die Hoffnung aufgegeben, je wieder zu arbeiten. Das Marine-Ministerium hatte ihm jedoch durch all die Monate die volle Löhnung ausbezahlt, und dafür war er dankbar.
Das Baby rührte sich, murmelte etwas und gab leise Wimmerlaute von sich. Peter streckte die Hand aus, um den elektrischen Wasserkessel anzustellen, der mit dem Geschirr und der Milch für das Kind auf einem Tablett neben dem Bett stand. Mary bewegte sich und fragte, wieviel Uhr es sei. Er antwortete, küsste sie und sagte: »Es ist wieder ein herrlicher Tag.«
Sie setzte sich auf und strich ihr Haar glatt. »Ich habe mir gestern einen richtigen Sonnenbrand geholt. Jennifer habe ich am Abend mit Zinksalbe eingerieben; ich glaube, ich werde sie heute lieber nicht mit zum Strand nehmen.« Dann erinnerte auch sie sich. »Ach, fährst du heute nicht nach Melbourne, Peter?«
Er nickte. »Ich glaube, du solltest zu Hause bleiben und den Tag im Schatten verbringen.«
»Es scheint mir auch so.«
Er stand auf und ging ins Badezimmer. Als er zurückkam, saß das Kind auf dem Töpfchen und Mary kämmte sich vor dem Spiegel das Haar. Auf dem Bettrand, auf den er sich setzte, um Tee aufzugießen, lag ein waagrechter Sonnenstrahl.
Mary sagte: »Melbourne wird heute sehr heiß sein, Peter. Ich dachte mir, ich gehe mit dem Kind gegen vier Uhr in den Club, dann kannst du uns dorthin zum Schwimmen nachkommen. Ich nehme den Anhänger und deine Badesachen mit.«
In der Garage stand ein kleines Auto, aber seit vor einem Jahr der kurze Krieg zu Ende gegangen war, benutzten sie es nicht mehr. Da Peter Holmes einfallsreich und geschickt im Umgang mit Werkzeugen war, hatte er ein erträgliches Ersatzfahrzeug ersonnen. Aus den Vorderrädern von zwei Motorrädern hatte er einen kleinen Anhänger gebaut, der sich am Fahrrad befestigen ließ und ihnen als Kinderwagen und ganz allgemein zum Transport schwerer Dinge diente.
Nur der lange steile Wege von Falmouth herauf machte ihnen einige Schwierigkeit.
Peter nickte. »Kein schlechter Einfall. Ich nehme mein Rad und lasse es am Bahnhof.«
»Mit welchem Zug fährst du?«
»Neun Uhr fünf.« Langsam trank er Tee, sah dann auf die Uhr. »Ich hole die Milch, sowie ich das ausgetrunken habe.«
Er zog kurze Hosen und ein Unterhemd an und ging aus dem Zimmer. Sie hatten eine Parterrewohnung in einem alten Haus auf dem Hügelkamm oberhalb der Stadt, das man in Einzelwohnungen umgebaut hatte; eine Garage und ein großer Teil des Gartens gehörten zu der Wohnung. Auf der Veranda standen die Fahrräder und der Anhänger. Es wäre vernünftig gewesen, den Wagen unter den Bäumen stehenzulassen und die Garage für die Räder frei zu machen, dazu konnte sich Holmes aber nicht entschließen, da der kleine Morris sein erstes eigenes Auto war, in dem er Mary schon vor ihrer Verlobung spazieren gefahren hatte. 1961, sechs Monate vor Kriegsausbruch, hatten sie geheiratet, bald darauf fuhr er auf der HMAS Anzac auf See, und sie beide waren auf eine lange Trennung gefasst gewesen. Dann brach der kurze, unbegreifliche Krieg aus, der Krieg, dessen Geschichte niemand geschrieben hatte und die nun niemand je schreiben würde. Der Krieg hatte sich schnell über die ganze nördliche Hemisphäre ausgebreitet, bis dann am siebenunddreißigsten Tag die letzte seismische Registrierung einer Explosion sein Ende anzeigte. Drei Monate später war die Anzac mit dem letzten Rest von Brennstoff nach Williamstown zurückgekehrt, und Holmes war nach Falmouth zu Mary und dem Morris Minor gefahren, während in Wellington, in Neuseeland, die Staatsmänner der südlichen Hemisphäre tagten und sich über die neuen Lebensumstände berieten. Die vierzehn Liter Benzin, die noch im Autotank waren, und weitere fünfundzwanzig Liter, die Holmes an einer Tankstelle gekauft hatte, verwendete er unbekümmert; erst dann ging es den Australiern auf, dass alles Benzin aus der nördlichen Hemisphäre kam.
Holmes schob den Anhänger und das Rad von der Veranda auf den Rasen, befestigte den Anhänger am Rad, stieg auf und fuhr davon. Er musste vier Meilen fahren, um Milch und Rahm zu holen, da Transportschwierigkeiten Milchlieferungen von den umliegenden Gütern unterbunden hatten; sie hatten gelernt, in der elektrischen Mixmaschine selbst Butter zu machen. Glücklich in dem Gedanken, dass Arbeit auf ihn wartete, fuhr er in der warmen Morgensonne die Straße hinunter; hinter ihm auf dem Anhänger ratterten die leeren Blechkannen.
Auf der Straße war wenig Verkehr. Er überholte ein Gefährt, das einmal ein Auto gewesen war; man hatte den Motor herausgenommen und die Windschutzscheibe zerschlagen und ließ es nun von einem jungen Ochsen ziehen. Dann begegnete er zwei Reitern, die ihre Pferde sorgfältig auf dem Grasstreifen neben der Asphaltstraße hielten. Holmes wollte kein Pferd, das waren anfällige Geschöpfe, die nun so kostbar waren, dass man tausend Pfund oder sogar noch mehr für sie zahlen musste, er hatte aber schon einige Male daran gedacht, für Mary einen jungen Ochsen zu kaufen. Es wäre leicht gewesen, den Morris in einen Ochsenkarren umzuwandeln, nur wäre ihm das Herz dabei gebrochen.
Eine halbe Stunde später kam er zur Farm und ging sofort in die Molkerei. Er kannte den Farmer gut; der war ein großer, dünner Mann, der langsam sprach und infolge einer Verletzung, die er sich im Zweiten Weltkrieg zugezogen hatte, hinkte. Holmes fand ihn in dem Raum, wo eine Zentrifuge die Milch entrahmte; leise surrte der elektrische Motor, wobei Milch in ein Gefäß und Rahm in ein zweites floss.
»Guten Morgen, Mr. Paul«, sagte der Marineoffizier. »Wie geht es Ihnen?«
»Danke, gut, Mr. Holmes.« Der Farmer nahm ihm die Milchkanne aus der Hand und füllte sie aus der Kufe. »Ist bei Ihnen zu Hause alles in Ordnung?«
»Alles großartig. Ich fahre heute Morgen nach Melbourne zum Marine-Ministerium. Ich glaube, die haben endlich Arbeit für mich.«
»Das ist gut«, antwortete der Farmer. »So herumzusitzen, muss recht bedrückend sein.«
Peter nickte. »Wenn man mich auf See schickt, wird für Mary aber alles etwas schwierig werden. Sie kann nur zweimal wöchentlich Milch holen kommen, wird Ihnen aber den gleichen Betrag zahlen.«
Der Farmer antwortete: »Machen Sie sich wegen des Zahlens kein Kopfzerbrechen; das kann warten, bis Sie zurückkommen. Ich habe mehr Milch, als die Schweine selbst jetzt in der Hitze trinken wollen. Ich habe gestern hundert Liter in den Bach geschüttet - keine Transportmöglichkeit. Wahrscheinlich sollte ich mehr Schweine züchten, das kommt mir aber so zwecklos vor. Es ist schwer, sich zu irgendetwas zu entschließen...« Er schwieg einen Augenblick, sagte dann: »Es wird für Ihre Frau nicht leicht sein, hierherzukommen. Was wird sie mit Jennifer machen?«
»Wahrscheinlich nimmt sie sie im Anhänger mit.«
»Alles ein bisschen schwierig für sie.« Der Farmer ging zur Tür, blieb dort im warmen Sonnenschein stehen und betrachtete das Fahrrad und den Anhänger. »Ein guter Anhänger«, sagte er. »Der beste kleine Anhänger, den ich je gesehen hab. Haben Sie ihn selbst gemacht?«
»Ja.«
»Wo haben Sie die Räder herbekommen, wenn ich fragen darf?«
»Motorräder. Ich habe sie in der Elizabethstraße gekauft.«
»Glauben Sie, Sie könnten zwei für mich auftreiben?«
»Ich kann’s versuchen«, antwortete Peter. »Ich glaube, es gibt noch welche. Sie sind besser als kleine Räder - sie lassen sich besser ziehen.« Der Farmer nickte. »Vielleicht sind sie jetzt schon selten geworden. Die Leute scheinen ihre Motorräder nicht mehr gern zu verkaufen.«
»Ich habe meiner Frau gesagt«, bemerkte der Farmer langsam, »wenn ich einen kleinen Anhänger hätte, könnte ich eine Art Stuhl für sie daraus machen, den am Fahrrad befestigen und sie zum Einkäufen mit nach Falmouth nehmen. Es ist reichlich einsam für eine Frau auf einer Farm heutzutage«, fuhr er fort. »Vor dem Krieg war’s ganz anders, da waren wir mit dem Wagen in zwanzig Minuten in der Stadt. Mit dem Ochsenkarren brauchen wir dreieinhalb Stunden hin und dreieinhalb Stunden zurück; das sind sieben Stunden nur für die Fahrt. Sie hat versucht, radeln zu lernen; in ihrem Alter und da sie wieder ein Kind erwartet, wird sie’s aber nicht mehr schaffen. Ich möchte gar nicht, dass sie’s versucht. Wenn ich aber so einen kleinen Anhänger wie den da hätte, könnte ich sie zweimal wöchentlich mit nach Falmouth nehmen und gleichzeitig Mrs. Holmes Milch und Rahm bringen.« Nach kurzer Pause fuhr er fort: »Ich würde das gern für Ihre Frau tun. Schließlich wird’s nicht mehr sehr lange dauern nach dem, was man im Rundfunk sagt.«
Der Marineoffizier nickte. »Ich werde mich heute danach umsehen. Der Preis ist Ihnen wohl gleichgültig?«
Der Farmer nickte. »Vorausgesetzt, es sind gute Räder, mit denen man keine Schwierigkeiten hat. Gute Reifen sind das wichtigste. Solche wie Ihre hier.«
Der Offizier nickte. »Ich sehe mich heute danach um.«
»Ist es ein großer Umweg für Sie?«
»Ich kann mit der Straßenbahn hinfahren. Das macht mir gar nichts. Gott sei gedankt für die Braunkohle.«
Der Farmer drehte sich zu der Zentrifuge um, die noch immer lief. »Das stimmt. Ohne Elektrizität wären wir in einer schönen Lage.« Geschickt zog er die volle Kufe unter dem Milchstrom weg und schob eine leere an ihre Stelle. »Sagen Sie, Mr. Holmes«, fragte er, »benutzt man für die Kohle nicht große Grabmaschinen? Planierschlepper und ähnliches?« Der Offizier nickte. »Woher kommt der Treibstoff dafür?«
»Ich habe mich einmal danach erkundigt«, antwortete Peter. »Er wird an Ort und Stelle aus der Braunkohle destilliert. Fünf Liter kosten ungefähr zwei Pfund.«
»Was Sie sagen!« Der Farmer überlegte. »Ich dachte mir, wenn man das dort tun kann, könnte man es auch für uns tun. Bei dem Preis ist es aber kaum praktisch durchführbar...«
Peter stellte die Milch- und Rahmkannen auf den Anhänger und begab sich auf den Heimweg. Um halb sieben Uhr war er zurück. Er duschte, zog die Uniform an, die er seit seiner Beförderung selten getragen hatte, frühstückte schnell und fuhr auf dem Rad hügelabwärts, um schon den Zug um acht Uhr fünfzehn zu erreichen und sich noch vor seiner Verabredung bei den Autohändlern umzusehen.
Das Rad ließ er in der Garage, wo er in vergangenen Zeiten seinen Wagen hatte überholen lassen. Autos gab es dort nicht mehr. Stattdessen standen Pferde da, auf denen Geschäftsleute von ihren Landhäusern in Reithosen und Regenmänteln hierher geritten waren, um mit den elektrischen Zügen weiter in die Stadt zu fahren. Die Pferde wurden an den Benzinpumpen festgebunden. Am Abend kamen die Herren im Zug zurück, sattelten die Pferde, befestigten die Aktenmappen an den Sätteln und ritten wieder nach Hause. Das Tempo des Geschäftslebens hatte nachgelassen, was ein Vorteil war - der Schnellzug, der die Stadt um fünf Uhr drei zu verlassen pflegte, war durch einen Zug, der schon um vier Uhr siebzehn fuhr, ersetzt worden.
Auf der Fahrt nach der Stadt zerbrach sich Peter Holmes den Kopf, welcher Art seine neue Bestallung sein konnte. Wegen der Papierknappheit gab es keine Zeitungen mehr; Nachrichten erfuhr man nur über den Rundfunk. Die Königliche Australische Kriegsflotte war nun sehr klein. Sieben kleine Schiffe hatte man unter großem Kosten- und Arbeitsaufwand und mit unbefriedigendem Resultat von Ölverbrauch auf Kohlenverbrauch umkonstruiert. Den Versuch, den Flugzeugträger Melbourne ebenfalls umzubauen, hatte man aufgegeben, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er zu langsam sein würde; Flugzeuge würden nur bei sehr starkem Wind sicher darauf landen können. Außerdem musste man mit dem Vorrat an Flugkraftstoff so sparsam umgehen, dass man alle Ausbildungskurse so gut wie völlig aufgegeben hatte und es daher zwecklos schien, die See-Luftwaffe weiter aufrechtzuerhalten. Holmes hatte nichts von Umbesetzungen in den Offiziersreihen der sieben noch in Betrieb befindlichen Minenräumboote und Fregatten gehört. Vielleicht war jemand krank und musste ersetzt werden; oder vielleicht hatte man beschlossen, diensttuende Offiziere der Reihe nach durch unbeschäftigte zu ersetzen, um deren praktische Kenntnisse aufzufrischen. Es war aber wahrscheinlicher, dass man ihm irgendeinen langweiligen Landauftrag geben würde, eine Bürostelle in Kasernen oder im Marine-Depot eines trübseligen, verlassenen Ortes. Wenn man ihn nicht zu See schickte, würde er tief enttäuscht sein. Dabei wäre ein Posten am Land eigentlich vorzuziehen gewesen, weil er sich dann weiter wie bisher um Mary und das Kind kümmern könnte, wo nun sowieso alles nicht mehr lange dauern würde...
Nach etwa einstündiger Fahrt erreichte er die Stadt und stieg am Bahnhofsplatz in eine Straßenbahn. Unbehindert durch andere Fahrzeuge ratterte die durch die Straßen und brachte ihn schnell in den Stadtteil, wo die Autogeschäfte waren. Viele der Läden waren geschlossen, einige waren von den noch geöffneten übernommen worden, und die Schaufenster waren überfüllt mit nutzlosen Dingen. Holmes ging von Geschäft zu Geschäft, suchte nach zwei leichten, guterhaltenen und zueinander passenden Rädern und kaufte schließlich zwei gleich große Räder verschiedenen Fabrikats. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten mit der Welle konnte der einzige Mechaniker, der noch in der Garage arbeitete, beheben.
Mit den beiden mit einem Seil zusammengebundenen Rädern in der Hand fuhr Holmes in der Straßenbahn zum Marine-Ministerium. Er meldete sich beim Sekretär des Zweiten Seelords, einem ihm bekannten Zahlmeisteroberleutnant. Der junge Mann sagte: »Guten Morgen, Sir. Der Admiral hat Ihre Bestallungsurkunde auf dem Schreibtisch liegen. Er will Sie sprechen. Ich werde ihm melden, dass Sie hier sind.«
Der Lieutenant Commander zog die Augenbrauen hoch. Das war ungewöhnlich, in der reduzierten Flotte mochte aber alles etwas ungewöhnlich sein. Er legte die Räder neben den Schreibtisch des Zahlmeisters, sah sich besorgt seine Uniform an, nahm einen Faden vom Aufschlag seiner Jacke und schob die Kappe unter den Arm.
»Der Admiral erwartet Sie, Sir.«
Er betrat das Büro und nahm Haltung an. Der am Schreibtisch sitzende Admiral neigte den Kopf. »Guten Morgen, Lieutenant Commander. Setzen Sie sich.«
Peter setzte sich auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch. Der Admiral streckte ihm sein Zigarettenetui entgegen und zündete ihm dann die Zigarette mit dem Feuerzeug an. »Sie sind schon seit einiger Zeit unbeschäftigt?«
»Ja, Sir.«
Der Admiral zündete sich selbst eine Zigarette an. »Nun, wir haben einen seefahrenden Posten für Sie. Ich kann Ihnen leider kein Kommando geben und kann Sie nicht einmal auf einem unserer eigenen Schiffe unterbringen. Ich ernenne Sie zum Verbindungsoffizier auf der USS Scorpion.«
Er sah den jungen Mann an. »Man hat mir gesagt, dass Sie Captain Towers kennen?«
»Ja, Sir.« Er hatte den Captain der Scorpion während der letzten Monate zwei- oder dreimal getroffen. Er war ein ruhiger Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, der leise und mit leichtem amerikanischem Akzent sprach. Holmes hatte auch den Bericht des Amerikaners über den Kriegseinsatz seines Schiffes gelesen. Als der Krieg ausbrach, befand er sich mit seinem Atom-U-Boot auf einer Aufklärungsfahrt zwischen Kiska und Midway; sobald er das entsprechende Signal erhalten hatte, öffnete er seine versiegelte Order, tauchte und steuerte mit voller Geschwindigkeit auf Manila zu. Irgendwo nördlich von Iwojima nahm er am vierten Tag in Sehrohrtiefe eine Inspektion des Meeres vor, was er regelmäßig einmal während jeder Tageswache tat, und entdeckte, dass die Sicht durch irgendeine Art von Staub außerordentlich reduziert war; gleichzeitig zeigte der Geigerzähler am Sehrohr sehr hohe Radioaktivität an. Der Captain versuchte, das nach Pearl Harbour zu melden, erhielt aber keine Antwort. Er fuhr weiter; als er sich den Philippinen näherte, nahm die Radioaktivität zu. In der folgenden Nacht gelang es ihm, Verbindung mit Dutch Harbour herzustellen; er sandte dem Admiral einen verschlüsselten Funkspruch zu, erfuhr, dass die Radioverbindung nur noch uregelmäßig funktioniere, und erhielt keine Antwort. In der folgenden Nacht konnte er keine Verbindung mit Dutch Harbour mehr bekommen. Seinem Auftrag gemäß steuerte er das Schiff nördlich von Luzon in den Balintang Channel, wo sehr viel Staub war und die Radioaktivität weit über der Toleranzdosis lag; der Wind blies von Westen in Stärke vier bis fünf. Am siebten Kriegstag war er in der Bucht von Manila, sah die Stadt durch das Sehrohr und hatte noch immer keine Befehle empfangen. Die Radioaktivität der Luft war hier etwas geringer, aber noch immer gefährlich hoch, und er wagte daher nicht, aufzutauchen. Die Sicht war mäßig. Durch das Sehrohr sah er über der Stadt eine Rauchwolke und kam zu der Überzeugung, dass hier während der letzten Tage mindestens eine Atomexplosion stattgefunden hatte. Er war fünf Meilen von der Küste entfernt und sah am Festland keine Lebenszeichen. Als er sich dem Land näherte, fuhr sein Schiff unerwarteterweise in Sehrohrtiefe auf Grund; das geschah im Hauptkanal, der nach der Seekarte zwölf Faden tief war. Dieser Vorfall bestätigte seine früher gewonnene Ansicht. Er ließ die Tanks ausblasen, bekam das Schiff ohne Schwierigkeit wieder frei, drehte und fuhr ins offene Meer hinaus.
In der folgenden Nacht gelang es ihm wieder nicht, mit irgendeiner amerikanischen Funkstelle oder einem Schiff, das seine Nachrichten hätte weitergeben können, Verbindung herzustellen. Beim Ausblasen der Tanks hatte er einen großen Teil der Druckluft verbraucht, wagte es aber nicht, die vergiftete Luft dieser Gegend ins Schiff zu lassen. Er war bereits seit acht Tagen unter Wasser; seine Besatzung war noch in recht guter Verfassung; einige der Leute zeigten aber doch schon Symptome nervlicher Überlastung, da sie sich um ihre Familien Sorgen machten. Der Captain stellte Radioverbindung mit einer australischen Funkstelle in Port Moresby in Neuguinea her. Dort schien alles normal zu sein, man konnte seine Nachrichten aber nicht weitersenden.
Nach Süden zu fahren schien ihm die beste Lösung zu sein. Er fuhr nördlich von Luzon zurück und nahm dann Kurs auf Yap Island, eine Kabelstation, die den Vereinigten Staaten unterstand. Drei Tage später kam er dort an. Die Radioaktivität überschritt hier kaum die Normalgrenze; im ruhigen Meer tauchte er auf, ließ frische Luft in das Schiff, füllte die Tanks auf und erlaubte der Mannschaft, sich nacheinander in Gruppen auf die Kommandobrücke zu begeben. Er war erleichtert, als er beim Einlaufen in den Hafen einen amerikanischen Kreuzer sah. Der wies ihm einen Ankerplatz an und schickte ein Boot herüber. Der Captain ließ das Schiff festmachen, erlaubte der ganzen Besatzung an Deck zu gehen und fuhr selbst in dem Boot zu dem Kreuzer, um sich unter das Kommando von Captain Shaw zu stellen. Dort erfuhr er zum ersten Mal von dem russisch-chinesischen Krieg, der aus dem Krieg zwischen Russland und den NATO-Mächten erwachsen war; der ursprüngliche, israelisch-arabische Krieg war von Albanien begonnen worden. Er hörte, dass sowohl die Russen als auch die Chinesen Kobaltbomben abgeworfen hatten. Diese Nachricht kam auf Umwegen aus Australien und war von Kenia weitergeleitet worden. Der Kreuzer wartete in Yap verabredungsgemäß auf einen Öltanker der Kriegsflotte; er lag schon eine Woche hier und hatte seit fünf Tagen keine Verbindung mit den Vereinigten Staaten mehr. Der Captain besaß genug Treibstoff, um den Kreuzer in langsamer Fahrt gerade bis Brisbane zu bringen. Captain Towers blieb sechs Tage in Yap; während dieser Zeit wurden die wenigen Nachrichten immer schlimmer. Es gelang nicht, mit irgendeiner Funkstelle in den Vereinigten Staaten oder in Europa in Verbindung zu kommen; während der ersten beiden Tage fing man aber Nachrichtensendungen aus Mexiko auf, und die hätten kaum schlechter sein können. Dann hörten die Sendungen dieser Funkstelle auf, man hörte nur noch Panama, Bogota und Valparaiso; und dort wusste man so gut wie nichts über die Vorfälle auf dem nördlichen Teil des Kontinents. Auf den beiden Schiffen stellte man endlich Verbindung mit einigen amerikanischen Schiffen im südlichen Pazifischen Ozean her, die fast alle ebenso wenig Treibstoff hatten wie der Kreuzer. Es stellte sich heraus, dass der Kommandant des Kreuzers in Yap der dienstälteste von all diesen Offizieren war, und er traf daher die Entscheidung, dass alle amerikanischen Schiffe in australische Gewässer fahren und sich unter australisches Kommando begeben sollten. Er wies die kommandierenden Offiziere an, sich nach Brisbane zu begeben, wo er mit ihnen Zusammentreffen wollte. Zwei Wochen später trafen die elf Schiffe der amerikanischen Kriegsflotte dort ein; alle waren ohne Treibstoff, und es bestand wenig Hoffnung, dass sie welchen bekommen würden. Das war nun ein Jahr her, und sie lagen noch immer dort.
Den Atomtreibstoff, den die USS Scorpion brauchte, gab es in Australien nicht, als das U-Boot dort ankam; er konnte aber hergestellt werden. Es stellte sich heraus, dass das U-Boot das einzige Kriegsschiff in australischen Gewässern war, das einen größeren Aktionsradius besaß, und man ließ es daher in den dem Marine-Ministerium am nächsten liegenden Kriegshafen Williamstown in Melbourne kommen. Tatsächlich war die Scorpion das einzige Kriegsschiff in Australien, mit dem man noch etwas unternehmen konnte. Eine Zeitlang blieb es unbeschäftigt, da man erst Atomtreibstoff herstellen musste; vor etwa sechs Monaten war es wieder beweglich und einsatzfähig geworden. Es wurde nach Rio de Janeiro geschickt und nahm Treibstoff für ein zweites amerikanisches Atom-U-Boot mit, das sich dorthin gerettet hatte. Nach seiner Rückkehr wurde das Schiff in den Werften von Melbourne gründlich überholt.
All diese Dinge hatte Peter Holmes über den amerikanischen Captain Towers gehört; und sie fielen ihm nacheinander ein, während er vor dem Schreibtisch des Admirals saß. Der ihm angebotene Posten war neu, auf der Fahrt nach Südamerika hatte es an Bord der Scorpion keinen australischen Verbindungsoffizier gegeben. Der Gedanke an Mary und seine kleine Tochter machte ihm Sorge und veranlasste ihn zu fragen: »Für wie lange gilt diese Ernennung, Sir?«
Der Admiral zuckte leicht mit den Achseln. »Sagen wir für etwa ein Jahr. Ich nehme an, es wird Ihr letzter Auftrag sein, Holmes.«
Der junge Mann antwortete: »Ich weiß, Sir. Ich bin Ihnen für diese Chance sehr dankbar.« Er zögerte, fragte dann: »Wird das Schiff einen großen Teil dieser Zeit auf hoher See sein, Sir? Ich bin verheiratet, und wir haben ein kleines Kind. In letzter Zeit ist zu Hause alles ein wenig schwierig geworden, und jedenfalls dauert es ja nicht mehr sehr lange.«
Der Admiral nickte. »Wir befinden uns alle in der gleichen Situation. Deshalb wollte ich Sie sprechen, bevor Sie die Bestallung erhalten. Ich werde Ihnen keinen Vorwurf daraus machen, wenn Sie ablehnen; in diesem Fall kann ich Ihnen aber kaum Hoffnung auf einen anderen Posten machen. Was die Zeit auf hoher See anlangt - wenn das Schiff am Vierten fertig überholt ist...« Er warf einen Blick auf den Kalender. »...also in etwas mehr als einer Woche, soll es nach Cairns, Port Moresby und Port Darwin fahren, um über die Situation dort zu berichten; dann kommt es nach Williamstown zurück. Captain Towers nimmt an, diese Fahrt wird elf Tage dauern. Danach wollen wir es auf eine längere Fahrt schicken, die etwa zwei Monate dauern wird.«
»Wird es zwischen diesen beiden Fahrten längere Zeit im Hafen liegen, Sir?«
»Ich nehme an, für etwa zwei Wochen.«
»Und was sind die weiteren Pläne?«
»Im Augenblick gibt es keine.«
Der junge Offizier dachte nach - über Einkäufen, Krankheiten des Kindes, Milchlieferungen. Es war Sommer, daher musste kein Feuerholz gespalten werden. Wenn die zweite Fahrt Mitte Februar begann, würde er Mitte April zurück sein, also vor der kalten Jahreszeit, wenn man wieder heizen musste. Vielleicht würde der Farmer Mary mit dem Holz helfen, wenn er länger wegbleiben sollte; er hatte ja nun die Räder für den Mann. Wenn es nicht zu neuen Schwierigkeiten kam, konnte er wohl den Posten annehmen. Wenn es aber keine Elektrizität mehr geben sollte oder wenn sich die Radioaktivität schneller nach Süden ausbreitete, als die Wissenschaftler berechnet hatten - besser nicht daran denken.
Mary würde zornig sein, wenn er den Posten ablehnte und seine Karriere opferte. Sie war die Tochter eines Marineoffiziers, war in Southsea in Südengland geboren und aufgewachsen. Er hatte sie bei einer Tanzerei auf der Indefatigable kennengelernt, als er in England in der Königlichen Kriegsmarine diente. Sie würde wollen, dass er den Posten annahm...
Er sah auf. »Für die beiden Fahrten kann ich mich wohl verpflichten, Sir«, sagte er. »Wäre es möglich, erst dann weitere Entscheidungen zu treffen? Sie werden verstehen, dass es nicht leicht ist, weitere Pläne zu machen - ich meine wegen zu Hause - so wie die Dinge jetzt liegen.«
Der Admiral überlegte. Unter den gegebenen Umständen war das ein vernünftiges Ansinnen, vor allem von einem jungverheirateten Mann mit einem kleinen Kind; für ihn selbst war es allerdings eine neue Erfahrung, da jetzt nur sehr wenige Posten zu vergeben waren. Man konnte aber kaum von dem Offizier verlangen, dass er für die letzten paar Monate einen Posten außerhalb der australischen Gewässer annehmen solle. Er nickte. »Einverstanden, Holmes«, sagte er. »Ich gebe Ihnen die Bestallung für fünf Monate, bis zum 31. Mai. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie von der zweiten Fahrt zurückkommen.«
»Jawohl, Sir.«
»Melden Sie sich Dienstag, am Neujahrstag, auf der Scorpion. Wenn Sie jetzt draußen eine Viertelstunde warten, können Sie gleich den Brief an den Captain mitnehmen. Das Schiff ist in Williamstown, es liegt neben der Sydney, seinem Mutterschiff.«
»Ich weiß, Sir.«
Der Admiral stand auf. »Gut, Lieutenant Commander.« Er streckte die Hand aus. »Alles Gute für den Posten.«
Peter Holmes schüttelte ihm die Hand. »Vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben, Sir.« An der Tür blieb er noch einmal stehen. »Wissen Sie zufällig, ob Captain Towers heute an Bord ist?«, fragte er. »Da ich hier bin, könnte ich schnell hingehen, mich bei ihm einführen und vielleicht auch das Schiff sehen. Ich möchte das gern tun, bevor ich mich offiziell bei dem Captain melde.«
»Soviel ich weiß, ist er an Bord«, antwortete der Admiral. »Sie können mit der Sydney telefonieren - sprechen Sie mit meinem Sekretär.« Er sah auf die Uhr. »Um halb zwölf fährt ein Wagen vom Haupttor ab. Mit dem können Sie fahren.«
Zwanzig Minuten später saß Peter Holmes neben dem Chauffeur in dem Elektromobil, das nun auf den leeren Straßen zwischen dem Ministerium und Williamstown Omnibusdienste leistete. Der ehemalige Lieferwagen eines großen Melbourner Kaufhauses war nach Kriegsende beschlagnahmt und marinegrau umgestrichen worden. In gleichbleibendem Zwanzig-Meilen-Tempo fuhr der Wagen geräuschlos und durch keinen Verkehr behindert durch die Straßen. Um zwölf Uhr traf Peter Holmes an der Werft ein und ging auf den Anlegeplatz des nun unbeweglich gewordenen Flugzeugträgers HMAS Sydney zu. Er ging an Bord und in die Offiziersmesse hinunter.
Nur etwa ein Dutzend Offiziere befanden sich in der großen Messe, von denen sechs die khakifarbene Gabardinearbeitsuniform der amerikanischen Kriegsmarine trugen. Einer von ihnen war der Captain der Scorpion. Lächelnd ging er Peter entgegen. »Ich freue mich, dass Sie hergekommen sind, Lieutenant Commander.«
Peter Holmes antwortete: »Ich hoffte, Sie würden nichts dagegen haben, Sir. Ich soll mich erst am Dienstag bei Ihnen melden. Da ich aber im Ministerium war, hoffte ich, Sie würden nichts dagegen haben, wenn ich zum Mittagessen herüberkomme und mir vielleicht auch das Schiff ansehe.«
»Aber natürlich nicht«, sagte der Captain. »Ich habe mich gefreut, als mir Admiral Grimwade sagte, er werde Ihnen den Posten geben. Ich möchte Sie mit einigen meiner Offiziere bekannt machen.« Er wandte sich zu den anderen um. »Das ist mein Erster Offizier, Mr. Farrell. Mein Maschinenoffizier, Mr. Lundgren.« Er lächelte. »Wir brauchen für unsere Motoren hochqualifizierte Maschinenoffiziere. Das ist Mr. Benson, Mr. O’Doherty und Mr. Hirsch.« Ein wenig steif verneigten sich die jungen Männer. Der Captain fragte Peter: »Wie wäre es mit einem Cocktail vor dem Essen, Lieutenant Commander?«
Der Australier antwortete: »Ja, gern - vielen Dank. Kann ich Pink Gin haben, bitte?« Der Captain drückte auf eine Glocke an der Schotte. »Wie viele Offiziere sind auf der Scorpion, Sir?«
»Alles in allem elf. Es ist ein recht großes U-Boot, wir haben allein vier Maschinenoffiziere.«
»Die Offiziersmesse muss sehr groß sein.«
»Wenn wir alle gleichzeitig darin sitzen, ist es ein wenig eng, das kommt aber in einem U-Boot nicht oft vor. Jedenfalls haben wir eine Koje für Sie, Lieutenant Commander.«
Peter lächelte: »Für mich allein, oder alle zusammen wie in einer Sardinenbüchse?«
Der Captain war über diese Vorstellung leicht entsetzt. »Natürlich nicht. Jeder Offizier und jeder Matrose hat auf der Scorpion seine eigene Koje.«
Die Messeordonnanz erschien auf das Klingelzeichen des Captains, und der sagte: »Bitte, bringen Sie einen Pink-Gin und sechs Gläser Orangensaft.«
Peter war sehr verlegen, er hätte sich für seine Gedankenlosigkeit ohrfeigen können. Er hielt die Ordonnanz auf. »Trinken Sie im Hafen nicht, Sir?«
Der Captain lächelte. »Nein. Onkel Sam sieht es nicht gern. Aber lassen Sie sich nicht stören. Wir sind hier auf einem britischen Schiff.«
»Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich mich lieber Ihnen anschließen«, erwiderte Peter.
»Also sieben«, sagte der Captain leichthin. Die Ordonnanz verschwand. »Bei jeder Marine herrschen andere Sitten«, bemerkte er. »Im Endresultat scheint es mir kaum einen Unterschied zu machen.«
Sie aßen auf der Sydney; zwölf Offiziere saßen am oberen Ende von einem der großen, leeren Tische. Nach der Mahlzeit gingen sie auf die längsseits liegende Scorpion. Es war das größte U-Boot, das Peter Holmes je gesehen hatte; seine Wasserverdrängung betrug sechstausend Tonnen, die von Atomkraft betriebenen Turbinen produzierten mehr als zehntausend Pferdekräfte. Außer den elf Offizieren umfasste die Besatzung etwa siebzig Unteroffiziere und Matrosen. Sie alle lebten und schliefen in jenem Gewirr von Röhren und Drähten, das allen U-Booten eigen ist. Für die tropischen Zonen war das Schiff außerdem mit einer Klimaanlage und einem großen Kühlschrank ausgestattet. Peter Holmes war kein U-Boot-Offizier und konnte daher das Schiff nicht vom technischen Standpunkt aus beurteilen; der Captain sagte ihm aber, es steuere sich leicht und lasse sich trotz der großen Länge gut manövrieren.
Der größte Teil der Bewaffnung und der Munitionsvorräte war bei der Überholung herausgenommen worden; nur zwei Torpedorohre waren noch geblieben; und die Messen und sonstigen Gemeinschaftsräume waren daher geräumiger, als sie es sonst auf U-Booten zu sein pflegten. Die Herausnahme der Achterrohre und des Torpedostauraums erleichterte die Arbeit im Maschinenraum. Peter verbrachte mit dem Maschinenoffizier Lieutenant Commander Lundgren eine Stunde in diesem Teil des Schiffes. Er hatte nie auf einem Schiff mit Atomantrieb gedient, und da außerdem ein großer Teil dieser Anlagen noch geheim gehalten wurde, war das meiste völlig neu für ihn. Man zeigte ihm die Anordnung des Kühlkreises mit flüssigem Natrium, der die Wärme aus dem Reaktor übertrug, die verschiedenen Wärmeaustauscher und die geschlossenen Heliumkreisläufe für die hochtourigen Zwillingsturbinen, die das Schiff mittels gewaltiger Übertragungsgetriebe antrieben; diese letzteren waren viel größer und empfindlicher als die anderen Bestandteile der Kraftanlage.
Nach der Besichtigung ging Holmes in die winzige Kabine des Captains. Der Amerikaner läutete dem Negersteward und bestellte Kaffee, dann ließ er einen Klappsitz für Peter herab. »Haben Sie sich die Maschinen gut angesehen?«, fragte er.
Der Australier nickte. »Ich bin kein Ingenieur«, sagte er. »Vieles davon ist mir völlig unverständlich; es hat mich aber sehr interessiert. Haben Sie oft Schwierigkeiten damit?«
Der Captain schüttelte den Kopf. »Bis jetzt nicht. Sollten die Maschinen auf See versagen, könnte man nicht viel machen. Man kann nur ans Holz klopfen und hoffen, dass sie sich immer weiter drehen werden.«
Schweigend tranken sie Kaffee. Dann sagte Peter: »Ich habe Befehl, mich Dienstag bei Ihnen zu melden. Wann soll ich auf dem Schiff sein, Sir?«
»Wir machen Dienstag Versuchsfahrten«, antwortete der Captain. »Es kann Mittwoch werden, obwohl ich es nicht glaube. Am Montag laden wir Vorräte und die Besatzung kommt an Bord.«
»Dann werde ich mich lieber schon Montag melden«, sagte der Australier. »Soll ich im Lauf des Vormittags kommen?«
»Das wäre gut«, antwortete der Captain. »Ich nehme an, dass wir Dienstag um die Mittagszeit auslaufen können. Ich habe dem Admiral gesagt, dass ich eine kurze Probefahrt in den Bass Strait machen möchte und etwa am Freitag zurückkommen und Fahrbereitschaft melden werde. Es wäre mir recht, wenn Sie irgendwann am Montagvormittag an Bord sein könnten.«
»Kann ich in der Zwischenzeit etwas für Sie tun? Wenn ich behilflich sein kann, komme ich schon Samstag an Bord.«
»Ich weiß das zu schätzen, Lieutenant Commander, aber es gibt nichts zu tun. Die Hälfte der Besatzung ist jetzt auf Urlaub, und ich werde dem Rest der Leute morgen Mittag Wochenendurlaub geben. Mit Ausnahme von einem Offizier und sechs wachhabenden Matrosen wird niemand hier sein. Montagvormittag ist früh genug.«
Er sah Peter an. »Hat Ihnen irgendjemand gesagt, was man mit uns vorhat?«
Der Australier war überrascht. »Hat man es Ihnen nicht gesagt, Sir?«
Der Amerikaner lachte. »Nicht ein Wort. Mir scheint, der Captain wird als letzter den Marschbefehl hören.«
»Der Zweite Seelord ließ mich zu sich kommen«, berichtete Peter, »und sagte mir, dass Sie nach Cairns, Port Moresby und Darwin fahren sollen und dass das elf Tage dauern wird.«
»Captain Nixon von der australischen Operationsabteilung hat mich gefragt, wie lange eine solche Fahrt dauern würde«, bemerkte der Captain. »Bis jetzt habe ich aber keinen Befehl erhalten.«
»Der Admiral sagte heute Morgen, dass danach eine viel längere Fahrt folgen soll, die ungefähr zwei Monate dauern wird.«
Bewegungslos hielt Captain Towers seine Kaffeetasse vor sich hin. »Das ist mir neu«, sagte er. »Hat er gesagt, wohin wir fahren?«
Peter schüttelte den Kopf. »Er sagte nur, die Fahrt werde etwa zwei Monate dauern.«
Nach kurzem Schweigen riss sich der Amerikaner zusammen und lächelte. »Ich glaube, falls Sie um Mitternacht hier hereinsehen sollten, würden Sie mich damit beschäftigt finden, Kreise auf der Seekarte einzuzeichnen«, sagte er ruhig. »Und morgen und übermorgen Nacht ebenfalls.«
Es schien dem Australier richtig, das Gespräch in leichtere Bahnen zu lenken. »Gehen Sie nicht fürs Wochenende weg?«, fragte er.
Der Captain schüttelte den Kopf. »Ich bleibe in der Nähe. Vielleicht fahre ich in die Stadt und sehe mir einen Film an.«
Das schien Peter ein trauriges Wochenendprogramm für einen, der weit von seiner Heimat in einem fremden Land war. Impulsiv fragte er: »Würden Sie für zwei Tage nach Falmouth kommen wollen, Sir? Wir haben ein Gästezimmer. Bei diesem Wetter verbringen wir den größten Teil des Tages im Segelclub - schwimmen und segeln. Meine Frau würde sich über Ihr Kommen freuen.«
»Das ist schrecklich nett von Ihnen«, antwortete der Captain nachdenklich. Er trank einen Schluck Kaffee, während er sich den Vorschlag überlegte. Menschen der nördlichen Hemisphäre fanden seit dem Krieg den gesellschaftlichen Umgang mit denen der südlichen Hemisphäre nicht einfach. Zu vieles und zu verschiedene Erfahrungen trennten sie. Das unerträgliche Mitgefühl war die größte Barriere. Towers wusste all das und wusste darüber hinaus, dass der australische Offizier das trotz der Einladung ebenfalls wusste. Aus beruflichen Gründen hätte er aber den Verbindungsoffizier gern besser kennengelernt. Wenn der Kontakt mit dem australischen Marinekommando über ihn aufrechtgehalten werden musste, so hätte der Amerikaner gern gewusst, wie dieser Mann beschaffen war; das sprach für den Besuch. Nach der widerlichen und quälenden Beschäftigungslosigkeit der letzten Monate wäre ihm außerdem eine Abwechslung willkommen gewesen, und trotz der Peinlichkeit war die Einladung einem einsamen, von Gedanken und Erinnerungen gequälten Wochenende auf dem von Leere widerhallenden Flugzeugträger vorzuziehen.
Der Lieutenant Commander stellte die Tasse nieder und lächelte leicht. Das Wochenende mochte peinlich werden, es wäre aber noch peinlicher, wenn er die freundlich gemeinte Einladung seines neuen Offiziers mürrisch ablehnte. »Sind Sie sicher, dass es Ihrer Frau nicht zu viel sein wird?«, fragte er. »Hat sie nicht genug Arbeit mit dem Kind?«
Peter schüttelte den Kopf. »Sie wird sich freuen«, antwortete er. »Es ist eine Abwechslung für sie. Unter den jetzigen Umständen trifft sie so selten Menschen. Natürlich hindert sie auch das Kind daran.«
»Ich möchte sehr gern für eine Nacht kommen«, sagte der Amerikaner. »Morgen muss ich noch hierbleiben, am Samstag würde ich aber gern schwimmen. Das habe ich schon lange nicht getan. Wie wäre es, wenn ich Samstag mit dem Zug nach Falmouth käme? Sonntag muss ich aber zurückfahren.«
»Ich hole Sie am Bahnhof ab.« Sie unterhielten sich kurz über die Zugverbindungen. Dann fragte Peter: »Können Sie radeln?« Der Amerikaner nickte. »Dann bringe ich ein zweites Rad mit. Wir wohnen ungefähr zwei Meilen vom Bahnhof.«
Captain Towers sagte: »Großartig.« Der rote Oldsmobile war ihm schon so unwirklich wie ein Traum. Es war erst fünfzehn Monate her, dass er darin zum Flughafen gefahren war, und jetzt konnte er sich kaum mehr erinnern, wie das Instrumentenbrett aussah und auf welcher Seite sich der Hebel zum Verschieben des Sitzes befand. Der Wagen stand wohl noch immer in der Garage seines Hauses in Connecticut - vielleicht waren er und all die anderen Dinge, an die nicht zu denken er gelernt hatte, ganz unberührt. Man musste in der neuen Welt leben und sich bemühen, die alte zu vergessen - nun gab es also Fahrräder an einem Bahnhof in Australien.
Peter fuhr in dem Lieferwagen ins Marine-Ministerium zurück, nahm dort das Bestallungsdokument und die beiden Räder in Empfang und fuhr mit der Straßenbahn zum Bahnhof. Er kam gegen sechs Uhr in Falmouth an, hing die schweren Räder über die Griffe der Radlenkstange und radelte mühselig den Berg hinauf. Eine halbe Stunde später kam er schwitzend nach Hause, wo er Mary in einem dünnen Sommerkleid neben dem erfrischend plätschernden Rasensprenger vorfand.
Sie ging ihm entgegen. »Wie heiß du bist, Peter!«, sagte sie. »Ach, du hast die Räder bekommen.«
Er nickte. »Es tut mir leid, dass ich nicht zum Strand kommen konnte.«
»Ich dachte mir schon, dass du aufgehalten worden bist. Wir sind um halb sechs Uhr zurückgekommen. Erzähl' mir von deinem neuen Posten.«
»Das ist eine lange Geschichte«, antwortete er und stellte dann das Fahrrad und die beiden Räder auf die Veranda. »Ich möchte gern erst duschen und es dir dann erzählen.«
»Gut oder schlecht?«, fragte sie.
»Gut«, erwiderte er. »Auf See bis April. Dann nichts mehr.«
»Ach, Peter«, rief sie aus, »das ist ja genau das richtige! Dusch dich, und wenn du abgekühlt bist, erzähle mir alles genau. Ich stelle die Liegestühle heraus; eine Flasche Bier ist auch im Eisschrank.«
Eine Viertelstunde später saß er erfrischt, mit offenem Hemdkragen und in leichten Drillichhosen, im Schatten, trank kaltes Bier und berichtete ihr genau. Zum Schluss fragte er: »Bist du Captain Towers je begegnet?«
Sie schüttelte den Kopf. »Jane Freeman hat sie alle bei einer Gesellschaft auf der Sydney kennengelernt. Sie sagte, er sei recht nett. Wie wird er als Vorgesetzter sein?«
»Ganz ordentlich, glaube ich«, antwortete er. »Er ist ein fähiger Offizier. Ich werde mich zuerst auf einem amerikanischen Schiff etwas merkwürdig fühlen. Aber ich muss sagen, sie haben mir alle gefallen.« Er lachte. »Ich habe mich gleich schön blamiert - ich habe einen Pink-Gin bestellt.« Er erzählte ihr den Vorfall.
Sie nickte. »Das hat mir Jane auch gesagt - sie trinken an Land, aber nicht auf dem Schiff. Ich glaube, sie trinken überhaupt nicht, wenn sie in Uniform sind. Auf der Gesellschaft tranken sie ziemlich trübselig eine Art Fruchtcocktail, während alle anderen riesige Mengen Alkohol in sich hineingossen.«
»Ich habe ihn zum Wochenende eingeladen«, sagte Peter. »Er kommt Samstagvormittag.«
Entsetzt starrte sie ihn an. »Doch nicht Captain Towers?«
Er nickte. »Ich hatte das Gefühl, ich müsse ihn einladen. Es wird ihm guttun.«
»Ach - das stimmt nicht, Peter. Es tut ihnen nicht gut. In Privathäuser zu kommen, ist viel zu schmerzlich für sie.«
Er versuchte, sie zu beruhigen. »Er ist anders. Zunächst einmal ist er ziemlich viel älter als die anderen. Er wird sich bestimmt wohl fühlen.«
»Das hast du auch bei dem englischen Fliegermajor geglaubt«, gab sie zurück. »Du weiß, wen ich meine - ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der, der geweint hat.«
Er ließ sich nicht gern an jenen Abend erinnern. »Ich weiß, es ist schwer für sie, in ein Privathaus zu kommen und noch dazu das Kind zu sehen. Der Mann ist aber bestimmt anders.«
Sie fügte sich in das Unvermeidliche. »Wie lange wird er bleiben?«
»Nur eine Nacht. Er sagte, er müsse am Sonntag wieder an Bord sein.«
»Wenn es nur für eine Nacht ist, wird es vielleicht nicht so schlimm werden...« Mit gerunzelter Stirn dachte sie nach. »Wir müssen ihn die ganze Zeit beschäftigen, dürfen ihm keine ruhige Minute lassen. Das haben wir bei dem Fliegeroffizier falsch gemacht. Was tut er gern?«
»Schwimmen«, antwortete Peter. »Er will schwimmen.«
»Segelt er? Am Samstag ist eine Regatta.«
»Ich habe ihn nicht gefragt. Ich nehme an, er segelt. Er sieht so aus, als täte er es.«
Sie trank einen Schluck Bier. »Vielleicht könnten wir mit ihm ins
Kino gehen?«, sagte sie nachdenklich.
»Was für ein Film läuft dort?«
»Ich weiß nicht. Das ist ja auch ganz gleichgültig, wenn wir ihn nur mit etwas beschäftigen.«
»Ein Film über Amerika wäre nicht gerade sehr gut«, erwiderte er. »Womöglich ist es ausgerechnet ein Film, der in seiner Heimatstadt gedreht wurde?«
Entsetzt starrte sie ihn an. »Das wäre furchtbar! Aus welcher Stadt kommt er, Peter? Aus welcher Gegend?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt.«
»Lieber Gott. Wir müssen irgendetwas mit ihm am Abend anfangen, Peter. Ein englischer Film wäre wahrscheinlich das gefahrloseste; aber vielleicht läuft keiner.«
»Wir könnten ein paar Leute einladen«, schlug er vor.
»Wenn kein englischer Film läuft, müssen wir das tun. Vielleicht ist es überhaupt das Beste.« Nach einigem Nachdenken fragte sie: »Weißt du, ob er verheiratet war?«
»Ich weiß nicht, nehme es aber an.«
»Ich glaube, Moira Davidson würde kommen und uns helfen«, sagte sie; »vorausgesetzt, dass sie nichts anderes vorhat.«
»Vorausgesetzt, dass sie nicht betrunken ist«, warf er ein.
»Sie ist es nicht ununterbrochen«, erwiderte seine Frau. »Sie würde jedenfalls das Ganze in Schwung halten.«
Er überlegte sich den Vorschlag. »Das ist kein schlechter Einfall«, sagte er. »Man müsste ihr von vornherein sagen, was sie tun soll. Sie muss dafür sorgen, dass er sich keinen Augenblick langweilt - im Bett oder außerhalb.«
»Du täuschst dich. Sie tut nur so.«
Er grinste. »Wie du meinst.«
Sie riefen Moira Davidson noch am Abend an und besprachen die Sache mit ihr. »Peter fühlte sich verpflichtet, ihn einzuladen«, sagte Mary. »Er ist schließlich jetzt sein Captain. Du weißt aber doch, wie die sind und was in ihnen vorgeht, wenn sie in ein Privathaus kommen, dort Kinder, Windeln und eine Babyflasche in einem Topf mit heißem Wasser sehen. Wir wollen deshalb das Haus ein bisschen aufräumen, all das verbergen und versuchen, ihn aufzuheitern - sozusagen ununterbrochen, weißt du. Die Schwierigkeit ist nur, dass ich wegen Jennifer nicht viel dazu beitragen kann. Könntest du kommen und uns helfen? Leider kann ich dir nur ein Feldbett im Wohnzimmer oder, wenn dir das lieber ist, auf der Veranda anbieten. Es wäre nur für Samstag und Sonntag. Wir dachten uns, man müsste ihn ständig beschäftigen. Er darf sich nicht einen Augenblick langweilen. Für Samstagabend werden wir wohl noch einige Leute einladen.«
»Das klingt ziemlich schrecklich«, antwortete Miss Davidson. »Ist er sentimental und wie eine Klette? Wird er sich an meinem Busen ausweinen und mir versichern, dass ich seiner seligen Frau ähnlich sehe? Einige von ihnen tun so was.«
»Möglich wäre es«, erwiderte Mary zögernd. »Ich kenne ihn nicht. Wart einen Augenblick, ich frage Peter.« Sie kam zum Telefon zurück. »Moira? Peter sagt, es ist viel wahrscheinlicher, dass er mit dir boxen wird, wenn er erst genug getrunken hat.«
»Das klingt schon besser«, sagte Miss Davidson. »Gut, ich komme Samstagvormittag. Übrigens trinke ich keinen Gin mehr.«
»Du trinkst keinen Gin mehr?«
»Der verbrennt einem nur das Gedärm - durchlöchert den Magen und führt zu Geschwüren. Ich habe das jeden Morgen beim Aufstehen erlebt, darum habe ich den Gin aufgegeben. Ich trinke nur noch Cognac. Rechne mit sechs Flaschen für mich - für das Wochenende. Von Cognac kann man große Mengen trinken.«
Am Samstagvormittag fuhr Peter Holmes auf dem Rad zum Bahnhof von Falmouth. Dort traf er Moira Davidson, ein zartes Mädchen mit glattem blondem Haar und sehr weißer Gesichtshaut. Ihr Vater war Farmer, Besitzer eines kleinen Grundstücks, das Harkaway hieß und in der Nähe von Berwick lag. Sie fuhr in einem eleganten vierrädrigen Pferdewagen vor, den ihr Vater vor einem Jahr auf irgendeinem Hinterhof entdeckt und für ziemlich viel Geld neu hatte herrichten lassen; eine schöne, lebhafte Stute zog den Wagen. Das Mädchen trug leuchtendrote Hosen und eine gleichfarbige Bluse; der Lippenstift und der Lack auf ihren Finger- und Fußnägeln waren darauf abgetönt. Sie winkte Peter zu, der neben dem Kopf des Pferdes stehengeblieben war, sprang ab und band die Zügel lose an der Schranke fest, an der sich früher einmal wartende Autobuspassagiere in einer langen Reihe aufzustellen pflegten. »Guten Morgen, Peter. Ist dein Freund nicht eingetroffen?«
»Er kommt mit dem nächsten Zug. Wann bist du von zu Hause weggefahren?« Sie wohnte zwanzig Meilen von Falmouth entfernt.
»Um acht. Zu nächtlicher Zeit!«
»Hast du gefrühstückt?«
Sie nickte. »Cognac. Ich möchte noch einen trinken, bevor ich dieses Gestell wieder besteige.«
Er war ihretwegen besorgt. »Hast du nichts gegessen?«
»Gegessen? Speck, Eier und all das Zeug? Liebes Kind, ich war gestern Abend auf einer Gesellschaft bei den Symes. Mir wäre übel davon geworden.«
Sie gingen auf den Bahnsteig zu. »Wann bist du ins Bett gegangen?«, fragte er.
»Ungefähr halb drei.«
»Ich verstehe nicht, wie du das aushältst. Ich könnte es nicht.«
»Ich kann’s. Ich kann’s aushalten, solange ich muss, und das ist ja nicht mehr sehr lange. Warum soll man mit Schlafen Zeit vergeuden?« Sie lachte ein wenig schrill. »Das wäre doch ganz sinnlos.«
Er antwortete nicht, weil sie ihm Recht zu haben schien, obwohl er selbst ganz anders reagierte. Als der Zug einlief, erwarteten sie Captain Towers auf dem Bahnsteig. Er trug Zivilkleidung, eine hellgraue Jacke und beigefarbene Drillichhosen, beide von so amerikanischem Schnitt, dass man ihn in der Menschenmenge sofort als Ausländer erkannte.
Peter Holmes stellte vor. Als sie vom Bahnsteig hinuntergingen, sagte der Amerikaner: »Ich bin seit Jahren nicht auf einem Rad gesessen. Wahrscheinlich werde ich hinunterfallen.«
»Wir haben etwas Besseres für Sie«, antwortete Peter. »Moira hat ihren Rennwagen gebracht.«
Der Amerikaner runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht - was?«
»Sportwagen«, sagte das Mädchen. »Jaguar XK hundertundvierzig. Bei Ihnen heißt er, glaube ich, Thunderbird. Das neueste Modell, nur eine Pferdekraft, auf ebener Strecke macht er aber gute acht Meilen in der Stunde. Gott, ich will was trinken.«
Sie kamen zu dem Wagen, und Moira band die Zügel der grauen Stute los. Der Amerikaner trat einen Schritt zurück und sah sich den in der Sonne glänzenden, sehr elegant aussehenden Wagen an. »Ich muss sagen«, rief er aus, »das ist ja ein richtiger Kohlenwagen!«
Moira lachte. »Ein Kohlenwagen! Das ist die zutreffende Bezeichnung. Es ist wirklich ein Kohlenwagen, was? Reg dich nicht auf, Peter, er ist nicht schmutzig. Wir haben auch einen Customline in der Garage herumstehen, Captain Towers; den hab ich aber nicht gebracht. Das hier ist ein Kohlenwagen. Steigen Sie ein, ich werde Vollgas geben, um Ihnen zu zeigen, wie schnell er fährt.«
»Ich habe mein Rad hier, Sir«, sagte Peter. »Ich werde damit fahren, und wir treffen uns zu Hause.«
Captain Towers stieg in den Wagen, das Mädchen setzte sich neben ihn, nahm die Peitsche in die Hand, wendete das Pferd und fuhr hinter dem Rad her. »Bevor wir die Stadt verlassen«, sagte sie zu ihrem Begleiter, »will ich aber unter allen Umständen etwas trinken. Peter ist ein netter Kerl und Mary ebenfalls, aber die beiden trinken nicht genug. Mary behauptet, es mache dem Baby Bauchschmerzen. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen. Wenn Sie es vorziehen, können Sie ja Coca Cola trinken.«
Captain Towers fühlte sich etwas verwirrt, aber zugleich angeregt; er war schon lange nicht mehr mit einer jungen Frau dieser Art zusammengetroffen. »Ich halte mit«, sagte er. »Ich habe im vergangenen Jahr so viele Cokes getrunken, dass mein Schiff darin in Sehrohrtiefe schwimmen könnte. Alkohol wird mir guttun.«
»Dann sind wir uns also einig«, bemerkte sie und fuhr ihren Wagen recht geschickt in die Hauptstraße. Einige verlassene Autos standen diagonal zum Straßenrand; sie standen schon über ein Jahr da. Es gab so wenig Verkehr in den Straßen, dass sie niemand störten, und Benzin, um sie abzuschleppen, gab es nicht. Moira hielt vor dem Pier-Hotel an, stieg ab, band die Zügel an der Stoßstange eines Autos fest und ging mit ihrem Begleiter in den Damensalon der Wirtschaft.
Er fragte: »Was darf ich für Sie bestellen?«
»Einen doppelten Cognac.«
»Mit Wasser?«
»Ganz wenig, aber viel Eis.«
Er bestellte beim Barkellner. Das Mädchen beobachtete ihn von der Seite, wie er da in Gedanken verloren stand. Amerikanischen Whisky hatte es hier nie gegeben, schottischen bekam man schon seit Monaten nicht mehr, und ohne jeden Grund war ihm australischer Whisky verdächtig. »Ich habe noch nie Cognac auf diese Art getrunken«, sagte er. »Wie schmeckt das?«
»Ganz unspektakulär«, antwortete das Mädchen; »macht sich nur sehr langsam bemerkbar. Bekömmlich für die Eingeweide. Darum trinke ich ihn.«
»Ich glaube, ich bleibe doch besser bei Whisky.« Er bestellt, wandte sich ihr wieder zu und fragte belustigt: »Sie trinken eine ganze Menge, nicht wahr?«
»Das sagen mir alle.« Sie ließ sich von ihm das Glas reichen und zog dann aus der Handtasche eine Schachtel Zigaretten, die ein Gemisch aus südafrikanischem und australischem Tabak enthielten. »Nehmen Sie eine? Sie schmecken scheußlich, ich konnte aber keine anderen bekommen.«
Er bot ihr von seinen Zigaretten an, die genauso scheußlich waren, und gab ihr dann Feuer. Sie blies den Rauch durch die Nase. »Immerhin sind Ihre eine Abwechslung. Wie heißen Sie?«
»Dwight«, antwortete er. »Dwight Lionel.«