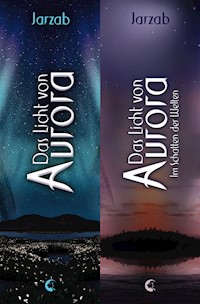Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Licht von Aurora
- Sprache: Deutsch
Einmal Prinzessin und zurück! Die spannende Fortsetzung von Anna Jarzabs Jugendbuch-Reihe Das Licht von Aurora überzeugt durch märchenhafte Parallelwelten, politische Machtkämpfe und eine weltenübergreifenden Liebesgeschichte. Romantische Mädchenfantasy, die nicht nur Fans von Selection und Die rote Königin lieben werden! Verzweifelt versucht Sasha zurück nach Aurora und zu ihrer großen Liebe zu gelangen. Aber in der Parallelwelt wartet nicht nur Thomas sehnsüchtig auf sie, sondern auch Selene, die dringend Sashas Unterstützung benötigt. Doch um Selene zu helfen, müsste Sasha das Königreich erneut verlassen. Soll sie ihrem Schicksal folgen, auch wenn sie das ihre große Liebe kosten könnte? "Das Licht von Aurora – Im Schatten der Welten" ist der zweite Band der Aurora-Reihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wo Sie sind, ist mein Heim – mein einziges Heim.
Charlotte Brontë: Jane Eyre
Das Buch der Natur
Prolog
Alles wiederholt sich.
Das ist einer der wichtigsten Grundsätze des Multiversums. Alles wiederholt sich, Mal um Mal, wieder und wieder. In allen Universen fügen sich die Atome nach vorherbestimmten Mustern zusammen.
Alles wiederholt sich, ein jeder wiederholt sich. Du. Ich. Deine beste Freundin. Der Junge, in den du verknallt bist. Wir sind alle nur eine Person von vielen, durch das Paraband – ein zartes Band dunkler Energie, zarter noch als der feinste Seidenfaden – verbunden mit all den anderen, die in jeder der Welten dasselbe Gesicht haben. Wenn alles nach Plan läuft, wirst du keinen deiner Analoge, deiner Doppelgänger der parallelen Welten, je treffen. Die Universen sind dazu bestimmt nebeneinander zu existieren. Jeder soll davon ausgehen, dass er einzigartig ist. Glaub daran. Wieso auch nicht? Die Chance, dass du nie eines Besseren belehrt wirst, liegt bei 99,9Prozent.
Ich hingegen weiß es besser, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Eine andere Welt, die sich nicht sonderlich von meiner unterscheidet, aber doch genug, dass mir die Worte fehlen, sie zu beschreiben. Und ich habe sie gesehen – meinen Analog, meine Doppelgängerin. Ich habe ihr in die Augen geschaut – in meine Augen –, als sie mich verraten hat, als sie mir mein Leben wegnehmen wollte. Vielleicht verstehst du jetzt, warum du daran glauben solltest, dass du einzigartig bist. Weil es besser ist. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, haben die Lügen etwas Tröstliches.
THOMAS AN DER SCHWELLE
»Siehst du das?« Der Mann griff nach Thomas’ Haaren und riss ihm den Kopf so weit nach hinten, dass er ihm fast das Genick brach. An der Wand hing eine Uhr, die vier blutrote Ziffern zeigte: 11:38. Während Thomas hinsah, verschwand die Acht.
»Noch elf Stunden und siebenunddreißig Minuten, dann stehst du vor dem Erschießungskommando«, zischte der Mann. Die Fingernägel bohrten sich in Thomas’ Kopfhaut. Als Thomas darauf nicht reagierte, schlug der Mann ihm mit der Rückseite der Hand ins Gesicht. Sein Kopf kippte zur Seite, aber Thomas zeigte keine Reaktion. Der Schmerz war weit entfernt.
Die letzten Wochen waren nichts weiter als ein dunkler Erinnerungsklecks in seinem Gedächtnis. Ein unerträglicher, verschwommener Fleck aus blendendem Licht und ohrenbetäubenden Geräuschen. Das Schlimmste waren die Schreie gewesen, die sie wie Musik über Lautsprecher in seine winzige Zelle hatten dröhnen lassen. Irgendwann, während dieser endlosen Stunden, war er in einen Halbschlaf verfallen und hatte geträumt, es wäre Sasha, die schrie, als würde sie in tausend Stücke zerrissen. Er hatte sie vor sich gesehen, als wäre sie wirklich dort, vor Schmerzen zusammengekauert auf dem Boden, und würde ihn anflehen, ihr zu helfen. Vergeblich hatte er versucht, zu ihr zu gehen, doch sein gepeinigter Körper hatte nicht gehorcht. Er hatte sie trösten wollen, doch sein Hals war so trocken und rau gewesen, dass er nicht hatte sprechen können. Er hatte nicht einmal weinen können, fast so, als gäbe es in ihm nicht einmal mehr genug Flüssigkeit für Tränen.
Als er schon dachte, es würde nie enden, hatten sie ihn aus der Zelle gezerrt. Seine Knie waren über den rauen Betonboden geschürft, als sie ihn grob in eine andere Zelle schleiften und dort auf eine Pritsche stießen. Zwar fand er ein paar Stunden Schlaf, wurde aber von Fieberträumen geschüttelt. Als er erwachte, war er gefesselt, schwere Eisen schnitten ihn an den Hand- und Fußgelenken. Er hatte eine Platzwunde an der Lippe, schmeckte Blut und sein rechtes Auge war so dick angeschwollen, dass er es nicht öffnen konnte. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so mutlos gefühlt wie jetzt. Nicht einmal, als er am Küchentisch irgendeines namenlosen Nachbarn vor der Urne mit den sterblichen Überresten seiner Eltern gestanden hatte. Damals war er noch zu jung gewesen, um das alles zu begreifen, aber damals hatte er immerhin noch daran geglaubt, dass eine schöne Zukunft vor ihm lag.
Doch jetzt hatte er die schönsten Momente seines Lebens bereits hinter sich. Thomas erinnerte sich deutlich an jeden einzelnen von ihnen. Der allerschönste war am Abend des Abschlussballs gewesen, nach dem Fest. Als er mit Sasha am Ufer des Sees gestanden und sich Gedanken über die unendliche Weite des Universums gemacht hatte. Und ihm bewusst geworden war, welche ungeahnten Wege sich ihm plötzlich eröffneten. Die Erkenntnis, dass alles, was er sich je gewünscht hatte – ein normales Leben, jemand, dem er wichtig war, eine Zukunft mit unendlichen Möglichkeiten –, zum Greifen nah und doch unerreichbar war. Er klammerte sich an diese Erinnerung, die in gleichem Maße schön wie schmerzhaft war, weil er wusste, dass sie schon sehr bald für immer verloren sein würde, fort, als hätte sie nie existiert.
Wenigstens war Sasha in Sicherheit, auf der Erde, wo sie hingehörte. Er hatte ihr ein Versprechen gegeben und es gehalten. Obwohl er von vornherein gewusst hatte, wie schwer es ihm fallen würde, sie wieder nach Hause zu schicken, hatte er sich nicht vorstellen können, wie traurig und Furcht einflößend es letzten Endes sein würde, sie verschwinden zu sehen. Plötzlich war sie fort gewesen, als wäre sie nur seiner Fantasie entsprungen. Vor ihm im einen, fort im nächsten Augenblick.
Und trotz allem konnte er sie nicht vergessen. Manchmal rechnete er damit, die Augen aufzuschlagen und sie neben sich zu entdecken. Ganz am Anfang, als dieser Albtraum gerade erst losgegangen war, hatte er noch geglaubt, zu ihr zurückkehren zu können. Zweimal hatte er versucht auszubrechen, wild entschlossen, nicht kampflos aufzugeben. Beim ersten Mal war er sogar bis zur äußersten Mauer des Gefängnisses gekommen. Beim zweiten Mal, verlangsamt vom Hunger und geschwächt vom Fieber, hatte er es nicht einmal aus dem Gebäude geschafft.
Die Wärter hatten ihre Lektion gelernt und ihn für ihre Verfehlung büßen lassen. Er wusste, was als Nächstes passieren würde. Erschöpft und gefesselt würde er im Gefängnis des Adastra Palasts sterben. Sein Leichnam würde verbrannt und seine Asche auf dem Hof zwischen unzähligen Kriminellen, Spionen, Verrätern und Feinden verscharrt werden. Seine Zukunft beschränkte sich auf einen Platz in einem Massengrab.
Sein Peiniger ließ ihn los und setzte sich wieder. »Sag uns, wo das Mädchen ist, dann verschonen wir dich.« Das war das Einzige, was sie wissen wollten.
Thomas dachte kurz darüber nach zu fragen, welches Mädchen er meinte, dabei spielte das keine Rolle. Jedenfalls für den Mann, denn für ihn waren Sasha und Juliana ein und dieselbe Person. Für Thomas hingegen nicht. Ganz im Gegenteil.
Die Wärter waren verblüfft gewesen, als sie ihn allein in der Zelle vorgefunden hatten – eine Schusswunde in der Schulter und halluzinierend aufgrund des Blutverlusts. Sie hatten den Gefängnisarzt gerufen, der Thomas so lange am Leben erhalten sollte, bis die Königin von Farnham seinen Tod beschloss. Der Befreiungstrupp, auf den Thomas insgeheim gehofft hatte, war nie aufgetaucht.
Lucas und Juliana waren weit vor Sonnenaufgang verschwunden. Möglich, dass Lucas gezögert hatte, unschlüssig, ob er Thomas wirklich zurücklassen sollte. Aber zu dem Zeitpunkt war Thomas schon an der Schwelle zur Ohnmacht gewesen, konnte es also nicht mit Sicherheit sagen. Aber ganz egal, ob Lucas ihn nun leichtfertig zurückgelassen hatte oder nicht, am Ergebnis änderte das nichts: Sein Bruder und seine Freundin hatten ihn auf dem kalten Boden sich selbst überlassen, wo er unweigerlich verblutet wäre.
»Du weißt schon, dass da draußen Krieg herrscht, oder?«, fragte der Mann in gemäßigterem Ton. Folter hatte zu nichts geführt, Drohungen genauso wenig. Jetzt versuchte er also, Thomas mit Freundlichkeit zur Kooperation zu bewegen. Aber auch damit würde er keinen Erfolg haben. »Du kannst uns dabei helfen, ihn zu beenden. Sag uns einfach, wo wir die Prinzessin finden, dann lassen wir dich laufen. Das ist es doch, was du willst, habe ich recht?«
»Ich glaube Ihnen nicht.« Seine eigene Stimme klang Thomas fremd. Nasal und abgehackt. Ihm schmerzte die Kehle.
Der Mann streckte den Arm aus. Mit einer schnellen Bewegung hielt er Thomas eine Feldflasche an die Lippen. Das Mundstück war kalt und Thomas konnte kühles, frisches Wasser riechen. Sein Stolz mahnte ihn, es nicht zu trinken, doch sein Körper brauchte es, also tat er es doch.
Kaum war die Feldflasche leer, verschwand sie aus seinem Blickfeld und der Mann lehnte sich vor, bis sein Gesicht nur noch wenige Zentimeter von Thomas’ entfernt war. »Hör jetzt gut zu: Niemand ist unterwegs, um dich zu holen. Die lassen dich hier krepieren. Macht dich das nicht wütend, Junge? Hasst du sie nicht dafür, dass sie dich einfach im Stich lassen?«
»Ich bin kein Junge«, sagte Thomas leise und mit bitterem Ton. Sie hielten ihn für schwach, aber da war noch Kraft in ihm. Eine gefährliche, animalische Kraft, ungezügelt und uralt. Wenn sich ihm nur die Gelegenheit böte, könnte er ihnen allen heimzahlen, was sie ihm angetan hatten. »Ich werde nicht reden, Sie vergeuden Ihre Zeit.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe alle Zeit der Welt. Du bist derjenige, dem sie davonrennt. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Wenn du uns nicht verrätst, was wir wissen wollen, werden wir dich umlegen.«
»Worauf warten Sie dann noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
Dabei hatte der Mann in einem Punkt recht: Thomas war wütend. Er hatte mehr verloren, als sie jemals begreifen konnten. Aber zu einem Verräter würden sie ihn nicht machen. Er hatte einen Eid abgelegt, den er nicht brechen würde. Nicht einmal jetzt, wo sein Leben auf dem Spiel stand.
»Gehen wir«, sagte der Mann zu den Wärtern und erhob sich. »Soll er mal ein bisschen über seine Sterblichkeit nachdenken.«
Und dann war Thomas allein. Allein mit seinen Gedanken, seinen Schmerzen und der Uhr, die gewissenhaft seine letzten Lebensminuten hinunterzählte.
Noch elf Stunden und vierundzwanzig Minuten.
Als die Zeit abgelaufen war, ging alles ganz schnell. Thomas’ Muskeln zitterten, so viel Kraft kostete es ihn, aufrecht zu stehen. Die Männer zerrten ihn aus der Zelle und durch endlos viele Gänge, bis sie einen großen, leeren Hinterhof erreichten, auf dessen festgestampfter Erde nicht einmal Unkraut zu wachsen wagte. Da Thomas so viele Stunden im Dunkel verbracht hatte, stach ihm das Sonnenlicht in den Augen. Aber er zwang sich, die Lider offen zu halten, damit er den Himmel betrachten konnte. Er war strahlend blau, von weißen Wolkenbändern durchzogen. Trotz allem sah er wie immer aus.
Thomas leckte sich über die Lippen und schmeckte Blut. Er hatte einen Kloß von der Größe eines Felsbrockens im Hals und versuchte vergeblich, dagegen anzuschlucken. Er gab sich die größte Mühe, seine letzten Atemzüge in Würde zu tun. Vor seinen Augen begann es zu flackern. Er war so unglaublich erschöpft. Die Männer und Frauen des Erschießungskommandos trugen Masken, die ihre Gesichter verbargen. Er fragte sich nicht, ob sie gute Schützen waren. Sie wären schließlich nicht hier, wenn dem nicht so wäre. Ein Wärter verband ihm die Augen und fragte, ob er noch etwas sagen wolle.
»Zielt hoch«, sagte Thomas. Er hatte sich noch nie hinter geheucheltem Mut verstecken müssen, diesmal jedoch hatte er wirklich Angst. Eine Angst, die sich ganz tief in einer dunklen Ecke seines Herzens versteckt hatte – wie ein Skorpion unter einem Stein – und nur auf den finstersten Moment gewartet hatte, um hervorzuschnellen. Die Angst breitete sich rasend schnell wie Gift in seinem ganzen Körper aus. Seine Finger schlossen sich, als hätte jemand seine Hand genommen. Thomas machte die Augen zu und stellte sich vor, dass Sasha ihm den Kopf an die Schulter lehnte, dass ihre Haare sanft über seinen Hals strichen. Seine eigene Stimme wurde von einer Erinnerung herangespült: Was auch passiert, das war der schönste Abend meines Lebens. Er hatte diese Worte ernst gemeint, aber erst jetzt wurde ihm bewusst, wie wahr sie waren.
Thomas wappnete sich, als die Schützen ihre Waffen ansetzten. Er hörte die Schüsse, spürte aber keinen Schmerz. Fühlte es sich wirklich so an zu sterben?
Aber er war gar nicht tot, wie er nach ein paar holprigen Herzschlägen merkte. Sie hatten zwar geschossen, aber nicht auf ihn. Seine Beine gaben nach und er fiel auf die Knie. Jemand nahm ihm die Augenbinde ab und er blinzelte angestrengt zu der Gestalt hinauf, die sich über ihn beugte, während jemand seine Fesseln löste. Eine vertraute Stimme sagte seinen Namen.
»Du bist in Sicherheit.« Das war Adele, eine Freundin aus seiner Zeit an der Akademie. Sie legte ihm sanft die Hand auf die Schulter, woraufhin er zusammenzuckte, weil die Schusswunde noch nicht richtig verheilt war. Adele half ihm beim Aufstehen und Thomas sah sich auf dem Hof um.
Leichen lagen nun auf der Erde verstreut – die Wärter waren tot.
Thomas war darüber erleichtert und fragte sich unweigerlich, ob nicht doch etwas in ihm gestorben war.
»Was macht ihr hier?«, fragte er.
»Wir befreien dich«, antwortete Adele und machte eine Geste, die das gesamte Team einschloss, das zu Thomas’ Rettung gekommen war. Er kannte ein paar der Gesichter: Sergei und Cora, Navin und Tim.
Adele schenkte ihm ein zögerliches Lächeln und fügte hinzu: »Wie du siehst.«
Thomas rang sich ein Lachen ab. Er verstand nicht, warum sein Vater überhaupt einen Befreiungstrupp ausgesandt hatte. Aber gleichzeitig war er dankbar dafür, dass der General ausgerechnet seine Freunde geschickt hatte. Dankbar und ein bisschen misstrauisch.
Adele sprach etwas in ihr Funkgerät und wandte sich dann wieder an Thomas. »Kannst du laufen?«
Er nickte. »Was machst du hier, Adele?« Das letzte Mal hatte er sie und die anderen kurz vor seinem Abschluss von der Akademie gesehen, sie waren damals noch Rekruten gewesen. Es musste über ein Jahr her sein, dass er mit einem von ihnen gesprochen hatte. Er fragte sich erneut, ob er nicht doch tot war oder zumindest halluzinierte. Das alles fühlte sich so unwirklich an.
»Mittlerweile Agent Nguyen.« Sie umklammerte die schwarze Maske fester. »Ich bin hier, weil ich darum gebeten habe. Aber jetzt lass uns erst einmal von hier verschwinden. Ich schätze, wir haben noch ungefähr drei Minuten, bis auffällt, was hier passiert ist. Und es ist schließlich noch ein weiter Weg bis zum Labyrinth.«
Das Labyrinth war ein Militärgelände, auf dem sich das Ausbildungszentrum des Königlichen Elitedienstes befand.
Thomas wollte kein einziger Grund einfallen, warum Adele ihn ausgerechnet dorthin bringen wollte. »Zum Labyrinth?«
»Ganz genau«, sagte sie. »Der General möchte dich sehen.«
Ein Klopfen an der Tür. Selenes Herzschlag beschleunigte sich. Dabei konnte sie nicht sagen, ob es an dem Besucher lag, den sie erwartete, oder an der Nachricht, die er vermutlich bei sich trug. Aber egal, was der Grund war, sie freute sich. Leonid war der einzige Mensch, der gerade wichtig war. Er kam forschen Schrittes ins Zimmer, sah, wie sich ihre Augen weiteten, und lächelte. Selene schlug das Herz bis zum Hals. Er hatte das letzte, fehlende Stück der Anleitung bei sich, mit der sie den Terminus endlich starten konnten – die Maschine, die Taiga und seine Bewohner retten würde.
Selene hatte nie daran gezweifelt, dass es ihm gelingen würde. Ein paar der älteren Denker hatten protestiert, als ihre Wahl auf Leonid gefallen war. Aber die hatte sie ignoriert. Sie hatte nämlich von Anfang an gewusst, dass Leonid der einzige Denker war, der ihr helfen konnte, die Prophezeiungen des Kairos zu entschlüsseln. Das hatte weder mit Erfahrung noch mit Intelligenz zu tun, Leonid hatte sich durch seine Intuition von den anderen abgehoben und durch seine für Denker ungewöhnliche Unvoreingenommenheit. Er hatte ein ähnlich gut ausgeprägtes Gehör für die Zwischentöne, die in den Worten des Kairos steckten, wie Selene. Sie konnte sich außerordentlich glücklich schätzen, ihn zu haben. Aus diesem und so vielen anderen Gründen. Leonid war ihr Vertrauter, ihr Gefährte, ihr Partner. Es gab so vieles, das sie allein bewältigen musste, aber das, was sie teilen konnte, das teilte sie mit ihm.
»Und, wie lautet sie, die letzte Prophezeiung?«, fragte Selene.
»Ich bin mir nicht ganz sicher«, antwortete er und drückte ihr ein Blatt Papier in die Hand. »Aber das ist ja auch Eure Aufgabe.«
Selene versuchte, ihr Lächeln vor ihm zu verbergen. Sie durfte niemanden bevorzugen, trotzdem sollte er wissen, dass sie ihn am liebsten mochte. Wahrscheinlich sogar mehr als nur mochte. Dabei wusste sie, wie gefährlich es war, sich von ihrer Aufgabe ablenken zu lassen. Ihre persönlichen Gefühle durften der Zukunft ihrer Welt nicht in die Quere kommen. Sie faltete das Blatt auseinander und wandte sich ab.
»Wisst Ihr, was sie bedeutet?«, fragte er ungeduldig.
Ihr gefiel Leonids Eifer, jeder Sache auf den Grund zu gehen. Wenn er an einer Prophezeiung arbeitete, aß, schlief und sprach er nicht, ehe er sie entschlüsselt hatte. Und leicht war diese Aufgabe nicht. Kairos war ein chiffrierter Text, den man nur mithilfe von Mathematik und intensiver Analyse entziffern konnte, nur um dann unerklärliche Prophezeiungen zu erhalten. Kairos zu entschlüsseln, war die Aufgabe der Denker. Die Deutung der Prophezeiungen war Aufgabe des Orakels, der sogenannten Korydallos – Selenes Aufgabe. Es lag in ihrer Hand, ob das Leben auf dieser Welt weitergehen oder enden würde.
»Ja«, flüsterte sie. »Ich glaube schon.«
Ihr langer weißer Rock rauschte ihr um die Beine, als sie den Saal betrat. Es ärgerte sie, dass Leonid sie nicht begleiten durfte. Nur Angehörige des zweiten Ranges durften den Versammlungssaal der Tetraktys betreten und als junger Denker bekleidete Leonid erst den dritten Rang. Dabei hätte sie ihn gern bei sich gehabt, wenn auch nur zur moralischen Unterstützung. Die Tetraktys würde ihre Bitte sicher abschlagen. Sie schickte niemanden willkürlich in die andere Welt.
Die Mitglieder der Tetraktys saßen an einem großen, dreieckigen Tisch. Erastos, ihr hochrangigster Vertreter, betrachtete Selene mit wachsender Neugierde. Er war ein klein gewachsener Mann, sehr konservativ und fürchterlich realitätsfremd. Selene konnte ihn nicht leiden. Nie lächelte er, und noch dazu waren ihm alle Lenker suspekt, weshalb er auch Selene nicht sonderlich mochte. Aber da sie beide die wichtigsten Einwohner Apeirons waren, mussten sie einander zwangsläufig tolerieren. Dabei konnte sich Selene gerade genug zusammenreißen, um ihm mit der gebotenen Höflichkeit zu begegnen.
Selene sah ihnen nacheinander fest in die Augen. Wenn sie sich Angst oder Besorgnis – oder noch schlimmer: Unsicherheit – vor der Tetraktys anmerken ließ, büßte sie einen Großteil ihrer Machtposition ein. Corinna, die vorherige Korydallos, hatte Selene auf dem Totenbett gewarnt, dass die Tetraktys sie für jede Prophezeiung kämpfen lassen würde, dass sie erst tätig werden würde, wenn Selene jede ihrer Prophezeiungen penibelst begründet hatte.
»So sind sie einfach«, hatte Corinna gesagt.
Selene, damals erst dreizehn Jahre alt, hatte so große Angst vor dieser neuen Verantwortung gehabt, dass sie am ganzen Körper gezittert hatte. Die Angst war länger geblieben, als sie sich eingestehen wollte.
»Sie müssen dich hinterfragen, weil einem Orakel sehr viel Macht innewohnt. Das Volk verehrt die Korydallos und fürchtet die Tetraktys. Die Korydallos verkörpert den Geist, die Tetraktys das Gesetz. Es muss ein Gleichgewicht zwischen beiden geben, nur so lässt sich Chaos verhindern.«
»Korydallos«, sagte Erastos jetzt. »Es sind viele Monate verstrichen, seit Ihr diesen Saal mit Eurer Anwesenheit beehrt habt. Ich muss also davon ausgehen, dass Ihr eine Prophezeiung mit Euch führt.«
»Das tue ich«, sagte Selene. »Ich bin heute hier, um euch drei Dinge mitzuteilen. Erstens: Mein Denker und ich haben die letzte Prophezeiung des Kairos entschlüsselt. Es gibt keine weiteren.«
Erastos hob überrascht die Augenbrauen.
Kairos war selbst für die Tetraktys ein Mysterium. Nur Selene und Leonid wussten, wie viel des Textes über die Jahrhunderte entschlüsselt worden war. Selene hatte immer gewusst, dass sie die letzte Korydallos sein und zu ihren Lebzeiten der Kairos vollständig entschlüsselt werden würde. Aber nie hätte sie geahnt, dass dies so schnell eintreten würde. Dennoch war sie erleichtert. Die neue Zeit brach bald an. Wenn es endlich so weit war, wurde vielleicht alles anders. Vielleicht durfte dann auch sie glücklich werden. Sie wünschte sich erneut Leonid an ihrer Seite, schob den Gedanken aber rasch beiseite.
»Zweitens«, fuhr sie fort, »der Terminus ist vollendet.«
»Nein«, entfuhr es Hypatia, einer großen, eleganten Frau mit der für Eingeborene der Neuen Länder typisch dunklen Hautfarbe. Sie saß zu Erastos’ Rechten als Zeichen ihres Status, schließlich stand sie im Rang direkt unter ihm. »Die Frage nach der Energiequelle ist nach wie vor nicht geklärt. Der Bau des Terminus mag abgeschlossen sein, aber ohne Treibstoff ist er nicht einsatzfähig.«
»Ich sagte ja, dass ich euch drei Dinge mitzuteilen habe.« Bei dieser Zurechtweisung versteifte Hypatia sich. Wenngleich die Mitglieder der Tetraktys Selene offenbar wenig bis gar nicht mochten, so schuldeten sie ihr dennoch Respekt. »Drittens: Die letzte Prophezeiung des Kairos befasst sich damit, wie der Terminus betrieben wird.«
Aufgeregtes Gemurmel hob an.
Selene lächelte. Ihr gefiel es, die Tetraktys zu schockieren.
Erastos neigte den Kopf, damit Hypatia in sein Ohr flüstern konnte. Dann räusperte er sich und schon verstummten die anderen Tetraktys. »Was besagt sie?«
»Ihr wisst, dass ich das nicht verraten darf.« Selene war es erlaubt, den Inhalt der Prophezeiungen weiterzugeben, der genaue Wortlaut jedoch blieb das Geheimnis von ihr und ihrem Denker. »Nur, dass der Treibstoff nicht auf Taiga zu finden ist. Genauer gesagt, er ist nicht allein auf Taiga zu finden.«
»Was heißt das?«
»Ihr müsst mich in die andere Welt schicken.« Allein der Gedanke, darum zu bitten, hatte sie schrecklich nervös gemacht, und nun war es ihr doch ganz leichtgefallen. Schließlich war sie felsenfest von ihrer Deutung überzeugt. Das war nicht immer so gewesen. Obwohl auch alle ihre anderen Prophezeiungen richtig gewesen waren, ganz so, wie es ihr von Corinna versichert worden war.
»Es gibt einen guten Grund dafür, dass jede Generation nur eine Korydallos hervorbringt«, hatte Corinna erklärt. »Man kann es nicht lernen, nur fühlen. Alles, was dazu nötig ist, kommt tief aus dir selbst und von weit über dir. Es ist wahrhaftig ein Geschenk Apeirons. Du bist gesegnet, mein Kind. Zweifle nicht an dir und dulde niemanden, der an dir zweifelt.«
Es war Selene nicht leichtgefallen, an die Überlegenheit ihrer Instinkte zu glauben, sie war schließlich erst eine Dreizehnjährige vierten Ranges gewesen, quasi gerade erst den Kinderschuhen entwachsen. Aber unter Corinnas Anleitung hatte sie schnell gelernt. Und das alles war nur die Vorbereitung auf diesen Moment gewesen, den Beginn des Neuanfangs. Und die Tetraktys konnte sie nicht aufhalten.
»Auf gar keinen Fall«, spuckte Erastos hervor. »Wir werden Euch ganz sicher nicht durch den Schleier schicken.«
»Warum nicht?«, wollte Selene wissen. »Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Treibstoff finden, ihn mitbringen, und dann ist der Terminus endlich einsatzfähig. Der Neuanfang, Erastos, ist zum Greifen nah.« Sie betrachtete ihre nackten Handgelenke, stellte sich das eingebrannte Kennzeichen der Reisenden am linken vor.
»Ihr seid siebzehn«, widersprach Erastos. »Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was Euch dort erwartet.«
»Aber Ihr?« In ihren Augen glühte die Begeisterung für die bevorstehende Reise. Trotz Erastos’ Entrüstung war sie davon überzeugt, dass sie ihren Willen durchsetzen würde.
»Ich habe die Berichte gelesen«, erwiderte Erastos. »Dort ist es nicht wie hier. Diese Barbaren führen Krieg gegeneinander, töten einander wegen Nichtigkeiten. Moral und Werte sucht man vergebens. Ihr würdet dort nicht einmal einen Tag überleben und ich schicke wohl kaum unsere einzige Korydallos durch den Schleier in ihren sicheren Tod!«
»Ich bin stärker, als Ihr mir zutraut«, beharrte Selene. »Und klug. Schickt jemand anderen, schickt ein Dutzend anderer. Egal wie viele, sie werden sie nicht finden. Ich bin die Einzige, die das zu tun vermag.«
»Sie?« Erastos’ Gesicht wurde puterrot, so viel Mühe kostete es ihn, seinen Zorn zu zügeln.
Selene entging nicht, dass er kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren. Ihr war nie verboten worden, vom Schleier und der Welt zu sprechen, die dahinter lag. Trotzdem war das etwas, das nur wenige zu erwähnen wagten. Aber Selene gehörte nicht zu den Menschen, die Tabuthemen mieden. Sie mochte Kontroversen. Auf diese Weise hatte sie das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben.
»Die Energiezellen«, sagte sie. »Es gibt mehr als eine.« Drei, dachte sie, wir brauchen drei.
»Dann sag uns, wo wir sie finden, und wir schicken jemanden hin, um sie zu holen.«
»Das werde ich nicht tun«, entgegnete Selene. »Ich bin die Einzige, der es gelingen wird, sie herzubringen.« Sie senkte die Stimme. »Ich bin keine gewöhnliche Lenkerin, Erastos, und das wisst Ihr sehr gut. Meine Visionen sind klar und deutlich und ich habe mich noch nie geirrt. Ihr müsst mir vertrauen.« Dann erhob sie sich plötzlich.
Schockiertes Flüstern setzte in der Tetraktys ein. Niemand durfte den Saal der Tetraktys verlassen, ohne verabschiedet worden zu sein. Aber Selene war nicht irgendjemand. Sie war ihre Korydallos. Und sie wollte ihnen zeigen, wie sicher sie sich war.
Kapitel 1
Zum wiederholten Mal seit meine Schicht angefangen hatte, meldete sich mein Handy. Schnell verschwand ich im Pausenraum und zog es aus der Tasche. Fünf verpasste Anrufe: einer von Gina und vier von Grant. Außerdem mehrere SMS, alle von Grant und alle mit derselben Frage: Wo steckst du? Ich hörte die Mailbox ab, ohne wirklich wissen zu wollen, was Grant zu sagen hatte.
»Wo steckst du, Sasha? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Wenn du als meine Freundin durchgehen willst, dann geh wenigstens ran, wenn ich anrufe.«
Meine Hände zitterten, als ich die Nachricht löschte. Ich wusste, dass ich ihn zurückrufen sollte. Schließlich ignorierte ich ihn schon seit mehreren Stunden, und Grant kam nicht gut damit klar, sich selbst überlassen zu sein. Ich holte tief Luft und atmete langsam aus. Dann wiederholte ich mein Mantra – Alles ist gut –, ganz so, wie meine Therapeutin es mir beigebracht hatte, für den Fall, dass meine Unruhe Oberhand nahm. Manchmal half es, diesmal allerdings leider nicht.
»Erde an Sasha.« Mein Chef, Johnny, schnipste mit den Fingern vor meiner Nase. Ich hatte nicht einmal mitgekriegt, dass er den Raum betreten hatte. »Was soll das? Du hattest schon Pause.«
»Tut mir leid«, sagte ich und umklammerte das Handy fest – es war eigentlich ein Wunder, dass es nicht zerbrach. »Ich brauche nur ein paar Minuten, ist was Persönliches.«
»Das Restaurant ist voller Gäste, die gerne noch in diesem Jahrhundert bedient werden wollen. Deine paar Minuten Persönliches müssen also noch bis zum Feierabend warten. Und jetzt beweg dich.« Er schob mich vor sich her aus dem Pausenraum bis zu dem kleinen Empfangstisch.
»Tut mir leid«, wiederholte ich. Ein Stapel Speisekarten rutschte mir aus der Hand und fiel zu Boden, wo er sich auffächerte wie ein Kartenspiel. Ich bückte mich, um die Karten aufzuheben, und stammelte weitere Entschuldigungen. »Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Irgendwie bin ich heute ein bisschen neben der Spur.«
Johnny schnaubte verächtlich. »Heute und jeden Tag seit du diesen Sommer hier arbeitest. Was ist denn eigentlich los mit dir, Sasha? Letzten Sommer warst du doch auch nicht so.«
Letzten Sommer. Seither war ja auch eine ganze Menge passiert.
Mein Verschwinden nach dem Abschlussball war nicht gerade unbemerkt geblieben in Hyde Park, dem verschlafenen kleinen Stadtteil im Süden Chicagos, wo ich seit meinem achten Lebensjahr wohnte. Ich hatte es sogar in die Zeitung geschafft, was die Anwohner zu unendlichen Spekulationen über die Gründe meines Verschwindens veranlasst hatte. Die wohl beliebteste war, dass Grant und ich in einer Anwandlung jugendlicher Spinnerei nach Las Vegas durchgebrannt waren, um dort zu heiraten, nur um dann unverrichteter Dinge zurückzukehren, weil ich noch nicht alt genug dafür gewesen war. Grant und ich hatten entschieden, dieses Gerücht Fuß fassen zu lassen, uns nicht weiter auffällig zu verhalten und die Sache einfach auszusitzen. Denn selbst wenn wir erzählt hätten, wo wir wirklich gewesen waren, hätte uns das ja doch niemand abgekauft. Da wollten wir sie lieber in dem Glauben lassen.
»Ich habe gerade einen neuen Gast an Tisch dreiundzwanzig gesetzt«, sagte Johnny. »Los, mach deine Arbeit.«
Irgendwie war ich dankbar dafür, einen Grund zu haben, Grants Nachricht erst einmal ignorieren zu können. Aber wenn ich ihn zu lange mied, kam er im Restaurant vorbei, wohin ich ging, um von ihm und all dem wegzukommen, an das er mich erinnerte: an den Ort, wo wir tatsächlich gewesen waren, an das, was wir dort erlebt hatten, und an Thomas, den Jungen aus einer anderen Welt, der genauso wie Grant aussah. Wenn ich jedoch zu lange über all das nachdachte, würde ich vermutlich wirklich den Verstand verlieren, und ich konnte es mir nicht leisten, verrückt zu werden. Das hatte Grant schon für sich beansprucht.
Er war ziemlich kaputt auf die Erde zurückgekehrt: unnahbar und launisch, zu Wutausbrüchen neigend, auf die Phasen von undurchdringlichem Schweigen folgten. Er zog sich von seinem Umfeld zurück – seiner Mutter, seinen Freunden, allen … außer mir. Vielleicht weil ich wusste, was er durchgemacht hatte. Oder vielleicht auch nur, weil ich sein Verhalten ertrug. Warum auch immer, Grant vertraute mir. Ich war sein Anker, ich erinnerte ihn an das, was echt war. Und er war meiner, was auch geschah. Es hätte mir allerdings die ganze Sache immens erleichtert, wenn er wie irgendjemand anders ausgesehen hätte. Egal wer.
Jede Minute, die ich mit Grant zusammen war, fühlte sich an wie Tausende kleiner Nadelstiche mitten ins Herz. Die Form seiner Nase, sein goldblondes Haar, seine breiten, muskulösen Schultern – selbst seine Rastlosigkeit –, all das erinnerte mich an Thomas. Manchmal konnte ich es vor lauter Schmerz nicht einmal ertragen, Grant anzusehen, weil er mir nur zu deutlich vor Augen hielt, was mir fehlte. Ich war als Gefangene nach Aurora gekommen, aber Thomas hatte mich befreit. Er hatte für mich gekämpft und an mich geglaubt, an das, wozu ich fähig war, und an das, was aus mir werden konnte. Und ich hatte nicht einmal gewusst, wie wichtig das für mich gewesen war, bis ich es selbst erfahren hatte. Und genau dann hat er mich gehen lassen.
Wobei, eigentlich hatte ich ihn verloren, ihn entgleiten lassen, weil ich viel zu große Angst davor gehabt hatte, meinem alten Leben den Rücken zu kehren. Kaum war ich zehn Minuten zu Hause, da bereute ich meine Rückkehr schon. Ich hätte in Aurora bleiben sollen. Meine Aufgabe dort war noch nicht abgeschlossen und eigentlich war ich noch nicht bereit gewesen zu gehen. Ich hatte nie an so etwas wie Schicksal geglaubt, bis ich Thomas traf. Bis eine Verwicklung von Ereignissen mein Leben für immer verändern sollte. Aber allmählich wandelte sich das. Ich war mir so sicher wie noch nie zuvor, dass meine Zukunft in Aurora auf mich wartete, auf der anderen Seite dieses mysteriösen Schleiers, der unsere Welten voneinander trennte. Aber ich war nicht dumm genug zu glauben, dass sie dort für immer auf mich warten würde.
Die Welt, in die ich geboren worden war, fühlte sich nicht mehr nach zu Hause an und würde es vermutlich auch nie wieder. Alles war noch immer vertraut, gleichzeitig aber auch so verwirrend unwirklich. Ein bisschen wie eine Filmkulisse, in der Grant nichts weiter als ein Abziehbild des Jungen war, den ich zurückgelassen hatte. Aber ich weigerte mich, daran zu zerbrechen. Ich war aus einem härteren Material gemacht – das hatte mir die Zeit in Aurora gezeigt. Jetzt aufzugeben, käme einer Verschwendung des Opfers gleich, das Thomas für mich erbracht hatte. Also machte ich das Einzige, was mir einfiel: Ich suchte mir einen Job. Allerdings einen, in dem ich ziemlich kacke war.
Tisch dreiundzwanzig war im hinteren Teil des Restaurants, lediglich ein Gast saß dort und versteckte sich hinter einer Speisekarte.
Ich holte tief Luft und rang mir ein Lächeln ab. »Hallo, ich heiße Sasha und bin heute Ihre Bedienung. Haben Sie schon gewählt?«
Der Gast ließ die Speisekarte langsam sinken und mit Schrecken erkannte ich, dass Gina sich dahinter verborgen hatte. Meine beste Freundin, zumindest ehemals beste Freundin. Seit meiner Rückkehr hatten wir noch kein Wort gewechselt, was allerdings nicht an ihr lag. Als unsere Blicke sich trafen, fingen meine Wangen an zu glühen.
»Hallo«, sagte sie. Schärfe lag in ihrer Stimme.
»Was machst du hier?« Ich hätte wissen müssen, dass sie nicht aufgeben würde. Gina gehörte nicht gerade zu den Menschen, die einen Wink verstanden und sich danach richteten. Insgeheim war ich froh, dass sie mich noch nicht aufgegeben hatte, aber unsere Freundschaft war ein Relikt aus einer Zeit, in der alles viel leichter gewesen war. Und mir wollte nicht einfallen, wie sich die Kluft zwischen vorher und nachher überbrücken ließe.
»Ich habe dich angerufen«, sagte Gina. »Ich rufe ständig bei dir an, aber du gehst nie dran. Was hätte ich denn sonst tun sollen?«
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte ich und versuchte, freundlich und unpersönlich zu klingen. Dabei starrte ich Löcher in meinen kleinen Notizblock. Geh doch bitte, flehte ich innerlich. Bitte, bitte, geh doch einfach wieder.
Ehrlich gesagt hätte ich liebend gern mit Gina gesprochen. Ihr alles erzählt, was vorgefallen war, um ihr mein Herz auszuschütten, jemandem, dem ich vertraute. Aber selbst sie hätte mir nicht geglaubt. Und der Gedanke, dass sie mich für verrückt hielt, war einfach unerträglich.
»Lass uns doch mal reden, ja? Wie Freundinnen. Wir sind doch noch Freundinnen, oder?«
Ich fühlte mich so schuldig. Am liebsten wäre ich unter den nächstbesten Tisch gekrochen, hätte mir die Augen zugehalten und dort ausgeharrt, bis das Restaurant schloss. Stattdessen ignorierte ich Ginas Frage und wartete weiterhin auf eine Antwort.
»Ich habe keinen Durst«, sagte Gina. »Bitte, setz dich doch, du machst mich ganz nervös, wenn du so dastehst.«
»Ich darf mich nicht setzen, ich arbeite.«
»Du arbeitest?« Sie wurde lauter und allmählich wandten sich andere Gäste nach uns um. »Jetzt arbeitest du und vor sechs Wochen bist du einfach mit Grant Davis nach Las Vegas abgehauen und hast nicht mal mir was davon erzählt.«
»Hör bitte auf«, flehte ich. Die Leute starrten uns schon an, nicht mehr lange und sie würden anfangen zu tuscheln. So lief das jedes Mal. Sie wussten, wer ich war, wie ich aussah. Als ich wie vom Erdboden verschwunden war, wurde mein Foto in den Nachrichten gezeigt und in den Zeitungen abgedruckt. Eine Gruppe wohlmeinender Nachbarn hatte sich die Mühe gemacht, das gesamte Viertel mit Vermisst-Zetteln zu plakatieren. Mindestens ein Mal pro Tag hatten wir hier im Restaurant einen Tisch mit Gaffern, die mich einfach nur beobachten wollten. Sie nuckelten ewig an ihren Drinks und nutzten es sehr lange aus, dass bei uns umsonst nachgeschenkt wurde, während sie darüber spekulierten, wo ich gewesen war und warum.
Die anderen Mitarbeiter versuchten ihr Bestes, um mich zu schützen, aber selbst auf der Straße wurde ich angesprochen und oft klingelten auch einfach wildfremde Menschen bei uns zu Hause, um schockierend persönliche Fragen zu stellen. Journalisten durchwühlten unseren Müll und befragten meine Klassenkameraden. Sie jagten meinem achtundsiebzigjährigen Großvater mit Kameras und Mikros hinterher.
Die Las-Vegas-Story hatte diejenigen zufriedengestellt, die sowieso nur an Klatsch und Tratsch interessiert waren. Wer aber wirklich wissen wollte, was passiert war, hatte nicht aufgegeben, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich konnte ihre Blicke immer und überall spüren. Genau deshalb war ich in Therapie – nicht, um über das zu sprechen, was ich erlebt hatte, das ging ja aus naheliegenden Gründen nicht. Nein, ich brauchte Unterstützung, um mit der ganzen Aufmerksamkeit fertigzuwerden. Manchmal hatte ich das Gefühl, Fortschritte zu machen. Dann wiederum gab es Situationen wie diese, in denen ich mich fragte, warum ich mir überhaupt so eine Mühe gab.
»Was ist mit dir los?«, fragte Gina. »Du wirkst so traurig.«
Ich wickelte die Schlaufe meiner Schürze so fest um meine Finger, dass sie zu pochen anfingen. »Du kapierst es einfach nicht.«
»Nein«, sagte sie. »Ich kapiere es einfach nicht. Aber ich würde gern. Red doch mit mir, Sasha. Ich hab das Gefühl, ich kenne dich gar nicht mehr.«
»Vielleicht liegst du damit gar nicht so falsch.« Ich drehte mich um, rannte zur Küche und riss mir die Schürze vom Leib, als ich durch die Schwingtür trat.
Johnny starrte mich zornig an. »Was willst du denn hier hinten? Wir haben Gäste!«
»Ich gehe nach Hause«, sagte ich und warf meine Schürze auf die Arbeitsfläche. Arme Gina, dachte ich. Noch vor sechs Wochen wäre mir nicht im Traum eingefallen, sie so sitzen zu lassen, ihr die kalte Schulter zu zeigen, wenn sie mir ganz eindeutig helfen wollte. Dabei war Gina nicht die Einzige, die das Gefühl hatte, mich gar nicht mehr zu kennen. Manchmal erkannte ich mich selbst nicht wieder.
»Deine Schicht ist noch nicht um.«
»Ist mir egal.« Wenn ich länger blieb, würde ich Gina alles erzählen. Nur damit ich dieses Geheimnis nicht länger mit mir herumtragen musste. Das Restaurant wirkte mit einem Mal so eng und bedrohlich, ich musste einfach raus. »Nikki kann übernehmen, ich muss weg.« Ich verließ die Küche, ohne Johnnys Reaktion abzuwarten. Sollte er mich doch feuern, wenn er wollte, das war mir gerade so was von egal.
Die Luft draußen war schwer und feucht, aber eine kühle Brise wehte vom Lake Michigan herüber. Ich atmete tief ein und versuchte, mich zu beruhigen. »Alles ist gut«, sagte ich, als würden die Worte wahr werden, wenn ich sie nur laut aussprach. Meine Stimme zitterte, ich hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden, zwang mich aber, weiter einen Fuß vor den anderen zu setzen.
»Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut«, wiederholte ich unermüdlich, bis die Wörter nichts mehr als eine Reihe von Buchstaben waren, die gar nichts mehr bedeuteten.
Ich schleppte mich durch das Viertel, vorbei an den Backsteinhäusern, Spielplätzen und Schaufenstern, die mir alle so vertraut waren wie mein Name, zu denen ich aber keinen Bezug mehr fand, egal wie sehr ich auch versuchte, mich an schöne Zeiten zu erinnern oder mir eine glückliche Zukunft vorzustellen. Immer hatte ich das Gefühl, mir etwas vorzumachen, mir etwas Falsches auszudenken, das ich mir nicht glauben wollte. Als ich die 57. Straße überquerte, sah ich auch schon Großvaters baufälliges viktorianisches Haus mit seinen fröhlichen kornblumenblauen Fensterläden und der breiten Veranda vor mir. Es war der einzige Ort auf der Erde, an dem ich mich sicher fühlte. Es war mein Zuhause oder zumindest das, was einem Zuhause in dieser Welt am nächsten kam.
Ich lief, ohne langsamer zu werden, am Briefkasten vorbei, weil ich davon ausging, dass Großvater die Post schon hereingeholt hatte, bis mir wieder einfiel, dass er auf einer Konferenz in St.Louis war und erst in ein paar Tagen heimkehren würde. Etwas ließ mich auf halber Treppe zur Veranda stehen bleiben und umdrehen. Ich öffnete den Briefkasten mit einer Mischung aus Aufregung und Angst, wusste nicht, was ich finden würde, war mir aber sicher, dass etwas darin auf mich wartete.
Ganz oben auf einem ordentlichen Stapel aus Briefen, Lebensmittelprospekten und Katalogen voller Dinge, die weder mein Großvater noch ich je kaufen würden, lag ein kleiner weißer Origamistern.
Ich nahm ihn heraus und ignorierte den Rest der Post, rannte ins Haus, ließ die Tür laut hinter mir ins Schloss fallen und streifte mir die Schuhe ab. Meine Hände zitterten, als ich die Stufen zu meinem Zimmer hinaufrannte. Ich schmiss achtlos meine Tasche hin, warf mich aufs Bett und schloss die Augen.
Sei von ihm, flehte ich die Universen an. Bitte, bitte, sei von ihm.
Das Letzte, was ich gesehen hatte, bevor ich den Schleier zwischen den Welten kreuzte, war, dass auf Thomas geschossen wurde. Ein Monat war seit jener Nacht vergangen. Grant sagte mir ständig in einem Ton, der bedauernd klingen sollte, aber eher hoffnungsvoll bei mir ankam, dass Thomas wahrscheinlich tot war. Er schätzte wohl, ich könnte niemals mit dem Thema abschließen oder wieder zufrieden mit meinem alten Leben sein, wenn ich weiter hoffte, dass Thomas noch lebte. Dabei hatte ich weder das eine noch das andere vor.
Langsam knibbelte ich den Stern auf und atmete tief ein. Darauf stand: Er lebt.
Sonst nichts.
Kapitel 2
»Woher hast du den?«, fragte Grant und gab mir den Stern zurück.
Es war nicht zu übersehen, dass er nur ein paar Stunden geschlafen hatte und seit Tagen dieselben Klamotten trug. Er hatte dunkle Halbmonde unter den Augen und spielte an seiner Armbanduhr herum, öffnete und schloss rastlos den Verschluss. Ich legte meine Hand auf seine, damit er aufhörte, doch nahm sie schnell wieder weg. Bewusst vermied ich es, ihn zu berühren – es war einfach zu merkwürdig.
»Der lag im Briefkasten, als ich nach Hause kam.« Ich schaute über Baumkronen und Häuserdächer hinweg in die Ferne.
Als ich mich endlich bei Grant zurückgemeldet hatte, hatte er um ein Treffen in dem Park gebeten, der direkt bei ihm um die Ecke lag. Nun saßen wir auf den Schaukeln des Kinderspielplatzes. Die Abendsonne glänzte auf den Motorhauben der geparkten Wagen, die Straßenlaternen gingen gerade an. Wenn wir in Aurora wären, würden sich längst grüne Lichtbänder am Himmel winden. Dies war jedoch eine gewöhnliche Nacht auf der Erde und am Himmel waren bloß Wolken zu sehen.
»Von wem ist der?« Grant blickte zu mir und ich hielt für einen Moment die Luft an. Schon wieder hatte ich kurz vergessen, dass er nicht Thomas war. Ich schluckte und rückte ein Stück von ihm ab.
»Das weiß ich nicht. Aber wer auch immer ihn geschickt hat, muss mit der anderen Seite in Verbindung stehen.« Ich starrte ihn an.
»Also hast du mich in Verdacht? Ja, ganz sicher, Sasha.« Grant fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, das er wachsen ließ, wodurch er Thomas definitiv weniger ähnelte. In Gedanken führte ich eine kleine Liste mit ihren Unterschieden. Trotzdem setzte mir jedes Mal das Herz aus, wenn ich Grant ansah. Insgeheim hoffte ich, dass das aufhören würde, aber vergebens. Vielleicht würde es nie aufhören. Thomas war wie ein Glassplitter, der tief unter der Haut saß – schmerzhaft, aber unmöglich zu entfernen.
»Wenn ich durch die Augen meines Analogs sehen kann, ist die Annahme, dass du das auch kannst, doch gar nicht so weit hergeholt.«
»Dass du das glauben willst, heißt noch lange nicht, dass es auch stimmt«, sagte Grant.
Ich seufzte, denn er hatte natürlich recht. Aus welchem Grund auch immer war meine Fähigkeit, durch Julianas Augen sehen zu können, einzigartig. Dr.Moss, ein Physiker, dem ich in Aurora begegnet war, hatte die Theorie aufgestellt, dass ich diese starke Verbindung zu Juliana hatte, weil mein Vater in Aurora zur Welt gekommen war. Durch diese Information war mein ganzes Leben aus den Fugen geraten – ich hatte das Gefühl, als hätte ich meine Eltern ein weiteres Mal verloren und mit ihnen den Menschen, für den ich mich immer gehalten hatte. Thomas war nicht der einzige Grund dafür, dass ich mich auf der Erde so fehl am Platze fühlte, denn ich war obendrein zur Hälfte aus Aurora, und seine Welt war gewissermaßen auch meine. Ich war noch nicht fertig mit Aurora und seit ich die Nachricht aufgefaltet hatte, wusste ich: Aurora auch noch nicht mit mir.
»Ich muss herausfinden, wer mir den Stern geschickt hat«, sagte ich. »Ich muss wissen, ob es stimmt.«
»Und dann?« Grant betrachtete mich aus schmalen Augen.
»Wie meinst du das?«
»Ich bin nicht bescheuert, weißt du?« Grant ließ den Kopf hängen, damit er mir nicht in die Augen sehen musste. So hatte ich ihn das erste Mal im Gefängnis von Farnham erlebt. Bereits dort hatte er gewirkt, als sei er geschlagen, wie der König der Highschool, der seines Throns beraubt worden war. Die Erfahrung stand ihm mit Narben ins Gesicht geschrieben, die nur für mich sichtbar waren. Als er fortfuhr, zitterte seine Stimme. Es war nicht zu übersehen, dass er sich von mir verraten fühlte. »Ich habe mitbekommen, dass du einen Weg zurück suchst, seit wir wieder zu Hause sind.«
»Und?«
»Und?« Er schüttelte den Kopf. »Ich fasse es nicht. Kannst du dich nicht mehr an das erinnern, was da drüben passiert ist? Was die mit uns gemacht haben? Wir wurden gekidnappt. Als Geiseln genommen. Willst du wirklich nur wegen diesem Typen wieder zurück?«
»Hey!«, blaffte ich. Mittlerweile hatte ich echt genug von seinen Launen. Unabhängig von den Lügen, die wir erzählt hatten, waren wir kein Paar. Genau genommen waren wir nicht einmal befreundet. Aurora war das Einzige, was uns verband. Ich schuldete ihm keine Erklärung. »Du hast keine Ahnung, was ich da drüben erlebt habe.«
»Ich wünschte, er wäre tot«, sagte Grant und ballte die Fäuste so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Vielleicht könnte ich dann aufhören, ständig über die Schulter zu gucken, aus Angst, dass sie immer noch hinter mir her sind und mich zurückholen wollen.«
»Ach, leck mich, Grant«, platzte es aus mir heraus. Es machte mich unglaublich wütend, ihn so vor mir zu sehen: völlig gesund, unverletzt und absolut antriebslos, während Thomas in Aurora leiden musste. Selbst wenn Thomas noch lebte, war das lange nicht genug. Es bedeutete nämlich längst nicht, dass er auch frei war. Wie konnte Grant sich Thomas’ Tod wünschen? Juliana hatte versucht, mir mein Leben zu stehlen, trotzdem wollte ich weder, dass sie verletzt oder gar getötet wurde. »Du bist schuld, dass überhaupt auf ihn geschossen wurde!«
»Das habe ich geahnt«, sagte Grant mit zusammengebissenen Zähnen, als müsste er sich daran hindern, noch etwas viel Schlimmeres zu sagen. »Du machst mich dafür verantwortlich.«
»Er wollte dich doch zurückschicken! Wenn du nicht die Beherrschung verloren und ihn geschlagen hättest, wären wir längst auf der Erde gewesen, als Lucas und Juliana in die Zelle gekommen sind. Dann wäre Thomas nicht verletzt worden!« So offen hatte ich das bisher noch nicht ausgesprochen, weil es mir völlig unnötig vorgekommen war. Ich konnte Grant noch so große Vorwürfe machen, das änderte ja doch nichts. Aber er hatte mit diesen sinnlosen Anschuldigungen angefangen und das wollte ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen.
»Und woher hätte ich das wissen sollen?«
Ich massierte mir die Schläfen. Da hatte er nicht ganz unrecht. »Das konntest du nicht.«
»Es tut mir leid«, sagte er, aber ich wusste nicht, ob er es ernst meinte.
»Nein, mir tut es leid«, sagte ich. »Auch, dass du Angst hast …«
»Ich habe keine Angst«, log er.
»Es tut mir jedenfalls leid, dass du das alles durchmachen musstest. Trotzdem hast du mir nicht zu sagen, was ich zu tun oder zu denken oder zu wollen habe.«
»Du bist auch nicht schuld an dem, was passiert ist«, sagte Grant. »Das weiß selbst ich.«
»Sie waren hinter mir her«, erinnerte ich ihn. »Du warst einfach nur Mittel zum Zweck, um an mich heranzukommen. Und deshalb wurdest du gequält und das tut mir leid. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, um das zu ändern, ich würde es tun.«
»Im Ernst?«
Ich zögerte. »Nein.«
»Vielleicht schuldest du mir dann doch eine Entschuldigung.« Er seufzte. »Hör mal, ich verstehe, dass du meinst, mich geht das nichts an, und vielleicht hast du sogar recht. Ich bin nicht gerade Experte darin, glücklich zu sein. Ich glaube einfach nicht, dass … Da drüben wartet nichts auf dich. Du bist von der Erde und hier gehörst du auch hin.«
»So fühlt es sich aber nicht an«, gestand ich. »Zumindest nicht im Moment. Es gibt wahnsinnig viel, über das ich mir selbst noch nicht im Klaren bin, aber in dem Punkt bin ich mir immerhin sicher.« Wir stritten uns immer wieder über das Gleiche und das war ermüdend. Grant wollte nichts lieber als vergessen, so tun, als wäre das alles nie passiert. Aus dem Grund klammerte ich mich umso heftiger an meine Erinnerungen. »Komm, ich bring dich nach Hause.« Der Gedanke, Grant nach Einbruch der Dunkelheit allein durch das Viertel gehen zu lassen, gefiel mir nicht. Ich machte mir immer Sorgen, dass er etwas Leichtsinniges tun würde.
Grant schaute sich in dem verlassenen Park um. »Hier ist es übrigens passiert. Hier hat er auf mich gewartet. Er trat hinter diesem Baum hervor und sah genauso aus wie ich. Haargenau so. Er trug sogar die gleichen Sachen. Ich habe gedacht, ich fantasiere. Und weißt du, was das Lustigste war?«
»Was?«
»Er sah aus, als hätte er genauso große Angst wie ich.«
Das war überhaupt nicht lustig. Seinen Analog zu treffen, war wie ein elektrischer Schock. Es trifft dich, als würde dir ein Speer tief in die Brust gerammt, und erweckt einen Teil von dir zum Leben, den du bis dahin nicht gekannt hast. Etwas Altes, Intensives und Ehrliches, das dir durch Mark und Bein geht. Es ist gleichzeitig wundervoll und fürchterlich. So unnatürlich und trotzdem so richtig. Dieser Mensch ist du und ist nicht du, das Gehirn braucht eine Weile, um das zu verarbeiten, und noch mal länger, um es wirklich zu begreifen. Und dann ist es meistens bereits zu spät.
»Grant«, sagte ich, weil mir plötzlich wieder einfiel, wieso wir eigentlich hier waren. »Warum hast du mich angerufen?«
Grant räusperte sich. »Ich ziehe um.«
»Du ziehst um? Wohin?«
»Mein Dad hat mir angeboten, bei ihm zu wohnen«, antwortete er. »Bis der Sommer vorbei ist.«
»Und dann?«
Er zuckte mit den Schultern. »Mal sehen.«
»Aber Los Angeles ist so weit weg.« Dann würde ich von Grant sicher nichts mehr hören. Wenn man vor etwas weglief, schaute man nicht zurück. Es würde ihm leichtfallen, den Kontakt abzubrechen. Er wartete ja geradezu darauf, bisher hatte er nur den nötigen Mut nicht aufbringen können.
Er spielte mit der Spitze seiner Chucks im Rindenmulch. »Ich kann hier nicht atmen. So halte ich sicher nicht mal ein Jahr durch.«
Unter normalen Umständen wäre Grant im Herbst aufs College gegangen, nun setzte er aber lieber noch ein Jahr aus, weil ihn allein der Gedanke ans Lernen überforderte. Das war bei mir nicht anders. Jedes Mal, wenn ich den September im Kalender näher rücken sah, bekam ich Panik. Ich in einem Unterrichtsraum voller Menschen? Da gab es doch keine Möglichkeit, sich zu verstecken.
»Was will mir denn dieser Blick sagen?«, fragte Grant und betrachtete mein Gesicht.
»Nichts«, sagte ich, weil mir die Antwort peinlich war. Sosehr es auch schmerzte, Grant anzuschauen, die Vorstellung, ihn gar nicht mehr zu sehen, tat noch hundertmal mehr weh. Er war die einzige Verbindung zu Thomas, die ich noch hatte, und der einzige Mensch auf der Erde, der zumindest in Bruchteilen verstand, was mir widerfahren war. Ohne ihn war ich wirklich allein.
Und dann verwandelte Grants Gesicht sich plötzlich, aber nicht in das von Thomas, sondern in das eines anderen Jungen. Eines Jungen, den ich nicht kannte. Ich konnte ihn nur undeutlich erkennen, so als würde ich durch eine beschlagene Scheibe schauen. Sein Mund bewegte sich, aber ich konnte zuerst nichts verstehen. Doch dann erreichte mich seine Stimme in einem Schwall: Wollt Ihr das wirklich tun? Ich wusste nicht, wie ich ihm darauf antworten sollte, wusste nicht einmal, ob ich überhaupt sprechen konnte, da hörte ich mich selbst Ja, will ich wirklich sagen, bevor sein Gesicht wieder verschwand.
»Sasha?« Grant schüttelte mich an der Schulter. Ich blinzelte, versuchte, das Gesicht des fremden Jungen zu vergessen. »Alles in Ordnung?«
»Ja, mir geht’s gut.« Vielleicht hätte ich ihm davon erzählen sollen, aber ich wusste nicht, wie ich es ihm erklären sollte. Ich konnte es mir ja nicht einmal selbst erklären. Die Visionen, die ich durch das Paraband hatte und die mich mit Juliana verknüpften, wurden immer stärker. Sie kamen nicht mehr nur in Träumen, sondern meldeten sich jederzeit und zerschnitten meine Realität. Manchmal konnte ich gar nicht mehr auseinanderhalten, was mir und was meinem Analog zustieß.
Noch dazu konnte ich manchmal nicht einmal sagen, ob die Visionen von Juliana kamen oder von jemand anderem. Diese neuen Visionen unterschieden sich nämlich von den früheren. Sie fühlten sich anders an, irgendwie beabsichtigt. Als wären es Nachrichten und nicht nur bloße Momentaufnahmen. Ich hatte zu große Angst davor, darüber nachzudenken, wer sie schicken könnte, aber ich war mir bewusst, dass irgendjemand dahinterstecken musste. Und dass weder die Visionen von Juliana noch von dieser anderen Person verschwinden würden. Dabei hätte ich alles dafür gegeben, sie nicht mehr erleben zu müssen, aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte.
»Komm«, sagte Grant und setzte sich in Bewegung Richtung Bürgersteig. »Wie wär’s, wenn ich dich nach Hause bringe? Es wird schließlich schon dunkel.«
Im Haus war es still. Normalerweise mochte ich die Ruhe, aber an diesem Abend empfand ich sie als bedrückend. Es war unheimlich ohne Großvater, der mich am liebsten gar nicht allein gelassen hätte. Aber seine übertriebene Fürsorge hatte mir allmählich den letzten Nerv geraubt, weshalb ich ihn überzeugt hatte, doch zu fahren und mir etwas Freiraum zu geben. Außerdem brauchte ich Zeit, mein Projekt abzuschließen. Und es war eine erhebliche Erleichterung, nicht verstecken zu müssen, woran ich arbeitete. Wenn ich wollte, konnte ich mich jetzt im ganzen Haus ausbreiten.