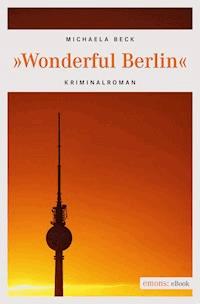11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So fremd und doch so nah
Der Arbeiterjunge Konrad schwört der schönen Selma aus reichem Hause, Medizin zu studieren, um ihre behinderte Schwester Alma zu heilen. Erst die Nazis ermöglichen es ihm, seinen Schwur zu erfüllen. Brigitte muss mit ihren Eltern gegen ihren Willen in den Westen flüchten und revoltiert gegen alles und jeden. Das treibt sie schließlich in die Arme der RAF. Andrés Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die DDR bietet dem talentierten Kunstspringer eine sozialistische Vorzeigefamilie als Ersatz. Doch seine ungeklärte Vergangenheit lässt ihn nicht los.
Drei Menschen, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts entfremdet hat. Und doch gibt es etwas, das sie untrennbar verbindet.
Kraftvoll, eindringlich, prall von Leben - ein großer deutscher Familienroman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungGedichtTEIL IKONRADBRIGITTEANDRÉKONRADBRIGITTEANDRÉKONRADANDRÉTEIL IIBRIGITTEKONRADANDRÉKONRADBRIGITTEANDRÉTEIL IIIKONRADBRIGITTEKONRADANDRÉBRIGITTEKONRADTEIL IVKONRADBRIGITTEANDRÉKONRADBRIGITTEKONRADANDRÉBRIGITTEKONRADBRIGITTETEIL VANDRÉKONRADBRIGITTEKONRADANDRÉBRIGITTEKONRADANDRÉBRIGITTEEPILOGDANKSAGUNGNACHWORTÜber dieses Buch
Der Arbeiterjunge Konrad schwört der schönen Selma aus reichem Hause, Medizin zu studieren, um ihre behinderte Schwester Alma zu heilen. Erst die Nazis ermöglichen es ihm, seinen Schwur zu erfüllen. Brigitte muss mit ihren Eltern gegen ihren Willen in den Westen flüchten und revoltiert gegen alles und jeden. Das treibt sie schließlich in die Arme der RAF. Andrés Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die DDR bietet dem talentierten Kunstspringer eine sozialistische Vorzeigefamilie als Ersatz. Doch seine ungeklärte Vergangenheit lässt ihn nicht los.
Drei Menschen, die die Geschichte entfremdet hat. Am Brandenburger Tor führen ihre Lebenswege sie zusammen, Silvester 1989.
Über die Autorin
Michaela Beck ist Autorin, Dramaturgin und Dozentin. Neben einem Kinofilm und Drehbüchern für TV-Serien, hat sie auch Radiofeatures, ein Hörspiel und einen Krimi veröffentlicht. Ihre Web-Graphic-Novel NINETTE war für den GRIMME-ONLINE-AWARD und ihr Manuskript EIN HIMMEL VOLLER ESKIMOS für den OLDENBURGER KINDER- UND JUGENDBUCHPREIS nominiert. Michaela Beck lebt mit ihrem Mann in Berlin.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023/2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Dr. Ann-Catherine Geuder, Lübeck
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
unter Verwendung eines Motivs von © Mariia aiiraM/shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4803-2
luebbe.de
lesejury.de
Für D.B., der mir direkt ins Herz gesegelt ist
Wenn der Mensch die Welt betritt,sieht er sich um, sucht seinen Platz,nimmt ihn an, nimmt ihn nicht an,sucht Verbündete, erwirbt Feinde.Er liebt ein erstes Mal, wird wiedergeliebt,und wenn nicht, so spürt er ihren Verlust,sucht womöglich die Liebe im Geheimen.Er hofft auf sie, spart sich für die eine große Liebe auf.Blind vor Sehnsucht verschwendet er die Zeit, im Vertrauen auf sie.Das formt den Menschen, macht ihn aus,so dass er ein anderer wird, ein besserer, schlechterer.In jedem Fall einer, der ohne die Liebe auszukommen glaubt.Erst im Nachhinein erkennt der Mensch,dass die Welt ohne die Liebe nicht existieren kann.Denn in unserem Verständnis wäre sie so für immer verloren.
TEILI
Wenn der Mensch die Welt betritt,
sieht er sich um, sucht seinen Platz,
nimmt ihn an, nimmt ihn nicht an,
sucht Verbündete, erwirbt Feinde.
KONRAD
Berlin
1919
Konrads Vater, Hans Sollmann, musste im Krieg fallen, damit Konrad das Mädchen Selma, die Liebe seines Lebens, treffen konnte. Noch ein halbes Jahr zuvor hatte er den Tod seines Vaters als etwas vollkommen Sinnloses empfunden, aber als Selma dann in ihrem weißen Rüschenkleid in ihrer ärmlichen Küche stand, wusste Konrad, dass der Tod des Vaters auch etwas Gutes hatte.
Hans Sollmann hatte, wohl in dem Glauben, dass sein Leben keinen Pfifferling mehr wert war – der Krieg war verloren und seine Ehe zerrüttet –, sich vor seinen verwundeten Hauptmann und in den feindlichen Kugelhagel geworfen, um dessen Leben zu retten. So sah es später Selma, so würden es alle sehen, außer Konrads Mutter und Konrad selbst. Sie wussten, der Vater löste mit seiner angeblich heldenhaften Tat nur ein Versprechen ein, das er ihnen in seinem ersten Brief von der Front im Jahr 1916 gegeben hatte: Ihr Leben würde nach dem Krieg ein besseres sein. Dass dieses bessere Leben ohne den Vater stattfinden würde, nur ohne ihn ein besseres werden konnte, hatte Konrad nicht geahnt.
Konrad war erst zehn und sein kleiner Bruder Fritz neun, als im Dezember 1918 der amtliche Brief mit der Mitteilung kam, dass Hans Sollmann »für Kaiser und Vaterland auf dem Feld der Ehre geblieben« war. Während Konrads Mutter den Brief öffnete, waren Konrad und Fritz gerade auf dem Hof, wo sie mit ihren Holzschwertern als Franzosen und Deutsche gegeneinander kämpften und wo Konrad, obwohl ihn eine Münze zum Franzosen bestimmt hatte, verlor, weil sein kleiner Bruder immer gewann, alles daransetzte zu gewinnen, auch unlautere Mittel wie Kratzen und Beißen einsetzte, was meist nicht einmal nötig war, denn Fritz war zwar kleiner als Konrad, aber viel robuster und auch ehrgeiziger.
Als Konrad und sein Bruder damals nach oben in den dritten Stock gerufen wurden, hatte ihre Mutter ganz ruhig auf ihrem Lieblingsplatz in der Küche, auf dem Kohlenkasten neben dem Herd, gesessen und zwischen zwei Zügen aus ihrer Zigarette ihre beiden Söhne seit Langem mal wieder angelächelt. Ganz ruhig angeschaut hatte ihre Mutter sie, und Konrad hatte sofort gewusst, dass irgendetwas nicht stimmte. Auf ihrem Schoß hatte ein offener Brief gelegen, also konnte der nicht vom Vater sein, denn in den letzten zwei Jahren hatte sie keinen seiner Briefe mehr geöffnet. Das hatte sie stattdessen Konrad überlassen, sollte der sich ruhig mit den törichten Versprechungen seines Vaters vergnügen, wenn er unbedingt wolle.
»Euer Vater hat seinem Hauptmann das Leben gerettet, und deshalb bekomme ich jetzt eine Witwenrente«, hatte sie mit unverhohlener Freude gesagt und wieder einen Zug von ihrer Zigarette genommen. Dann hatte sie versonnen zum Fenster hinausgeschaut, als dächte sie bereits darüber nach, was sie sich von der Rente kaufen könnte, und vergaß das erste Mal, ihre Söhne ans Händewaschen zu erinnern. Kein Wort des Bedauerns war über ihre Lippen gekommen, sie hatte nur die Mundwinkel nicht nach unten gezogen, so wie sonst, wenn sie über ihren Mann sprach, und ihn auch nicht »Mistkerl« oder »dieser Hurenbock, der euer Vater ist« genannt.
In den darauffolgenden Monaten hatte Konrad beinahe jede Nacht unter der Bettdecke geweint und die Mutter gehasst, die über den Tod ihres Mannes keine einzige Träne vergoss. Im Gegenteil. Sie war froh und erleichtert über die Todesnachricht gewesen, weil sie auf diese Weise »mit Anstand« ihren Mann losgeworden war, den sie sowieso niemals wieder in ihr Bett, in ihre Wohnung gelassen hätte, wie sie einmal Kaltmamsell Günzel beim Kartoffelschälen flüsternd anvertraute, während Konrad lauschte und vorgab, mit Fritz Zigarettenbildchen zu sortieren.
Andere Frauen, deren Männer als vermisst galten, hatten da viel weniger Glück, wie Konrad mitbekommen hatte. Die mussten sich damals sogar fragen, ob ihr Mann vielleicht im Krieg nur eine andere kennengelernt hatte. Vielleicht in Polen, in Frankreich oder in Afrika? Und gern verschollen blieb, um dort ein neues Leben mit einer neuen Frau, mit einer neuen Familie zu beginnen, ohne dass seine Frau daheim durch eine Witwenrente wenigstens ein bisschen abgesichert gewesen wäre. Solche Geschichten gab es: »Jeder Stoß ein neuer Franzos’!«, kommentierten die Frauen das gehässig und gackerten gellend.
So hatte Else Krause vom dritten Hinterhof ihrer Mietskaserne einen heimkehrenden Kameraden ihres Mannes so lange zu seinem Verschwinden ausgequetscht, bis sie durch die Unstimmigkeiten in seinen Aussagen ihren Verdacht bestätigt bekam. Konrads Mutter wäre über so eine Geschichte nicht zerbrochen, so wie diese Else, die sich bald darauf in die Spree warf mitsamt ihren beiden Kleinkindern aus zwei Fronturlauben. Konrads Mutter hätte höchstens gelacht, so wie sie immer lachte, wenn ihr das Schicksal einen Wunsch erfüllte – den Kopf in den Nacken, die Hände auf den knochigen Hüften.
Mit der Nachricht vom Tod des Vaters war für Bertha Sollmann das Thema Ehe beendet. Nie wieder sollte sie ihren Mann erwähnen. Nicht im Guten und nicht im Bösen. Er war die größte Enttäuschung ihres Lebens, hatte sie betrogen und belogen und oft seinen Lohn noch am selben Tag versoffen, während sie nicht wusste, wie sie die Jungs satt kriegen sollte.
Ihre Klagen und ihr Gezeter über den Vater kannte Konrad von klein auf, aber die wohl größte Enttäuschung bereitete der Mutter sein erster Brief von 1916. Denn der war nicht, wie sie zuerst glaubte, aus dem fernen Amerika, aus New York oder Chicago gekommen, sondern aus dem elsässischen Colmar von einem Infanterieregiment.
Wie Konrad auch, hatte seine Mutter nämlich bis dahin insgeheim gehofft, dass ihr Mann es endlich nach Amerika geschafft hätte, zwar ohne sie und die Kinder, aber immerhin nach Amerika, und bestimmt hatte sie vermutet, dass der Brief eine Einladung, ihm zu folgen, oder vielleicht sogar eine bezahlte Schiffspassage für sie und die Söhne enthielt.
Aber der »Schweinehund, der Konrads Vater war«, war nicht, nachdem Bertha Sollmann ihn im September 1914 rausgeschmissen hatte, nach Hamburg gegangen, um sich dort im Hafen eine Fahrkarte nach New York zu verdingen, so, wie es mal ihr gemeinsamer Plan gewesen war, sondern er hatte sich freiwillig in den Krieg gemeldet, wie er in seinem ersten Brief aus Colmar Bertha und den Söhnen mitteilte, die ihm nun angeblich so sehr fehlten. »Ihr sollt ihm fehlen?«, hatte Konrads Mutter gehöhnt. »Halbtot geprügelt hat er euch an dem Tag, Konrad, besoffen, wie er war. Frag die Nachbarn. Deshalb hab ich ihn rausgeschmissen, deshalb, Konrad.«
Konrad glaubte seiner Mutter kein Wort. Denn warum hätte sein Vater seine damals sechs- und fünfjährigen Söhne halbtot prügeln sollen? Was hätten sie in dem Alter schon getan haben können, um einen solchen Zorn bei ihm hervorzurufen?
»Weil er glaubte, dass ihr an seinem beschissenen Leben schuld seid«, erklärte ihm seine Mutter und fügte abschließend verächtlich hinzu: »Aber in Wirklichkeit ist er schuld an unserem beschissenen Leben.«
Konrad, der sich mit seinen zehn Jahren kaum noch an das Gesicht seines Vaters erinnern konnte, kannte viele weitere hässliche Geschichten über seinen Vater, die ihm seine Mutter immer dann erzählte, wenn er sich besonders dringend wünschte, der Vater würde endlich heimkehren, ihn in die Arme nehmen und ihm von all den Schlachten berichten, die er seit seinem Rauswurf bei ihnen als Soldat erlebt hatte.
Erst der Brief mit der amtlichen Todesmeldung hatte all seine Hoffnungen zunichtegemacht, und Konrad versuchte gar nicht erst, sich einzureden, dass sein Vater irrtümlicherweise für tot erklärt worden und ein anderer anstelle des Vaters »für Kaiser und Vaterland auf dem Felde der Ehre geblieben« war, denn zwei Wochen später hatte die Mutter die Bestätigung für die Witwenrente, und das verstand selbst Konrad mit seinen zehn Jahren, dass die Mutter die Rente niemals auf einen möglichen Irrtum hin bekommen würde. Sein Vater war tot, und abends im Bett fragte sich Konrad, worauf er jetzt noch hoffen konnte. Sein zukünftiges Leben schien so sinnlos wie der Tod des Vaters.
Bis dann Selma über seinen Hinterhof spaziert kam.
Konrad lebte gern in Prenzlauer Berg, einem Stadtteil von Berlin, in dem hauptsächlich Arbeiter und Tagelöhner in den viel zu engen Hinterhöfen wohnten und in den Vorderhäusern die etwas besseren, eher bürgerlichen Leute lebten. Besonders seine Straße, die Schönhauser Allee, mochte er, weil sie so breit war, dass dort vor ein paar Jahren sogar eine Hochbahnstrecke durch den Magistrat genehmigt worden war. Unter der konnte jeder bei Regen trockenen Fußes spazieren gehen, selbst wenn er keinen Schirm besaß, so dass die Hochstrecke schnell ihren Spitznamen »Magistratsschirm« weghatte. Doch die Schönhauser Allee war seitdem keine Flaniermeile mehr. Die richtig feinen Leute waren aus den großzügigen Wohnungen der Vorderhäuser fortgezogen, weil die Züge so viel Lärm und Dreck machten, wenn sie an den Fenstern vorbeirumpelten, dass die vornehmen Damen beim Kaffeekränzchen im Salon ihr eigenes Wort nicht mehr verstanden.
Im vierten Hinterhof der Schönhauser Allee war die Bahn jedoch nicht zu hören, nur ein leises Zittern und Vibrieren war zu spüren, das sich wellenartig nach jeder Durchfahrt im ganzen Quartier ausbreitete und das Bertha Sollmann als Ausrede nutzte, wenn Konrad und Fritz darum bettelten, hochkommen zu dürfen, weil sie so froren und vor Kälte zitterten.
»Das ist nur die Hochbahn«, rief sie dann aus dem Küchenfenster herunter und riet ihnen, sich mehr zu bewegen.
Auch an diesem Tag, dem 20. März des Jahres 1919, war es noch furchtbar kalt. Doch es war auch der Tag des Frühlingsanfangs, und Bertha Sollmann hatte am Abend zuvor Konrads an den Knien durchgescheuerte Winterhose kurzerhand abgeschnitten und bestimmt, dass die Winterhose nun seine Sommerhose sei, die Hose wäre sowieso schon »Hochwasser« gewesen. Fritz hatte gefeixt, schließlich hatte er das Problem nicht, weil er nach ihrem Vater geraten war, also nicht so schnell wuchs wie Konrad, und es war wahrscheinlich, dass er seine Winterhose auch noch im nächsten Winter tragen konnte. Konrad dagegen sollte wie ein kleiner Junge in kurzen Hosen auf den Hof spielen gehen und sich auslachen lassen! Dabei war er schon elf. Aber dann hatte außer Fritz niemand auf dem Hof mehr lange Hosen an, und alle taten so, als wäre ihnen wunderbar warm, was Fritz natürlich ärgerte, dabei bibberten sie alle vor Kälte, und ihre Zähne schlugen klappernd aufeinander wie die Glasmurmeln in ihren ausgebeulten Taschen.
Konrad und die anderen Kinder vom vierten Hinterhaus hockten frierend auf der einzigen Bank im Hof, der so schmal war, dass in ihn höchstens im Sommer zur Mittagszeit mal ein Fleckchen Sonne fiel, und warteten darauf, dass ihre Mütter sich endlich aus dem Fenster lehnten und sie nach oben zum Abendbrot riefen. Sie hatten wie immer Kohldampf, der bis in die Eingeweide schmerzte und den sie nur mit Helmuts wundersamen Kochbuchgeschichten vergessen konnten. Helmut Günzel, der einmal Pfarrer werden wollte und dessen Mutter Kaltmamsell bei einer Herrschaft war, kannte alle Rezepte aus dem Kochbuch seiner Mutter auswendig und wusste diese so schön vorzutragen, dass die gespickten Wildschweinbraten, der Karamellpudding oder die Fleischklößchensuppe wahrhaftig vor ihren hungrigen Augen auferstanden und sie all die Speisen geradezu riechen und schmecken konnten.
Das Rezept für eine mehrstöckige Cremetorte, deren Zutaten allein schon wie die Zaubergaben aus einem Märchen klangen, nahm gerade ihrer aller Aufmerksamkeit in Anspruch, als plötzlich die Hoftür des dritten Hinterhauses aufsprang und ein Mädchen in Konrads Alter zusammen mit einem Mann den Hof betrat und sich umschaute. Sie hatte halblanges blondes Haar und trug einen dunkelblauen, samtig schimmernden Mantel mit grauem Persianerkragen, der ihr bis zu den Waden reichte. Unterhalb des Mantelsaumes bauschten sich mehrere Schichten weißer Rüschen, die wohl zu ihrem Kleid gehörten und das Mädchen wie die von Helmut beschriebene Cremetorte wirken ließ, denn auf ihrem Kopf thronte ein kreisrundes schwarzes Barett, auf dem überdies eine rote Bommel saß – wie die Kirsche auf einer Schokoladencreme-Rosette.
Alle Kinder auf dem Hof starrten die wundersame Erscheinung an, während das Mädchen sie gar nicht zu bemerken schien, sondern versonnen an einem roten Apfel knabberte und die Beschriftungen über den Türen des Seitenflügels studierte. »Da ist es«, sagte sie zu dem Mann und zeigte auf den Eingang, wo Konrad und Fritz, aber auch Hertha und Helmut wohnten, und marschierte direkt darauf los. Erst jetzt sah Konrad, dass dem Mann der rechte Arm fehlte und der Ärmel seines Gehrocks leer in seiner Seitentasche steckte. In der linken Hand hielt er eine Fahnenstange, mit der er sich wie mit einem Zepter abstützte und von deren oberem Ende eine zerfetzte, schwarz-rot-goldene Fahne traurig herabhing. Um in Konrads Hauseingang zu gelangen, mussten die beiden »feinen Pinkels« an ihrer Bank vorbei. Normalerweise wäre dies nicht ohne eine freche Bemerkung von Fritz oder Elsbeth geschehen, die größte Kodderschnauze gleich nach ihrer Mutter, aber der rote Apfel des Mädchens hypnotisierte sie alle. Stumm starrten sie den Apfel an, und sie hätten alles gegeben, um wenigstens einmal an ihm zu schnuppern. Einen Apfel im Frühling, noch dazu von solch roter Farbe, hatte bisher keiner von ihnen gesehen, geschweige denn gegessen.
Das Mädchen war mittlerweile in Höhe ihrer Bank, während der Mann etwas zurückgefallen war, als Konrad plötzlich Fritz’ Bein vorschnellen sah, direkt zwischen die Lackschuhe des Mädchens. Sie stolperte und warf, mit den Händen Halt suchend, ihren roten Apfel in hohem Bogen von sich. Als hätten alle nur darauf gewartet, stürzten sich die Kinder auf den Apfel und balgten sich darum in einem dichten Knäuel aus Händen und Armen, bissen und kratzten einander, nur um als Erster an den Apfel zu gelangen.
Konrad interessierte der Apfel nicht. Er half dem fremden Mädchen auf, und als er ihr gerade beim Abklopfen ihres feinen Mantels behilflich sein wollte, rollte der Apfel wie von Zauberhand aus dem Knäuel seiner Freunde heraus, direkt vor seine Füße. Er hob den Apfel auf und reichte ihn, unter dem wütenden Geschrei der anderen, dass er das doch nicht tun könne, dem Mädchen.
Konrad hätte hinterher nicht sagen können, warum er das tat, aber das Lächeln, das ihm das Mädchen dafür schenkte, würde ihn für die zu erwartenden Frotzeleien seiner Freunde entschädigen, und keine noch so gemeine Stichelei würde es in seinem Gedächtnis jemals löschen.
Ihr Lächeln.
»Den isst du nicht mehr!«, rief plötzlich der Mann und schlug dem Mädchen den Apfel mit der Fahnenstange aus der Hand. Die anderen begannen sofort wieder, sich um den Apfel zu keilen, nur Konrad stand da und schaute den beiden nach, wie sie im Treppenaufgang verschwanden.
Natürlich ergatterte Fritz den Apfel, und während die anderen ihn anbettelten, sie doch wenigstens mal davon abbeißen zu lassen, hoffte Konrad, dass seine Mutter sie heute später als sonst zum Essen rufen würde, damit er das Mädchen, wenn es festgestellt hätte, dass es sich in der Adresse geirrt hatte – denn solch feine Leute kannte hier niemand –, noch einmal auf ihrem Weg zurück über den Hof sehen würde. Aber wie immer, wenn Konrad sich etwas besonders sehnsüchtig wünschte, machte ihm seine Mutter einen Strich durch die Rechnung. Kurz darauf ging im dritten Stock das Küchenfenster auf, und die Stimme seiner Mutter gellte über den Hof: »Konrad? Fritz?«
Mehr war nicht nötig, um Fritz sofort in Bewegung zu setzen. Er schlang unter den neidischen Blicken der anderen den Rest des Apfels hinunter, brachte sich am Eingang in Position und schrie wie üblich: »Wer als Erster oben ist, hat gewonnen!«
Konrad, der sonst die Wette immer annahm, ließ seinen Bruder einfach laufen, stieg langsam und bedächtig die Stufen nach oben und lauschte in den Treppenflur. Da war nichts zu hören außer Fritz’ keuchendem Atem, keine entgegenkommenden Schritte. Der Mann und das Mädchen hatten sich offenbar doch nicht in der Adresse geirrt und mussten nun in einer der vielen Wohnungen sein. Vielleicht bei Helmuts Mutter, die ja als Kaltmamsell mit feinen Leuten Umgang hatte. Konrad würde es bestimmt schon am nächsten Tag auf dem Hof erfahren.
Aber bis dahin hatte er immerhin ein Lächeln.
BRIGITTE
Dorf Mecklenburg
1950
»Grins nicht so blöde!«, sagte Brigitte und versuchte zu erraten, in welche Richtung Johann ausweichen würde. Links um den Tisch oder rechtsherum? Rechtsherum war Johann der Tür näher, und nur dort entlang hatte er wirklich eine Chance, ihr zu entkommen. Also machte Brigitte als Täuschungsmanöver einen Schritt nach links, um dann gleich wieder nach rechts zu rennen. Johann lief ihr auch wirklich fast in die Arme, aber dann blieb sie dummerweise mit ihrem Trägerrock an einem der Stühle hängen. Mist! Sonst wäre er ihr bestimmt nicht entkommen, sie war immer schon schneller und wendiger und vor allem pfiffiger als er gewesen, obwohl sie drei Jahre jünger war. Doch so entwischte Johann durch die Tür der guten Stube, und während Brigitte sich noch aus der Umklammerung des Stuhls hakelte, hörte sie, wie er durch die Diele zur Haustür hinausrannte und sie hinter ihm ins Schloss krachte.
»Was gibt es denn jetzt schon wieder?«, fragte ihre Mutter drohend, als Brigitte in die Diele schlitterte und knapp unterhalb der Treppe, wo die Mutter stand, zum Halten kam.
»Nichts«, antwortete sie so unbescholten wie möglich. »Wirklich!«
»Und warum kannst du dann nicht langsam laufen?«
Brigitte wollte keine Diskussion, nicht jetzt. Deshalb lächelte sie brav und ging mit kleinen Schritten die letzten paar Meter durch die Diele, nahm beherrscht ihren Mantel vom Haken und knöpfte sorgsam die schweren Metallknöpfe durch die engen Schlitze. Der muffige Geruch, der ihm entströmte, stammte vermutlich von einem toten Soldaten der Wehrmacht, und das kleine Loch oberhalb der Brust war wahrscheinlich das Eintrittsloch der tödlichen Kugel gewesen. Doch der Mantel und seine Geschichte waren ihr heute egal, denn etwas anderes beschäftigte sie viel mehr. Nämlich: Wo konnte Johann das, was er vorhin in seiner Hand vor ihr verborgen hatte, jetzt versteckt haben? In der Tasche seiner Maurerjacke? In der Stullenbüchse? Brigitte öffnete die Tür und spähte hinaus. Johann wartete mit dem Fahrrad vorm Gartenzaun und sprach leise mit dem Vater, der in seinem schwarzen Anzug und den gebeugten Schultern von hinten aussah wie ein müder alter Rabe.
»Hast du nicht etwas vergessen?«, fragte ihre Mutter, und Brigitte erwiderte schnell: »Einen schönen Tag, Mutti«, und trat aus der Tür, um die drei Stufen hinab in den Garten zu rennen.
»Deine Mütze!«
Die Mütze! Brigitte fummelte schnell die verfilzte Pudelmütze aus der Manteltasche, die Johann noch im letzten Frühjahr getragen hatte und jetzt nicht mehr benötigte, weil er diese kecke Maurerschiebermütze hatte. Sie stülpte sie sich auf den Kopf, die Zöpfe links und rechts gut sichtbar, als Zeichen ihres Mädchendaseins. Denn das mochte ihre Mutter gar nicht, dass sie aussah wie ein Junge. Als ob Jungen in Trägerröcken umherlaufen würden!
»Dir auch einen schönen Tag«, hörte sie ihre Mutter sagen und wusste, sie würde gleich wieder seufzend die Stufen nach oben in die Nähkammer steigen, wo sie die am letzten Sonntag von den Gemeindemitgliedern gespendeten Sachen sortieren und ausbessern würde. Später würde sie all die Sachen, selbst wenn sich darunter ein passender Wintermantel für Brigitte befinden sollte, einem befreundeten Pfarrer in Berlin schicken, damit er sie an die Bedürftigen in seiner Gemeinde verteilen konnte. So wie vor ein paar Monaten geschehen, als unter den gespendeten Sachen auch dieser dunkelblaue, samtweiche Mantel mit dem grauen Persianerkragen und den drei angeschliffenen Knöpfen gewesen war, der Brigitte so gut gestanden hatte. Richtig schick hatte sie darin ausgesehen! Das hatte selbst ihre Mutter zugeben müssen. Aber der Mantel hatte Agnes aus dem Nachbardorf gehört, die letzten Sommer an Diphtherie gestorben war, und sollte deshalb zusammen mit allen anderen Sachen nach Berlin geschickt werden. Denn das ging nicht an, dass jemand aus dem Dorf Brigitte in einem gespendeten Mantel sah. Wie würde das denn aussehen, hatte selbst ihr Vater ihr zu bedenken gegeben. Die Leute könnten ja sonst glauben, dass die Günzels die Spendensammlung nur für ihr eigenes Wohl organisierten, und das widerspräche der christlichen Anteilnahme, die sie den Menschen hier in Dorf Mecklenburg nahebringen wollten.
Doch da hatte der Vater den Mantel noch nicht gesehen, und Brigitte, die wusste, dass der Vater manchmal doch nachgab, wenn sie nur lang genug bettelte, versuchte ihr Glück, zog sich in der brütenden Mittagshitze den Mantel einfach über und stolzierte darin hinüber in die Kirche. Seine erste Reaktion war ganz genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Der Vater, der vor dem Altar stand und darauf ein paar Dinge ordnete, drehte sich beim Widerhall ihrer Schritte um – und erstarrte fast im selben Augenblick.
»Selma? Selma, bist du es?«, fragte er mit seltsam erschrockener Stimme, und Brigitte blieb fast das Herz stehen, als sie sein sonst so frisches Gesicht bleich werden sah.
»Ich bin’s doch, Vati! Deine Gitti!«, erwiderte sie, und einen Moment glaubte sie, ihr Vater hätte den Verstand verloren. Noch nie hatte er sie auf diese Art und Weise angestarrt, und noch nie hatte er sie Selma genannt. Doch dann, als käme ihr Vater von einer langen Reise zurück, sagte er: »Gitti! Wo… woher … hast du diesen Mantel?«
»Ist der nicht schön?« Sie drehte sich einmal um ihre Achse, damit er es noch besser sähe, und noch ehe ihr Vater etwas antworten konnte – wenn sie ihn überzeugen wollte, musste sie jetzt schnell sein –, sagte sie: »Den Mantel hat Agnes Lüderkamp von einer Cousine aus Berlin bekommen, aber dann ist sie ja an Diphtherie gestorben, und ihre Mutter hat ihn für die Kleidersammlung gespendet. Er ist natürlich desinfiziert. Findest du nicht auch, dass er mir viel besser steht als diese doofe Wehrmachtsjoppe, bei der ich mich jedes Mal grusele, weil …«
»Zieh sofort den Mantel aus!«
»Was?«
»Du ziehst diesen Mantel sofort aus, oder ich …«
Ihr Vater hatte tatsächlich nicht nur die Stimme, sondern auch die Hand erhoben und machte bedrohlich schnell einen Schritt auf sie zu. Noch im selben Moment hatte sie sich den Mantel vom Leib gerissen und war heulend aus der Kirche gerannt, vorbei an ihrer Mutter, die misstrauisch geworden und ihr gefolgt war.
Doch das zu erwartende Donnerwetter war danach ausgeblieben. Ihre Mutter blieb sehr lange beim Vater in der Kirche, und beim Abendbrot kamen die beiden auch nicht darauf zu sprechen, dass Brigitte wieder einmal die Eltern gegeneinander hatte ausspielen wollen. Sie sahen Brigitte nur so seltsam an und schienen gar die Tränen unterdrücken zu müssen.
Das alles nur wegen dieses blöden Mantels! Brigitte konnte es nicht verstehen. Schon gar nicht, als sie später auf der Suche nach ihrem Geburtstagsgeschenk entdeckte, dass ihre Mutter den Mantel gar nicht in die Kleidersammlung gegeben hatte, sondern dass er ganz hinten im Schrank hing, mit einem Sträußchen getrockneten Lavendels gegen die Motten versehen. Wochenlang hatte Brigitte geglaubt, dass ihre Eltern wegen des Mantels doch noch ein Einsehen hätten, aber an ihrem Geburtstag bekam sie eine mit Zucker bestreute Stulle zum Frühstück – nur sie allein, Johann nicht – und ein Paar selbstgestrickte braune Strümpfe, die wie die Pest kratzten. Der blaue Mantel mit dem grauen Persianerkragen und den drei angeschliffenen Knöpfen war im Schrank geblieben, und da würde er wohl auch bis in alle Ewigkeit hängen, denn Brigitte wagte es nicht, ihn noch einmal zu erwähnen. Deshalb würde sie die umgearbeitete Wehrmachtsjacke nicht nur diesen Winter, sondern auch noch nächstes Jahr tragen müssen.
Brigitte schlenderte gemächlich zur Gartenpforte. Sie hatte keine Eile mehr, denn sie würde sowieso nichts aus ihrem Bruder herausbekommen, solange er beim Vater stand. Deshalb setzte sie sich abwartend auf die kleine Mauer, die den Pfarrgarten umgab, ließ aber Johanns Gesicht nicht aus dem Blick. Sie konnte sehen, dass er dem Vater nicht zuhörte, sondern fieberhaft nach einer Ausrede suchte, die er ihr nachher auftischen konnte. Ach, wenn ihr Vater doch endlich hinüber in die Kirche ginge, um dort seine Predigt für den kommenden Sonntag vorzubereiten!
Es konnte nur ein Liebesbrief sein, dachte Brigitte, denn sie erinnerte sich plötzlich, in Johanns Hand kurz Papier aufblitzen gesehen zu haben. Natürlich, ein Liebesbrief! Warum sonst sollte ihr Bruder wegen eines Zettels solch ein Aufheben machen?
Nur, für wen war der Liebesbrief gedacht? Für die dicke Gisela, die in der Bäckerei in Bad Kleinen gleich neben Johanns Baustelle arbeitete? Oder für diese Hanne, eine Vertriebene aus Ostpreußen, die gerade eine Lehre in der Buchhaltung bei der Frau von Johanns Chef machte? Brigitte hatte Hanne noch nie gesehen, aber sie hatte Johann schon mehrmals ihren Namen mit so viel Hochachtung aussprechen hören, dass sie gleich hellhörig geworden war. Trotzdem empfand sie bei Hanne weniger Eifersucht als bei der dicken Gisela, die mit ihrem »vielem Holz vor der Hütte« und ihrem süßlichen Duft nach frischem Brot nicht nur Jungs wie Johann betörte, sondern nahezu alle Männer der Gegend. Denn Hanne würde wieder zurück nach Ostpreußen gehen, wenn der Führer erst einmal seine Wunderwaffe herausrückte, aber der Hunger, der sie alle zu Gisela trieb, würde noch eine Weile bleiben.
Einhunderttausend Mann hatte der Führer bereits aufgestellt, so hatte es der alte Berthold, der auf dem Friedhof der Pfarrei manchmal für ein paar Groschen das Ausheben der Gräber übernahm, Brigitte heimlich anvertraut und sie zur Verschwiegenheit ermahnt. Niemand durfte das wissen, noch nicht. Die Russen nicht und auch nicht die Kommunisten, die nur Speichellecker der Russen und Verräter an ihrem eigenen Vaterland waren. Sollten sie nur die Mär glauben, der Führer sei tot, sollten sie sich nur in Sicherheit wiegen und glauben, sie könnten Deutschland ungestraft plündern und schänden. Aber die würden schon sehen, die Russen und die Kommunisten, wenn der Führer wie Phönix aus der Asche auferstünde und zurückkäme und sie allesamt mit seiner Wunderwaffe, die er sich genau für solch eine Aktion aufgespart hatte, zum Teufel jagen würde. Und Onkel Konrad, über den, seit die Kommunisten an der Macht waren, nicht mehr im Pfarrhaus gesprochen wurde – jedenfalls verstummten die Eltern jedes Mal, wenn Brigitte ihn nur erwähnte, und gingen zu einem anderen Thema über –, Onkel Konrad würde in seiner strahlenden Uniform eines dieser Bataillone anführen und sie alle befreien.
Onkel Konrad würde die Ordnung im Dorf wiederherstellen, hatte der alte Berthold gesagt, und der musste es wissen, denn er war von Anbeginn an in der Partei gewesen und hatte damals als oberster Befehlshaber des Dorfes bis zuletzt mit ihr und den anderen Kindern das Dorf gegen die Russen verteidigt. Alle anderen hatten sie da schon im Stich gelassen und lieber die Bettlaken rausgehängt. Und hätten die Eltern sie nicht alle nach Hause geholt, hätten sie den Krieg zwar auch nicht gewonnen, aber sie wären als Helden gestorben und müssten nun nicht mit dieser Schmach leben.
»Brigitte! Träum nicht!« Johann hatte sein Fahrrad bereits auf den Weg geschoben und schaute sie mahnend an. Ihr Vater musste wohl schon in der Kirche sein, denn er war nirgends mehr zu sehen. Brigitte setzte sich auf die Querstange, während Johann den Lenker festhielt. Dann nahm er etwas Anlauf und sprang selbst auf den Sattel.
Brigitte mochte das morgendliche Fahrradfahren zur Schule, genoss die Nähe ihres Bruders, dessen von Tag zu Tag stärker werdende Arme sie links und rechts sicher einrahmten und dessen Wange, wenn sie nach vorne auf den Weg sah, manchmal die ihre berührte.
Johann mochte das nicht, jedenfalls nicht mehr, dabei waren sie immer so zur Schule gefahren, seit es wieder Schule gab. Doch vor einer Woche hatte er sie das erste Mal gebeten, vor dem langen Anstieg zur Schule abzusteigen und auf dem Gepäckträger Platz zu nehmen, weil sie angeblich so leichter den Berg nehmen konnten. Sie hatte sich darauf eingelassen, obwohl es auf dem Gepäckträger viel unbequemer war und sie aufpassen musste, dass ihre langen Spinnenbeine weder die Straße berührten noch in die Speichen kamen, und mit beiden Armen seine Hüfte umschlungen. So hatten sie den steilen Anstieg bewältigt, auf dessen höchstem Punkt die alte Volksschule stand, ein dunkelroter Backsteinbau, der ’45 ein stark umkämpfter strategischer Punkt gewesen war und von dem nach dem Krieg als gemeinsames Aufbauwerk der Gemeinde zunächst nur das erste von drei Geschossen wieder notdürftig hergerichtet worden war.
Doch es gab noch eine Veränderung zwischen ihr und Johann seit der letzten Woche. Ihr Bruder hatte sich erstmalig nach ihrem üblichen Abschiedskuss vor der Schule nicht nur verächtlich den Mund abgewischt, als würde sie neuerdings wie ein Kleinkind sabbern, sondern er hatte sich auch verschämt nach den beiden Mädchen aus der Achten umgesehen, die vor der Schule standen, als bräuchten sie eine Extraeinladung. Und so war es praktisch jeden Tag seit der letzten Woche gegangen. Immer musste Brigitte vor dem Anstieg auf den Gepäckträger wechseln, und immer standen die beiden aus der achten Klasse da, und ihr Bruder war rot bis über beide Ohren, aber bestimmt nicht von der Anstrengung, die ihm der kleine Berg abverlangte. Und deshalb hatte sie Johann auch verpetzt, als die Mutter vor zwei Tagen wegen ihrer Schuhe geschimpft hatte und wieder nur die Schuld bei Brigitte und ihrem Temperament gesucht hatte. Da hatte sie gesagt, dass Johann am Zustand ihrer Schuhe schuld war, denn natürlich waren ihre Schuhe doch in die Speichen gekommen und hatten am Abend ausgesehen, als wären die Dorfköter über sie hergefallen. So bekam Johann die Schelte und das Verbot, Brigitte jemals wieder auf dem Gepäckträger zu transportieren.
Trotzdem ließ Johann sie weiter vor dem Anstieg hinten aufsteigen, und Brigitte musste noch mehr aufpassen, dass ihre Füße nicht in die Speichen kamen, denn sie hatte nur noch Strümpfe an. Ihre Schuhe hingen ihr an den zusammengeknoteten Schnürsenkeln um den Hals, damit sie heil blieben und die Mutter nichts mehr sagen konnte. Dafür bekam Brigitte sonntags Johanns Pudding. Der war zwar eigentlich zu wenig dafür, sich dem Verbot der Mutter zu widersetzen und dafür Schelte und einen durch die Speichen abgehackten Zeh zu riskieren, aber doch ein gewisser Anreiz. Und so streckte sie die Beine möglichst weit von sich, um das Risiko, wie eine der bösen Stiefschwestern von Aschenputtel zu enden, möglichst klein zu halten.
Doch heute dachte sie nicht an abgehackte Zehen, sondern an den Zettel in Johanns Hand. Jedenfalls würde sie ihn danach fragen, noch bevor sie die Schule erreichten, und dann sollte Johann besser eine gute Ausrede parat haben.
Als sie durch das Waldstück vorm Anstieg fuhren, wollte Brigitte gerade die Frage stellen, da tauchte am Ende des Weges ein Geländewagen mit Russen auf – gut zu erkennen wegen der Staubwolke, die ihn umgab –, und der nahm vorerst Brigittes und wahrscheinlich auch Johanns ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, denn Johann fuhr instinktiv langsamer, so als könnte er allein dadurch den Russen weniger auffallen.
Es war immer etwas heikel, Russen zu begegnen. Manchmal taten sie nichts, hielten nicht einmal an, aber manchmal nahmen sie einem das Fahrrad weg, einfach so, weil sie Russen waren und die Macht dazu hatten, wie der alte Berthold sagte. Und manchmal schenkten sie einem auch etwas – ein Lächeln, ein Brot –, so wie im Winter vor zwei Jahren, der besonders hart gewesen war und die Menschen, die knapp den Krieg überlebt hatten, frieren und hungern ließ. Wenn die Russen kein Erbarmen mit ihnen gezeigt hätten, wären die Günzels glatt verhungert, die, weil sie nur Pfarrersleute waren und nichts mit den eigenen Händen schufen, auf die freiwilligen Gaben der Bauern ringsum angewiesen waren. Die blieben aber in diesem harten Winter ’48 aus, weil sich jeder selbst der Nächste war und die Bauern durch die häufigen Lebensmittelrazzien auch kaum etwas zu beißen hatten. Irgendein russischer Offizier hatte sich bei der Durchfahrt durch ihr Dorf jedoch gefragt, wovon sich eigentlich der Pfarrer und seine Familie ernähre. Wie der Weihnachtsmann persönlich war er dann eines Tages an ihrer Tür erschienen und hatte ihnen eine Kiste voller Lebensmittel überreicht und als Gegenleistung nur verlangt, dass ihr Vater ihm die Beichte abnehme, was eigentlich gegen seinen Glauben ging, da er ja Protestant und nicht Katholik war, was aber dem Russen – und ihrem Vater am Ende auch – völlig egal war, denn er verstand sowieso nicht, was der russische Offizier ihm da unter Tränen beichtete. Auch der Russe verstand kein Wort von dem, was der Pfarrer redete, jedenfalls war es nicht die Absolution, die ihm ihr Vater erteilte, wie er später seiner Familie gestand, auch wenn der Russe das glaubte. Und manchmal, manchmal verschenkten diese unberechenbaren Russen angeblich sogar ein Fahrrad, obwohl das schwer zu glauben und nur in Filmen zu sehen war. Propagandafilme, nannte der alte Berthold diese Filme, die im wieder notdürftig hergerichteten Ballsaal des Adlers gezeigt wurden, der nun ein Kreiskultursaal des Volkes und gleichzeitig Sitz der russischen Kommandantur in der Kreisstadt war.
Der russische Geländewagen war, ohne von ihnen überhaupt Notiz zu nehmen, vorbeigefahren, und Johann trat wieder kräftiger in die Pedale. Brigitte schaute in das bunte Dach aus Blättern über ihnen, das sich an einigen Stellen schon zu lichten begann, und fand den Moment gekommen, Johann endlich nach dem Zettel zu fragen.
»Das ist nur eine Nachricht für Dieter. Ich will ihn morgen Abend am See treffen«, sagte Johann, nicht gerade wie aus der Pistole geschossen, wie Brigitte es erwartet hatte, sondern langsam, überlegend, eigentlich so wie sonst auch, wenn er bemüht war, seiner kleinen Schwester eine ernsthafte Antwort zu geben. Brigitte war einen Moment verunsichert und versuchte Johann in die Augen zu schauen, dann würde sie ja sehen, ob er die Wahrheit sagte oder nicht, aber Johann hielt den Blick fest auf den Weg vor ihnen gerichtet.
»Und warum hast du dann den Zettel vor mir versteckt?«
»Weil du nicht alles wissen musst und deine Neugier beherrschen lernen sollst.«
Das war ganz klar ihr großer Bruder, der schon bald fünfzehn werden würde und deshalb glaubte, sich noch oberlehrerhafter als ihr Vater oder dieser Albrecht aufspielen zu können. Wie sie ihn in solchen Momenten hasste! Aber sie ließ sich nicht einschüchtern, nicht von ihrem Bruder, der so angestrengt auf den Weg schauen konnte, wie er wollte. Brigitte wusste genau, dass mit dem Zettel etwas nicht stimmte, sonst hätte er nicht solch einen Zirkus darum gemacht.
»Warum sagst du Dieter nicht einfach, dass du ihn am See treffen willst? Er ist doch in deiner Brigade.«
Wieder verweigerte Johann ihr den Blick. »Er ist krank, deshalb will ich seiner Schwester den Zettel geben.«
Dieters Schwester? Das war doch eine von den beiden Mädchen, die am Morgen immer vor der Schule standen. Die aus der achten Klasse. Diese Helga!
Nun war Brigitte alles klar. Sie brauchte keinen Blick mehr von Johann, um zu wissen, dass er sie anlog, denn wenn Dieter krank war und nicht zur Arbeit gehen konnte, dann würde ihn seine Mutter ganz bestimmt nicht abends an den See lassen. Johann wollte sich mit dieser Helga verabreden! Und da heute der letzte Schultag vor den Herbstferien war, musste er ihr schreiben, wenn er sie in den nächsten Tagen sehen wollte.
»Ich schwöre: Der Zettel ist für Dieter«, sagte Johann, und das machte sie nur umso wütender.
»Was ich von deinen Schwüren zu halten habe, weiß ich ja«, erwiderte Brigitte leise und bekam dafür endlich einen Blick von ihrem Bruder.
»Mein Gott, Gitti! Da war ich sechs! Da konnte ich doch noch nicht wissen, dass Bruder und Schwester nicht heiraten dürfen!«
Konnte er nicht, wirklich nicht, aber das hatte sie auch nicht gemeint, als sie seinen Schwur anzweifelte. Dort oben vor der Schule hatte Johann damals im April ’45 geschworen, dass er bis zu seinem Tode für den Führer kämpfen würde, und nun wollte er davon nichts mehr wissen, sondern behauptete sogar, nicht er, sondern Berthold und die anderen würden lügen. »Denn der Führer ist tot, Gitti. Er hat sich feige davongeschlichen, anstatt dafür einzustehen, dass er Deutschland ins Elend gestürzt hat mit seiner Machtbesessenheit.«
Das war für Brigitte nichts Neues, auch die Eltern hatten das schon behauptet und die Lehrer in der Schule sowieso. Aber die mussten so reden, damit die Kommunisten sie nicht bei den Russen denunzierten und sie dann an die Wand stellten. Dass der Führer tot sei, war aber nur ein Trick, sagte der alte Berthold, um seine Anhänger auf die Probe zu stellen, ob sie ihren einstigen Treueschwur auch ernst nahmen, so wie sie, die eine der jüngsten unter seinen treuen Anhängern war. Warum schwor man denn sonst bei seinem Leben? Das hatte sie auch Johann gefragt, von dem nicht nur sie, sondern auch der alte Berthold enttäuscht war.
»Berthold ist nicht ganz richtig im Kopf, Gitti«, sagte Johann, »aber die anderen, die sollten es mittlerweile besser wissen. Die belügen dich!« Und dann hatte Johann noch gesagt, dass sie sich von denen und besonders vom alten Berthold fernhalten sollte.
Damit entlarvte sich ihr Bruder aber nur selbst, dachte Brigitte, denn das waren genau die Sprüche der Speichellecker, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus waren und ihr Fähnchen nach dem Wind drehten, wie der alte Berthold sagte und dabei immer angeekelt ausspuckte.
Schweigend fuhren sie weiter, jeder seinen Gedanken nachhängend, bis sie den Wald hinter sich und den Anstieg endlich vor sich hatten. Johann hielt an und ließ Brigitte absteigen. Sie zog sich die Schuhe aus, verknotete die Schnürsenkel und hängte sich die Schuhe um den Hals. »Du willst mit Helga an den See, ja?«
Johann schnappte ertappt nach Luft. »Selbst wenn, Gitti. Das geht dich nichts an.«
Das ging sie nichts an? Dass Johann ein Mädchen, das zwar schon in der Achten war, aber trotzdem schlechter rechnete als Brigitte, am Abend am See treffen wollte?
Dabei hatte sie ihn doch noch nie verraten! Nicht, als Johann damals heimlich gegen den Willen der Eltern der HJ beigetreten war und sie, seine Schwester, ihm die ganzen Ausreden erfand, weil er nicht genügend Fantasie dafür hatte. Und auch nicht, als Johann mit dem alten Berthold und den großen Jungen der umliegenden Dörfer hinauf zur Schule ging, um dort auf eigene Faust den strategisch wichtigen Punkt unterhalb der Mühle gegen die Russen zu verteidigen. Bis zum letzten Sommer waren sie unentwegt zusammen gewesen, kaum für Stunden getrennt, und jetzt sollte ihr Bruder und die Dinge, die ihn bewegten, sie plötzlich nichts mehr angehen?
Brigitte war empört, und doch ahnte sie, dass Johann recht haben könnte. Ihre Mutter hatte ihr erst letztens erklärt, dass ihr großer Bruder bald schon ein richtiger Mann sein und seine eigenen Erfahrungen machen würde, bei denen sie nicht immer dabei sein könne. Warum das nicht ginge, hatte ihre Mutter nicht weiter ausführen wollen, nur von Brigitte gefordert, Johann eine verständnisvolle kleine Schwester zu sein, nur dann würde er sie weiter lieben wie bisher.
»Vielleicht solltest du vorher küssen üben«, sagte Brigitte also wie eine verständnisvolle Schwester. Johann schaute sie erstaunt an.
»Ich meine, wenn du dich mit dieser Helga am See triffst, erwartet sie ganz bestimmt, dass du sie küsst.«
»Meinst du wirklich?«
Johann schien an diese Möglichkeit tatsächlich nicht gedacht zu haben, und das zeigte nur wieder einmal, wie wenig Fantasie er im Gegensatz zu Brigitte besaß. Dabei hatte er ebenso wie sie diese Filme im Kreiskultursaal gesehen, und wenn es auch Propagandafilme gewesen waren, wie der alte Berthold behauptete, ein bisschen von einem Liebesfilm hatten sie auch, jedenfalls gab es da auch immer eine Frau für den russischen, heldenhaften Soldaten, die auf ihn wartete und der er sich entgegensehnte, auch wenn er erst einmal die bösen Deutschen besiegen musste und sie erst ganz am Ende des Films wiedertraf, wo er sie zuvor aber noch aus einer brenzligen Situation retten musste, in der sie manchmal sogar starb, weil alles schiefging. Aber der russische Soldat küsste sie trotzdem noch.
»Hast du denn schon mal geküsst?« Johann sah sie skeptisch an.
Natürlich hätte Brigitte jetzt lügen und behaupten können, dass sie es schon getan hätte. Johann konnte nicht wissen, mit wem sie ihre Nachmittage verbrachte, seitdem er es vorzog, seine Freizeit in der Kreisstadt mit den Kollegen vom Bau zu verbringen, aber würde er ihr glauben?
»Nein«, erwiderte sie deshalb wahrheitsgemäß, »aber ich muss es auch lernen.«
Johann machte große Augen. »Du hast einen Freund? Du bist erst elf!«
Brigitte verkniff sich das Lachen, weil das »elf« wie ein Quieken aus seinem Mund gekommen war und sie als verständnisvolle kleine Schwester nicht lachen sollte, nur weil ihr Bruder ein Mann wurde und im Stimmbruch war.
»Und wenn schon«, sagte sie. »Das geht dich nichts an.« Patt.
Wenn Johann etwas mochte, dann, dass Brigitte so schnell von ihm lernte und seine eigenen Argumente gegen ihn verwandte. Das würde seine Rhetorik schärfen, meinte er immer, und auch jetzt grinste er anerkennend.
»Also gut«, sagte er, »Was ist schon dabei. Schließlich sind wir nur Bruder und Schwester. Du hilfst mir, und ich helfe dir.«
Dann aber war doch etwas dabei gewesen, und deshalb war Brigitte nicht mehr auf den Gepäckträger gestiegen, und Johann hatte auch gar nicht lange darum gebeten. Auch er schien nach ihrem »Trainingskuss« alleine sein zu wollen und war schnell aufs Fahrrad gestiegen und den langen Aufstieg in einem Affenzahn nach oben geradelt. Brigitte hatte noch einen Moment dagestanden, ganz benommen war sie gewesen, und sie hatte lange die Felder betrachtet, ohne sie wirklich zu sehen.
Erst als sie glaubte, dass Johann über die Kuppe des kleinen Hügels geradelt sein musste, wo diese Helga nun diesen Zettel mit der Verabredung von ihm entgegennehmen würde, folgte sie ihm langsam.
Neulehrer Albrecht sagte nichts, als Brigitte mit erheblicher Verspätung in die Klasse kam und sich, ohne diese Helga eines Blickes zu würdigen, in ihre Bank setzte. Er durfte nichts sagen. Er durfte auch nicht mit dem Lineal oder einem Rohrstock schlagen, deshalb war er ja hier und der alte Jorges pensioniert, weil er den Dorfkindern Bildung ganz ohne Strafen angedeihen lassen sollte, so sahen es die neuen Richtlinien vor, die der alte Jorges nicht mal bei Androhung von Strafe hatte beachten wollen und deshalb Anfang September von den Russen entlassen und in Pension geschickt worden war.
Sie hatten Mathe, und während Albrecht die Schüler von der ersten bis zur dritten Klasse Birnen und Äpfel zusammenzählen ließ, die von der vierten bis zur sechsten Klasse Teilaufgaben lösten, holte er die beiden Mädchen aus der siebenten und achten Klasse an die Tafel und versuchte, ihnen die Prozentrechnung zu erklären. Mein Gott, wie diese Hühner sich anstellten! Besonders diese Helga! Dabei hatten sie die ganze Prozedur schon mindestens fünfmal bei den Älteren mit anhören können. Seit fünf Jahren, so lange, wie Brigitte in diese Schule ging, hatte der alte Jorges denen aus der Siebenten und Achten die Prozentrechnung erklärt. Nein, im ersten Jahr nach dem Krieg nicht, da hatte es keine Schüler in der siebten und achten Klasse gegeben. Hermann, der in der Siebenten hätte sein müssen, war kurz vor Kriegsende an Typhus gestorben, und der blonde Hein, der nach dem Krieg in die Achte gemusst hätte und schon einmal sitzen geblieben war, war noch kurz vor Schluss eingezogen worden und hatte sein Leben für den Führer gegeben.
Also mindestens schon viermal hatten die beiden Puten da vorn etwas über Prozentrechnung gehört, und es war davon nichts bei ihnen hängen geblieben. Sie starrten nur erschrocken auf die Zahlen und lehnten sich, immer wenn Albrecht sie etwas fragte, kichernd aneinander, als müssten sie sich gegenseitig stützen, um nicht aus lauter Blödheit umzufallen.
Dann in der zweiten Stunde sprach Albrecht über die neuen Grenzen in Europa und hatte diese in die alten Wandkarten aus der Vorkriegszeit mit einem Stück Kreide einzuzeichnen begonnen. Diese dumme Helga, wie Brigitte aus dem Augenwinkel sah, hatte das Gesagte andächtig mit ihrem Bleistift in ein Schreibheft notiert, die nur die aus der Siebenten und Achten hatten, bis zur Sechsten hatten sie allesamt Schiefertafeln, weil Papier noch Mangelware war.
Es war nicht der Neid auf dieses Schreibheft, der Brigitte den Finger und, als sie von Albrecht das Zeichen zum Sprechen bekam, die Stimme erheben ließ. Sie hatte zu Hause genügend Schreibhefte, und wenn es etwas in der Pfarrei gab, dann war es Papier. Deshalb hätte sie überhaupt nicht sagen können, warum sie plötzlich ihres und Bertholds Geheimnis preisgeben wollte, und Neulehrer Albrecht verstand auch nicht gleich, was sie meinte, als sie sagte, dass er vorsichtig mit den Wandkarten umgehen solle, denn die würden noch gebraucht. Erst als Albrecht das näher erklärt haben wollte und seine Stirn in Falten legte, hatte Brigitte schließlich hinzugefügt: dann nämlich, wenn der Führer zurückkäme und die alte Ordnung wiederherstellte, und damit auch die alten Grenzen.
ANDRÉ
Ostberlin
1976
André starrte auf die Europakarte an der Wand und betrachtete den großen roten Fleck, den die sozialistischen Staaten darauf bildeten. Da unten, kurz vor der blauen Türkei, war Bulgarien. Doch wo war die Wüste? Diese bescheuerte Wüste, in der er gewesen war und ein Maschinengewehr in den Händen gehalten hatte! Das bildete er sich nicht ein, das wusste er, da konnten die anderen ihn noch so auslachen und verspotten: »Ein Maschinengewehr? Eine Kalaschnikow? Was für ein Spinner, dieser Rothemark!«
Was hatte sich André gefreut, in die fünfte Klasse zu kommen und endlich Erdkunde zu haben. Noch am letzten Schultag vor den Sommerferien hatten ihn die neuen Bücher fürs nächste Schuljahr mehr interessiert als sein Zeugnis, das nichts an Überraschungen bereithielt, außer vielleicht bei den Kopfnoten, da hatte er mit einer Vier in Betragen gerechnet und immerhin eine Drei bekommen.
Besonders auf das Erdkundebuch und auf den großen Atlas, der dazugehörte, war er gespannt gewesen, denn dann würden ja alle sehen, dass er recht hatte. Die zu Hause hatten nur einen veralteten Atlas, und die waren sowieso auf Onkel Fritz’ Seite, wenn es um die Wüste ging, die angeblich nur der Strand bei Burgas war, wo er und seine Adoptiveltern Urlaub gemacht hatten. Aber Burgas lag am Schwarzen Meer! Und in der Wüste, in der er vor dem Tod seiner Eltern gewesen war, gab es kein Meer! Das wusste er genau, auch wenn er kein rechtes Bild von dieser Wüste vor Augen hatte. Auch nicht von seinen Eltern. Kein einziges Bild – wegen des Schocks, hatte ihm Onkel Fritz damals erklärt, und weil er erst fünf gewesen war, als der Unfall passierte.
Aber wie sich die Wüste angefühlt hatte, daran konnte er sich erinnern. Sie war heiß und trocken, und von der Sonne hatten ihm die Augen gebrannt. Und da war auch so ein Geruch in der Luft gewesen, ein ganz bestimmter Geruch, den er nicht beschreiben konnte, aber den er schon mehrmals in seinen Träumen gerochen hatte und der mit nichts zu vergleichen war. Schon gar nicht mit diesem Geruch nach Seetang und Salzwasser, den die Rothemarks ihm im letzten Urlaub an der Ostsee präsentierten: Nein, so hat die Wüste auf keinen Fall gerochen!
Die Rothemarks hatten sich damit herauszureden versucht, dass das riesige Schwarze Meer vielleicht doch etwas anders rieche als die kleine Ostsee, dort gab es ja auch Palmen und an der Ostsee nicht, dort herrsche ein ganz anderes Klima. Aber auch in Burgas würde es nach Salzwasser riechen, hatte er beharrt, da wäre er sich ganz sicher, und in seiner Wüste rieche es nicht nach Salzwasser! Punkt. Schließlich hatten seine Adoptiveltern ihm zugestimmt, aber nur, damit er endlich einsähe, dass es in Burgas – in ganz Bulgarien – keine einzige Wüste gab.
Das hatte er in der letzten Stunde der vierten Klasse an seiner alten Schule in Berlin-Mitte dann tatsächlich einsehen müssen. Auf jedem Platz hatten bereits die Lehrbücher für die fünfte Klasse gelegen, und er hatte sich sofort den Atlas gegriffen und jede bescheuerte Karte darin eingehend studiert, auf der die Volksrepublik Bulgarien abgebildet war. Nirgends eine Wüste! Er hatte auch hinten im Register unter »Wüste« nachgeschlagen und ganze drei Vermerke gefunden, aber keine der Wüsten befand sich in Bulgarien. Und während die Gruppenratsvorsitzende zu seiner Verabschiedung an die Kinder- und Jugend-Sportschule, ein selbst geschriebenes Gedicht vortrug, in dem sein »Wüstenfimmel« natürlich erwähnt wurde und wie beabsichtigt einen Lacher bekam, da beschlich ihn der Gedanke, dass Onkel Fritz sich geirrt haben könnte: Er hatte André nicht aus Bulgarien aus dem Krankenhaus abgeholt, sondern vielleicht aus der Mongolei! Dort jedenfalls gab es eine Wüste, und die Mongolei war auch ein sozialistisches Bruderland, also vielleicht hatten seine Eltern dort mit ihm Urlaub gemacht, bevor sie …
Onkel Fritz war richtig sauer gewesen, als André ihn gleich am nächsten Tag wegen »dieser idiotischen Wüste« belästigte, und André musste ihm am Ende sein Pionierehrenwort geben, nie wieder von der Wüste anzufangen und sie schon gar nicht in seiner neuen Klasse an der KJS zu erwähnen.
»Du willst dich doch nicht gleich am Anfang lächerlich machen?«, hatte Onkel Fritz in einem Tonfall gesagt, als stünde das außer Frage, dabei war es André eigentlich vollkommen egal. Er hatte wegen seines sogenannten »Wüstenfimmels« und besonders wegen des Maschinengewehrs schon so viel Spott über sich ergehen lassen müssen, so viele Einträge von den Lehrern erhalten und so viele Schläge dafür bekommen – weil es eben nicht sein konnte, dass ein fast Fünfjähriger mit einem Maschinengewehr herumballerte, schon gar nicht in einem bulgarischen Urlaubsort wie Burgas –, dass André die Meinung seiner neuen Mitschüler wenig kratzte.
Trotzdem würde er ihnen nichts von der Wüste und dem Maschinengewehr erzählen, nein, er würde besser seine neue Klassenlehrerin fragen, Frau Sienha, bei der sie Russisch und Erdkunde hatten. Die stand nämlich gerade vorn am Lehrertisch und sagte, dass sie, ihre neuen Schüler, mit jeder Frage, jedem Problem zu ihr kommen könnten. Auch bei schwierigen Situationen im Elternhaus sollten sie ruhig ihr Herz bei ihr ausschütten. Dabei verweilte ihr mütterlicher, liebevoller Blick einen Moment bei den drei Jungen mit den platten Nasen. Das mussten die Boxer sein, dachte André, über die sich Burghard am Abendbrottisch so aufgeregt hatte, weil er nicht wollte, dass André mit den Kindern irgendwelcher Assis in einer Klasse war, und er doch nichts dagegen hatte tun können, obwohl er der berühmte Rothemark war.
»Was sind Assis?«, hatte André damals gefragt, obwohl er beim Essen nicht sprechen sollte, und Doris Rothemark, die André ohne ihren Mann vielleicht gemocht hätte, hatte sofort nervös mit den Augen zu klimpern begonnen, so viel Schiss hatte sie vor dem großen Burghard. Doch dessen Wut über die Assis in Andrés zukünftiger Klasse war so groß gewesen, dass er die Ungezogenheit seines Adoptivsohns glatt überhört hatte und nur das Augenklimpern wahrnahm. »Ist doch aber wahr«, hatte er einlenkend gebrummt, weil das Klimpern auch ein Zeichen von Doris war, »vor dem Kind« nicht so zu reden.
»Ist doch aber wahr«, hatte er noch mal gebrummt und hinzugefügt: »Leute, die ihr Kind methodisch verprügeln lassen und das Sport nennen, können doch nur Assis sein.«
André hatte daraus immerhin gelernt, ohne dass er die Frage noch einmal stellen musste, dass Doris und Burghard keine Assis waren, denn das Wort »Methode« hatten sie einmal im Deutschunterricht nachgeschlagen, als sie den Umgang mit Nachschlagewerken übten. »Methodisch« bedeutete demnach: planmäßiges, folgerichtiges Handeln oder Vorgehen. Burghard aber prügelte niemals methodisch, jedenfalls hätte André nie sagen können, wann und warum er eine gewischt bekam. Oder wann gar der Handfeger dran war.
Obwohl.
Der Handfeger hatte irgendetwas mit der verstrichenen Zeit zu tun, die zwischen dem Zeitpunkt lag, an dem André etwas ausgefressen hatte, und dem Zeitpunkt, an dem Burghard seines Sohnes habhaft wurde. Zwischen beiden Zeitpunkten konnte sich seine Wut dermaßen steigern, dass sie durch eine schnelle Ohrfeige nicht zu stillen war, so dass dann der Handfeger zum Einsatz kam. Gewöhnlich erwartete er André in diesen Fällen bereits mit dem Handfeger an der Tür. »Nicht ins Gesicht!«, rief Doris dann, bevor André ihm in die hintere Ecke des Flurs, in die Hobbykammer, folgen musste, weil die praktischerweise an der Außenwand des hellhörigen Neubaus lag. Außerdem übertönte die Bohrmaschine, die für diesen Zweck wohl extra angeschafft worden war und jedes Mal zuvor angeschaltet wurde, jedes Geräusch.
»Ej, Zwerg! Du bist dran!«
Ein Junge, der einen ähnlich grünen Schimmer im blonden Stoppelhaar hatte wie André, aber schon fast so groß wie Burghard war, hatte sich zu André in der letzten Bank umgedreht und grinste ihn von oben herab an, obwohl ihm das einige Schwierigkeiten bereiten musste, so fest schlang sich das blaue Halstuch um seinen muskulösen Hals, so knapp saß ihm die viel zu enge Pionierbluse, die sie alle am ersten Schultag zu Ehren des Weltfriedenstages trugen. André stand schuldbewusst auf und war im Stehen gerade mal so groß wie diese »Flosse« vor ihm, denn dass es sich bei dem Jungen um eine solche handelte, war vollkommen klar. Erstaunlich war nur, dass er trotz seiner Größe genauso alt wie André sein musste, also höchstens elf Jahre. Auf keinen Fall war er zwischendurch sitzen geblieben, denn um auf die Sportschule zu dürfen, musste man nicht nur gut in seiner Sportart sein, sondern auch in der Schule.
»Dieses ›Zwerg‹ will ich nicht noch einmal hören«, rief Frau Sienha vom Lehrertisch aus und begann langsam, im Watschelschritt einer Exturnerin, auf André zuzuschreiten.
»Ihr werdet noch lernen, dass es bei einer Sportart nicht allein auf euer Talent, eure Ausdauer oder eure Disziplin ankommt, sondern dass euer ganz spezieller Körperbau mindestens genauso eine wichtige Voraussetzung für eure sportlichen Leistungen ist. Oder hast du eine Ahnung« – Frau Sienha fixierte aus schmalen Augen die Flosse vor André –, »warum es von Vorteil sein könnte, dass dein neuer Klassenkamerad hier kleiner ist als du?«
Die Flosse schwitzte und schien keine Luft übrig zu haben, um zu antworten. Dafür zischelte vorn jemand: »Weil er als Hüpfer Saltos machen muss.« Die Mehrheit der Klasse lachte, auch die drei Plattnasen, nur die zehn Kunstspringer nicht.
»Salti! Ganz recht, er ist ein Hüpfer und keine Flosse.« Diesmal war das Lachen dünner, weil die sechzehn Schwimmer still blieben. »Und auch keine Plattnase!« Außer den drei Plattnasen lachten wieder alle.
»Das wäre also geklärt«, sagte Frau Sienha zur Klasse in ihrem Rücken, während sie André anlächelte. »Und wer bist du nun? Lass mich raten: André Rothemark?«
Ein Raunen schwappte durch den Klassenraum, und die vorne Sitzenden versuchten an Frau Sienhas Rücken vorbei einen Blick auf André zu erhaschen, auf den Adoptivsohn des Olympiazweiten im Kunstspringen von Rom. Wie er das hasste! Deshalb nickte er nur knapp.
Auch Frau Sienha sah ihn gleich noch eine Spur durchdringender an. Gleich würde sie erzählen, wann sie Burghard Rothemark das erste Mal getroffen hatte, wie sehr sie ihn schätze und wie froh André sein könne, gerade in diese Familie adoptiert worden zu sein. André schob abwehrend die Unterlippe vor, aber dann sagte Frau Sienha nur: »Du bist das also«, und watschelte zurück zum Lehrertisch, wo sie begann, ihnen den Stundenplan zu diktieren.
Er war das also! Das hieß, dass sie über André Bescheid wusste und wahrscheinlich sogar mit Doris, die auch diesen Watschelgang hatte, irgendwann einmal gemeinsam in einer Trainingsgruppe gewesen war. Die kannten sich irgendwie alle. Nein, André konnte es gleich wieder vergessen, Frau Sienha nach der Wüste in Bulgarien zu fragen, obwohl sie eine Erdkundelehrerin war und es vielleicht wissen könnte. Denn selbst wenn Frau Sienha Doris vielleicht gar nicht persönlich kannte, so war die Verbindung zu den Rothemarks an einer Sportschule wie dieser, wo die Trainer in engem Kontakt mit den Lehrern standen, einfach zu nah. Frau Sienha könnte es seinen Adoptiveltern so ganz nebenbei erzählen, und dann würden sie es Onkel Fritz erzählen, und dann würde er Onkel Fritz – der einzige Mensch, den André wirklich mochte, obwohl er streng, aber im Gegensatz zu Burghard methodisch war – nie wiedersehen. Das hatte Onkel Fritz angedroht. Und Onkel Fritz drohte nie einfach nur so, der hielt auch, was er sagte, im Guten wie im Schlechten.
Onkel Fritz war Andrés Großvater, jedenfalls behauptete André das vor anderen Kindern immer, auch wenn sie eigentlich gar nicht miteinander verwandt waren. Meistens dann, wenn die anderen von ihren Großeltern erzählten. Onkel Fritz hatte selbst keine Enkel, nicht mal Kinder, und war ein richtiger alter Kommunist, so wie die im Fernsehen, die für das Gute und den Sozialismus gekämpft hatten. Einer, der 1945, als André noch »eine Rosine im großen Käsekuchen war«, mit den Sowjetsoldaten Berlin befreit hatte. Und der deshalb einen riesigen schwarzen Tschaika mit Chauffeur besaß, mit dem er André in der dritten Klasse sogar einmal von der Schule abgeholt hatte.
Onkel Fritz war mit seinem Tschaika von Berlin extra in Andrés Dorf gekommen, um ihn von der Schule abzuholen. Da hatten die anderen Kinder aus dem Dorf Bauklötze gestaunt und André beneidet, auch wenn André es dann nicht so recht genießen konnte, denn er hatte Mist gebaut, riesigen Mist, den er noch heute bereute. Denn wegen diesem Mist sah er das Dorf im Erzgebirge und die Eltern, also die Leute, die er damals so nannte, nie wieder. Deshalb wohnte er jetzt in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, und war der Adoptivsohn des Olympiazweiten im Kunstspringen von Rom. Auch wenn André jetzt Onkel Fritz viel näher war, tat ihm das Ganze noch heute leid, und er verfluchte den Tag, an dem dieses Mädchen, diese Jessica, neu in seine Klasse im Erzgebirge gekommen war und ihm schon ein paar Tage später anvertraute, dass seine Eltern nicht seine Eltern wären.
Natürlich hatte er Jessica kein Wort geglaubt, aber sie wusste es von ihren Eltern, die Andrés Eltern von früher kannten, aus einer anderen Stadt. Nur hatten die Eltern aus dem Erzgebirge da noch gar kein Kind, weil die Frau, die André bis zu diesem Tage Mutti genannt hatte, laut Jessicas Eltern gar keine Kinder bekommen konnte.