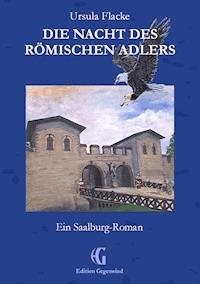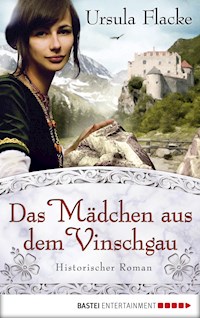
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laas in Südtirol, 1519. Die junge Luzia ist unsterblich in den verarmten Bergbauer Toni verliebt. Doch ihr Vater, ein aufstrebender Marmorhändler, zwingt Luzia zur Verlobung mit Diethard, einem angesehenen Geldleiher für Steinmetzarbeiten. Sofia ist völlig verzweifelt, ihr Herz gehört nur Toni. Als der eines Tages spurlos verschwindet, zögert Luzia deshalb keine Sekunde und macht sich auf die gefährliche Suche nach ihm - unbarmherzig verfolgt von Diethard, der sich zurückholen will, was ihm gehört: Luzia...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über die Autorin
Ursula Flacke ist Autorin, Musikerin und Schauspielerin. Sie hat über 50 Bücher veröffentlicht, Fernsehdrehbücher, Bühnenprogramme und Musicals verfasst. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Jugendliteraturpreis und den Deutschen Kulturförderpreis. Mit der Veröffentlichung ihres historischen Romans Das Mädchen aus dem Vinschgau geht für die passionierte Südtirol-Urlauberin ein Herzenswunsch in Erfüllung.
Ursula Flacke
Das Mädchen aus dem Vinschgau
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe Copyright © 2015 by Bastei LübbeAG, Köln Lektorat: Judith Mandt Textredaktion: Anke Pregler, Rösrath Karte: Markus Weber, Guter Punkt München | Thinkstock Titelillustration: Johannes Wiebel, punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Paolo Ramponi; Shutterstock/R.S.Jegg; Shutterstock/Jozef Klopacka Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, MünchenDatenkonvertierung E-Book: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0670-5
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
»Warum fremden Herren dienen, wenn ihr euch selbst gehören könnt.«
Paracelsus (1493–1541) Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker, Laientheologe und Philosoph.
Göflan am Nördersberg, im Jahre 1519
1
Noch war es still. Eine dichte Schneedecke drückte die Zweige der Schwarzkiefern weit herunter. Die steilen Berghänge wirkten wie erstarrt, so wie jedes Mal, bevor der Schnee zerbarst. Nur wenig Sonnenlicht fiel durch die aschgrauen Wolken an den Bergspitzen. Kein Schrei des Steinadlers durchschnitt die Stille. Kein Lufthauch wiegte die sperrigen Zweige der alten Birnbäume. Auch der Himmel schien zu schweigen.
Luzia stapfte und stolperte durch hohe Schneewehen, die der Jochwind aufgetürmt hatte, und hastete immer weiter auf das Steinhaus zu, das vorgelagert auf einer gerodeten Bergebene lag.
Sie zitterte am ganzen Leib. Die Murmeltierfelle, die mit Eisenstiften an die Kanten ihrer Holzschuhe genagelt und mit Schnüren um die Waden gewickelt waren, wärmten nur wenig. Die Tierhäute waren brüchig geworden und rissen Fetzen für Fetzen an den Nägeln ein.
Frost sog die Wärme aus Luzias Füßen. Die nackten Finger brannten vor Kälte. Trotzdem hielt sie eine kleine Kupferkanne mit kostbarem Öl fest umklammert.
Nur kurz blickte sie sich um. Das Tal unter ihr versank im Dunst, den der Fluss ausatmete. Hin und wieder schimmerten die schiefergrauen Fluten der Etsch auf, die sich durch die sumpfige Ebene schlängelte.
Nur weiter! Wie getrieben hastete Luzia voran. Noch war alles ruhig. Doch ihr war, als würde sich die Luft bedrohlich zusammenballen. Der Atem brannte ihr in der Lunge, sie keuchte und hustete und leckte sich über die ausgetrockneten Lippen. Wieder schob sie die fröstelnden Finger der einen Hand unter die Fellmütze, die an Fuchsschwänzen unter dem Kinn festgebunden war, während sie mit der anderen das Kupferkännchen an sich drückte. Ihr dicker Zopf baumelte an einer Seite vor dem Lodenumhang hin und her, Schneekristalle hatten sich in dem dunklen Haar verfangen.
Der Nebel im Tal kroch unerbittlich die Dörfer hoch, durch enge Gassen und schmale Wege, und ließ die kahlen Felder und Baumwipfel ringsum im Dunstschleier versinken.
Keine dreihundert Schritte mehr waren es bis zu Luzias Elternhaus, das aus Bruchsteinen der Berge hochgemauert war. Eine helle Rauchfahne quoll aus dem Schornstein, zerfaserte allmählich und löste sich auf. Das Schrägdach mit den Holzschindeln war vom Schnee freigeschaufelt worden, damit es unter der schweren Last nicht zusammenbrach. Auch das Dach vom Viehstall war mit Brettern freigeschabt worden, denn dort malten sich Furchen und Kratzer neben den Steinbrocken ab, die als Gewicht auf den Querlatten lagen.
Das Holzhaus der Birchlers weiter hinten lag wie verloren da. Kein Ofen war entzündet, keine Rauchfahne stieg auf. Nur ein festgetrampelter Pfad führte von dort durch den Schnee zu ihrem eigenen Haus herüber.
Luzia stockte. War da nicht ein Knirschen, Bersten und Rutschen zu hören? Sie warf einen schnellen Blick zum Berghang hoch. In den letzten Tagen war es wärmer geworden. Die Schneemassen waren jetzt schwer und rutschig, die Kristalle vollgesogen mit Wasser, rissige Spalten durchzogen das Weiß.
Sie hastete weiter. Eisklumpen klebten an den zerrissenen Murmeltierfellen, und Luzia rutschte fast aus den Holzschuhen, zog dann aber die Zehen mit den umwickelten Lappen hoch und fand besseren Halt.
Nur noch ein paar Schritte! Die eiskalten Finger ihrer linken Hand griffen nach dem Türriegel und pressten ihn zur Seite. Er klemmte ein wenig, denn das Holz hatte sich verzogen. Es knarrte und quietschte, als sie die schwere Eingangstür aufdrückte. Dann stolperte sie in den düsteren Flur.
»Kind, wo bleibst du denn?« Luzias Mutter, die Moidl, eine kleine, drahtige Frau, zog hastig die niedrige Tür wieder zu. Mit einer fahrigen Bewegung wischte sie ihrer Tochter den Schnee vom Lodenrock, der schwer über die schmalen Hüften fiel. »Und? Hast du es?«
Luzia nickte und öffnete langsam die rotgefrorene Hand. Ein Schmerz wie von glühendem Eisen durchfuhr ihre Finger. »Es ging nicht schneller. Die alte Magda musste noch Schweinefett …«
»Später, Kind, später!« Erleichtert nahm die Moidl das kupferne Kännchen an sich. »Komm in die Stube. Wer weiß schon, was geschieht.« Während sie zurückhastete und ihre Schritte im Flur nachhallten, raunte sie: »Sie hat es. Jesus Maria, sie hat es. Endlich.«
»Und? Was hat sie denn?«, war die neugierige Stimme der Trina Birchler zu hören. Die Nachbarn aus dem hinteren Holzhaus hatten hier Zuflucht gesucht. »Was ist denn dadrin, in der Kanne?«
»Nichts weiter«, antwortete die Moidl verlegen. »Nur ein … Öl. Für rissige Haut.«
»Dass die Weiber nur an glatte Haut denken können!« Ferdl, Luzias älterer Bruder, zog verächtlich die Oberlippe hoch. »Und sie ist spät dran. Hat wieder mal getrödelt. Wie üblich!«
»Ein Mädel! Was kann man da anderes erwarten?« Diethard, der Sohn der Birchlers und ein kräftiger Bursche, der wohl zuzupacken wusste, spuckte die Worte aus wie vergorene Mehlklumpen. Er hielt nichts von Weibern, ihrem Getratsche und der häuslichen Arbeit, die sie zu verrichten hatten. Trotzdem starrte er Luzia, die schon im heiratsfähigen Alter war, oft wie entrückt hinterher. Und sein glasiger Blick verriet, dass er sich nur allzu gerne vorstellte, was sich da unter ihrem schwingenden Lodenrock verbarg.
Die Birchlers vom Nachbarshof waren Zugezogene, arme Bauersleute. Man erzählte sich, sie kämen ganz aus der Nähe von Einsiedeln und wären sogar entfernt mit dem Vogt Hans Birchler verwandt. Sie hätten ganz in der Nähe dieses berühmten Wallfahrtsortes gelebt, nicht weit vom Benediktinerkloster mit seiner Kapelle, die von Christus selbst und seinen Engeln geweiht worden war. Und wohin zum Fest der Engelsweihe jährlich über hunderttausend Pilger strömten und beteten und Pilgerabzeichen erwarben, die sie sich an die Joppe oder den Filzhut steckten.
Die Moidl wäre zu gerne einmal nach Einsiedeln gepilgert, den weiten Weg über den Alpenpass bei Reschen bis zur heiligen Stätte mit der Schwarzen Madonna. Vielleicht würde der Herrgott ihr ja später einmal die Zeit dafür schenken.
Dafür wanderte sie nach Taufers ins Münstertal zur Kirche St. Johann, die für Pilger auf ihrer Wallfahrt nach Chur errichtet worden war. Das Gewölbe war mit Wandfresken ausgemalt, die der Moidl jedes Mal den Atem stocken ließen. Da war ein Adler mit zwei Köpfen zu sehen, die Taufe Christi, Moses als Gesetzgeber, Juden, Äbte, Fürsten, Ritter, die Enthauptung Johannes’ des Täufers, die heilige Katharina …
Man mochte kaum hochschauen, pflegte die Moidl zu sagen, sonst würden die Augen ganz betrunken von so viel Malerei.
Das Prunkstück aber war für die Moidl die Schwarze Madonna mit dem Kind, die den Pilger schon draußen über der Tür empfing. Immerhin ein schwacher Trost, wenn es ihr vorerst nicht vergönnt war, nach Einsiedeln zu pilgern.
Warum die Birchlers aber von dort erst vor Kurzem hergezogen waren, hierher in die Nähe von Laas, Göflan und Schlanders, und die kleine Holzhütte auf der Hochebene nah dem Berghang erworben hatten, das konnte keiner sagen. Vielleicht hatten sie Dreck am Stecken und mussten fliehen. Wer wusste das schon.
Luzia mochte den Birchlersohn Diethard nicht, nicht sein aufreizendes Grinsen und erst recht nicht, wenn er sich mit seinem muskulösen Oberkörper aufplusterte und gebärdete wie ein brünstiger Hirsch. Im Spätsommer erst hatte sie ihn bei aufkommender Dunkelheit vor ihrem Kammerfenster erwischt, wo er wohl öfter herumlungerte. Seitdem schloss sie die alten Holzläden schon früh und hängte sogar Wolllappen vor die Ritzen.
»Wahrscheinlich hat Luzia noch mit Weibern getratscht und Zeit verplempert«, platzte Ferdl von der Stube her in ihre Gedanken. »Die plappern doch immer munter drauflos, sobald zwei zusammenstehen.«
»Ich sagte ja schon: ein Mädel!« Diethard entfuhr ein spöttisches Glucksen. »Denen ist das Plappern angeboren. Wie den Rindsviechern das Fladenscheißen.«
»Willst du wohl Ruhe geben!«, rief Alois Birchler seinen Sohn zur Ordnung.
Luzia hauchte verärgert auf ihre klammen Finger. Plappern und tratschen! War es ihre Schuld gewesen, dass die alte Magda zuerst das ausgelassene Schlachtfett mit den gerösteten Grammeln in die Steinguttöpfe hatte gießen wollen? Dass sie sich im Wassertrog die Hände geschrubbt und dann erst hinter dem Verschlag das kostbare Öl hervorgeholt hatte? Verbeugt hatte sie sich davor, die alte Magda. Ganz tief. Und dann die strähnigen Haare zurückgekämmt, als wollte sie ihr Leben neu ordnen.
Drüben in der Stube erhob die Moidl gerade ihre Stimme. Ein Bittgebet floss über ihre Lippen, dass der heilige Vigilius, der Wetterheilige und Achtsame, sich ihrer erbarmen sollte. Die anderen fielen raunend mit ein, und ihre Gebete vermischten sich zu einem beschwörenden Singsang.
Im düsteren Flur löste Luzia die Knoten von den Schnüren, die um die Murmeltierfelle gebunden waren, und zog die Füße aus den Holzschuhen. Vorsichtig wickelte sie die Lappen ab und rieb und knetete die unterkühlten Zehen, bis sie schmerzten.
»Luzia! Wo bleibst du denn?«, platzte ihr Vater Jakob in die Gebete, die anschwollen wie das Murmeln eines Gebirgsbaches, der unbeirrt seinen Weg talabwärts sucht. »Komm endlich! Was trödelst du wieder herum?«
Luzia zerrte sich die Fellmütze vom Kopf, ohne die Fuchsschwänze aufzuknoten, schlüpfte schnell in Strümpfe und hastete in die Stube.
Dort war es düster. Die Holzläden waren zugeklappt, nur hauchdünne Lichtstreifen sickerten durch die Ritzen. Eine Kerze aus Rindertalg flackerte in einer breiten Schale auf der Eckbank beim Herrgottswinkel, wo das Holzkreuz mit dem Heiland hing. Dicht neben der Talgkerze hatte die Moidl die Kanne mit der öligen Flüssigkeit abgestellt. Das Kerzenlicht spiegelte sich in dem kupfernen Behältnis und tanzte goldfarben über die gehämmerte Rundung. Ein zweites Licht brannte auf der gemauerten Ofenbank, wo die Großmutter hockte.
Die Moidl kniete sich neben Jakob vor die lange Eckbank nieder, legte wie die anderen auch die gefalteten Hände auf die dunkle Sitzfläche und richtete den Blick auf das Jesuskreuz. Die Gebete der beiden wurden immer flehentlicher, immer eindringlicher. Neben ihnen stammelten die Birchlers ihre Bitten. Der dürre Singsang der Naandl, der Großmutter, flocht sich knarzend mit ein. Im Ofen knisterten und knackten Holzscheite.
Plötzlich krachte ein Stück Holz drüben im Küchenherd in sich zusammen. Die Betenden schreckten hoch und atmeten erleichtert auf: Es war ein Holzscheit, nur ein Holzscheit gewesen.
Jakob, ein kräftiges Mannsbild, hatte den Arm um seine Tochter Sofie gelegt, die sich kniend hin- und herwiegte, dann vorbeugte, die Wange auf die Sitzbank legte und wie entrückt ins Kerzenlicht starrte.
»Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.« Sofie winselte leise und zog die Schultern verängstigt hoch. Die Flamme spiegelte sich in ihren weit aufgerissenen Augen, die ein wenig schräg standen und so blickten, als könnte sie in zwei Welten gleichzeitig schauen. Das kinnlange, dunkle Haar kräuselte sich wirr. Nichts in der Welt hätte es bändigen können. Die Gebetsstimmen um sie herum schwollen an, füllten die Stube, den Flur, die Kammer, die Küche.
»Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!« Sofies Stimme klang nun sirrend hoch, wie die eines bittenden Kindes.
Wieder knackten Holzscheite im Ofen, wieder verstummten die Gebete für einen Atemzug. Und setzten neu ein.
Jeder spürte es: Es könnte etwas geschehen.
»Die Berggeister«, jammerte Sofie leise. »Sie wollen meine Seele zerreißen. Hört ihr nicht? Da! Das Scharren ihrer Klauen …«
»Sofie, die Berggeister tun dir nichts!« Die Moidl warf Trina über die gefalteten Hände hinweg einen kurzen Blick zu. Die Birchlerin beugte sich weiter vor, nickte mitleidsvoll und zupfte sich die leicht schmuddelige Haube zurecht, unter der fusselig rote Haare hervorquollen.
»Doch! Sie schaben Grübchen in Steine …« Aus Sofies Stimme klangen Angst und Erschrecken. »Oben in den Bergen … sie saufen und saufen und feiern wüste Gelage … überall … sie kommen, sie kommen!«
»Sofie!« Jakob fuhr ihr beruhigend durch das wirre Haar. »Die Geister kommen nicht. Nicht in unsere Stube mit dem Heiland am Kreuz.«
Luzia kniete sich zu ihrer Zwillingsschwester auf die Holzbohlen und wischte ihr über die erhitzte Stirn. »Ganz ruhig, Sofie. Dir geschieht nichts. Hast du nicht neulich sogar geweihte Eier im Hof vergraben? Als Schutz vor den Berggeistern?«
Sofie hielt inne. Ihr Mund öffnete sich leicht, und etwas Spucke tropfte ihr von der Unterlippe. Dann schloss sie zufrieden die Augen und summte ihre alte Weise, unwirklich und schwebend leicht. »Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!«
Die Töne tanzten durch die Stube, vermischten sich wieder mit dem Knistern und Knacken der Holzscheite im Ofen und dem eintönigen Gemurmel der Bittgebete.
Der brennende Docht schmolz den Rindertalg in der Schale, der längst nicht so fest war wie das kostbare Wachs der Bienen. Er roch rußig und ranzig. Das Licht warf tanzende Flecken auf die Gesichter der Betenden, ließ Falten aufblitzen wie feine Verästelungen von Rinnsalen, die dünne Furchen in die Erde trieben.
Luzia schaute ihre Zwillingsschwester bekümmert an. Bei der Geburt hatte sich die Nabelschnur um Sofies Hals geschlungen, gerade so, als hätte man ihr mit einem Galgenstrick die Luft abschnüren wollen.
Das hätte ihr den Verstand geraubt, hieß es, und ihren Geist verwirrt. Dabei blickten die Leute Luzia jedes Mal derart vorwurfsvoll an, als hätte sie ihrer Schwester vor dem Herausdrängen aus dem Geburtskanal eigenhändig die Nabelschnur um den Hals gelegt, um selbst als Erstgeborene ins Leben zu schlüpfen. Dieser Gedanke lastete schwer auf ihrer Seele, denn wer konnte schon sagen, was sich da im Mutterleib abgespielt hatte.
»Aber seht doch …« Sofie schrie plötzlich auf und starrte entsetzt in das Kerzenlicht. »Johann … der Knecht … er ist zurück … zurück ist er …«
»Der Johann ist tot!« Luzia fasste sie an den Oberarmen und schüttelte sie sanft. »Er ist tot! Bei der Gamsjagd am Ortler ist er abgestürzt. Tot ist er. Er kann dir nichts mehr tun.«
»Tot ist er?« Sofie lachte hell auf, leckte sich über die Kuppen von Daumen und Zeigefinger und löschte die Dochtflamme. »Hört ihr, wie es zischt und pfeift? Wie seine büßende Seele winselt? Ja, er ist tot! Er büßt und winselt.«
»Sofie!«, beschwor der Vater sie eindringlich. »Jetzt gib endlich Ruhe!«
Sofie sackte in sich zusammen, wagte kaum zu atmen und verharrte regungslos. Aber schon bald wurden ihre Finger ungeduldig, krochen über Holzkanten, Leinenrock und Sitzbank. Dann nahm ihr Oberkörper die Unruhe auf und fing an, sich zu wiegen. Vor und zurück. Dazu summte sie eine alte Weise vor sich hin.
Die Moidl hatte sich hochgerappelt. Mit einem Holzspan, der an der Spitze brannte, entzündete sie den Kerzendocht erneut.
Sofie schreckte hoch und deutete mit dem Finger in die rußende Flamme. »Ich seh ihn! Da, der Johann!« Sie kniff die Augenlider zusammen und spuckte ins Feuerlicht.
»Was tust du da?« Die Naandl schlug erschrocken die Hände zusammen. »Das ist Sünde. Du triffst eine arme Seele!«
»Ich will sie ja treffen!« Sofie spuckte wieder in das lodernde Licht. Es zischte und qualmte. »Büßen soll der Johann. Das ist keine Sünde, das ist Strafe! Leiden soll er, büßen soll er. Noch und noch und noch. Das ist nur gerecht.«
»Sollen wir …?« Die Moidl schaute kurz zu der Kupferkanne mit dem Öl.
»Nicht jetzt!« Jakob zog Sofie eng an sich heran und bedeckte ihr fürsorglich mit der Hand die Augen.
»Leiden soll er, büßen soll er.« Sofie winselte, stieß mit den Ellbogen und versuchte sich aus der Umklammerung zu befreien.
»Jetzt halt endlich dein Maul«, fuhr Jakob sie an. »Und gib Ruhe. Es ist nicht deine Sache zu strafen. Das macht nur der Herrgott im Himmel.«
Dann war es still. Nur die Spucke knisterte, als sie sich im flüssigen Rindertalg schaumig aufwölbte und verdampfte.
Luzia wischte sich eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht und drückte sie zurück in den dicken Zopf, der ihr bis auf die Brust reichte. Er war draußen im Winterwetter feucht geworden, und in den Flechten hingen noch Reste von verklumptem Schnee, die an den Fingerkuppen prickelten, wenn sie zu Wasser zerdrückt wurden.
Aus den Augenwinkeln betrachtete sie das müde Gesicht ihrer Mutter. Wie abgekämpft sie aussah! Vom herben Winter. Von der beißenden Kälte. Vom Hunger. Und vom Tod des jüngsten Buben, den das Leben nicht hatte haben wollen.
Das gurgelnde Keuchen und Rasseln seines Atems hatte die Moidl keine Ruhe finden lassen. Auch nachts hatte sie ihm ausgeworfenen Schleim von den kleinen Lippen gewischt, die Stirn gekühlt und nasse Tücher um die Waden gewickelt. Bis Josefchen keine Kraft mehr gefunden hatte, sich noch einmal ins Leben zu atmen, und sich seine Kinderseele leise, ganz leise in die Ewigkeit zurückgezogen hatte.
Die Moidl kam aus Tschengls, einem Dorf, das nicht weit entfernt lag. Dort hatten sich die Bergketten so steil aufgetürmt wie nirgendwo sonst in Tirol. So als hätte unbändige Sehnsucht sie getrieben, schroff und gewaltsam emporzuwachsen, um dem Himmel noch näher zu sein. Und wo die Sonne schon im frühen Herbst das Bergdorf ein letztes Mal mit Licht durchflutet, sich dann hinter den Schneebergen verbirgt und erst im Frühjahr wieder über den Gipfeln aufsteigt. Wo sich das Licht zurückzieht wie zu einem langen Winterschlaf. Und wo jeder im März ausgehungert auf die ersten Strahlen der höher steigenden Sonne wartet, die sich rotglühend über die Bergkuppen schieben. Tag für Tag rückt dann der Lichtbalken gegenüber an den steilen Hängen tiefer ins Tal, bis er sich im vorbeiziehenden Wasser der Etsch wie in einem Lichterrausch widerspiegelt und endlich ihr eigenes Dorf erreicht. Im Wechsel der Zeiten. Jedes Jahr aufs Neue.
Luzia spürte neben sich die Wärme des Vaters, der seinen Arm fest um die winselnde Sofie gelegt hatte. Im Licht der Kerze wirkten die dunklen Bartstoppeln in seinem Gesicht wie Rußflecken von angekohltem Holz. Trotzig hatte er den Kopf erhoben und das kräftige Kinn vorgeschoben. An der Nasenwurzel wölbte sich ein kleiner Höcker, das Überbleibsel eines Bruches, der nicht richtig zusammengewachsen war.
Er war ein Überbleibsel aus jener Zeit, als die Soldaten im Calvenkrieg plündernd und mordend durch das Land gezogen waren und alles niedergebrannt hatten, was sich ihnen in den Weg gestellt hatte: Mals, Glurns, Schlanders, das alles waren Dörfer, in denen riesige Feuer gebrannt hatten. Auch Jakobs Vaterhaus in Kortsch war damals in Flammen aufgegangen.
Hoch oben vom Hasl-Hof am Nördersberg aus hatte es ausgesehen, als würde das ganze Tal fast bis Kastelbell in einer feuerspuckenden Hölle versinken. Sturmglocken hatten geläutet. Dröhnende Hörner wurden geblasen, wie zur Jagd auf Menschenseelen. Als hätte die todbringende Apokalypse längst ihren Lauf genommen.
Gellende Schreie hatten durch die Täler gehallt, brennende Kirchturmspitzen rotglühende Funkenfetzen Hunderte von Metern hochgeschleudert. Und der Rauch hatte sich in den Wäldern festgebissen, in den Berghängen, aber auch in der Haut und im Gedächtnis der Menschen. So hatte die Naandl es jedenfalls berichtet, die gerade dort oben auf dem Hasl-Hof bei einer entfernten Base gewesen war, um beim Zerlegen von Wildfleisch zu helfen. Der Ernst hatte nämlich einen gewaltigen Hirsch erlegt, aber das durfte sonst niemand wissen, denn Bauern war die Jagd verboten.
Luzia war da noch nicht geboren, aber ihr Vater Jakob hatte oft genug von diesem Krieg geredet. Von dem Krieg der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit all ihren Verbündeten auf der einen Seite und den Tirolern auf der anderen. Die Tiroler, das waren unter Kaiser Maximilian die Habsburg-Österreicher, die mit dem Schwäbischen Bund paktierten.
Um Gebietsansprüche wäre es ihnen gegangen, hatte der Vater immer wieder kopfschüttelnd berichtet. Um etwas Land, um einen Streifen Acker, um ein Stück Feld. Und was hatte dieser Krieg gebracht? Gar nichts! Nur Tausende von Toten, unsägliches Leid und verbrannte Heimat.
Die Eidgenossen hatten Maximilians Truppen bei Calven besiegt und dann die flüchtenden Soldaten durch den Vinschgau bis nach Kastelbell verfolgt. Überall hätten Tote gelegen, an den Feldwegen und im Sumpfgebiet der Etsch, in deren blutrotem Wasser leblose Körper davontrieben. Beim Rückzug plünderten die Eidgenossen dann in einem gnadenlosen Rachefeldzug Dörfer und Höfe, brannten alles nieder, schändeten und mordeten. Kein männlicher Einwohner über zwölf Jahre dürfte am Leben bleiben, hieß es. Gefangene sollte es nicht geben.
»Diese Kuhschweizer«, spuckte der Vater jedes Mal hasserfüllt aus, wenn er darüber sprach. »Die es mit den eigenen Viechern treiben. Immer mitten hinein in die Kuhscheiße! Und diese verfluchten Gotteshäusler, diese Zehngerichtbünder, die mit den Schweizern paktieren! Und diese Pfaffen, die sich um das Seelenheil kümmern sollten und nicht um ihre weltlichen Pfründe!« Manchmal wandte er dann störrisch den Kopf und fuhr sich mit der schwieligen Hand über die Augen.
Bei den mörderischen Attacken der Eidgenossen im Vinschgau war nämlich auch Jakobs Vater gestorben, drüben in Kortsch. Niedergemetzelt hatten sie ihn, im Kriegsrausch mit Schwertern aufgeschlitzt. Sein Leib war dann aufgebahrt worden. Das Gebeinhaus der Kirche St. Markus in Laas hatte all die Toten kaum aufnehmen können. Selbst in der Krypta waren sie notdürftig auf Brettern abgelegt worden, damit die Totenmesse gesprochen werden konnte.
Wie verzweifelt musste sein Weib, die Naandl, damals gewesen sein, als ihr Josef so ohne Leben dagelegen hatte: die so oft geküssten Lippen leidvoll verzerrt. Die zärtlich gestreichelten Wangen so blass und kalt. Und die Hände, die sie in Notzeiten gehalten, die sie zum Glühen gebracht und ihre Schenkel sanft geöffnet hatten, lagen regungslos in Todesstarre. Ein Abschied. So plötzlich. So unfassbar.
Wie oft blickte die Naandl in die Ferne, mit der Wurzelholzpfeife des Großvaters in der Hand, in der er getrocknete Hanffasern geschmaucht hatte.
»Manchmal hört sich die Stille mit dir ganz anders an«, sagte Sofie dann. Und ihre Stimme wurde weich und die Berührung ihrer Fingerkuppen so behutsam, als könnte sie die aufgeworfenen Adern an Naandls Hand verletzen.
Luzias Kniescheiben drückten auf den blanken Bohlen vor dem Herrgottswinkel und schmerzten. Vorsichtig verlagerte sie ihr Gewicht. Ihre Füße waren eiskalt. Zu gerne hätte sie sich wärmende Socken über die dünnen Strümpfe gezogen, aber sie wollte keine Unruhe verbreiten und den Vater verärgern. Sofie neben ihr keuchte und hielt den Kopf an seine Brust gepresst, die Blicke ängstlich auf die flackernde Kerze gerichtet.
»Ave Maria …« Ihre Stimme war nur ein sirrender Hauch zwischen den Gebeten der anderen.
Luzia faltete die klammen Hände und schaute hoch zum Holzkreuz, das Bauer Anton aus dem Zirmholz der Zirbelkiefer geschnitzt hatte und das einen wundersamen Geruch verströmte, der Dämonen abwehren sollte.
Wie erhaben Christus da aussah! Das Gesicht war nicht von Schmerzen verzerrt, er war nicht der leidend Gekreuzigte, der in sich zusammengesunken an durchbohrten Händen hing, um tiefstes Mitleid bei den Betenden heraufzubeschwören, Schuldgefühle, Reue und Unterwürfigkeit. Hier war Jesus der Sieger. Zwar waren auch seine Handflächen von Nägeln durchbohrt, aber Jesus stand aufrecht auf einem kleinen Vorsprung am Kreuz. Und er trug keinen gewundenen Kranz aus Dornen, sondern eine Krone: Der Tod war besiegt. Luzia liebte diese Schnitzerei. Christus, der König! Dem konnte sie sich anvertrauen.
Luzia schreckte hoch. Urplötzlich war da ein Windpeitschen und Rauschen. Ein Grollen, Knirschen und Donnern. Ein Dröhnen und Bersten, als würde der Berg einstürzen. Ein Schleifen und Tosen. Das Bauernhaus wankte, Holz krachte. Ein Luftschwall stemmte sich gegen die Wände, als sollten sie weggefegt werden. Das Talglicht flackerte aufgeschreckt hoch. Noch ein leichtes Rutschen, ein Knacken im Gebälk, dann war es wieder ruhig.
»Sancta Maria!« Sofie kreischte auf und kratzte sich mit den Fingernägeln durchs Gesicht. Blutige Striemen zogen sich über ihre Wangen.
»Nicht, Sofie!« Die Mutter umklammerte die Handgelenke des Mädchens. »Es ist vorbei. Verstehst du? Alles ist gut!«
»Vorbei?« Sofies Lippen verzogen sich zu einem zaghaften Lächeln.
Trina ächzte auf, als hätte ihr jemand einen Tritt in den Magen versetzt, krümmte sich und verbarg das Gesicht in den Händen. Alois stieß hörbar Luft aus, sein Sohn Diethard wirkte wie erstarrt.
Sie horchten. Einen Atemzug lang, zwei Atemzüge … Noch immer hallte das Dröhnen und Krachen in ihren Ohren nach. Die Kerzenflamme brannte wieder ruhig. Dünne Lichtadern fielen durch die Ritzen der Fensterläden.
»Ja, es ist vorbei. Alles ist gut gegangen. Dem Himmel sei Dank.« Jakobs raue Stimme klang beruhigend. Noch einmal horchten sie für ein paar Atemzüge. Dann fuhr er fort: »Aber vielleicht hat es ja den Wanga erwischt.«
»Jakob, was redest du da!« Die Moidl schlug energisch mit der flachen Hand auf die Holzbank. »Willst du dich versündigen? Und das auch noch unter dem Kreuze unseres Herrn? Schämen solltest du dich!«
»Jetzt beruhig dich, Weib! Ich habe doch nichts weiter gesagt, als dass es den Wanga vielleicht erwischt hat.« Jakob zog harmlos dreinblickend die Augenbrauen hoch. »Da ist nichts Gotteslästerliches dran.«
»Bist du mir ein Knietl!« Die Moidl stemmte die Fäuste in die Hüften. Ihre Holzschuhe knallten auf den Holzdielen, als sie auf ihn zuging. Das schmale Kinn hatte sie herausfordernd angehoben. »Nichts Gotteslästerliches? Willst du mir erzählen, dass da sonst nichts in deinem Schädel herumspukt?«
»Hört endlich auf mit der Tratscherei! Seht lieber nach, was mit dem Schnee ist.« Die Naandl ächzte und drückte sich von der Ofenbank hoch. Den Blick hatte sie auf die Birchlerin gerichtet, die sich als Letzte aufrappelte. Jetzt standen sie alle regungslos da, wie verloren und von dunkler Vorahnung erfüllt.
»Du bleib lieber hier. Hier ist es schön warm.« Die Moidl drückte die Naandl sanft zurück. »Das lass die Männer machen.«
»Warum nicht die Naandl?« Sofie schaute die Mutter verständnislos an. »Lasst sie doch. Die Naandl muss verbraucht werden. Sonst kommt der Tod zur falschen Zeit.«
»Was redet sie denn da schon wieder?« Trina schob spöttisch die dickliche Unterlippe vor. Die Worte platzten aus ihr heraus, als müsste sie Überdruck loswerden. »Der Tod kommt zur falschen Zeit? Der Irrsinn breitet sich wahrhaftig von Tag zu Tag mehr in ihr aus. Eine Herrgottsstrafe muss es sein, so ein Kind …«
»Lass gut sein, Trina. Auf der Stelle!«, fuhr Alois sie scharf an. Seine kräftigen Hände zitterten. Die Augenlider zuckten. Verängstigt schaute er gegen die dunklen Holzbretter, mit denen die Wohnstube ausgekleidet war, in Richtung seines Hauses, das näher am Berghang stand. »Ich bitte dich, lass es verdammt noch mal gut sein!«
»Wieso? Die Mama hat doch recht.« Diethards kantiges Gesicht wirkte im aufflackernden Kerzenlicht wie eingefallen. Die Augen blitzten. »Jeder hier weiß doch, dass der Wahnsinn sie geißelt.«
Luzia sprang auf ihn zu und hob drohend die Hand. »Lass sofort die Sofie in Ruhe!«, fauchte sie. Der Geruch von zerkautem Kümmel und Männerschweiß zog ihr in die Nase. »Oder du bekommst es mit mir zu tun.«
»Hu, da hab ich aber Angst!« Er grinste breit, umfasste derb ihr Handgelenk, zog sie näher zu sich heran und drückte ihre Hand langsam nach unten. Sein warmer Atem ließ sie frösteln. »Siehst du, wie mir die Beine schlottern?«
»Ruhe jetzt!«, donnerte Alois. »Es gibt wahrhaftig Wichtigeres zu tun.«
Dann war es ruhig. Die Männer warfen sich Wolljoppen und Lodenmäntel über und drückten die Holztür auf. Sie quietschte gleichmäßig in den Angeln, kein Widerstand war zu spüren. Die Lawine hatte die Vordertür nicht erreicht. Grelles Sonnenlicht fiel in die Stube, ein Herrgottsfinger, der zwischen den Wolken ein Schlupfloch gefunden hatte.
»Ich höre sie«, summte Sofie leise.
»Was hörst du?« Trina kniff angriffslustig die Augenlider zusammen. »Sind sie wieder da, deine … Berggeister?«
»Nein, ich höre die Stille. Es hört sich gut an, wenn’s still ist.« Sofie kauerte sich auf die warme Ofenbank und schmiegte den Kopf in Naandls Schoß. »Wenn du nicht redest. Dann hört es sich gut an.«
Trinas Augen blitzten im Licht der Talgkerze auf. Wütend presste sie ihre Schmolllippen zusammen, raffte den Lodenrock, sodass sie noch stämmiger wirkte, und stapfte hinter Diethard und Ferdl her ins Freie. Ein kühler Luftzug fuhr in die Stube, das Kerzenlicht am Herrgottswinkel erlosch. Zurück blieb ein stechender Geruch von verbranntem Fett.
Luzia zwängte ihre Füße in die Stiefel aus Schweinsleder. Wie störrisch und hart das Leder war, und wie sehr es an Zehen, Fußballen und Knöcheln drückte und schabte! Trotz des dick einmassierten Fettes war es längst nicht so geschmeidig wie Rindsleder, für das man aber so manche Münze hinzählen musste und das deshalb viel zu teuer für sie war. Mit staksigen Schritten folgte sie der Birchlerin durch die Haustür ins grelle Tageslicht.
Inzwischen hatte sich der Nebel verzogen, und die Wolkenberge zerfielen und lösten sich immer mehr auf. Die Sonne blendete, selbst der Schnee war von Licht erfüllt. Luzia blickte sich um und presste erschrocken die Hand vor den Mund. Die Lawinenzunge hatte sich nur bis zum hinteren Schuppen herangewälzt, dem Heustadel, der dicht ans Bauernhaus grenzte. Gottlob war auch der Schweinestall nicht zerborsten. Aber zum Berghang hin wurden die Schneemassen immer breiter, wölbten sich massiv auf, und in das glitzernde Weiß mischten sich Erdbrocken, zerfetzte Sträucher und Äste. Vom Holzhaus der Birchlers war nichts mehr zu sehen.
Die dickliche Trina stand wie versteinert, ihre Kinnlade war heruntergeklappt. Das fusselig rötliche Haar, das unter der Haube hervorlugte, tanzte in den Windböen rauf und runter. Alois starrte regungslos zur Schneehalde hinüber. Nur sein malmender Kiefer verriet seine Anspannung. Aber die Birchlerin hatte sich schnell wieder gefasst.
»Wir wollten ja sowieso nach Schlanders ziehen«, sagte sie und spitzte überheblich die Lippen. Feine Längsrillen durchzogen die Haut. »Dann kann uns der Berg so leicht nichts mehr anhaben.«
»Nach Schlanders?« Die Moidl schaute sie verwundert an.
»Der alte Schuster ist doch verstorben.« Trina verschränkte selbstbewusst die Arme über dem kräftigen Busen. »Wir haben sein Haus … erwerben können. Der Sohn wollte noch Bett, Tisch und Stühle rausholen. Aber wir können bestimmt jetzt schon rein.«
»Dann ist ja für euch gesorgt. Alles wendet sich zum Guten.« Die Moidl streckte die gefalteten Hände hoch. »Der Himmel hat es gut mit uns allen gemeint.«
Jakob ließ seinen Blick über die Schneemassen gleiten, die in einer Schneise vom Berg heruntergedonnert waren. »Wir sind noch einmal davongekommen.«
»Trotzdem! Eine Woche später, und wir hätten noch unsere Sachen packen können.« Trina schüttelte verärgert den Kopf. Das rötliche Zottelhaar wischte über ihr Kragentuch.
Erst jetzt bemerkte Luzia, dass Alois ein längliches Gebilde bei sich trug, das in Decken aus Schafswolle gewickelt war. Es musste zerbrechlich sein, denn der Birchler hielt es vorsichtig und legte es jetzt in Trinas Arme. Was sie da wohl vorsorglich aus dem Holzhaus mitgenommen hatten? Kostbare Töpferware, die ineinandergestapelt in dicke, schützende Wolldecken gepackt war? Wichtige Dokumente in Pergamenthüllen? Bestickte Seidenballen oder orientalische Gewürze, die in Holztöpfchen verwahrt wurden?
Zeternd fuhr die Birchlerin fort: »Dabei sind wir erst neulich ins Martelltal gepilgert. Hoch zur Wallfahrtskapelle. Mit unserem lieben Priester vom Deutschen Orden in Schlanders, der dort jeden Sonntag eine heilige Messe feiert. Drei Kerzen haben wir gestiftet und wahrhaftig um Beistand gefleht. Und nun das!«
»Die Berge kennen keine Lüge!« Sofie lachte, wobei sie mit ausgebreiteten Armen über die Türschwelle in eine Schneewehe hüpfte. Die zerzausten Haare flogen im Wind, und die Wolljoppe flatterte um ihren schmalen Leib. »Der Berg tut, was er mag. Der Wind weht, wo er will. Und der Himmel, so schön. So blau. Der Schnee, so weiß und still.«
»Stiller Schnee?« Trinas Unterlippe zitterte, während sie den umwickelten Gegenstand behutsam an sich drückte. »Warum verbietet eigentlich niemand dieser Irren den Mund?«
»Sofie!«, fuhr Jakob das Mädchen entsetzt an. »Du bist ja barfuß!«
»Ich bin Schneeberg und Winterwind. Die lügen nicht. Die sind, was sie sind. Weißer Schnee, so still!« Sofie kicherte und sprang weiter. »Und ich tue auch, was ich bin. Ich bin die Sofie! Ich lüge auch nicht.«
»Doch, Sofie, du lügst!« Jakob rannte auf sie zu, packte sie und zerrte sie zurück zum Haus. »Du belügst nämlich deinen Körper. Der friert, und du bekommst einen schweren Husten.«
»Ich will raus!« Sofie strampelte, schlug mit den Händen um sich und wollte sich losreißen. »Ich will weg!«
»Es ist wieder so weit«, raunte die Moidl ihm zu. »Sie will weg. Gib ihr von dem Walpurgisöl.«
»Walpurgisöl?« Trina wurde hellhörig. »Ach! In der Kanne da in der Stube ist Walpurgisöl? Heiliges Walpurgisöl? Na, sieh mal einer an. Wer hat euch das denn beschafft?«
»Das geht dich einen feuchten Dreck an!« Jakobs Gesicht war wie versteinert, und die höckerige Bruchstelle auf seiner Nase lief rot an. Wütend zerrte er Sofie ins Haus. »Bleibt ihr hier! Ich bin gleich mit Schaufeln zurück.«
Die Moidl hatte entsetzt die Hand vor den Mund geschlagen. Luzia duckte sich, als erwartete sie einen Schlag ins Genick. Das mit dem Walpurgisöl hätte keiner wissen sollen. Das Wort war aus der Moidl herausgerutscht und hatte sich einfach davongemacht. Wie ein quirliger Fisch, den man im Flusswasser nicht mit der Hand hatte fassen können.
»Von der alten Magda habt ihr das, stimmt’s?« Trina kniff das rechte Auge zu einem schmalen Schlitz zusammen. »Ich habe selbst gehört, wie Luzia …«
»Jetzt gib verflucht noch mal Ruhe!« Alois presste die Worte hervor. Seine hellen Wimpern flatterten, als er zum schneebedeckten Hügel starrte, aus dem zersplitterte Balken und Bohlen herausstaken. »Wir haben jetzt weiß Gott was anderes zu tun.«
»Meinst du, dass Walpurgisöl auch Irre heilt?« Diethard grinste unbeeindruckt und schlenderte herausfordernd auf Luzia zu. »Was meinst du? Ob es auch … Irre heilt?«
Luzia rührte sich nicht. Nur ihr Blick ging zur Moidl, die kaum merklich den Kopf schüttelte. Nicht die Birchlers weiter herausfordern! Dass nur die Trina nicht wieder die Sprache auf das Walpurgisöl bringt!
Mit der Fingerkuppe fuhr Diethard über Luzias Stirn und drückte eine Haarsträhne zurück in ihren Zopf. Seine Haut fühlte sich unangenehm weich an. Er hat sicherlich in seinem Heimatort nahe Einsiedeln nicht auf dem Feld oder im Stall arbeiten müssen, dachte Luzia. Hinter ihnen knirschte der Schnee unter derben Tritten, und Diethard ließ die Hand wieder sinken.
»Na, dann woll’n wir mal!«, rief Jakob und versuchte versöhnlich zu lächeln, während er die Schaufeln in seinen Händen vorstreckte. »Vielleicht ist da noch Brauchbares, das ihr mit nach Schlanders nehmen könnt.«
»Und wenn nicht, werden wir das auch überleben!« Trinas Stimme wurde spitz, noch spitzer als die vollen Lippen, die sie zu einem Kussmäulchen formte. Mit koketter Überheblichkeit wiegte sie das Deckenbündel in ihren Armen.
Wie in einer Prozession zogen sie durch die Schneemassen auf die verschüttete Holzhütte zu. Vorn gingen die vier Männer, die zuerst eine Gasse freischaufelten. Ihnen folgte Trina mit dem Bündel, am Schluss die Moidl. Sie wirkte mit ihren hochgezogenen Schultern, als wollte sie sich vorsorglich ducken, um nicht von einer schweren Last, die ihr aufgehalst wurde, erdrückt zu werden.
»Pass du auf Sofie auf! Hörst du?«, rief Jakob noch Luzia zu. »Und auf die Naandl. Dass sie Ruhe gibt und am Ofen hocken bleibt!«
»Natürlich, Vater!«, rief Luzia zurück. »Keine Sorge!«
Da bemerkte Luzia, wie ein Windstoß eine Tuchecke von Trinas umwickeltem Gebilde hochschlug. Für den Bruchteil eines Atemzugs glänzte etwas Schwarzes darunter hervor. War das eine Hand gewesen? Eine Hand aus dunklem Holz geschnitzt und blank poliert? Luzia schaute ihnen nachdenklich hinterher. Dann schüttelte sie den Kopf. Und wenn schon, was ging es sie an! Viel wichtiger war doch, dass Trina das mit dem Walpurgisöl nicht weitertratschen würde. Aber ihr Schandmaul plapperte alles weiter, hemmungslos und ohne Rücksicht. Mit Sicherheit würde sie das tun! Dabei hatte Jakob einen Eid geschworen, kein Wort davon verlauten zu lassen …
Was hatte der Vater nicht alles darangesetzt, um etwas von dieser Kostbarkeit zu bekommen, von diesem Ölfluss, der seit Jahrhunderten unter dem Sargstein mit den Gebeinen der heiligen Walpurgis herabtropfte und dem unzählige wundersame Heilungen nachgesagt wurden.
»Die heilige Walpurga wird der Sofie helfen«, hatte Jakob immer wieder beteuert. Dann hatte der Wanga ein halbes Kännchen voll von einer Handelsreise aus Eichstätt mitgebracht und durch die alte Magda dem Vater zukommen lassen. Für diese Kostbarkeit hatte sich Jakob beim Wanga verschuldet. Wie hoch die Summe allerdings war, das wusste Luzia nicht zu sagen.
»Ein Halsabschneider«, hatte der Vater nur immer wieder verächtlich gebrummt und ihm die Beulenpest an den Hals gewünscht. »Der Wanga ist ein Halsabschneider.«
Diese Schuld war zu tilgen, wie hoch sie auch immer sein mochte, dazu noch den Zehnten an die Kirche und den Zins für das Lehen. Zwar war der Wanga der Grundherr, aber sie hatten das Erbrecht nach dem Gesetz der freien Erbleihe. Tirol war das Land der freien Bauern. Leibeigenschaft wie auf der anderen Seite der Alpen gab es nicht mehr.
Allerdings warf die karge Feldarbeit nicht viel ab, und dann war vor ein paar Jahren auch noch das Vieh an einer seltsamen Seuche verendet. Die Schafe waren plötzlich schreckhaft geworden, die Köpfe mit den zuckenden Ohren hatten sich hin und her gewiegt, schaumige Spucke war ihnen aus dem Maul getroffen. Dann schleiften die Klauen über den Boden, die Tiere rieben ihr verkrustetes Fell an Pfosten und Bäumen, als hätte sie ein diabolischer Juckreiz erfasst, und ihr Gang wurde schwankend, bis sie endlich kraftlos in sich zusammensackten. Auch die Bergrinder taumelten und strauchelten. Die dunklen Augen waren angstvoll aufgerissen, und ihr durchdringendes, anhaltendes Muhen hallte wie eine Beschwörung durch die Berge.
»Sie rufen die Kuhgötter«, hatte Sofie geraunt und ehrfürchtig gehorcht. »Einen Kuhgott wie bei den heißen Quellen. Der mit dem Hörnerhelm. Und der ein Horn bläst. Sie gehen bald nach Hause …«
Seit Sofie am Stilfser Joch dieses übermannshohe Steinrelief eines Heroen mit Schild, Standarte und Hörnerhelm gesehen hatte, war sie davon überzeugt, dass Kühe mit ihrer gewaltigen Sprache den gehörnten Stiergöttern huldigten.
»Der Himmel ruft!« Sie hatte gelächelt und die Hände gefaltet. »Sie dürfen nach Hause gehen. Nach Hause …«
Als auch die letzte Kuh von der Seuche dahingerafft worden war, hatte Jakob vor der Jungfrau Maria ein Gelübde abgelegt. Gebettelt und gefleht hatte er, dass wenigstens die Familie von allem Unheil verschont bleiben möge! Zum Dank würde er alles, aber auch alles dafür tun, damit Sofies verirrter Geist wieder zurück in ihren Körper fand.
Aber Sofie hatte über das Gelöbnis nur gekichert. »Der Himmel ist Himmel. Der schließt keinen Pakt mit Öl oder Salz oder Hühnerdreck.«
»Gott hat dich erschaffen«, hatte Jakob da gesagt. »Da kann er auch die Gnade erschaffen.«
Gottlob waren ihnen vier äußerst fruchtbare Säue geblieben. Jeder Wurf war prachtvoll, und die kräftigen und lebensstarken Ferkel wurden gerne gekauft. Dann hatten sie noch die kostbaren Marillen- und Palabirnbäume, die von den Soldaten im Calvenkrieg nicht in Brand gesetzt worden waren und deren Früchte manche Münze einbrachten. Außerdem wuchs die Gerste gut auf ihrem Ackerland, dieses anspruchslose Getreide, das nicht viel zum Leben brauchte. So wie sie selbst.
Luzia schaute gedankenverloren zu dem heruntergedonnerten Schneehaufen hinüber. Jetzt schaufelten die Männer Schneisen in den Hügel, und Brocken von schwerem Schnee flogen durch die Luft, die hinter ihnen Löcher in das Weiß brachen.
Plötzlich blieb Jakob stehen und stocherte mit der Schaufel im Schnee herum. Er war auf etwas gestoßen, und es hatte geklungen, als hätte er mit hartem Metall auf Stein getroffen. Geduckt schaute er sich um, ließ den Blick über Alois und Diethard wandern, über Ferdl und die Moidl. Aber niemand war hochgeschreckt, selbst Trina hatte nichts bemerkt. Nachdenklich wandte er sich ab, blieb regungslos stehen und …
»Es ist tot! Es ist tot!«, hörte Luzia da Sofies kreischende Stimme. »Die Angst hat sein Herz zerdrückt!«
2
Luzia rannte sofort in Richtung Schweinestall, von wo das aufgebrachte Schreien gekommen war. Die zähen, schweinsledernen Stiefel schabten inzwischen an ihren Knöcheln und drückten an den Zehenspitzen. In den Fersen pochte das Blut. Trotzdem hetzte sie weiter und stieß die Stalltür auf. Streu und Spelzen wirbelten hoch, staubiger Dunst flirrte im Licht. Sofie stand dicht an eine Bretterwand gepresst und zeigte auf ein rosiges Schwein. Es lag ausgestreckt auf dem Stroh und rührte sich nicht mehr. »Tot ist es. Tot. Aus Angst vor dem Schnee!«
Luzia kniete sich neben die Sau und versuchte mit dem Zeigefinger seine Halsschlagader zu ertasten. Nichts regte sich. Sie trat gegen den Schweinerücken, schlug nach den Klauen. Nichts. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sollte sie Jakob rufen? Oder den Ferdl? Die Naandl am Ofen war zu schwach, um ihr zu helfen. Oder sollte sie etwa selbst … die Zeit drängte …
»Stich es ab!« Sofie schrie und weinte. »Stich es ab, sonst macht das Blut das Fleisch kaputt. Stich es ab! Das Blut muss raus! Sonst sitzt die Angst im Fleisch.«
Luzia rannte auf sie zu, wollte sie im Arm wiegen und ihr beruhigend übers Haar streichen. »Komm mit zur Naandl, dann musst du nicht …«
»Ich will aber sehen, wie das Blut läuft!«, unterbrach Sofie sie störrisch und rührte sich keinen Halm breit. Haarsträhnen klebten an ihren tränennassen Wangen. »Stich es ab. Schnell. Hol die Angst raus!«
Luzia atmete tief durch. »Dann bleib du hier stehen, und rühr dich nicht von der Stelle, hörst du? Ich hol nur schnell das Messer. Versprochen?«
»Ich verspreche es.« Sofie blieb stocksteif stehen.
»Und nicht weglaufen?« Luzia blickte zu ihrer Schwester, dem Spiegelbild ihrer selbst. Sie hatten die gleichen dichten schwarzen Wimpern, das gleiche fein geschnittene Gesicht, das gleiche leicht rundliche Kinn. Ihre Lippen waren voll, und die untere wölbte sich vor, wenn Wut in ihnen aufstieg. Nur waren Sofies dunkle Augen ein wenig schräg gestellt, ihre Kopfform war etwas schmaler, und ihr dunkles Kraushaar stand störrisch vom Kopf ab.
»Nein, ich lauf nicht weg. Ich will doch die Angst sehen!«, antwortete Sofie mit beschwörender Stimme, riss die tränennassen Augen weit auf und starrte lauernd auf das tote Schwein, als könnte es im nächsten Moment aufspringen und die Flucht ergreifen.
Luzia zögerte kurz, dann rannte sie los, schlug die Stalltür auf und stemmte sich gegen die Windböen, die jetzt über die Hochebene fegten.
In der Ferne zerrte der Vater gerade geborstene Bretter aus dem Schnee, während die Moidl weiterschaufelte. Die Birchlerin stand mit dem länglichen Bündel in den Armen da und hielt das Kinn prüfend hochgereckt, als würde sie über das gesamte Geschehen wachen.
»Bring auch die Holzschüssel mit!«, rief Sofie ihrer Schwester hinterher. »Und den Löffel. Den Löffel! Vergiss nicht den Löffel!«
Nur wenig später war Luzia zurück im Viehstall. In der einen Hand hielt sie ein scharfes Messer, in der anderen eine tiefe Holzschüssel und einen Löffel. Sie musste sich beeilen, sonst würde das Blut gerinnen und sich im Muskelfleisch festsetzen. Sie schob den kleinen Bottich seitlich unter den Schweinekopf mit den starr blitzenden Äugelchen und den zurückgeklappten Ohren. Wie rau sich doch die Schwarte mit den Borsten anfühlte! Luzia atmete noch einmal tief durch und setzte dann die Messerklinge an die Halsschlagader.
»Stich es ab!«, schrie Sofie und hielt sich die Ohren zu. »Lass die Angst raus!«
Es knirschte, als Luzia Haut, Sehnen und Adern durchtrennte. Ein Blutschwall ergoss sich in den Bottich. Dunkelrote Tropfen spritzten gegen die Holzwand, auf das Stroh und auf Luzias Hände. Sie verzog das Gesicht. Sie hasste den Geruch von warmem Schweineblut. Trotzdem hielt sie die tiefe Holzschüssel mit beiden Händen fest, damit sie nicht kippen konnte. Gurgelnd lief der Blutstrahl hinein und warf Blasen, bis er allmählich dünner wurde und versiegte.
Die drei anderen Säue im Stall waren unruhig geworden. Grunzend kamen sie näher, stießen mit den Schnauzen gegen Luzia und wollten im Bottich vom Blut saufen. Luzia trat nach ihnen und beugte sich schützend über die Holzschüssel, die aufgeschlitzte Halswunde der toten Sau dicht vor ihren Augen. Wie die Schwarte sich aufwölbte und die erstarrten Schweinsäugelchen sie anglotzten!
»Du musst pumpen, pump es!«, schrie Sofie, die sich immer noch die Hände auf die Ohren hielt. »Die Angst muss raus. Das Herz ist tot. Das kann nicht mehr. Jetzt musst du es tun!«
»Ja, ich weiß, Sofie. Ich weiß.« Luzia konnte das Schwein nicht aufhängen, damit es ausbluten konnte. Dafür war es zu schwer. Also fasste sie nach dem vorderen rechten Schweinebein und bewegte es hin und her. Immer kräftig gegen die Schweinsrippen. Im Takt eines schlagenden Herzens. Hin und her. Wieder floss Blut. Wieder drängten sich die anderen Säue heran. Und wieder trat Luzia nach grunzenden Schweineschnauzen. Pumpen musste sie, hin und her, damit auch das letzte Blut aus dem Körper pulsierte.
»Und jetzt schlagen!« Sofie umklammerte ihre Schultern, als wollte sie sich an sich selbst festhalten. »Schlag die Angst heraus!«
»Natürlich, Sofie. Ich schlag das Blut.« Luzia schluckte, hockte sich breitbeinig auf einen Schemel und klemmte sich den Bottich zwischen die Schenkel. Dann fing sie an, das Blut mit dem Holzlöffel zu schlagen. Ganz allmählich wölbte sich Schaum auf der roten Brühe. Nur noch wenige Schläge, dann konnte es nicht mehr gerinnen.
»Schlag es! Schlag die Angst raus!« Sofie war aufgesprungen und feuerte Luzia an.
Der Unterarm tat Luzia weh, und die Finger, die den Löffel umklammert hielten, wurden langsam taub. Sie versuchte sich abzulenken und dachte an das Lob des Vaters und das anerkennende Nicken von Ferdl, der sonst nur abfällige Bemerkungen für sie übrighatte.
»Weiter! Schneller! Die Angst, sie muss raus!« Sofie zwirbelte Haarsträhnen um ihren Zeigefinger, während sie auf einem trockenen Halm herumkaute.
Luzia hielt den Bottich ein wenig schräg. Das eintönige Geräusch des Holzlöffels, der gegen die Wand der Holzschüssel klackte, das Plätschern und Spritzen und der Geruch des erkaltenden Schweineblutes ließen Übelkeit in ihr aufsteigen. Trotzdem schlug sie weiter, immer das beifällige Lob des Vaters im Ohr. Ihr Atem ging gehetzt, Schweißperlen rannen ihr über Wangen und Hals ins Schultertuch.
Nun zerrte eine kräftige Sau an dem toten Tier, sodass sein Kopf zur anderen Seite ins Stroh kippte.
»Weg ihr! Haut endlich ab!« Luzia trat derb nach dem quiekenden Schwein, das vom zurückgeklappten Ohr der toten Sau abgebissen hatte und darauf herumkaute.
»Warum starren die Toten eigentlich immer in eine bestimmte Richtung? Was gibt es denn da zu sehen?« Sofie kam langsam näher und folgte dem starren Blick der Sau, der auf die hintere Stallwand gerichtet war. Suchend kniff sie ein wenig die Augen zusammen. »Ob es vor der Wand etwas sieht? Oder dahinter?« Sie blinzelte und schaute und hielt den Kopf schräg. Mit den Fingerspitzen fuhr sie sich durch das dunkle, wirre Haar, wischte sich die nassen Strähnen von der Wange und beugte sich noch tiefer, um der Blickrichtung der Sau folgen zu können.
»Das kann ich nicht sagen.« Luzia zuckte mit den Schultern. »Das ist bei uns Menschen sicherlich anders.«
»Anders? Und wie?« Sofie legte die Wange auf die hochgezogene Schulter und suchte noch immer mit den Augen die Bretterwand ab.
»Das hängt bestimmt von jedem Einzelnen ab.« Ein letztes Mal quirlte Luzia die Blutbrühe in der Schüssel auf. »Aber ich kann’s nicht sagen, ich war ja noch nicht tot.«
Sofie nickte nachdenklich. »Wenn man tot ist, muss man ja auch nichts mehr sehen. Dann ist man einfach tot und im Himmel. Gibt es eigentlich auch einen Angsthimmel, wo man hinkommt, wenn man nur umfällt?«
»Ich weiß es nicht.« Luzia seufzte, stellte den Bottich auf den Schemel und begann, den rötlich aufgedunsenen Schaum abzuschöpfen. »Ich weiß es wirklich nicht, Sofie.«
»Es muss schön sein, einfach nur umzufallen. Dann öffnet sich der Himmel, und man geht heim.« Sofie hob ehrfürchtig den schrägen Blick. »Ganz schön und ganz einfach.«
»Für dich ist immer alles ganz einfach«, sagte Luzia leise. »Viel zu einfach.«
Die Tür zum Schweinestall knarrte. Jakob und Ferdl polterten herein und klopften sich Schnee von den Kleidern. Gleichzeitig fuhr ein eisiger Windstoß in die Stallung und wirbelte Streu und Spelzen hoch.
»Tot war die Sau!« Sofie hatte vor Aufregung die dunklen Augen weit aufgerissen.
»Was? Eine Sau ist tot? Was habt ihr angestellt?« Jakob und Ferdl schauten erschrocken zu dem ausgestreckten Tier. Zu der blutigen Schaumlache, die allmählich in sich zusammenfiel. Und zu den drei anderen grunzenden Schweinen, die mit den Schnauzen im Stroh wühlten.
»Der Bergschnee hat ihr Angst gemacht.« Sofie strahlte. »Da ist sie einfach umgefallen. Und ich hab Luzia geholfen, die Angst wegzujagen!«
Mit ausgebreiteten Armen lief sie auf Jakob zu, der sie behutsam an sich drückte. »Das hast du gut gemacht, kleine Sofie.«
Argwöhnisch kamen die Männer näher, bauten sich breitbeinig vor Luzia auf und begutachteten die aufgeworfene Stichwunde am Schweinehals, den Bottich mit dem Blut und den abgeschöpften Schaum, dessen rötlich schimmernde Blasen zwischen dem Stroh zerplatzten.
»War es auch wirklich tot?«, fragte Ferdl misstrauisch. Er hatte seine buschigen Augenbrauen hochgezogen, sodass zwischen seinen Haarfransen an der Schläfe ein dunkles Muttermal zu sehen war. »Vielleicht war es ja nur benommen …«
»Es war tot!« Luzia rieb sich das schmerzende Handgelenk. »Da war kein Herzschlag mehr.«
»Es hat sich auch nicht tot gestellt!« Sofie nickte ernsthaft. »Ich habe genau geguckt, ob es beim Gurgeldurchschneiden gezuckt hat.«
Der Vater wandte sich Ferdl zu. Gemeinsam besprachen sie, wann und wie sie die Sau verarbeiten sollten. Sie redeten über das Enthaaren mit der Kette, das Abbrühen in der Wanne, das Aufhängen an den Hinterbeinen und das Ausweiden. Über Hauswürste und Speckseiten, die in der Wanne mit wohlriechenden Gewürzen übereinandergestapelt würden, und über die Därme, die ausgespült werden müssten, und das Verarbeiten des Blutes zu Würsten. Über das Auslassen von Fett, das Räuchern und Salzen. Und über das Geld, das der Verkauf bringen würde.
Gemeinsam verließen sie den Schweinestall. Jakob hatte seinen kräftigen Arm schützend um Sofie gelegt, als wäre sie zu verletzlich für dieses Leben. Auf der anderen Seite ging Ferdl, und seine Augen strahlten. Sicherlich blieb eine fette Wurst für sie selbst übrig.
Luzia blieb allein zurück. Sie schaute ihnen hinterher, bis die knirschenden Schritte im Schnee verklungen waren. Die Stalltür war offen geblieben.
Die Säue quiekten, wühlten mit den Schnauzen im Stroh und wollten vom Blut. Luzia fühlte sich wie aus dem Leben gefallen. Kein Lob. Keine Anerkennung. Nichts. Dann hörte sie Schritte, schnelle kleine Schritte. Es war Sofie. Aufgewühlt rannte sie Luzia entgegen.
»Du hast doch die Angst herausgeschlagen!«, rief sie schon von Weitem.
Luzia nickte und ließ die Hand mit dem Holzlöffel sinken.
»Und wo ist sie jetzt?« Sofie starrte ihre Schwester an. »Wo ist sie? Wo ist die Angst hin? Kann sie mich finden?«
»Die Angst ist fort.« Luzia versuchte zu lächeln. »Außerdem bist du die Sofie. Die kennt keine Angst.«
Sofie stockte. Ihr Blick wanderte nachdenklich über Bretterwand, Stroh und Säue. Dann kicherte sie und küsste Luzia auf die Wange. Es war ein feuchter Kuss. »Das stimmt. Ich bin die Sofie. Und die Angst ist die Angst.« Dann rannte sie wieder davon.
Ein kühler Windstoß wehte in den Stall und ließ Luzia frösteln. Sie atmete tief durch und wischte sich Blutspritzer aus dem Gesicht. Mit festem Griff umfasste sie den Blutbottich und trug ihn durch den Schnee zum Verschlag neben dem Bauernhaus.
Der Kirchgang am Sonntag war von einer Vorahnung auf den Frühling getragen. Schneefladen fielen von den Lärchenästen klatschend zu Boden, dünne Rinnsale von Schmelzwasser suchten sich ihren Weg. Der Abstieg über den Kirchsteig hinunter nach Göflan war zwar rutschig glatt, aber die Luft war durchdrungen vom Geruch nach frischer Erde.
Göflan war die Urpfarre der Gegend. Schon sehr früh befand sich hier eine Kirche, der viele Bauernhöfe angeschlossen waren. Vom Schnalstal und sogar dem Ötztal brachten sie ihre Toten, um sie auf dem Göflaner Friedhof begraben zu lassen, denn von dieser Anhöhe aus waren sie sicherlich auch dem Himmel ein Stück näher. Wie oft standen Trauernde an der hinteren Friedhofsmauer, nachdem sie an Gräbern gebetet hatten, und richteten den Blick hoch zum Himmel und dann hinunter ins Etschtal, das sich als breite Ebene zwischen hoch aufragenden Bergmassiven hindurchzog.
Ferdl war wie immer mit der Moidl vorweggegangen. Ihnen folgte der Vater, der Sofie an einem Gurt festhielt, um sie im Kirchgedränge nicht zu verlieren. Luzia schlidderte ihnen hinterher, auf abschüssigen Wegbiegungen, vorbei an Feldern und Wiesen, Kiefernwäldern und vertrocknetem Gehölz.
Neben einer Steilkurve lag am Berghang hinter dürrem Ackerland eine Steinhütte. Dort lebte die alte Magda, die für Luzia das Walpurgisöl verwahrt hatte. Die Fensterläden ihrer Hütte mit dem tiefen Schrägdach waren wegen der Kälte zugezogen, dünner Rauch stieg aus dem Schornstein.
Magda lebte schon seit Jahren allein. Ihr Mann war ausgehungerten Wölfen zum Opfer gefallen, als er seine beiden Ziegen mit Knüppeln vor den Bestien hatte schützen wollen. Seit dem Tod ihres Mannes verließ die Magda nur noch selten das Grundstück. Sie beackerte ihren Garten selbst, baute Saubohnen an, die zu Mehl für Brot zermahlen wurden, und molk die Bergziege, die ihr noch geblieben war. Wenn sie abends schlaflos auf ihrem Strohlager in die Dunkelheit starrte, schmiegte sich der struppige Kater an sie, dessen wohltuende Wärme sie nicht missen mochte. Die alte Magda war eine Freundin der Naandl, allerdings begegneten sich die beiden nur noch selten.
Sobald das Wetter es zuließ, hockte sich Magda zwischen Haus- und Gartenarbeit auf eine Holzbank, die ihr Bertold einst gezimmert hatte, und blickte an dem fernen Wegkreuz, dem Marterl, vorbei in die Ferne. Gerade so, als wartete sie auf jemanden, der ihr verloren gegangen war. An diesem Tag stand die Bank leer, und geschmolzener Schnee tropfte zwischen den Bretterritzen hindurch zu Boden.
Normalerweise legte die alte Magda ein geflochtenes Seil um Gartenpforte und Zaunpfosten. Wenn das Seil lose am Boden hing, waren Besucher willkommen. Wenn es allerdings dreimal um die Pfosten festgezurrt war wie an diesem Tag, wollte die alte Magda niemanden sehen.
Auch die Naandl hatte sich nicht zum Gottesdienst auf den Weg gemacht, sondern war im Bauernhaus geblieben. Zwischen dem hochgemauerten Ofen und der Zimmerwand gab es nämlich eine Lücke, das Höllele, wie sie es nannten. Dort, wo sich die Wärme staute, passte so eben ein Strohsack rein, auf dem sich die Naandl gerne zur Ruhe legte.
»Die Alten frieren, weil sie endlich die Zeit dazu haben«, hatte Sofie noch gesagt. »Ich habe keine Zeit zum Frieren. Ich will noch weg.«
Luzia sah schon von Weitem den spitzen Turm der zierlichen Walpurgiskirche von Göflan, die gleich neben der größeren Kirche St. Martin erbaut worden war. Die wurde allerdings gerade renoviert und war für die Sonntagsmesse geschlossen. Luzia mochte das grazile Kirchlein sowieso lieber, das wie eine Monstranz wirkte, wie sie der Pfarrer beim Hochamt vorantrug. Außerdem war sie der heiligen Walpurga geweiht, deren Gnade sie für Sofies Heilung erflehten und auf die der Vater alle Hoffnung setzte.
Kaum auf dem Kirchweg in Göflan angekommen, drängten sich auch schon die Birchlers durch die Kirchgänger. Trina zwängte sich mit ausgestreckten Ellbogen an Dörflern vorbei, wohl darauf bedacht, dass ihr neuer Lodenmantel nicht beschmutzt wurde. Das fusselig rote Haar hatte sie sorgsam unter einer bestickten Haube verborgen. Wieder hatte sie die Lippen gespitzt, als wäre dies ein Zeichen herrschaftlicher Herkunft. Ihr folgte Alois mit gewalktem Umhang um den Schultern und einem schmalkrempigen Filzhut mit Feder auf dem Kopf, genauso einem, wie ihn sich der Jakob schon immer gewünscht hatte.
»Wie schön, dich hier zu treffen«, flüsterte jemand Luzia ins Ohr. Es war Diethard. Sein warmer Atem fuhr ihr über den Nacken und ließ sie frösteln. »Hat es was gebracht? Das Walpurgisöl bei der Irren?«
Behutsam legte er seine Hand auf Luzias Schulter, drückte langsam zu, bis es schmerzte und sie jeden einzelnen seiner Finger spürte.
»Nimm deine Hand da weg«, fuhr sie ihn mit unterdrückter Stimme an, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Warum denn? Mir gefällt das.« Seine Stimme war so sanft, so herausfordernd, dass Übelkeit in ihr aufstieg.
»Mir aber nicht! Lass mich sofort los«, fauchte sie und versuchte sich aus der Umklammerung zu befreien.
»Du willst doch nicht, dass jemand etwas von diesem … Öl erfährt?«, hauchte er. »Da musst du schon ein wenig brav sein.«
Mit einem Ruck löste sie sich aus dem schmerzhaften Griff und lief der Moidl hinterher. Kiesel knirschten unter ihren Sohlen. Luzia hob die Schultern. Sicherlich starrte Diethard ihr jetzt hinterher und ließ seinen Blick über ihren Nacken und abwärts zu Hüfte und Hinterteil wandern. So wie immer, wenn er sie mit gierigen Augen beäugte, als könnte er satt davon werden. Unwillkürlich presste sie die Gesäßmuskeln zusammen. Sie fühlte sich nackt. Trotz des festen Leinenrockes, trotz der Strickweste, trotz des Umhangs. Er ekelte sie so sehr.
»Es ist der Trieb«, hatte die Naandl ihr einmal zugeflüstert, als sie dicht beieinander auf der Ofenbank hockten. »Den brauchen die Mannsbilder. Damit’s genug Burschen und Maidele gibt. Für den Hof.«
»Und wenn kein Hof da ist«, hatte Sofie gesagt, die Naandls Worte aufgeschnappt hatte, »dann ist der Trieb ganz umsonst da. Darum wird er dann verkauft. Auf dem Markt, damit alle Mannsbilder auf Höfen einen Trieb haben. Und es genug Burschen und Maidele gibt. Nicht wahr, Naandl?«
»Ja, meine Sofie. Der wird dann verkauft«, hatte die Naandl geantwortet. Und ihre Stimme war ganz kraftlos geworden, als würden ihr die Worte am Gaumen kleben bleiben. Und ihr Atem war so flach geworden, als wollte sie ihn nicht mehr haben. Als wollte sie fort in ein fernes Land, wo es keine Erinnerungen mehr gab.
Noch hallten keine Glockenschläge vom Kirchturm herab, doch immer mehr Dorfbewohner drängten sich zum Kirchplatz. Der Himmel war zwar von nebligen Wolkenfeldern bedeckt, sodass nur blassgraues Sonnenlicht zur Erde fiel, aber es war entschieden wärmer geworden. Auf dem Platz war der Schnee fast schon weggeschmolzen. Rutschige Graupelreste hingen zwischen dem Kies, der auf den Kirchwegen und zwischen den Gräbern ausgestreut war. An der Mauer glänzten einige der Steinchen zwischen feuchtem Moos und Grasbüscheln schneeweiß auf. Luzia bückte sich und hob eins davon hoch. Der Marmorkiesel lag tropfnass auf ihrer Handfläche, glatt geschliffen von den Gletschermoränen der Berge, den Gerölllawinen oder den Sturzbächen bei der Schneeschmelze.
Wieder legte sich eine Hand auf Luzias Schulter. Blitzartig schnellte sie herum, aber diesmal war es nur Pfarrer Thimotheus, der die Kirchgänger begrüßte und der ihren Dorfpfarrer vertrat, der auf Pilgerreise war.
Pfarrer Thimotheus sah noch recht verschlafen aus, aber er lächelte selig vor sich hin. Seine Augen waren mit roten Äderchen durchzogen. Ihm fehlte ein Schneidezahn, und jedes Mal, wenn er auflachte, versuchte er die Lücke mit einer Hand zu verbergen. Vertraulich zwinkerte er einer jungen Dienstmagd mit üppigem Busen zu, die ihm einen koketten Blick zuwarf. Er rülpste, versuchte aber sofort mit kräftigem Räuspern die Peinlichkeit zu überdecken. Der Geruch von säuerlichem Wein zog Luzia in die Nase. Die Moidl schaute verschämt zu Boden, während Ferdl die buschigen Augenbrauen hob und der vollbusigen Dienstmagd hinterherlinste, die verführerisch die Hüften wiegte.
»Nun geht schon«, drängte Jakob sie in die Kirche, während er Sofie fest am Gürtel hielt. »Lasst uns bei der heiligen Walpurga für … für uns alle beten.«
Der Kirchraum von St. Walpurgis war klein. Das netzartige Kreuzgewölbe mit seinen Blüten- und Blätterranken wirkte wie ein emporgehobener Garten. Alles war in sanftem Gelb gehalten, als wollte der Maler erstes Frühlingslicht darin einfangen. Die braunbemalten Deckenstreben sahen aus wie gezähmte Äste, aus denen die zarten Malereien hervorwuchsen. Und dort, im linken Gewölbezwickel, die heilige Walpurga mit ihrer Ölkanne …
Schnell schob Jakob seine Tochter Sofie in eine Gebetsbank, ganz nah unter das Bildnis. Die Moidl, Ferdl und Luzia zwängten sich hinterdrein.
Auf der rechten Seite ließen sich die Birchlers auf eine Kirchbank nieder. Trina ächzte schwerfällig, als sie sich setzte. Fröstelnd schob sie ihre Finger in einen Muff aus Kaninchenfell, der an Kordeln um ihren Hals hing. Alois rieb die kalten Handflächen aneinander, und Diethard hob sein kantiges Kinn und blinzelte Luzia zu.
In der kleinen Kirche war es kühl. Jedes Hüsteln hallte von den Wänden wider, jedes plötzliche Stiefelscharren verstärkte sich zu einem Lärm, der die Betenden aufschrecken ließ.
Sofie schob den Oberkörper vor, sodass ihr der Umhang von den Schultern rutschte. Ihre Nase war von der Kälte gerötet, die dunklen Augen glänzten. »Der Berg lässt sich nicht belügen!«, rief sie laut der Birchlerin zu. »Und nicht bestechen. Auch nicht mit Kerzen …«
»Bist du wohl still.« Jakob presste Sofie die Hand auf die Lippen, während er gequält lächelte, der Birchlerin zunickte und seiner Tochter ins Ohr flüsterte: »Wenn du still bist, kriegst du auch Schnitze von der Palabirne. Wenn du ganz still bist …«
Birnenschnitze? Sofies Augen weiteten sich, und die Hand des Vaters löste sich zögerlich von ihren Lippen.
Drei der kostbaren Birnbäume wuchsen bei ihnen auf dem Hofanger. Ein Medicus pflegte einen großen Teil der Ernte der Pilli-Palli-Birnen – wie die Naandl sie nannte – aufzukaufen. Sie strotzten vor gesunden Säften, deshalb wurden sie selbst reichen Venezianern als Medizin verschrieben. Auch der Brückenwirt von Schlanders erwarb jährlich mehrere Stiegen davon. Nur herabgefallene Früchte mit Druckstellen verarbeitete die Moidl selbst. Sie schnitt die Birnen in Streifen und trocknete sie im Ofen für die Feiertage. Dann erst wurden sie in den Brotteig gemengt und gebacken. Vorher war Naschen verboten. Nur Sofie wurde manchmal ein Scheibchen zugesteckt.
»Birnenschnitze will ich nicht. Und ich schweige, wann ich will!«, rief Sofie. Ihre Stimme hallte laut im Gewölbe wider, während Trina angewidert das Gesicht verzog. »Ich lüge nicht! Ich nehme die Schnitze nur, wenn es wirklich nur Schnitze sind.«
»Wenn es wirklich nur Schnitze sind«, raunte die Birchlerin spöttisch.