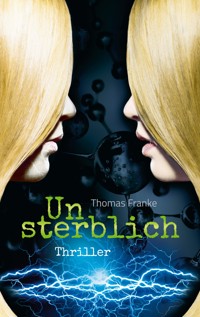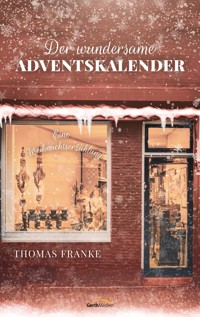Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Miriam hat ihren beruflichen Erfolg hart erkämpft. Das fromme Weltbild ihres strengen Elternhauses hat sie jedoch längst abgelegt. Doch als alte Wunden aufbrechen, beschließt sie, sich einer neuartigen Therapie zu unterziehen, um ihre traumatischen Kindheitserfahrungen endgültig hinter sich zu lassen. Doch irgendetwas geht schief, und mit einem Mal sieht sich Miriam ihrem kindlichen Ich gegenüber. Fortan wird sie auf Schritt und Tritt von dem kleinen rothaarigen Mädchen begleitet, das niemand außer ihr sehen kann. Dies bringt nicht nur Miriams Berufs- und Privatleben gehörig durcheinander, sondern stellt auch ihre scheinbar so fest verankerte Weltsicht infrage ... Eine berührende Geschichte, die dabei hilft, die ungeheure Kraft des kindlichen Glaubens zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Thomas Franke ist Sozialpädagoge und bei einem Träger für Menschen mit Behinderung tätig. Als leidenschaftlicher Geschichtenschreiber ist er nebenberuflich Autor von Büchern. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Mehr über den Autor: www.thomasfranke.net
Inhalt
Schuhlöffel und Pflegeengel
Das Angebot
Der Schatten
Recherche
Barbie und die Lumpenpuppe
Die zweite Stimme
Sneakers und ein verschollener Patient
Fake-Profil und Märchenbrunnen
Wut und Blumen
Erntediebe im Kastanienbaum
Zwischen Tonerkartuschen und Aktenvernichter
Der braune Umschlag
Erdachte Vertrauenswürdigkeit und ein unerwarteter Anruf
Der schmale Weg
Bilder
Das Böse
Wundenreparatur und Zwiebelmett
Charles
Du musst genauer hinsehen
Falsche Fragen und Kannibalen
Probierhäschen
Die Jesus-Brille
Das, was alles verändert
Der Artikel
Merkst du es nicht?
Wolle und die Lichtung
Flucht und Frieden
Das Bekenntnis
Blumen pflanzen
Vielleicht
Nachwort und Dank
Schuhlöffel und Pflegeengel
Morgenlicht flutete die Dachterrasse und zeichnete den scharfen Schatten eines ungenutzten Blumenkübels auf die rötlichen Bangkirai-Dielen. In den Kästen auf der Balkonbrüstung wucherte Löwenzahn. Eine winzige Blaumeise hüpfte von Kasten zu Kasten und suchte nach etwas Essbarem.
Miriam stand am bodentiefen Fenster ihres Wohnzimmers und ließ den Blick über die verwahrloste Terrasse schweifen, während sie an ihrem Cappuccino nippte. Vor gut zwei Jahren war sie hier eingezogen. Sie hatte Blumenzwiebeln gekauft, es aber noch nicht geschafft, sie einzupflanzen. Noch immer hingen keine Gardinen an den Fenstern, und im Schlafzimmer stapelten sich zwei Dutzend unausgepackte Umzugskartons.
Sie seufzte. Ob sie sich hier jemals zu Hause fühlen würde?
Im Inforadio wurde stockender Verkehr auf der Berliner StadtautobahnA100 gemeldet. Wenn sie die Rushhour vermeiden wollte, blieb ihr nicht mehr viel Zeit.
Miriam stellte den Kaffeebecher ins Spülbecken und eilte in die Diele. Nach kurzem Zögern entschied sie sich für die HighHeels mit den Zwölf-Zentimeter-Absätzen. Zwar war sie mit ihren 1,76Metern ohnehin keine kleine Frau, aber in ihrem Business konnte es niemals schaden, wenn die Männer zu ihr aufblicken mussten.
Sie trat hinaus in den Hausflur, schloss die Tür hinter sich ab und wollte sich gerade die Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer in die Ohren stecken, als ein lauter Ruf durchs Treppenhaus hallte.
„Raus hier, aber sofort!“
„Frau Kühnemann, ich …“, erwiderte eine Frauenstimme besänftigend, wurde jedoch gleich wieder unterbrochen.
„Verlassen Sie meine Wohnung oder ich rufe die Polizei.“
Miriam verdrehte die Augen. Es war wieder einer dieser Tage… Um ihre Absätze bangend, hastete sie die Treppe hinunter und erreichte den dritten Stock im selben Augenblick, als Gerda Kühnemann, einen metallenen Schuhlöffel schwingend, auf die Fußmatte trat. Die Augen der betagten Dame starrten über die Lesebrille hinweg angriffslustig auf eine beleibte Mittvierzigerin, die ängstlich hinter dem Treppengeländer in Deckung ging.
„Was ist denn hier los?“, fragte Miriam im selben forschen Tonfall, mit dem sie ein Meeting eröffnete.
„Diese Person ist in meine Wohnung eingedrungen und wollte mich vergiften!“, behauptete Gerda Kühnemann.
„Das stimmt nicht! Ich bin ein Engel!“, verteidigte sich die Frau hinter dem Treppengeländer.
„Bitte was?“, fragte Miriam irritiert.
Gerda stach mit dem Schuhlöffel in die Luft. „Sie wollte mich umbringen!“
„Sie hätte mir beinahe den Schädel eingeschlagen!“, empörte sich die Frau, ohne die sichere Deckung zu verlassen.
Miriam rückte unauffällig dichter an ihre Nachbarin heran. „Keine Sorge, Gerda“, sagte sie in ruhigem Tonfall. „Ich kümmere mich darum.“
Die alte Dame ließ den Schuhlöffel sinken, starrte ihre Kontrahentin aber weiterhin finster an.
„Können Sie mir bitte erklären, was hier los ist?“, wandte Miriam sich wieder an die beleibte Frau hinter dem Treppengeländer.
„Ich komme von der PflegeengelGmbH. Als ich geklingelt habe, hat niemand aufgemacht, deshalb habe ich aufgeschlossen. Ich hörte Frau Kühnemann im Bad. Also habe ich mich durch ein lautes Guten Morgen bemerkbar gemacht und bin dann in die Küche gegangen, um die Medikamente für die Woche zu stellen. Und da kam sie auf einmal wie eine Furie um die Ecke gestürmt und wollte mir mit diesem … Ding den Schädel einschlagen!“
„Stimmt das, Gerda?“, fragte Miriam.
„Na ja, was würdest du denn machen, wenn auf einmal eine wildfremde Frau in deiner Küche steht und dir irgendwelche Pillen ins Frühstück mischt?“
„Ich bin nicht wildfremd, ich bin Schwester Karin!“, sagte die Pflegerin, während sie vorsichtig aus der Deckung trat.
„Sie können meinetwegen auch Schwester Hildegard sein, ich kenne Sie trotzdem nicht!“, schnaufte die alte Dame.
„Es war mit Ihnen abgesprochen, dass ich Ihnen die Herztabletten unter die Haferflocken mische.“
„Unsinn!“, fauchte Gerda. „Wenn ich mich vergiften wollte, würde ich das schon selber machen.“
Miriam warf einen Blick auf ihre Uhr. Einen Moment lang erwog sie, die beiden mit ihrem Zwist alleinzulassen. Schließlich ging sie das Ganze nicht wirklich etwas an. Gerda Kühnemann war nur ihre Nachbarin. Aber dann erinnerte sie sich daran, was sie der alten Frau verdankte, und zwang ein verbindliches Lächeln auf ihre Lippen. „Schwester Karin, würden Sie bitte einen Augenblick hier warten?“
„Ich habe keine Zeit! Eigentlich müsste ich schon längst beim nächsten Patienten sein!“
„Ach, das nächste Opfer wartet schon?“, giftete die alte Dame. „Auftragskillerin scheint ja ein stressiger Job zu sein!“
Die Pflegerin schnappte empört nach Luft.
Miriam mutmaßte, dass sie diese Tätigkeit noch nicht lange ausübte, sonst wäre sie sicher nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. „Es dauert nur einen Moment“, fügte sie freundlich hinzu. Dann hakte sie sich bei ihrer Nachbarin unter und zog sie sanft, aber bestimmt in die Wohnung. „Komm, Gerda, wir müssen etwas besprechen.“
Kaum hatte Miriam die Tür hinter sich geschlossen, änderte sich die Haltung der alten Frau. Sie sackte förmlich in sich zusammen. Als sie den Schuhlöffel ins Regal zurücklegte, zitterten ihre Hände, und ihr Gesicht bekam einen verzweifelten Ausdruck. „Ich glaube, ich muss mich einen Augenblick hinsetzen“, murmelte sie.
Miriam führte sie ins Wohnzimmer – oder in die gute Stube, wie Gerda es nannte – und die alte Dame setzte sich.
„Soll ich dir ein Glas Wasser holen?“
Gerda schüttelte den Kopf und seufzte leise. „Ach Kati, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist!“
Kati war Gerdas jüngere Schwester, wie Miriam inzwischen wusste. Sie war vor zwei Jahren verstorben.
Statt zu antworten, hockte Miriam sich hin, sodass sie auf Augenhöhe mit ihrer Nachbarin war.
„Meinst du wirklich, die Frau ist eine Pflegerin?“, fragte Gerda verunsichert.
Miriam nickte langsam. „Ehrlich gesagt glaube ich das. Seit gut drei Monaten kommt ein Pflegedienst zu dir, um dir deine Medikamente zu verabreichen und dir beim Duschen zu helfen.“
„Tatsächlich?“ Die Verwirrung stand der alten Frau ins Gesicht geschrieben. Ihr Blick verlor sich in der Ferne.
Miriam schaute wieder auf die Uhr. Mit dem Morgenmeeting würde es knapp werden. „Weißt du, was? Ich habe eine Idee!“
„Wie schön für Sie“, sagte Gerda mit neu erwachtem Misstrauen. „Und was machen Sie in meiner Wohnung?“
Miriam verspürte einen Stich der Besorgnis. So vergesslich wie heute hatte sie ihre Nachbarin noch nie erlebt. „Gerda“, sagte sie sanft, „du kennst mich doch.“ Sie strich sich eine Strähne ihres roten Haars hinters Ohr.
„Kati?“
Miriam lächelte.
„Ach Schätzchen, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist.“
„Komm, wir machen ein Foto.“
Die alte Dame erhob sich und betastete ihre Frisur. „Nicht, solange ich aussehe wie ein Pudel, der in ein Starkstromkabel gebissen hat.“
„Doch nicht von dir, von der Pflegekraft“, erwiderte Miriam. „Das Bild hängen wir dann in deiner Wohnung auf, damit du sie beim nächsten Mal zuordnen kannst.“
Einen Augenblick lang zeigte sich Verwirrung auf Gerdas Gesicht, doch schließlich nickte sie.
Miriam erwischte den Pflegengel gerade noch auf dem letzten Treppenabsatz. „Warten Sie.“
„Ich habe wirklich keine Zeit mehr!“
„Bitte, lassen Sie mich ein Foto von Ihnen machen, als Erinnerungshilfe für Frau Kühnemann.“
„Okay, meinetwegen.“
Die Pflegerin knipste ein halbherziges Lächeln an, und Miriam schoss ein Foto mit ihrem Smartphone. „Was ist mit den Medikamenten?“, fragte sie dann.
„Sind noch in der Tablettenbox.“
Miriam eilte zurück in die Wohnung ihrer Nachbarin und achtete darauf, dass Gerda die Tabletten auch wirklich schluckte. Dann hastete sie zu ihrem Auto.
Sie war dankbar für den Stellplatz in der Tiefgarage, auch wenn sie sich für die unverschämt hohen Kosten eine Zweitwohnung hätte leisten können. Allerdings entsprach die Wahrscheinlichkeit, in dieser Gegend einen freien Parkplatz zu finden, in etwa der Chance, vom Blitz getroffen zu werden.
Die 200PS ihres Sportwagens waren angesichts des morgendlichen Stadtverkehrs nicht wirklich hilfreich. Miriam war zehn Minuten zu spät, als sie mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz der Agentur hielt.
Sobald sie ausgestiegen war, war von Eile jedoch nichts mehr zu spüren. Kontrolle war alles.
Sie lächelte kühl, als sich ein junger IT-Mitarbeiter neben ihr in den gläsernen Aufzug quetschte. Er murmelte ein „Guten Morgen“ und blickte dann unsicher blinzelnd an ihr vorbei.
Wie ein Mantra wiederholte Miriam innerlich die Worte ihres Mentors. Als Frau musst du intelligenter, härter und skrupelloser sein als jeder Mann, um in diesem Business Erfolg zu haben.
Die Aufzugstüren öffneten sich. Miriams HighHeels klackten laut auf den auf Hochglanz polierten Marmorfliesen. Durch die Glastür des Besprechungsraums sah sie, dass ihr Team bereits auf sie wartete.
Sie unterdrückte den Impuls, sich zu beeilen, und zog stattdessen ihr Smartphone aus der Tasche, als hätte sie noch etwas Wichtiges zu überprüfen.
Wenn sie schon zu spät kam, dann wenigstens mit der selbstverständlichen Nonchalance einer elisabethanischen Aristokratin.
Das Angebot
Die Besprechung verlief unspektakulär. Einige ihrer Kollegen nutzten jede Gelegenheit, sich zu profilieren, andere starrten gelangweilt auf ihre Latte-Macchiato-Gläser oder blickten verträumt der hübschen Praktikantin hinterher, die einen Überblick über die Umsatzzahlen des ersten Quartals austeilte.
Miriam war genervt.
Da sich ihr Geschäftsführer Sebastian Köhler überwiegend in der Zweigstelle in London aufhielt, hatte sie als seine Stellvertreterin hier das Sagen. Fast zwei Drittel der Mitarbeitenden waren männlich, und jeder von ihnen schien insgeheim der Ansicht zu sein, besser für Miriams Job geeignet zu sein als sie. Es war ein täglicher Kampf, den sie nur durch knallhartes Auftreten und Erfolg gewinnen konnte.
Bedauerlicherweise blieb der Erfolg seit einiger Zeit aus. Die Quartalszahlen lagen deutlich unter Vorjahresniveau. Dabei mangelte es der Agentur keineswegs an Aufträgen; die Kundenzahl war innerhalb eines Jahres sogar um fast fünfzig Prozent gestiegen. Arbeit gab es reichlich, sie brachte nur nicht genug ein – jedenfalls nicht genug, um die Erwartungen der Gesellschafter zu erfüllen.
Nach einer knappen Stunde beendete Miriam das Meeting und begab sich in ihr Büro. Die nächste Gesellschafterversammlung würde in einer Woche stattfinden. Wenn ihr bis dahin nicht irgendein genialer Schachzug einfiel, konnte sie sich auf ihre ganz persönliche Inquisitionserfahrung einstellen.
„Miriam, kommst du bitte mal?“ Die junge Praktikantin kam ins Büro gestöckelt. „Da will dich jemand sprechen.“
Miriam löste den Blick nicht von der Powerpoint-Präsentation auf ihrem Bildschirm. „Hat dieser Jemand einen Termin?“
„Nein, aber –“
„Dann sag ihm, er soll seine Anfrage online stellen. Wir melden uns dann.“
„Er behauptet, es sei dringend und ein gemeinsamer Freund habe dich wärmstens empfohlen.“
Miriam seufzte und wandte sich um. „Hat er auch verraten, von welchem Freund er spricht?“
Die junge Frau schüttelte den Kopf. „Nein, er meinte nur, du würdest mit hundertprozentiger Sicherheit mit ihm reden wollen.“ Sie blickte Miriam länger als sonst ins Gesicht, und in ihrem Blick zeigte sich eine Mischung aus Neugier und gespielter Besorgnis. „Alles okay mit dir? Du siehst müde aus.“
„Tatsächlich?“ Miriam verzog die Lippen zu einem Lächeln bar jeden Humors. „Seit wann bist du hier?“
„Äh, seit drei Monaten. Du hast mich doch selbst eingestellt“, antwortete sie sichtlich irritiert.
„Seit wann heute Morgen?“, hakte Miriam nach, als hätte sie es mit einer geistig Minderbemittelten zu tun.
Ein Hauch von Verunsicherung zeigte sich auf dem hübschen Gesicht der Praktikantin. „Seit 9 Uhr. Warum?“
„Du machst das hier also mehr zum Zeitvertreib, nehme ich an“, bemerkte Miriam.
Die Augen der jungen Frau wurden groß. „Nein, die Arbeit ist mir wichtig. Sehr wichtig sogar! Es ist mein absoluter Traum, hier zu arbeiten.“
Miriam hob die Brauen. „Tatsächlich?“ Sie stand auf. „Wo wartet der Kunde?“
„In Konferenzraum zwei.“
„Danke.“
„Miriam, warte!“ Die Praktikantin stöckelte eilig hinter ihr her. „Ich dachte, es ist normal, um 9 Uhr anzufangen. Niemand hat mir etwas anderes gesagt! Aber … ich kann gerne früher kommen. Das ist gar kein Problem. Sag mir einfach, wann ich da sein soll.“
„Wenn man dir sagen muss, was du zu tun hast, bist du hier fehl am Platz.“
Die junge Frau blieb verunsichert stehen.
Miriam beachtete sie nicht weiter und stieß die Glastür zum Konferenzraum auf.
Der Mann stellte seine Espressotasse ab, erhob sich und lächelte charmant. Er war groß gewachsen, schlank und gebräunt. Sein Anzug war ohne Zweifel maßgeschneidert. „Frau Eckert“, er reichte ihr die Hand, „wie schön, Sie kennenzulernen.“
Miriam erwiderte seinen Händedruck. Ihr Lächeln fiel jedoch etwas knapper aus. „Guten Tag. Und Sie sind?“
„Markus Bergmann. Marketingmanager der Hoehnbeck AG.“
Äußerlich zeigte Miriam keine Regung, aber sie spürte, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann. Hoehnbeck war eine große Nummer. Der Konzern gehörte zu den Top 20 der Chemiekonzerne weltweit.
Bergmann hielt ihre Hand noch ein wenig länger fest als nötig. „Oliver Klaaßen hat Sie mir wärmstens empfohlen.“
„Ach, hat er das?“ Miriam verzog keine Miene, als der Name ihres Liebhabers fiel. Sie entzog Bergmann die Hand und bedeutete ihm, Platz zu nehmen. Nun kam es darauf an, das Spiel auf die richtige Weise zu spielen. Wenn ihr Gegenüber spürte, wie dringend sie einen neuen Auftrag brauchte, hatte sie schon verloren.
„Wir haben uns auf einer Konferenz in Zürich kennengelernt und stehen seitdem in losem Kontakt. Oliver meinte, Sie seien absolut vertrauenswürdig und in Bezug auf Diskretion und Fachkompetenz unschlagbar.“
Miriam setzte sich ebenfalls und schlug die Beine übereinander. „Worum geht es?“
Der Mann räusperte sich. „Bevor ich beginne …“ Er ergriff eine Ledermappe und fischte ein Dokument heraus, das er ihr zuschob. „Unsere juristische Abteilung hat da etwas vorbereitet.“
Miriam warf einen flüchtigen Blick auf das Papier – eine Verschwiegenheitserklärung. Sie schob das Blatt zurück. „Sie reden von meiner Vertrauenswürdigkeit, und das Erste, was Sie tun, ist, mir Ihr Misstrauen zu signalisieren?“
Er lächelte entschuldigend. „So läuft das Geschäft. Es war nicht meine Entscheidung.“
„Ach ja?“ Miriam blickte ihn mit großen Augen an. „Man hat Ihnen in dieser Angelegenheit also nicht freie Hand gegeben? Vielleicht wäre es dann besser, wenn ich mit demjenigen rede, der bei Ihnen die Entscheidungen trifft.“
Bergmanns Lächeln wirkte ein wenig verkniffen. „Sie wissen, dass solche Vereinbarungen in unserer Branche üblich sind.“
„Und Sie wissen, dass bestimmte Probleme nur auf einer Ebene des Vertrauens behandelt werden können.“ Es war ein Schuss ins Blaue. Noch hatte Miriam keine Ahnung, worum es ging. Aber je mehr Bergmann sich ihr auslieferte, desto besser war ihre Verhandlungsposition. Letztlich ging es in diesem Geschäft immer um Macht.
Markus Bergmann lehnte sich zurück. Die gespielte Freundlichkeit war von ihm abgefallen wie alter Schorf von einer Wunde. Seine Kiefermuskeln traten deutlich hervor.
„Sie sind zu mir gekommen, nicht ich zu Ihnen“, sagte Miriam betont freundlich. „Sie wollen etwas von mir. Aber damit ich Ihnen helfen kann, muss ich alles wissen, verstehen Sie? Alles! Jedes schmutzige Detail.“
Bergmann presste die Lippen zusammen. Dann holte er tief Luft, doch Miriam sprach weiter, bevor er etwas erwidern konnte. „Bitte, widersprechen Sie nicht. Es gibt schmutzige Details, sonst hätten Sie nicht Ihren Kontakt zu Oliver bemüht und wären ohne Termin hier aufgetaucht.“
Er stieß die Luft aus und schien ein wenig in sich zusammenzusacken. Sein Blick wanderte an Miriam vorbei zu der Wand hinter ihr. Dort stand das Firmenmotto der Agentur: Ihre Marke ist unsere Leidenschaft – get in touch with us.
Miriam beugte sich vor und blickte ihn ernst an. „Herr Bergmann, das hier wird nur funktionieren, wenn Sie mir vertrauen.“
Er seufzte. Dann nickte er langsam. „Also gut.“ Er schluckte. „Aber es wird hässlich werden.“
„Wie hässlich?“
„Es hat Tote gegeben.“
Miriam hob die Brauen.
„209 Tote, um genau zu sein.“
Miriam verzog keine Miene. „Was genau ist passiert?“
„Eine Explosion in einer Düngemittelfabrik. Nicht bei uns, sondern bei einem Subunternehmer in Indien. Der Kerl hat geschlampt und sich nicht an die Richtlinien gehalten.“ Er schnaufte frustriert. „Insgesamt starben 54 Männer, 87 Frauen und 68 Kinder …“
„Kinder?“ Miriam zeigte keine Regung. Einen Moment lang ergriff sie pures Entsetzen, dann brach sich ein neuer Gedanke Bahn. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemandem ist damit geholfen, wenn ein großes Unternehmen Insolvenz anmelden muss und Tausende von Arbeitsplätzen wegfallen.
Die Gedanken in ihrem Kopf überschlugen sich. Wenn Hoehnbeck eine Katastrophe dieser Tragweite überstehen wollte, dann war das Unternehmen wahrhaft auf Hilfe angewiesen. Diese Geschichte hatte das Potenzial, etwas ganz Großes zu werden.
Bergmann lächelte gequält. „Wie gesagt, der Subunternehmer hielt sich nicht an die Richtlinien.“
„Die Kinder, die dort gearbeitet haben – wie alt waren sie?“
„Die ganze Bandbreite von 6 bis 14 Jahren.“
„Das ist … nicht gut.“
„Das kann man so sagen.“
„Wussten Sie davon?“
„Ich sagte doch bereits, dass der Subunternehmer sich nicht an die Richtlinien gehalten hat.“
Miriam blickte ihn eindringlich an. „Herr Bergmann, wussten die Verantwortlichen in Ihrer Firma davon?“
„Nicht offiziell.“
„Aber sie wussten es?“
„Was denken Sie denn?“, fuhr er auf.
Miriam zog die Brauen hoch.
Er hob entschuldigend die Hand und räusperte sich. „Was wir nicht wussten: Ein investigativer Journalist aus den USA war vor Ort, als das Unglück geschah. Er wollte die Geschichte des zehnjährigen Bansa erzählen, der in der Fabrik arbeitete. Ein niedlicher Lockenkopf mit großen braunen Augen. Es gibt ein Interview, in dem der Kleine von seinen Träumen berichtet – und von seinen Albträumen, den Hustenanfällen in der Nacht und den Arbeitsunfällen, die bereits mehrere seiner Freunde zu verkrüppelten Bettlern gemacht haben … Der Junge starb bei der Explosion.“
„Und der Journalist?“
„War in der Nähe, als es geschah, und liegt ebenso wie die Hälfte der Menschen aus den umliegenden Dörfern mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus.“
„Das ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe.“
Bergmann lächelte schmallippig. „Deshalb brauchen wir Sie als Katastrophenhelferin.“
Miriam stand auf. Sie hatte ihn. Der Fisch hing am Haken! Sie tat so, als würde sie nachdenklich auf und ab gehen, während sie versuchte, ihren wummernden Herzschlag zu beruhigen. „Das wird nicht billig.“
„Ist uns vollkommen klar“, erwiderte Bergmann.
Miriam nickte. „Gut. Wir werden einen Plan ausarbeiten und Ihnen ein Angebot machen.“
Bergmann schüttelte den Kopf.
„Ich brauche jetzt Ergebnisse.“
„Wie bitte?“ Miriam blickte ihn überrascht an. „Sie dulden über Jahre hinweg massive Menschenrechtsverletzungen, verursachen eine Riesenkatastrophe, die Hunderte von Menschen das Leben kostet, und erwarten, dass ich Ihnen augenblicklich eine Lösung präsentiere?“
„Genau. Wie viel brauchen Sie dafür?“
Miriam stieß ein ungläubiges Lachen aus. „Herr Bergmann, das meinen Sie jetzt nicht ernst.“
„15 Millionen?“ Er zog ein Formular aus seiner Ledertasche. „Wenn Sie wollen, unterzeichne ich sofort einen entsprechenden Vertrag. 5 Millionen erhalten Sie als festes Honorar, den Rest zahlen wir, wenn die Kampagne Erfolg hat. Sie müssen uns nur die Möglichkeit verschaffen, heil aus dieser Sache herauszukommen.“
Miriam spürte, wie ihr Kehlkopf auf und ab hüpfte, als sie schluckte. Ein leichtes Schwindelgefühl bemächtigte sich ihrer, und sie setzte sich wieder. „20 Millionen, davon 10 Millionen Festhonorar und die übrigen 10 Millionen nach erfolgreicher Durchführung.“ Sie war froh, dass ihre Stimme so fest wie immer klang. „Und 3 Millionen brauchen wir als Vorschuss.“
„Gut!“ Ohne mit der Wimper zu zucken, begann Bergmann damit, die Zahlen in den Vertrag einzutragen.
Wie viel hätte ich denn noch verlangen können, wenn er das so klaglos akzeptiert?,schoss es Miriam durch den Kopf. Sie las sich den Vertrag sorgfältig durch und unterschrieb. Die Gedanken in ihrem Kopf rasten.
„Frau Eckert, welche Marschroute schlagen Sie vor? Bislang konnten wir die Sache unter den Teppich kehren. Aber das wird nicht mehr lange gut gehen. Spätestens, wenn der Journalist das Krankenhaus verlässt, wird uns ein Empörungs-Tsunami überrollen.“
Miriam nickte. Bergmann hatte absolut recht. „Das wird sich nicht aufhalten lassen. Wenn der Mann überlebt, haben Sie das volle Programm am Hals.“
Bergmann kniff die Augen zusammen. „Sie meinen, wir sollen das Problem an der Wurzel packen?“
Miriam starrte ihn ungläubig an. „Was genau wollen Sie denn damit andeuten?“
„Nichts!“ Er lächelte. „Aber genau diese Art kreativen Denkens brauchen wir.“
„Herr Bergmann, nicht, dass wir uns missverstehen: Ich habe Sie diesbezüglich zu nichts aufgefordert.“
Ihr Gegenüber nickte nachdenklich. „Natürlich nicht.“
„Ihnen ist schon klar, was für eine Katastrophe es wäre, wenn der Eindruck entsteht, Sie hätten beim Tod eines Journalisten nachgeholfen?“
Er winkte ab. „Selbstverständlich. Wir sind ja keine Amateure.“
„Okay.“ Miriam wischte das beklemmende Gefühl beiseite, dass sich in ihr breitmachen wollte, und konzentrierte sich darauf, eine grobe Strategie zu entwickeln.
„Also, was schlagen Sie vor?“, fragte Bergmann mit verbindlichem Lächeln.
„Im Grunde müssen wir eine Imagekampagne starten. Dieser Journalist, wie heißt er?“
„Alex Thompson.“
„Für wen arbeitet er?“
„Er hat ein paar Artikel für die New York Times geschrieben, ist aber als freier Journalist tätig.“
„Okay, er ist also mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Das ist eine gute Arbeitsgrundlage. Unsere Kampagne hat zwei Stoßrichtungen: Wir müssen eine stabile Glaubwürdigkeitsgrundlage für Ihr Unternehmen schaffen und gleichzeitig Ihren Gegner diskreditieren.“ Miriam zögerte einen Moment, dann fügte sie hinzu: „Um Letzteres kümmere ich mich.“ Dieser Job erforderte Fingerspitzengefühl, und Bergmann war ihr dafür zu grobschlächtig. „Sie sollten indessen alles daransetzen, einen über jeden Zweifel erhabenen Fürsprecher zu gewinnen“, fuhr sie fort. „Am besten wäre eine Umweltorganisation à la Greenpeace.“
„Bitte wie?“, brauste Bergmann auf. „Diese fanatischen Ökospinner würden uns niemals unterstützen!“
„Ihre Feindbilder müssen Sie über Bord werfen, sonst wird das nichts. Aber Greenpeace ist nur ein Beispiel und ohnehin eine Nummer zu groß. Versuchen Sie es mit einer der kleineren Organisationen, die alles dafür geben würden, etwas mehr Publicity zu bekommen. Ich hoffe, Sie haben wenigstens ein paar soziale Projekte auf der Haben-Seite?“
„Ja, ich glaube, da gibt es etwas …“ Er kratzte sich am Kopf. „Aber darum kümmert sich die Charity-Abteilung.“
Miriam verdrehte innerlich die Augen. „Mehr wissen Sie nicht darüber?“
„Dieses Sozialgedöns ist nicht mein Metier.“
„Dann ändern Sie das! Ein substanzieller Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen könnte Ihnen nämlich den Hintern retten. Also arbeiten Sie sich in das Thema ein, pumpen Sie die Projekte auf, und zwar schnell. Jeder Tag zählt.“
„Das wird aber seine Zeit dauern.“
„Egal, fangen sie jetzt schon an, darüber zu reden. Fake it ’til you make it!“
„Gut.“
„Als Zweites müssen Sie schonungslos offen sein.“
Bergmann entgleisten die Gesichtszüge. „Wie bitte?“
„Vollständige Transparenz ist unabdingbar“, wiederholte Miriam ernst. „Sie haben doch selbst gesagt, dass der Subunternehmer Sie auf verbrecherische Weise hintergangen hat. Stellen Sie sicher, dass ein unabhängiger, vertrauenswürdiger Gutachter überzeugende Beweise dafür findet, und machen Sie die Sache öffentlich.“
„Ach so.“ Das verbindliche Lächeln kehrte auf Bergmanns Gesicht zurück. „Wir werden das unverzüglich in die Wege leiten.“
„Und dann müssen Sie Reue zeigen“, fuhr Miriam unerbittlich fort.
„Was?!“ Bergmann starrte Sie verdutzt an. „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wir sind gerade dabei, Millionen in unsere Unschuld zu investieren. Dieses Investment konterkarieren wir doch nicht, indem wir uns am Ende schuldig bekennen.“
„Niemand spricht von einem Schuldbekenntnis. Aber wenn Sie signalisieren, dass es Ihnen nur darauf ankommt, Ihre Firma reinzuwaschen und dass Ihnen die Menschen vollkommen egal sind, dann nützen Ihnen alle Ihre Investitionen nichts.“
Bergmann presste die Lippen zusammen.
„Machen Sie deutlich, dass Sie sich für die Menschen in der betroffenen Region verantwortlich fühlen. Unterstützen Sie dortige Schul-, Wohn- und Qualifizierungsprojekte. Auch eine Investition in die medizinische Versorgung wäre hilfreich.“
„Wir sind ein Chemieunternehmen, keine Wohlfahrtsorganisation.“
„Wollen Sie heil aus der Sache herauskommen oder nicht?“ Miriam lächelte. „Vertrauen Sie uns. Wir stellen Ihnen ein schönes Potpourri zusammen.“
„Und was müssen wir uns den Spaß kosten lassen?“
„Im mittleren einstelligen Millionenbereich sollte es schon liegen.“
Bergmann seufzte. „Also gut. Arbeiten Sie die Pläne aus.“ Er warf einen Blick auf seine Uhr. „Ich muss heute noch mit dem Vorstand sprechen. Können Sie mir eine kurze Präsentation innerhalb der nächsten, sagen wir einmal, drei Stunden zukommen lassen?“
„Ja, allerdings nur eine grobe Übersicht.“
„Das reicht völlig, Details interessieren niemanden. Hier, meine Karte.“
„Ich schicke Ihnen die Datei verschlüsselt zu.“
„Sehr gut.“ Er reichte ihr die Hand. „Auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen, Herr Bergmann.“
Er verließ raschen Schrittes den Konferenzraum. Zurück blieb nur ein Hauch seines sündhaft teuren Herrenparfüms.
Miriam ging in ihr Büro, rief in London an und informierte ihren Geschäftsführer Sebastian Köhler über den mit Abstand größten Deal der Firmengeschichte. Dann arbeitete sie eine kurze Präsentation aus und saß anschließend noch bis 2 Uhr nachts am Schreibtisch, um die Pläne zu konkretisieren.
Der Schatten
Müdigkeit hüllte sie ein und zerrte an ihr, so schwer und aufdringlich wie ein nasser Frotteebademantel.
Miriam ließ den Schlüssel auf das Sideboard plumpsen und zog sich die Schuhe aus. Mit schmerzenden Füßen tappte sie ins Badezimmer. Nachdem sie sich das Gesicht gewaschen hatte, löste sie ihren Zopf, ließ die langen rotbraunen Haare über ihre Schultern fließen und warf einen kritischen Blick in den Spiegel. Was sie darin sah, gefiel ihr nicht sonderlich. Nicht nur, weil ihre Nase zu spitz und ihre Lippen zu schmal waren. Ihre ohnehin schon blasse Haut wirkte beinahe durchsichtig. Dunkle Ringe lagen unter ihren Augen, die von feinen Fältchen umgeben waren. 34 Jahre hinterließen ihre Spuren. Zumindest hatte sie aufgrund des Stresses in letzter Zeit ein paar Kilo abgenommen und war genauso schlank wie ihre 15 Jahre jüngere Praktikantin. Nun ja, zumindest fast.
Sie schlüpfte in ihren Pyjama und schlurfte barfuß ins Schlafzimmer. Eine Matratze auf dem Boden, ein Stuhl und ein Kleiderschrank – das war die ganze Einrichtung, wenn man von den gestapelten Umzugskartons einmal absah. Mit einem Gähnen, das ihr fast den Kiefer ausrenkte, ließ sich Miriam auf die Matratze fallen.
Als sie sich gerade in ihre Decke einkuschelte, klingelte ihr Handy. Wenn sie jetzt ein Gespräch annahm, würde sie ihren toten Punkt überwinden und wäre wieder hellwach. Ohne auf das Display zu sehen, schaltete sie das Gerät aus und ließ es auf die abgezogenen Holzdielen plumpsen.
Ihr Blick wanderte zu den Bücherstapeln in der Zimmerecke und dann zu dem alten Lehnstuhl, auf dem sich ihre schmutzigen Klamotten stapelten. Ihre Wohnung war nicht gerade billig. 136 Quadratmeter Altbau im teuersten Kiez des Prenzlauer Bergs. Zwei Zimmer, Wohnküche, Bad, Parkett und ein Kamin im Wohnzimmer, sorgfältig restaurierter Stuck an den Decken. Aber in den lichtdurchfluteten Räumen standen insgesamt nur zwölf Möbelstücke. Im Grunde lebte sie noch immer wie eine Studentin.
Oliver fand das gut. Es gebe ihrer Beziehung etwas Verruchtes, hatte er behauptet.
Miriam verstand nicht, was an einer spärlich eingerichteten Wohnung für 4.336 Euro Kaltmiete im Monat verrucht sein sollte. Aber vielleicht hatte es auch eher etwas mit dem studentischen Ambiente zu tun. Oliver war 17 Jahre älter als sie. Möglicherweise gab es ihm einen Kick, wenn er das Gefühl hatte, mit einer Studentin zu schlafen.
Kurz erwog Miriam, ihn anzurufen. Sie hatten sich seit drei Tagen nicht gesehen. Er musste jetzt irgendwo in Kapstadt sein. In der afrikanischen Niederlassung seiner Firma gab es Ärger. Nein!, befahl sie sich selbst. Hör auf damit. Du weißt doch genau, wie das enden wird. Letztlich fühlst du dich noch einsamer. Du musst schlafen!
Sie löschte das Licht und schloss die Augen.
Im Wohnzimmer knackte etwas. Es hörte sich beinahe so an, als würde jemand durch den Raum laufen – schwere Schritte, die langsam näher kamen.
Miriam riss die Augen auf. Sie linste zur halb geöffneten Zimmertür. Hatte sich dort etwas bewegt?
Ihre Hand tastete nach dem Lichtschalter der kleinen Stehlampe. Sei nicht albern!, ermahnte sie sich. Wer soll das schon sein? Der alte Holzboden knackt ständig! Ihren Fingern waren diese Argumente offenbar egal, denn sie drückten auf den Schalter. Helles Licht flutete den Raum, und der Schatten verschwand.
Miriam seufzte und schaltete das Licht wieder aus. Du musst jetzt schlafen!Sie schloss die Augen und zwang sich, bewusst langsam ein- und auszuatmen.
Leider scherten sich ihre Gedanken nicht um ihren müden Körper, sondern wuselten umher wie quirlige Ameisen auf einem faulen Apfel. 20 Millionen Euro! Sie hatte heute einen Auftrag an Land gezogen, der den Jahresumsatz der Firma sage und schreibe vervierfachen würde. Sebastian hatte am Telefon kaum ein vernünftiges Wort herausgebracht. Bislang hatte meist er die größeren Deals an Land gezogen. Mit diesem Erfolg war Miriam auf einen Schlag all ihre Probleme los und hatte sogar beste Chancen, ihm den Geschäftsführerposten streitig zu machen.
Du musst schlafen!, mahnte sie erneut eine hartnäckige innere Stimme. Doch ihre Gedanken rasten weiter wild umher und entwarfen bereits eine Strategie für die nächste Gesellschafterversammlung, während Miriam sich gleichzeitig fragte, ob ihr bei der Präsentation des Indien-Projekts möglicherweise ein Fehler unterlaufen war.
Ihr Herz pochte. Sie schaltete das Licht wieder ein, tappte in die Küche und nahm eine von den Schlaftabletten, die der Arzt ihr verschrieben hatte. Das Zeug war ziemlich stark und konnte abhängig machen. Aber wenn sie heute Nacht keinen Schlaf fand, würde sie morgen im Büro zusammenbrechen, und das war mit Sicherheit keine Alternative.
Nach kurzem Zögern warf Miriam noch eine halbe Tablette mehr ein und spülte das Ganze mit einem Glas Milch hinunter. Dann ging sie zurück ins Schlafzimmer und kuschelte sich wieder in ihre Decke. Ihre Gedanken mäanderten noch eine Zeit lang umher, doch schließlich glitt sie hinüber in die Welt der Schatten.
Im Haus ist es dunkel. Miriam schlüpft aus ihrem Bett. Auf Zehenspitzen schleicht sie durch ihr Zimmer und auf den großen dunklen Kleiderschrank zu. Es ist ein alter Schrank mit seltsam verschlungenen Verzierungen und Schnitzereien. Fast wirkt es so, als würde er eine hölzerne Krone tragen. Ein goldener Schlüssel steckt im Schloss. Papa behauptet, der Schlüssel wäre nicht aus Gold, sondern aus Messing, aber Miriam findet, dass er genau so aussieht, wie ein goldener Schlüssel aussehen muss. Selbst im schalen Licht des Mondes glänzt er warm und verlockend wie ein wertvolles Schmuckstück.
Behutsam setzt Miriam einen Fuß vor den anderen. Der Holzboden knarrt leise. Erschrocken hält sie inne. Was, wenn Papa davon wach wird? Sie blickt über die Schulter. Es sind nur fünf Schritte bis zu ihrem Bett. Dort kann sie sich einfach die Decke über den Kopf ziehen und so tun, als würde sie schlafen. Ihr Blick wandert wieder zum Schrank.
Oma hat ihr neulich heimlich eine Geschichte erzählt, in der es auch einen alten, geheimnisvollen Schrank gibt. Und dieser Schrank ist die verborgene Tür zu einer fantastischen Welt mit sprechenden Tieren und Zwergen und einer Hexe, die dafür sorgt, dass immerzu Winter ist, es aber niemals Weihnachten wird.
Miriam stellt sich den Schrank genau so vor wie diesen alten Kleiderschrank in ihrem Zimmer. Behutsam schleicht sie weiter.
„Aber diese Geschichte darfst du niemals deinem Papa erzählen“, hallen Omas mahnende Worte in Miriams Kopf nach.
„Warum denn nicht?“
„Weil dein Papa die falschen Dinge fürchtet.“
Noch immer ist Miriam verwirrt von dieser Aussage. Papa kommt ihr überhaupt nicht furchtsam vor, nur sehr streng und unberechenbar. Oft scheint es, als wäre alles in Ordnung, und dann wird er plötzlich sehr wütend.
Den Blick fest auf den Schrank gerichtet, schleicht sie weiter. Er erscheint ihr wie eine sichere Zuflucht, wie das Tor zu einer schönen und geheimnisvollen Welt.
Die Tür des alten Schranks knarrt. Miriam hält den Atem an. Sie beugt sich vor und schiebt den Karton mit ihren Socken beiseite. Da ist es! Behutsam nimmt sie es heraus und hält es ins sanfte Licht des Mondes. Es glänzt wie echtes Silber. Die aufgenähten Perlen funkeln. Der Stoff fühlt sich glatt und kühl an, und wie herrlich er raschelt!
Miriam hat sich das Kleid von ihrer Freundin ausgeliehen. Morgen wird sie zum allerersten Mal zur Faschingsfeier gehen – verkleidet als Prinzessin.
Sie drückt das Kleid ganz fest an sich und dreht sich auf Zehenspitzen im Kreis wie eine Ballerina.
Und plötzlich, von einem Augenblick zum nächsten, weicht die Vorfreude dem kalten Gefühl der Angst. Ein großer Schatten wächst aus dem klaffenden Loch der geöffneten Zimmertür. Er kommt näher. Die Dielen ächzen unter seinem Gewicht. „Was machst du da?“
Ein Schauer läuft ihr über den Rücken.
Der Schatten scheint immer größer zu werden, wie eine schwarze Wand türmt er sich vor ihr auf. „Was machst du da?“, tönt es vielstimmig und heiser.
Die Mauer bewegt sich, löst sich auf in eine wimmelnde Menge vielgliedriger Gestalten. Dutzende, nein Hunderte Augenpaare starren Miriam an. Zornig, schmerzerfüllt, anklagend.
Eine Faust aus Eis presst ihr das Herz zusammen.
Asche, zerfetzte Kleidung, verbrannte Glieder. Eine Armee von Toten. „Was machst du da?“
Mit einem erstickten Schrei auf den Lippen schreckte Miriam auf. Ihre Kehle war wie ausgedörrt, und ihr Pyjama klebte an ihrem schweißnassen Körper.
Was für ein bescheuerter Albtraum!
Hustend wickelte sie sich aus der Decke und tappte ins Bad. Dort drehte sie den Wasserhahn auf, trank einen Schluck und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, um die schrecklichen Bilder zu vertreiben.
Sie blickte in den Spiegel. Im grauen Licht der Morgendämmerung zeichneten sich dunkle Ringe unter ihren Augen ab. Das zerknitterte Laken hatte Falten auf ihrer Wange hinterlassen. Die schweißnassen Haare hingen wie eine verfilzte Matte an ihr herunter. „Du siehst aus wie eine entlaufene Vogelscheuche“, begrüßte sie ihr Spiegelbild.
Miriams Blick wanderte zur Uhr. Es war 6:50 Uhr. Der Gedanke, noch einmal ins Bett zu kriechen, war verlockend, aber sie wusste, dass sie ohnehin nicht mehr einschlafen würde.
Warum konnte sie dieser Schatten aus der Vergangenheit nicht endlich in Ruhe lassen? Sie war ihrem frommen Gefängnis doch schon vor Jahren entkommen. Die beklemmende Enge, die Drohungen und das erdrückende Gefühl, von Grund auf falsch zu sein – all das gehörte doch längst der Vergangenheit an, spätestens, seit er fort war.
Miriam zog ihren Pyjama aus und stellte die Dusche an. Knapp vier Stunden Schlaf mussten reichen. Sie hatte schon schlimmere Nächte erlebt.
Während warmes Wasser auf ihre verspannten Schultern prasselte, erstellte sie in Gedanken bereits eine Liste mit all den Dingen, die heute zu erledigen waren.
Recherche
Guten Morgen.“ Die Praktikantin begrüßte Miriam mit einem erwartungsvollen Lächeln.
„Morgen“, murmelte Miriam. „Ist Lena schon da?“
„Ja. Ich glaube, sie kam kurz nach mir.“
Miriam nickte. „Sie soll in mein Büro kommen.“
„Okay.“ Doch anstatt sich gleich auf den Weg zu machen, folgte die junge Frau ihr. „Soll ich dir einen Espresso bringen?“
Miriam wandte sich um. Irrte sie sich oder starrte dieser unverschämt frisch aussehende Teenager mit dem makellosen Teint gerade selbstzufrieden auf die dunklen Ringe unter ihren Augen? „Ich will, dass du deinen Job erledigst!“
Sie wartete die Reaktion der Praktikantin gar nicht erst ab und ging stattdessen schnurstracks in ihr Büro.
Dort angekommen, fuhr sie ihren Rechner hoch. Als Startseite war die Firmenhomepage eingerichtet. Attraktive, perfekt gestylte Menschen in einem lichtdurchfluteten Besprechungsraum, die begeistert auf einen Bildschirm starrten. Darunter stand:
Als strategische Marketingagentur mit Sitz in Berlin, München und London arbeiten wir mit internationalen Konzernen genauso wie mit innovativen lokalen Start-ups zusammen, um ihre Marktposition zu optimieren.
Ihre Marke ist unsere Leidenschaft – get in touch with us.
Miriam fand den Text viel zu gewöhnlich, aber Sebastian hatte sich durchgesetzt. Nun, wer weiß, vielleicht würde sich das Machtgefüge innerhalb der Geschäftsführung bald ändern.
Sie checkte ihre E-Mails. Markus Bergmann hatte den Empfang ihrer Präsentation bestätigt. Eine inhaltliche Rückmeldung gab es noch nicht.
„Morgen, Miriam“, grüßte Lena sie.
Ihre Assistentin trug wie immer einen Hosenanzug mit einem weiten Jackett, um zu verbergen, dass sie ein paar Pfund zu viel auf die Waage brachte.
„Morgen.“ Miriam lächelte knapp. „Geht’s dir besser?“
Lena nickte und lehnte sich an den Besprechungstisch. „Migräneattacke – heftig, aber kurz. Ich bin wieder voll einsatzfähig.“
„Gut.“ Lena hatte dieses Jahr schon dreimal wegen Migräne gefehlt. Das war für Miriams Geschmack ein bisschen zu häufig.
„Und wie geht’s dir? Du siehst müde aus“, bemerkte Lena.
„War ein langer Tag gestern. Hast du mein Memo zum Hoehnbeck-Auftrag gelesen?“
„Ja.“
„Ich muss mehr über den amerikanischen Journalisten wissen, diesen Alex Thompson. Kannst du mir kurzfristig ein Profil von ihm erstellen?“
„Geht klar.“
In diesem Moment meldete sich Sebastian per Videoanruf. Miriam nickte ihrer Assistentin kurz zu und nahm das Gespräch entgegen. „Morgen, Sebastian.“
„Hallo, Miriam. Alles okay bei dir? Du siehst müde aus.“
Innerlich knirschte Miriam mit den Zähnen. Das habe ich jetzt oft genug gehört. Kannst du nicht einfach mal anerkennen, was ich leiste? Sie zwang sich zu einem Lächeln. „War eine kurze Nacht. Was gibt’s?“
„Dieser Hoehnbeck-Auftrag…“ Er verstummte.
„Ja?“
„Er bereitet mir Bauchschmerzen.“
Das glaube ich gern, dachte Miriam. So einen fetten Fisch hast du noch nie an Land gezogen. Nicht mal ansatzweise. Sie setzte eine neutrale Miene auf und wartete ab.
„Wenn die bereit sind, solche Summen zu investieren, ist da garantiert eine Riesenschweinerei am Laufen.“
„Natürlich, 209 Tote. Ich hatte dir die Fakten bereits geschrieben.“
„Glaubst du wirklich, dass dieser Bergmann dir die ganze Wahrheit gesagt hat?“
Nein, dachte Miriam. Ich glaube, dass Hoehnbeck nicht nur an dieser Stelle Mist gebaut hat. Aber das geht uns nichts an. „Sebastian, was willst du von mir? Soll ich die Sache abblasen? Willst du eine Vervierfachung unseres Jahresumsatzes in den Wind schießen?“
Sebastian seufzte. „Ich hätte es nur gut gefunden, wenn du vorher mit mir gesprochen hättest.“
Natürlich, damit am Ende du die Lorbeeren ernten kannst, dachte Miriam. Laut sagte sie: „Du weißt schon, dass ich befugt bin, einen solchen Abschluss auch allein zu tätigen?“
„Es geht hier nicht um irgendeine Befugnis“, fauchte Sebastian, „es geht darum, dass ich meine Verantwortung für diese Firma wahrnehmen muss –“
„Ach, hältst du mich für verantwortungslos?“, fiel Miriam ihm ins Wort.
Er seufzte und schüttelte den Kopf.
„Sebastian, was willst du?“
„Sei… einfach vorsichtig, okay? Und lass uns das bitte gemeinsam angehen.“
„Ich halte dich auf dem Laufenden, versprochen.“ Miriam konnte ihm ansehen, dass es nicht das war, was er hören wollte, aber Sebastian nickte. „Gut. Ich habe noch bis Mittwoch hier in London zu tun, dann komme ich für einige Tage nach Berlin.“
„Wie du willst“, erwiderte Miriam knapp.
„Bis dann. Ciao.“
„Tschüss.“
Sebastian beendete die Videoschalte.
Eine Weile starrte Miriam auf den Bildschirm, dann arbeitete sie weiter an der Hoehnbeck-Strategie.
Einige Zeit später schickte Lena ihr das Profil des Journalisten. Überrascht stellte Miriam fest, dass Alex Thompson einen Teil seiner Kindheit in Baden-Württemberg verbracht hatte. Er war vor 32 Jahren in Böblingen als Sohn einer deutschen Bürokauffrau und eines amerikanischen Marineinfanteristen zur Welt gekommen und bis zur sechsten Klasse in Deutschland zur Schule gegangen. Dann zog die Familie in die USA, lebte ein Jahr in Texas, bevor sie innerhalb von vier Jahren auf verschiedenen Militärbasen in Pakistan, Bahrain und Japan untergebracht war. Seinen Highschool-Abschluss machte Alex in Florida. Zu diesem Zeitpunkt trennten sich seine Eltern.