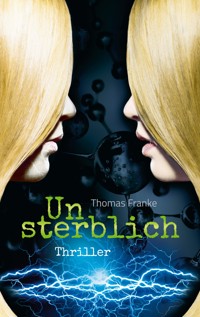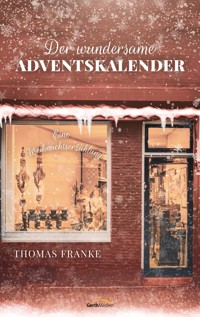Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Theo Marquardt ist Anfang 20 und lebt in einer Berliner Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung. Ohne seinen Rollstuhl kommt er nicht weit, denn er leidet an Kongenitaler Muskeldystrophie. Die Menschen, die für den Tod seines besten Freundes verantwortlich sind, scheinen es nun auf Theo abgesehen zu haben. Sie glauben, dass er der Schlüssel zu etwas ungeheuer Wertvollem ist. Theo selbst hat nicht die leiseste Ahnung, warum. In diesem zweiten und finalen Band der Reihe "Soko mit Handicap" kommen Theo und seine Freunde der Lösung des verzwickten Falls Schritt für Schritt näher. Und sie finden heraus, dass Theos Vater, der wenige Jahre nach der deutschen Wende spurlos verschwand, etwas mit der Sache zu tun hat ... Ein spannender, tiefgründiger und humorvoller Roman, der Bezug auf reale Ereignisse in der jüngeren deutschen Geschichte nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Thomas Franke ist Sozialpädagoge und bei einem Träger für Menschen mit Behinderung tätig. Als leidenschaftlicher Geschichtenschreiber ist er nebenberuflich Autor von Büchern. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Mehr über den Autor: www.thomasfranke.net
Inhalt
Das Anliegen
Ein Drink und eine Reiseempfehlung
Eine beunruhigende Hypothese
Hilfsbereites Chaos
Unsichtbare Augen
Der Unfall
Peter
Schollen-Jan
Aktenlage
Eine metaphorische Stahlbetonplatte
Alte Schulden
Gedankenkarussell und Pizzaassoziationen
Videochat
Der Grauhaarige
Abschied
Verklemmte Synapsen
Akteneinsicht
Ein Cocktail mit Folgen
Zugfahrt im Nebel
Herzmuscheln und ein väterlicher Rat
Traue niemandem
Verwirrende Nachrichten und Safranreis
Finsternis
Dreimal der laufende Mann
Der Trick der Dunkelheit
Wellen und Nebel
Operation jagender Hase
Die stille Tyrannin
Houston, da hamwa den Salat
Aktion Licht und der junge Mann
Hilflosigkeit
Der reinste Bikini
Freundschaft und ein verräterisches Licht
Bisse in der Finsternis
Die Stimme aus der Dunkelheit
Westketchup und Neun-Millimeter-Kugeln
Bekenntnisse
Die Wurzel der Wut
Der Schlüssel
Schüsse
Emmentaler und Leberwurst
Das Schweigen und der Riecher
Abendschau
Danksagung
Das Anliegen
Zerschnittenes Licht fiel durch das vergitterte Fenster auf den kahlen Boden. Ein leichter Geruch nach fauligem Abfluss lag in der Luft; sie schmeckte muffig und feucht. Ein Schritt vom Bett zum Tisch, zwei Schritte zum Waschbecken, einer zur Kloschüssel, vier Schritte zum Fenster, einer zurück zum Bett. Der Kunststoff seines blauen Trainingsanzugs rieb unangenehm auf seiner Haut. Doch Robert Marquardt konnte nicht aufhören, den winzigen Freiraum zu nutzen, der ihm geblieben war.
Von Zeit zu Zeit hörte er Schreie und gebrüllte Befehle. Dann wieder Stille. Am schlimmsten waren die Kontrollgänge. Alle paar Minuten, zumindest kam es ihm so vor, hallten Schritte auf dem Gang vor seiner Zelle wider. Er hörte das Ratschen des Schiebers, zwei Augen starrten stumm auf ihn, den Gefangenen. Manchmal befahl ihm eine Stimme, sich zu setzen und die Hände auf die Knie zu legen. Eine völlig absurde Maßnahme, aber er hatte gelernt, dass es nicht klug war, sich dieser Anweisung zu widersetzen.
Beim ersten Mal hatte er sich geweigert. Als zwei Wachen mit Knüppeln hereingekommen waren, um ihn zu zwingen, hatte er sie niedergeschlagen. Kurz darauf war die halbe Wachmannschaft hereingestürmt. Selbst mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten hatte er keine Chance gehabt. Nun gab es kaum einen Körperteil, der nicht in irgendeinem Farbton zwischen Blau und Grün schimmerte. Auch nachts erfolgten die Kontrollen ohne Unterlass. Er musste auf dem Rücken liegen, die Hände auf der Decke platzieren.
Seit fünf Tagen hatte er kaum geschlafen. Alles tat ihm weh, und ein bohrender Schmerz hatte sich in seinem Schädel häuslich niedergelassen.
Hohenschönhausen – wie um alles in der Welt bin ich nur hier gelandet? Er fuhr mit den Händen über sein stoppelbärtiges Gesicht. Seit dem Unfall war es stetig bergab gegangen. Vielleicht war Hohenschönhausen nur der logische Schluss seines systematischen Niedergangs. Es war, als hätte er mit der Fähigkeit, in der bestausgebildeten Elitetruppe der Nationalen Volksmarine zu dienen, auch seine Identität verloren. Zuerst hatte er getrunken, um den Schmerz zu betäuben, dann, um die Leere zu vertreiben. Es war verrückt, dass ein so harmlos klingendes Wort wie „Tauchuntauglichkeit“ ein ganzes Leben zerstören konnte!
Er war durch alle Raster gefallen, und zum Schluss hatte er auf Vermittlung eines wohlwollenden Beamten hin eine Pförtnertätigkeit bei der kommunalen Wohnungsverwaltung erhalten – gähnende Langeweile und noch mehr Frust. Irgendeine der Dummheiten, die er im Suff begangen hatte, musste ihn hierhergebracht haben. Vielleicht dieser blöde Witz, den er an die Wand geschmiert hatte?
Er stoppte seinen unruhigen Lauf und starrte auf die Lichtflecken auf dem Zellenboden. Sie waren grau und kalt wie Beton.
Das Einzige, was wirklich Licht in die Düsternis dieses Ortes brachte, waren die Erinnerungen an das Mädchen.
Die Sonne geht unter und legt einen purpurnen Schleier über die grauen Fassaden der Mietkasernen. Geschäftig eilen Menschen an ihm vorbei. Er bleibt stehen, hört das Quietschen der wegfahrenden Tram, und ihm fällt auf, dass er eine Station zu früh ausgestiegen ist.
Plötzlich ist da ein Gesicht, braune Locken, sommersprossige Nase und ein Lächeln, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. Sie fragt ihn irgendetwas, doch er ist so gefangen von ihrem Lächeln, dass er nichts anderes tun kann, als dümmlich zurückzugrinsen.
Auf ihrer makellosen Stirn zeigen sich irritierte Falten. „Willst du auch zum Jugendgottesdienst?“, fragt sie erneut. Ihre Stimme ist ein samtiger Alt.
„Äh …“ Er deutet ein Nicken an und erntet erneut dieses bezaubernde Lächeln.
„Ist gleich dort drüben.“ Sie weist mit der Hand auf die nächste Straßenecke. „Wir können zusammen gehen, wenn du willst.“
„Klar.“ Zusammen gehen hört sich großartig an, schießt es ihm durch den Kopf.
Von dem Gottesdienst bekommt er nicht allzu viel mit. Die Musik ist überraschend gut. Aber die Worte des Pastors rauschen an ihm vorbei. Größtenteils liegt es daran, dass dieses Mädchen neben ihm sitzt …
Das Quietschen eines Riegels riss ihn aus seinen Gedanken. Überrascht wandte er sich um. Die Tür ging auf.
„Hände auf den Rücken, Gesicht zur Wand!“, bellte einer der beiden Wachmänner.
Robert gehorchte. Ihm wurden Handschellen angelegt.
„Mitkommen!“
Sie führten ihn durch leere Flure, und schließlich ging es in ein kleines, muffig riechendes Zimmer. Die Mustertapete an der Wand hätte auch bei seinen Eltern im Wohnzimmer hängen können. Die Vorhänge am Fenster waren nikotingelb verfärbt und die Auslegware war abgewetzt.
Ein kräftiger Mann mit schütterem Haar saß am Schreibtisch und machte sich Notizen. Annähernd zwanzig Minuten stand Robert stumm da und wartete. Dann sah der Mann plötzlich auf und lächelte so herzlich, als wären sie alte Bekannte.
„Setzen Sie sich, Herr Marquardt.“ Er wies auf den gepolsterten Stuhl.
Robert setzte sich, während der Mann eine ziemlich dicke Akte aus seiner Schreibtischschublade nahm und sie langsam aufschlug.
„Möchten Sie etwas trinken? Ein Bier vielleicht oder Wodka?“
Robert hob überrascht die Brauen. „Ein Bier wäre schön“, erwiderte er.
Der Mann hinter dem Schreibtisch machte sich eine Notiz und blätterte in der Akte.
„Sie haben ein Alkoholproblem, Herr Marquardt.“
Robert schwieg. Was hätte er auch sagen sollen? Vermutlich hatte der Mann recht.
Erneut wurden Seiten umgeblättert. Der Verhörspezialist studierte die Akte, als wäre Robert Luft, und genauso sollte er sich wahrscheinlich auch fühlen.
Plötzlich seufzte der Mann und richtete sich auf. Er faltete die Hände auf der Akte und starrte Robert ins Gesicht. „Unser Land hat Ihnen viel gegeben, Herr Marquardt. Sie haben eine hervorragende Ausbildung genossen. Man hat Ihnen Vertrauen geschenkt. Und dann missachten Sie einen Befehl und machen alles zunichte.“
Ungerufen drangen Bilder vor Roberts inneres Auge.
Er sieht das aufgewühlte Meer, die lauernde Dunkelheit, das bleiche Gesicht des bewusstlosen Kameraden, spürt das Gewicht des schweren Körpers, der ihn in die Tiefe hinabzuziehen droht. Dann laute Rufe über ihm und Hände, die den reglosen Taucher packen. Kälte zieht die Kraft aus seinen Gliedern. Zu schwach, sich weiterhin gegen den Sog der Tiefe zu stemmen, sinkt er hinab, Wogen schließen sich über ihm und trüben das Licht des Scheinwerfers. Dann trifft ihn die Explosion der Unterwassermine wie eine gewaltige Faust.
Er biss die Zähne zusammen und schwieg.
„Man hat sich um Sie gekümmert, Ihnen Chance um Chance gegeben. Keine davon haben Sie genutzt. Dabei gibt es doch so viel schlimmere Schicksale, und manches lässt sich mit Humor besser ertragen. Haben Sie Humor, Herr Marquardt?“
Robert zuckte mit den Achseln.
„Ich fragte: Haben Sie Humor?“
„Ich denke, schon … manchmal“, erwiderte Robert.
„Es geht doch nichts über einen guten Witz. Kennen Sie den? Was ist der Unterschied zwischen Marx und Murks? – Marx ist die Theorie!“ Er lachte gekünstelt.
Robert verzog das Gesicht zu einem gequälten Lächeln. Genau diesen Spruch hatte er aus einer Laune heraus mit Kreide an eine Wand geschrieben. Dabei war er noch nicht einmal sonderlich politisch interessiert. Es war ihm nur darum gegangen, überhaupt irgendetwas zu spüren.
„Sie lächeln?!“, fuhr der Mann ihn an. „Das ist eine Verhöhnung der sozialistischen Grundpfeiler unseres Staates!“
„Ich hatte getrunken. Es tut mir leid“, sagte Robert. Beides war nicht gelogen. Er könnte sich in den Hintern beißen.
Wieder blätterte der Mann in der Akte. „Unser Land hat viel für Sie getan, sehr viel. Und Sie? Sie haben nichts zurückgegeben. Stattdessen finden Sie Gefallen an subversiven, konspirativen Tätigkeiten.“ Er blätterte weiter in der Akte, machte ein paar Notizen und hob dann wieder den Blick.
„Ich will ganz ehrlich sein: Es sieht nicht gut aus. Vier bis fünf Jahre Bautzen bringt Ihnen das allemal ein.“
„Vier bis fünf Jahre?!“, fuhr Robert auf. „Für einen Witz?“
„Ach?“ Der Mann lächelte. „Sie glauben, es geht hier um die paar Worte, die Sie an die Wand gekritzelt haben, diesen albernen Dummejungenstreich?“ Er schüttelte den Kopf, wurde schlagartig ernst und nahm einen Bogen Papier zur Hand. „Am 15. Mai 1987 haben Sie mit einer gewissen Mechthild Baumbach Kontakt aufgenommen, einem subversiven Element aus reaktionären Kirchenkreisen, die versucht, die Grundlagen unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu unterminieren. Halten Sie das für klug, Herr Marquardt?“
„Ich habe diese Frau nur einmal gesehen und das rein zufällig. Ich weiß nicht einmal, wo sie wohnt. Es wird keinen weiteren Kontakt geben.“
„Oh“, der Mann lächelte und beugte sich vor, „aber ich möchte, dass es weiteren Kontakt zwischen Ihnen gibt. Es ist mir sogar ein großes Anliegen.“
Ein Drink und eine Reiseempfehlung
Hauptkommissar Seidel lehnte an seinem Schreibtisch. Er hatte die massigen Arme vor der Brust verschränkt und musterte Lina, als wäre sie ein bizarres Insekt, das er zum ersten Mal in seinem Leben sah. „Also gut. Ich fasse noch mal zusammen – unterbrechen Sie mich, falls ich irgendetwas nicht korrekt wiedergeben sollte: Sie wurden gebeten, uns bei der Ermittlung im Todesfall Mike Lörke zu unterstützen, der gemeinsam mit Ihrem Bruder in einer WG für Behinderte gelebt hat. Laut pathologischem Befund kam es durch die intravenöse Injektion von Pentobarbital zu einem Atemstillstand. Reanimationsversuche schlugen fehl. Da dieses Medikament weder dem Opfer noch dessen Mitbewohnern verschrieben wurde und darüber hinaus in Deutschland heutzutage nur noch in Ausnahmefällen in der Humanmedizin verwendet wird, gingen wir von einem möglichen Tötungsdelikt aus. Und da kamen Sie ins Spiel. Ihr Auftrag war es, Marek Michalowski ausfindig zu machen, den Pfleger, der in der Nacht, in der unser Opfer starb, Dienst hatte. Denn bedauerlicherweise war dieser wie vom Erdboden verschlungen. Habe ich das so weit korrekt zusammengefasst?“
Lina nickte und lächelte verkniffen. Sie ahnte, was nun kommen würde.
„Sie gingen auch sehr engagiert zu Werke, allerdings taten Sie nicht, was Sie tun sollten. Stattdessen spielten Sie mir eine illegal aufgenommene Audiodatei vor, der zufolge die Leasingfirma, für die Herr Michalowski arbeitete, eine dubiose Überweisung getätigt hatte. Später verdächtigten Sie die Eltern des Verstorbenen, diese hätten ihren Sohn ermorden lassen, um an sein Erbe zu kommen.“
„Sie müssen zugeben, dass es ziemlich überzeugende Hinweise darauf gab –“
„Ich bin noch nicht fertig!“, unterbrach sie der Hauptkommissar barsch. „Jetzt kommen Sie zu mir und teilen mir mit, dass Sie inzwischen davon ausgehen, weder Familie Lörke noch Marek Michalowski, der übrigens immer noch verschollen ist, seien für Lörkes Tod verantwortlich, sondern eine unbekannte dritte Partei.“ Mit jedem Satz, den er sprach, wurde der Mann lauter. „Und diese habe den Verstorbenen möglicherweise gar nicht töten, sondern mit irgendeiner experimentellen Geheimdienstmethode verhören wollen. Wissen Sie, wie das klingt?“
„Äh … interessant?“
„Das klingt vollkommen bescheuert!“, explodierte Seidel. „Was glauben Sie, wo Sie sind? Wir spielen hier nicht in einer billigen Vorabendserie. Das ist die Mordkommission! Ich habe keine Zeit für solchen Blödsinn!“
„Finden Sie nicht, dass Sie meine Ausführungen ein klein wenig verkürzt wiedergegeben haben?“, wandte Lina ein.
„Ganz im Gegenteil: Ich finde, dass ich schon mehr als genug Zeit mit Ihren abstrusen Fantasien verschwendet habe.“
„Aber –“
„Danke für Ihre Mitarbeit. Sie können gehen!“
„Aber –“
„Ich sagte: Sie können gehen!“
Lina presste die Lippen zusammen und stand auf. Es kostete sie all ihre Selbstbeherrschung, die Tür nicht mit voller Wucht hinter sich zuzuknallen, nachdem sie den Raum verlassen hatte. Natürlich hatte sie geahnt, dass es ohne konkrete Beweise und Zeugenaussagen nicht leicht werden würde, den Kommissar von einem neuen Ermittlungsansatz zu überzeugen. Aber sie hatte Marek Michalowski nun mal versprochen, ihn aus dem Spiel zu lassen. Er hatte Angst um sein Leben, und Lina fürchtete, dass seine Sorgen nicht ganz unberechtigt waren.
Leider halfen ihr diese Überlegungen im Moment nicht weiter. Ihre Hoffnung, dauerhaft zur Mordkommission wechseln zu können, konnte sie begraben. Wut, Enttäuschung und Frustration strahlten ihr aus allen Knopflöchern, als sie ihre alte Dienststelle betrat und dort einige belanglose Aufgaben zugeteilt bekam.
Sie war gerade dabei, alte Akten zu schreddern, als es an der Tür klopfte. „Hi, Lina, darf ich reinkommen?“
„Wenn du kein Problem mit Feinstaub hast.“ Lina entleerte den Auffangbehälter in die Papiermülltonne und drehte den Kopf zur Seite, als feinste Papierteilchen aufstoben.
„Dieser Seidel ist ein Trottel“, sagte Ben, während er sich auf einen der Stühle setzte. „Er hat keine Ahnung, was ihm entgeht.“
„Die einzige Spezialistin für mechanischen Datenschutz mit Besoldungsgruppe A8?“, mutmaßte Lina und schob ein weiteres Dutzend Blätter in den Schlund des Aktenvernichters.
„Eine überaus scharfsinnige, unkonventionelle und hartnäckige Ermittlerin“, erwiderte Ben ernst, und mit einem Grinsen fügte er hinzu, „die darüber hinaus auch noch ausgesprochen attraktiv ist, selbst mit Papierstaub in der Frisur.“
Lina musste niesen.
„Gesundheit.“
„Danke.“
„Erzählst du mir, was passiert ist?“, fragte Ben.
„Seidel wollte, dass ich ihm Marek Michalowski liefere. Das habe ich nicht getan, also hat er mich zurückgeschickt.“
Ben runzelte die Stirn. „Da steckt noch mehr dahinter, habe ich recht?“
„Vielleicht … Aber momentan will ich nicht darüber reden. Ich muss erst mal in Ruhe nachdenken.“
„Verstehe.“ Er nickte langsam und erhob sich. „Dann will ich dich nicht weiter bei deinen wichtigen Aufgaben stören.“ Er wandte sich zur Tür.
„Ben?“
„Ja?“
„Danke für die Ermutigung.“ Lina lächelte. „Ich weiß das sehr zu schätzen.“
Er breitete die Arme aus. „Wenn du reden willst: Ich bin immer für dich da.“
„Okay, ich melde mich dann beim nächsten Champions-League-Finale.“
Er grinste und korrigierte: „Fast immer.“
„Ich werd’s mir merken.“
Ben verabschiedete sich, und den Rest ihres Arbeitstages verbrachte Lina allein mit ihren Sorgen und in Gesellschaft von kiloweise Altpapier.
Am Abend war sie sich sicher zu wissen, was zu tun war. Mit derselben Sicherheit ging sie davon aus, dass ihr Vorschlag Theo ganz und gar nicht gefallen würde, deshalb traf sie ein paar Vorkehrungen.
Anschließend fuhr sie zur Mohrenstraße 14. Es war Sarah, die junge Aushilfe mit den blau gefärbten Haaren, die ihr öffnete.
„Hi, du willst bestimmt zu Theo.“
„Genau.“
„Er ist in seinem Zimmer und zockt.“
„Danke!“
Im Flur stand Keno. Er wippte mit dem Oberkörper vor und zurück. Seine Finger bewegten sich blitzschnell hin und her, wie die Flügel eines Kolibris, und er schien voll und ganz in ihre Betrachtung versunken zu sein.
„Hi, Keno“, sagte Lina.
Er schien sie nicht zu bemerken, aber als sie ein paar Meter weitergegangen war, hörte sie ihn leise „Lina“ sagen.
Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Keno hatte sie begrüßt – darauf konnte sie sich etwas einbilden.
Als sie an der Tür zu der großen Wohnküche vorbeikam, erblickte sie zunächst das imposante Hinterteil von Helene, die gerade in den unteren Fächern des Kühlschranks stöberte. „Hallo, Lene.“
„Tachchen, Lina“, grüßte die älteste Bewohnerin der kleinen WG zwischen ihren Beinen hindurch. Dann nahm sie ihre Suche wieder auf und brummte: „Wo is’n der blöde Vanillepudding? Jestern jabs hier noch drei Stück von die Dinga.“
Aus Paulas Zimmer dröhnte ein Song von Billie Eilish.
Die Badezimmertür wurde geöffnet.
„Hallo, Scott!“, sagte Lina.
Theos hünenhafter Mitbewohner nickte ihr schüchtern lächelnd zu und verschwand in seinem Zimmer.
Lina klopfte an Theos Tür und trat ein. Sie konnte gedämpfte Schüsse vernehmen. Die Geräusche kamen aus den Kopfhörern ihres jüngeren Bruders und wurden untermalt von hektischem Tastendrücken auf einem Controller.
„Okay, der Zombie ist down. Pass auf! Pass auf, hinter dir! Oh, Mist!“
Lina verdrehte die Augen und zupfte an Theos Kopfhörern. Ihr Bruder zuckte erst erschrocken zusammen und meinte dann trocken: „Tut mir leid, ich muss Schluss machen, die Polizei ist hier. Ciao.“
Er nahm die Kopfhörer ab, wendete seinen E-Rollstuhl und schaute vorwurfsvoll zu seiner Schwester auf. „Musst du mich so erschrecken?“
„Leider hast du mein Klopfen nicht gehört.“ Lina ließ sich in Theos Besuchersessel fallen. „Ich finde es immer wieder bewundernswert, mit welcher Inbrunst du dich deinem Studium widmest. Um welches Fach ging es da gerade?“
„Survivalpsychologie – Überlebensstrategien in extremen Stresssituationen“, erwiderte Theo lässig. „Aber lass uns ruhig das Thema wechseln. Das ist nichts für Laien.“ Mit einer geschickten Bewegung seines Rollstuhls wich er dem Sofakissen aus, das Lina nach ihm warf. „Darf ich dir einen Drink anbieten?“
„Ein Malzbier on the rocks, bitte.“
„Hab ich nicht.“
„Cola light?“
„Hat Paula ausgetrunken.“
„Dann eben Cola ohne light.“
„Die hat Lene eliminiert.“
Lina seufzte. „Was hast du denn überhaupt da?“
„Momentan, äh, Milch und Leitungswasser.“
„Nicht dein Ernst!“
„Ich könnte dir auch einen Kaffee machen.“
„Ich nehme ein Wasser.“
„Kommt sofort“, flötete Theo, düste in die Küche und kam wenig später mit einem vollen Glas zurück.
Lina nahm ihr spartanisches Getränk von dem kleinen Tisch, der an seinem Rollstuhl befestigt war. Sie trank einen Schluck – wenigstens war es schön kalt.
„Wie lief das Gespräch mit Seidel?“, fragte Theo.
Lina warf ihrem Bruder einen finsteren Blick zu und nahm noch einen Schluck Wasser.
„So schlimm?“, hakte er nach.
„Du meinst, so schlimm, dass ich versuche, mich mit hochprozentigem Berliner Leitungswasser zu betrinken?“
„Ich habe eher deinen Blick gemeint. Das letzte Mal, als du so drauf warst, hast du anschließend den Sohn von Hausmeister Sobanski verprügelt.“
„Der Typ hatte meiner besten Freundin unter den Rock fotografiert“, brummte Lina zu ihrer Verteidigung. Dann fügte sie hinzu: „Ich bin raus. Seidel will mich nicht mehr dabeihaben.“
„Verflixt.“ Theo presste die Lippen zusammen. „Aber wenn ich ehrlich bin, überrascht mich das nicht. Du hast ihm nichts von Marek Michalowski erzählt?“
„Natürlich nicht!“, erwiderte Lina. Mithilfe von Theos Mitbewohnern hatten sie am Wochenende die Nachtwache ausfindig gemacht, die Zeuge von Mikes Tod gewesen war. Die Aussage des jungen Mannes hatte dem Fall eine dramatische Wendung gegeben. Demnach war tatsächlich ein Fremder in die WG eingedrungen, allerdings nicht, um zu töten, sondern um unter Verwendung eines Medikaments, das während des Kalten Krieges als Wahrheitsdroge gedient hatte, an Informationen zu gelangen. Mikes Tod war mehr oder weniger ein Unfall gewesen. Das wirklich Verrückte an der Sache war allerdings, dass Mike nur aufgrund einer Verwechslung hatte sterben müssen. Eigentlich hatte die ganze Aktion Theo gegolten. Der Eindringling hatte immer wieder gefragt: Wo ist es? Wo hat er es versteckt?
Ungünstigerweise hatten weder Theo noch Lina die leiseste Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Klar war nur: Der Typ war gefährlich. Er hatte Marek mit dem Tod gedroht, sollte dieser sich an die Polizei wenden. Lina hatte dem jungen Polen versprechen müssen, nichts von ihrem Gespräch zu verraten. Und daran hielt sie sich auch.
„Theo“, sagte Lina ernst, „ich habe nachgedacht –“
„Irgendwie hört sich das nicht gut an“, unterbrach sie ihr Bruder.
„Du bist hier in Gefahr! Früher oder später werden diese Leute ihren Irrtum bemerken. Was sollte sie daran hindern, noch einmal hier einzubrechen? Und dann bist du dran!“
„Ich glaube nicht, dass sie das noch mal machen werden. Das ist doch viel zu riskant.“
„Ach ja?“ Lina schnaufte. „Was hat sich geändert? Ich sehe keinen Wachschutz vor der Tür. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleine, die heute Dienst hat, in der Lage wäre, dich zu beschützen.“
„Lina“, sagte Theo in besänftigendem Tonfall, „das Ganze muss eine Verwechslung sein. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was die Typen suchen.“
„Das hatte Mike auch nicht!“, fuhr Lina ihn an. „Und jetzt ist er tot! Benutz deinen Verstand, Theo. Du weißt, dass ich recht habe. Du musst untertauchen, wenigstens für ein paar Tage.“
„Untertauchen?“ Theo blickte demonstrativ an sich herab. „Wie stellst du dir das vor?“
„Gut, dass du fragst“, erwiderte Lina. „Ich habe schon alles organisiert.“
„Du hast was?!“, fragte er ungläubig.
„Wie der Zufall es will, machen Mama und Oma Lilo gemeinsam Urlaub in einem Ferienhaus auf dem Darß. Und du bist dabei.“
„Was?“
„Das heißt nicht was, das heißt Danke schön“, erwiderte Lina. „Es ist geradezu perfekt. Da Oma wegen ihrer Hüft-OP noch mit dem Rollator unterwegs ist, musste das Häuschen ohnehin barrierefrei sein. Es gibt zwei Schlafzimmer und eine Schlafcouch im Wohnzimmer. Morgen früh geht es los. Die beiden freuen sich schon auf dich.“
Theo starrte sie mit offenem Mund an, und Lina gratulierte sich im Stillen. Es geschah nicht oft, dass ihr Bruder sprachlos war.
„Ich helfe dir, deine Sachen zu packen“, verkündete Lina freudestrahlend. „Dein Rollkoffer ist unter dem Schrank, oder?“
„Moment mal!“, empörte sich Theo. „So einfach geht das nicht!“
„Doch, das ist kein Problem für mich. Ich ziehe den Koffer hervor. Siehst du? Und jetzt lege ich ein paar Sachen hinein.“
„Sehr witzig!“, ätzte Theo. „Ich kann hier nicht weg. Ich studiere!“
„Im Fernstudium. Das Ferienhaus hat WLAN.“
„Lina, du kannst mich nicht einfach auf den Darß verfrachten und –“
„Ja, ich gebe zu, mit dem E-Rolli ist das nicht ganz unkompliziert“, unterbrach ihn Lina. „Deshalb werde ich mir euren Bus leihen und dich hinfahren.“
„So meinte ich das nicht, und das weißt du ganz genau!“
„Natürlich weiß ich das!“, fuhr Lina auf. „Mir war völlig klar, dass du auf stur schalten wirst. Aber hast du auch mal an Mama gedacht? Ist es nicht schlimm genug, dass Papa einfach von einem Tag auf den anderen verschwand? Soll sie jetzt auch noch ihren Sohn verlieren?“
Theo wurde blass. „Das ist nicht fair!“, stieß er hervor.
Lina legte beide Hände auf die Schultern ihres Bruders und sah ihm eindringlich in die Augen. „Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Ist das so schwer zu verstehen?“
„Ich kann mich nicht ewig verstecken.“
„Natürlich nicht“, bestätigte Lina.
Theo atmete tief durch. „Also gut, eine Woche!“
Lina wollte widersprechen, biss sich aber auf die Lippen. Eine Woche war besser als nichts. Und wenn Theo erst mal auf dem Darß war – nun, dann saß sie am längeren Hebel.
Eine beunruhigende Hypothese
Der Mann ohne Namen betrachtete sich im Spiegel des Aufzugs. Er sah die schlanke, sehnige Gestalt eines Mannes zwischen fünfundfünfzig und sechzig Jahren. Er trug Jeans und ein Hemd mit kurzen Ärmeln; secondhand, aber sauber. Die Haare waren geschnitten und er war frisch rasiert. Die helle Haut an seinem Kinn bildete einen seltsamen Kontrast zum dunklen Braun an Stirn und Wangen. Die Wunde an der Schulter spannte noch etwas, schien aber gut zu verheilen.
Ein heller Glockenton erklang, als der Aufzug den sechsten Stock erreichte. Der Namenlose stieg aus, zog einen zusammengefalteten DIN-A4-Bogen mit dem Logo des Pro-Humanis-Instituts aus der Brusttasche und zeigte ihn der Dame am Empfangstresen. Sie lächelte freundlich. „Zimmer 6.38, bitte. Den Flur links entlang.“
„Danke.“
Ihm war bewusst, dass er ein Risiko einging, aber ihm lief die Zeit davon. Er brauchte Antworten. Der Aushang in der Klinik hatte Hoffnung in ihm geweckt. Er hatte sorgfältig recherchiert und war sich ziemlich sicher, bei seiner Risikoanalyse keinen Fehler begangen zu haben. Nun musste er es einfach darauf ankommen lassen. Er klopfte an die Tür.
„Herein!“, ertönte eine Frauenstimme.
Ein weicher Teppich schluckte das Geräusch seiner Schritte, als er eintrat. Der Raum sah anders aus, als er erwartet hatte. Trotz der medizinischen Geräte vermittelte er aufgrund der Auslegware, des Sofas und des Bücherregals einen beinahe wohnlichen Eindruck.
Eine junge Frau um die dreißig erhob sich von ihrem Schreibtischstuhl und reichte ihm die Hand. Sie hatte asiatische Gesichtszüge, auf ihrem Namensschild stand „Dr. Cho Shiwon“.
„Guten Tag, Dr. Shiwon.“
Sie lächelte. „Dr. Cho. Im Koreanischen wird der Nachname stets zuerst genannt. Und Sie sind?“
Der Namenlose erwiderte das Lächeln. „Genau das ist das Problem.“
„Ich verstehe. Bitte nehmen Sie Platz.“ Sie wies auf den Besucherstuhl vor ihrem Schreibtisch. „Darf ich einen kurzen Blick auf Ihr Einladungsschreiben werfen?“
„Natürlich.“ Er reichte es ihr.
Sie warf einen Blick darauf und gab anschließend etwas in ihren Rechner ein – wahrscheinlich die Patientennummer, die man ihm zugeordnet hatte. „Ich sehe, dass Sie ursprünglich Herrn Dr. Kohlmann zugeteilt waren. Was hat Sie dazu bewogen, um einen Wechsel zu bitten?“
„Man sagte mir, dass es bei einem therapeutischen Setting in besonderer Weise auf eine gute Vertrauensbasis ankommt, und diese war meines Erachtens nicht gegeben.“
„Interessant. Können Sie das begründen?“
„Es war … so ein Gefühl“, erwiderte er. Und die Tatsache, dass ich Männern in meinem Alter, die darüber hinaus noch eine Weile im Staatsdienst tätig waren, grundsätzlich nicht traue, fügte er in Gedanken hinzu.
Ein winziges Lächeln umspielte die Lippen der jungen Frau, verschwand aber sofort wieder und machte einem professionell-neutralen Gesichtsausdruck Platz.
Der Namenlose hatte herausgefunden, dass sich nur äußerst wenige Probanden für diese Studie gefunden hatten. Soweit er wusste, war er der Einzige, der sich bei Dr. Cho in Behandlung begeben würde. Zumindest, wenn er der unbedachten Nebenbemerkung der Dame von der Anmeldung Glauben schenkte. Insofern bot er der Ärztin die einzige Chance, die Studie durchzuführen und an einer möglicherweise bahnbrechenden wissenschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Abgesehen davon argwöhnte er, dass es um das Verhältnis zwischen Dr. Kohlmann und Dr. Cho nicht zum Besten stand. Schließlich hatte er am Zucken ihrer Mundwinkel auch eine gewisse persönliche Befriedigung herauslesen können.
Dr. Cho studierte erneut die Angaben auf dem Bildschirm. „Ich sehe mir gerade Ihren medizinischen Befund an. Die MRT-Ergebnisse sind nicht ganz eindeutig. Sie haben vor vielen Jahren ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Es gibt nur geringfügige Hinweise auf Vernarbungen. Insofern gehen wir erst einmal davon aus, dass bei Ihnen eine dissoziative Amnesie vorliegt. Das bedeutet, dass der Verlust Ihrer Erinnerungen eine innerpsychische Abwehrreaktion auf ein oder mehrere traumatische Erlebnisse ist. In einem solchen Fall können wir Ihnen helfen. Sollten allerdings doch organische Faktoren ursächlich sein, wäre es möglich, dass wir Ihre Erinnerungen nicht zurückholen können.“
Der Namenlose nickte. „Ich verstehe.“
„Gut. Wir sind ein unabhängiges Institut, das im Auftrag unterschiedlicher pharmazeutischer Unternehmen Arzneimittelstudien durchführt. Dieser Prozess umfasst mehrere Stufen. Nachdem das Medikament Citoretrival an gesunden Probanden getestet wurde und nur geringfügige Nebenwirkungen aufgetreten sind, werden wir in einem zweiten Schritt Menschen behandeln, die tatsächlich an Amnesie leiden. Natürlich tun wir alles in unserer Macht Stehende, um Nebenwirkungen zu vermeiden, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie sich einem gewissen Risiko aussetzen. Das Medikament kann nicht nur Schwindel und Sehstörungen verursachen, sondern auch schwerwiegende Erkrankungen wie Epilepsie oder Psychosen initiieren.“
„Dessen bin ich mir bewusst.“
Die Ärztin nickte ernst. „Ich will ganz offen zu Ihnen sein: Manche Menschen lassen sich durch die nicht unbeträchtliche Höhe der Aufwandsentschädigung dazu verleiten, das Risiko auszublenden. Wenn Sie noch etwas Bedenkzeit benötigen –“
„Ich brauche keine Bedenkzeit“, unterbrach sie der Namenlose. „Meine Entscheidung ist gefallen. Ich habe gar keine andere Wahl.“
Ihr Blick huschte zu seinem wettergegerbten Gesicht. „Sie brauchen das Geld?“
„Nein. Ich brauche meine Erinnerung!“
Sie schluckte, und ihre Wangen röteten sich. „Entschuldigen Sie, ich wollte nicht …“
„Kein Problem“, erwiderte der Namenlose, und sein Lächeln zeigte ihr, dass er es genauso meinte. „Fangen wir einfach an.“
„In Ordnung.“ Sie blickte wieder auf ihren Bildschirm. „Ihre anamnestischen Daten wurden zwar bereits erfasst, aber ich würde gerne noch einmal von Ihnen persönlich hören, wie es Ihnen ergangen ist.“ Sie wandte sich ihm zu. „Wenn Sie zurückdenken, was ist Ihre älteste Erinnerung?“
Der Namenlose betrachtete die junge Frau. Ihr Blick war offen und ein klein wenig unsicher. Es war ein Blick, der Vertrauen in ihm weckte. „Alles, was ich Ihnen erzähle, ist vertraulich?“, fragte er.
„Ja. Die Studie umfasst lediglich die Wirkung des Medikaments. Nur die medizinischen Daten und Fakten werden weitergegeben und ausgewertet. Bezüglich der Inhalte Ihrer Erinnerungen unterliege ich der ärztlichen Schweigepflicht.“
„Gut.“ Der Namenlose lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Er schloss für einen kurzen Moment die Augen und begann zu erzählen. „Die älteste Erinnerung, von der ich mit Sicherheit weiß, dass sie kein Traum war, ist der Blick über eine weiße Bettdecke hinweg zu einer weiß verputzten Wand. Dort hingen ein Kruzifix und ein archaisches Bild von einem Hirten, der ein Lamm auf seinen Schultern trug. Der Maler war wohl kein großer Künstler, denn der Kopf des Schafes sah etwas unförmig aus, beinahe so, als trüge es einen weißen Verband um den Schädel. In meiner Situation fand ich das seltsam tröstlich.“
Die junge Ärztin machte sich Notizen und nickte auffordernd.
„Irgendwann registrierte ich, dass ich mich in einem Krankenhaus befand. Eine Krankenschwester betrat das Zimmer. Als sie sah, dass ich wach war, beugte sie sich vor und fragte: ‚Jak się masz?‘“
Dr. Cho hob die Brauen. „Und was heißt das?“
„Das ist Polnisch und bedeutet ‚Wie geht es Ihnen?‘. Ich antwortete der Frau, so gut ich konnte. Aber es stellte sich heraus, dass ich rasch an meine Grenzen kam. Ich konnte mich weder an meinen Namen erinnern noch an irgendetwas, was ich vor meinem Krankenhausaufenthalt getan hatte. Alle meine Erinnerungen waren wie weggeblasen. Meine Aussprache war seltsam und mein Wortschatz ziemlich eingeschränkt. Wie ich später herausfand, hatte ich ein mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Man hatte mich frühmorgens in einem Waldstück am östlichen Stadtrand von Swinemünde gefunden – mit einer Platzwunde an der Stirn und einer Kugel im Rücken. Laut Aussage der Ärzte war die Schusswunde älter als die Platzwunde; mehrere Stunden, vielleicht sogar einen halben Tag. Die Kugel hatte keine lebenswichtigen Organe verletzt und steckte fest. Dadurch war der Blutverlust mäßig, aber permanent. Es war keine medizinische Versorgung erkennbar. Meine Kleidung war blutdurchtränkt. Ich musste demnach mit der Wunde umhergelaufen sein. Aufgrund diverser Kratzer an Gesicht und Händen ging man davon aus, dass ich durch ein Waldgebiet gelaufen war.“
Falls Dr. Cho durch diese Äußerungen geschockt war, ließ sie es sich nicht anmerken. „Also sind Sie durch den Wald Richtung Swinemünde geflohen?“
Er zuckte mit den Achseln. „Möglicherweise. Das lässt sich im Nachhinein schwer feststellen. In jedem Fall war der Blutverlust auf Dauer so hoch, dass ich das Bewusstsein verlor und mit dem Kopf gegen einen Stein prallte. Die Folge war besagtes Schädel-Hirn-Trauma. Mein Leben verdanke ich einem Anwohner, der früh am Morgen mit seinem Hund in der Nähe spazieren ging.“
„Sie schildern das in einem bemerkenswert nüchternen Tonfall“, sagte Dr. Cho.
Der Namenlose zuckte erneut die Achseln. „Möglicherweise liegt es daran, dass ich nur wiedergebe, was man mir gesagt hat. Ich selbst habe keine Erinnerungen an diese Ereignisse.“
Die junge Ärztin nickte. „Was ist dann passiert?“
„Sobald man mich für vernehmungsfähig hielt, kamen Polizisten mit jeder Menge Fragen im Gepäck zu mir ins Krankenhaus. Ich konnte so gut wie keine davon beantworten. Nicht einmal meinen Namen wusste ich. Die Polizei tappte im Dunkeln. Es hatte keine Schießerei in der Nähe gegeben. Die Kugel vom Kaliber 7,62 mal 54 Millimeter war die Standardmunition der russischen Armee und kam bei den unterschiedlichsten Gewehren und Maschinengewehren im gesamten Gebiet des Warschauer Pakts zum Einsatz. Sie wurde und wird auch heute noch im Schießsport verwendet. Das bedeutete, die Aussagekraft ging gen null. Klar war eigentlich nur, dass die Munition nicht von einer Kurzwaffe abgefeuert wurde.“
„Entschuldigen Sie, ich bin militärisch nicht besonders bewandert. Was ist eine Kurzwaffe?“
„Eine Pistole.“
„Der Schuss kam also aus einem Gewehr. Könnte das Ganze auch ein Jagdunfall gewesen sein?“
„Auszuschließen ist nichts, wobei ich nicht unbedingt für die Jagd gekleidet war.“
„Was trugen Sie?“
„Einen schwarzen Neoprenanzug.“
„Das ist ungewöhnlich.“
„Zumindest modisch etwas eigenwillig“, bestätigte der Namenslose.
„Haben Sie eine Erklärung dafür?“
„Nein.“ Er schürzte die Lippen. „Vielleicht wollte ich schwimmen gehen?“
„Wie ging es weiter?“
„Die Besuche der Polizisten wurden seltener. Mir schien, sie hatten aufgegeben. Ich erholte mich zusehends, und dann hatte ich Glück. Ich begegnete Wolfgang, einem deutschen Rentner, der an der polnischen Ostsee Campingurlaub machte. Er war barfuß in einen beinahe sieben Zentimeter langen Wallerdrilling aus Carbonstahl getreten und hatte sich damit die Ferse bis zum Knochen durchbohrt.“
„Entschuldigung, in was ist er getreten?“
„In einen Angelhaken“, erklärte der Namenlose. „Wolfgang kam also ins Krankenhaus, wo wir uns begegneten. Rückblickend bin ich ihm dankbar, dass er nicht nur tollpatschig, sondern auch sehr redselig war, denn auf diese Weise wurde mir bewusst, dass ich hervorragend Deutsch sprach und verstand, weit besser als Polnisch. Und mir wurde klar, dass ich Deutscher sein musste. Also beschloss ich, das Krankenhaus auf eigene Faust zu verlassen. Ich packte meine wenigen Habseligkeiten zusammen, schlich mich nachts über die Grenze und –“
„Warum heimlich?“, unterbrach ihn Dr. Cho. „Warum gingen Sie nicht einfach zur deutschen Botschaft?“
„Gute Frage.“ Der Namenlose runzelte die Stirn. „Die Antwort lautet: Ich hatte Angst!“
„Wovor?“
„Wenn ich das wüsste. Seitdem ein Teil meiner Erinnerung zurückgekehrt ist, habe ich permanent das Gefühl einer lauernden Bedrohung. Etwas in mir zwingt mich dazu, mich in Deckung zu halten und gewissermaßen unterhalb des Radars zu leben.“ Er erwähnte nicht, dass er als Obdachloser lebte, denn das war der Ärztin mit Sicherheit bekannt.
„Wann ist das alles passiert?“
„Im Jahr 2003.“
„Das ist lange her.“
„Ja.“
Dr. Cho wirkte nachdenklich. „Und seitdem können Sie sich an kein einziges Ereignis erinnern, das vor diesem Zeitpunkt stattfand?“
„An nichts, was ich sicher von einem Traum unterscheiden könnte“, erwiderte der Namenlose.
„Über diese Träume würde ich gerne später mit Ihnen sprechen.“
Er spürte, wie ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief. „Natürlich“, erwiderte er und verdrängte das eisige Gefühl der Furcht, das sich in seinem Inneren ausbreitete.
„Eine letzte Frage noch für heute: Haben Sie jemals einen Menschen getroffen, der glaubte, Sie wiederzuerkennen?“
Erneut lief dem Namenlosen ein Schauer über den Rücken. Er dachte an den Fremden, der ihn gefangen genommen und mit Medikamenten vollgepumpt hatte. Wenn er allerdings diese Episode erwähnte, wusste er schon jetzt, in welche Schublade man ihn stecken würde.
„Sie zögern“, stellte die junge Frau fest.
„Nein, ich … ich erinnere mich, dass tatsächlich einmal ein Mann behauptete, er würde mich kennen. Er nannte mich Peter.“
„Und?“, hakte sie nach. „Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Was hat er zu Ihnen gesagt?“
„Wir haben keinen Kontakt mehr. Es war eher … eine flüchtige Begegnung.“
„Das ist bedauerlich.“ Die Ärztin wirkte enttäuscht. „Es hätte ein guter Ansatz sein können. Wäre es denkbar, dass Sie diesen Mann suchen und –“
„Nein“, unterbrach sie der Namenlose, „keine Chance.“
„Okay.“ Sie nickte langsam. „Und was hat der Name Peter in Ihnen ausgelöst? Hat er irgendeine Erinnerung oder ein Gefühl in Ihnen wachgerufen?“
„Ich habe es wirklich versucht, aber“, er schüttelte den Kopf, „da war nichts.“
Dr. Cho nickte langsam, schaute auf ihre Notizen und nickte wieder. Dann suchte sie den Blick des Namenlosen. „Ich … will ganz ehrlich zu Ihnen sein.“
„Ich bitte darum!“
„Es kann sein, dass diese Studie nicht das Richtige für Sie ist.“
Ein kalter Schreck durchfuhr den Namenlosen, aber er ließ sich nichts anmerken. „Was meinen Sie damit?“
„Es wäre möglich, dass Sie weit mehr ärztliche Hilfestellung benötigen, als wir in diesem Rahmen leisten können.“
Der Namenlose beugte sich vor und sah sie eindringlich an. „Sagen Sie mir einfach, was Sie denken.“
Dr. Cho biss sich auf die Lippen und wirkte mit einem Mal sehr jung und verunsichert. „Also gut. Es gibt verschiedene Formen der dissoziativen Störung. Manche Menschen reagieren mit einer Amnesie auf ein Trauma. Das bedeutet, sie drängen alles, was sie an das schreckliche Ereignis erinnert, in ihr Unterbewusstsein. Andere hingegen reagieren komplexer. Bei diesen Menschen kommt es zu einer Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen, und sie entwickeln eine multiple Persönlichkeit.“
„Und was heißt das?“
„Bei einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung entwickelt ein Mensch unterschiedliche Persönlichkeiten mit je einer eigenen Erinnerung. Dieses diffuse Gefühl der Bedrohung, das Sie vorhin erwähnten, könnte darauf hindeuten. Ebenso der Umstand, dass jemand Sie zu erkennen scheint, Sie aber mit dem Namen, bei dem er Sie nennt, nichts anfangen können. Wissen Sie, es könnte sein, dass Sie beides sind: der Mann, der sich an nichts zu erinnern scheint, und Peter.“
„Wie bitte?“
„Wie der Begriff ‚Multiple Persönlichkeit‘ schon sagt: Es könnte sein, dass Sie als Reaktion auf ein Trauma zwei oder sogar noch mehr Persönlichkeiten entwickelt haben, die unterschiedliche Erinnerungen haben, aber nichts voneinander wissen.“
„So wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde?“
„Na ja, der Vergleich hinkt etwas.“
Der Namenlose nagte nachdenklich an seiner Unterlippe. „Verstehe ich Sie richtig? Es wäre also möglich, dass ich eine multiple Persönlichkeit habe, muss aber nicht zwingend der Fall sein?“
„Korrekt. Das ist nur eine Hypothese.“
„Gut.“ Der Namenlose richtete sich auf. „Probieren wir es aus.“
Dr. Cho hob überrascht die Brauen.
„Was soll schon passieren? Wenn Sie feststellen, dass ich mich das nächste Mal mit Peter vorstelle, können Sie mich postwendend in die nächste psychiatrische Klinik einweisen. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass ich nicht krankenversichert bin. Und wenn es Sie beruhigt, können Sie mich während der Sitzung auch fixieren.“
„Also, das können wir nicht machen. Wir sind doch keine geschlossene –“
„Das ist mir vollkommen egal“, unterbrach sie der Namenlose. „Ich unterschreibe Ihnen gerne alle Einverständniserklärungen, die Sie brauchen. Meinetwegen können Sie mich in Ketten legen. Aber Sie müssen eines verstehen: Ich will endlich wissen, wer ich bin. Und Sie sind meine beste, vielleicht sogar meine einzige Chance, dieses Ziel zu erreichen. Bitte! Lassen Sie es uns versuchen!“
Die Ärztin schluckte. Sie war ein wenig blass um die Nasenspitze, als sie schließlich vorsichtig nickte. „Also gut, kommen Sie bitte am Mittwoch um 9 Uhr zur ersten Sitzung. Wir werden dann nach jeder Einheit entscheiden, ob und wie es weitergehen kann.“
Der Namenlose stand auf und ergriff ihre zierliche Hand. „Danke, Dr. Cho, vielen Dank! Ich bin mir sicher, Sie werden es nicht bereuen.“
Die junge Frau lächelte etwas nervös. „Ich freue mich auf unsere … Zusammenarbeit.“
Hilfsbereites Chaos
Frustriert blickte Theo zu dem Regalbrett hinauf, auf dem das Ladegerät seines Handys lag. Irgendjemand, wahrscheinlich die Reinigungskraft, hatte es dort abgelegt, und nun war es für ihn genauso unerreichbar wie die Deckenlampe.
„Watt glubschte denn die janze Zeit da ruff?“, meldete sich Helenes Stimme hinter ihm, „versuchste grad, dit Rejalbrett zu hyposinieren?“
„Es heißt hypnotisieren“, verbesserte Theo reflexhaft.
„Sag ick doch.“
„Mein Problem ist, dass ich nicht an mein Ladegerät herankomme“, erklärte er.
Helene fixierte das Regal und kniff abschätzend die Augen zusammen. „Da hamwa schonma watt jemeinsam. Ick müsste hüpfen, um da ranzukomm. Aba ick fürschte, dann wundert sich der Typ unter uns, warum plötzlich meene Alabasterlatschen aus seene Decke glubschen.“ Sie wandte den Kopf zur Tür und rief: „Scotti, kommste mal?“
Doch anstelle des hünenhaften Mitbewohners streckte Paula den Kopf zur Tür herein. „Was ist denn los? Warum brüllst du so?“
„Kommste an dit Teil da ran?“, erkundigte sich Helene.
„Klaro!“ Paula streckte sich und griff schwungvoll nach dem Ladegerät. Sie bekam es tatsächlich zu fassen, allerdings fegte sie dabei eine Buchstütze in Form einer gipsernen Leseratte herunter, die krachend auf dem Linoleumboden zersplitterte. Ihres Halts beraubt, polterten gleich darauf auch noch mehrere Fachbücher wie schwergewichtiges Herbstlaub zu Boden.
Helene brachte erstaunlich behände ihre Alabasterfüße in Sicherheit, und Paula sagte nur: „Upsi!“
Glücklicherweise behauptete der Pschyrembel seine Stellung und bereitete dem dominosteinartigen Absturz des Wissens ein Ende.
Nun betrat auch Scott den Raum und starrte mit großen Augen auf das Chaos.
„Bitte schön.“ Paula ließ das Ladegerät auf Theos Rollstuhltisch plumpsen. Dann funkelte sie Scott an und fauchte: „Wärst du früher gekommen, wäre das nicht passiert.“
Theo schob die linke Hand unter den rechten Ellenbogen. Nun konnte er die rechte Hand weit genug heben, um sich seufzend die Nasenwurzel zu massieren.
Paulas Blick fiel auf den offenen Koffer, der auf Theos Bett lag. „Soll’n wir dir beim Packen helfen?“
„Nein danke“, erwiderte Theo rasch. „Aber ich wäre froh, wenn ihr das Chaos hier beseitigen würdet.“
„Is so jut wie aledischt.“ Helene bückte sich ächzend und klaubte das abgebrochene Ohr der Leseratte vom Boden. Als sie wieder hochkam, taumelte sie ein wenig. „Puh“, sie hielt sich an Theos Rollstuhl fest, „mir iss grad ’n bisschen schwindlich. Ick gloob, ick bin untazuckat.“
Theo hob die Brauen. Er hatte ernsthafte Zweifel an der Selbstdiagnose seiner Mitbewohnerin. Da sie unter dem Prader-Willi-Syndrom litt und deshalb über keinerlei Sättigungsgefühl verfügte, war Unterzuckerung ein körperlicher Zustand, der ihr praktisch unbekannt sein dürfte.
Keno schob den Kopf zur Tür herein. Mit kritischem Blick betrachtete er das abgebrochene Hinterteil der Leseratte zu seinen Füßen. Dann bemerkte er: „Tim hat ein rotes Auto“, und verschwand wieder.
„Ohne Spezialausrüstung wird dit nüscht, Freunde“, resümierte Helene, nachdem sie ein paarmal tief durchgeatmet hatte. „Scotti? Biste mal so lieb und holst ’n Besen und ’n paar Schokoriegel?“
Der Hüne nickte bedächtig und verschwand im Flur.
Indessen hatte Paula sich im Schneidersitz auf Theos Bett niedergelassen und betrachtete den Inhalt seines Koffers.
„Du hast ja gar keine Pflegeprodukte eingepackt!“
„Was?“ Theo blickte sie entgeistert an.
„Null Problemo, ich helf dir.“ Sie sprang auf und eilte in Theos Badezimmer. Man konnte hören, dass sie eine Schranktür öffnete. „Was ist deine Lieblingsbodylotion?“
„Meine … Paula, hör sofort auf, in meinen Sachen herumzuwühlen!“
Scott betrat wieder den Raum, in der rechten Hand einen Besen, in der linken eine Tafel Schokolade.
„Supa, Scotti!“ Helene strahlte. „Ick denk ma, zuerst sollte ick ma um den medizinischen Notfall kümman.“ Sie griff nach der Schokolade.
„Paula, raus aus meinem Bad!“, rief Theo.
Seine Mitbewohnerin trat heraus, mehrere Tuben in den Händen haltend. „Wohin verreist du eigentlich?“
„Das … darf ich euch nicht sagen.“
„Ich muss es aber wissen. Sonst weiß ich nicht, welche Sonnencreme du brauchst.“
In diesem Moment betrat Lina das Zimmer. „Was ist denn hier los?“, entfuhr es ihr.
„Wir helfen Theo“, erklärte Paula.
„Jenau!“, bestätigte Helene.
Scott nickte ernst.
Lina blickte fragend zu ihrem Bruder. Der zuckte nur mit den Achseln. „Das ist wirklich sehr lieb von euch“, wandte sie sich wieder an die hilfsbereiten Mitbewohner, „aber zu viele Köche verderben den Brei. Es reicht, wenn ich Theo helfe.“
„Na jut.“ Ein Fleck auf Helenes Wange war alles, was von der Schokolade übrig geblieben war.
Bedächtig stellte Scott den Besen in die Ecke.
„Das Duschgel von Theo ist fast alle“, verkündete Paula.
Kopfschüttelnd blickte Lina den dreien hinterher.
„Man muss sie einfach lieb haben“, bemerkte Theo grinsend.
Etwa drei Stunden später saß er im Bus und starrte aus dem Fenster. Felder wechselten sich mit vereinzelten Brachen und Kiefernwäldern ab. Der alte T4 röhrte, als Lina Gas gab, und dem scheppernden Geräusch nach zu urteilen, konnte der Auspuff eine neue Schweißnaht gebrauchen.
Theos Gedanken mäanderten umher wie die schmalen Feldwege in dem spärlich besiedelten Umland, aber immer wieder kehrte er zu einer Frage zurück: Warum ich?
Der ungeklärte Todesfall seines Mitbewohners und Freundes Mike Lörke hatte die ganze WG erschüttert. Sie alle fragten sich, wer Mike getötet haben könnte und warum. Inzwischen hatten sie herausgefunden, dass ein Fremder sich im Schutz der Dunkelheit in die WG geschlichen hatte. Er hatte Mike ein Psychopharmakon gespritzt und ihn immer wieder gefragt: Wo ist es? Wo hat er es versteckt?,allerdingsohne zu verraten, was er suchte und wer mit „er“ gemeint war. Und dann war Mike kollabiert. Seine geschwächten Lungen hatten die Nebenwirkung des Medikaments nicht mehr kompensieren können. Er war erstickt.
Inzwischen wusste Theo, dass diese Befragung eigentlich ihm gegolten hatte, und er zermarterte sich das Hirn. Warum ich? Was hat der Fremde gesucht? Und wer ist „er“? Theo hatte nicht die leiseste Ahnung. Es gab in seinem Leben keine Geheimnisse, die für irgendjemanden interessant sein könnten. Niemand hatte ihm jemals ein Geheimversteck verraten. Vielleicht war auch er selbst Opfer einer Verwechslung? Aber war das realistisch? Der Einbrecher hatte großen Aufwand betrieben. So etwas tat man doch nicht, wenn man sich seiner Sache nicht sicher war.
Theo seufzte. Er steckte in einer Sackgasse.
Lina bog von der Landstraße auf einen schmalen Feldweg ab. Schotter prasselte gegen den rostigen Unterboden des Busses.
„Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind?“, rief Theo gegen den Lärm an.
„Ich nicht, aber das Navi!“, rief Lina zurück.
Sie suchte im Radio nach einem passenden Sender, und wenig später übertönte lauter Punkrock den Lärm.
Theo seufzte. „Das ist jetzt nicht dein Ernst!“
„Zu leise?“, rief Lina und grinste ihn über die Schulter hinweg an. Sie drehte den Regler noch ein wenig höher.
Theo hätte schwören können, dass er über das Getöse der Gitarrenriffs und ächzenden Stoßdämpfer hinweg hörte, wie seine Großhirnrinde rhythmisch gegen die Schädeldecke schnalzte.
Er schüttelte grinsend den Kopf. Manchmal hatte er den Eindruck, irgendein wichtiger Teil von Linas Gehirn habe noch nicht von Pubertät auf Erwachsensein umgeschaltet.
Plötzlich bremste seine Schwester so scharf, dass Theo in seinem Gurt nach vorn geschleudert wurde. Die blockierenden Reifen wirbelten eine imposante Staubwolke auf.
„Verflixt“, Lina kurbelte das Lenkrad, „da hätte ich doch beinahe die Einfahrt verpasst.“
„Kann es sein, dass du das Navi nicht mehr hörst?“
„Was?“, brüllte Lina. „Ich versteh kein Wort!“
Die Schotterpiste, die jede nordafrikanische Steppenlandschaft in den Schatten stellte, wich Kopfsteinpflaster.
Und dann, ganz abrupt, endete ihre Fahrt. Lina parkte den Bus vor einem reetgedeckten Häuschen, dessen weiß getünchte Wände im Licht der Nachmittagssonne strahlten.
Lina schaltete den Motor aus, und der Lärm verstummte. Sie streckte sich auf ihrem Sitz und öffnete die Tür. Der Wind trug fernes Meeresrauschen und den Schrei einer Möwe zu ihnen herüber.
Lina öffnete die Hecktür, löste Theos Gurte und brachte die Rampe an. Vorsichtig fuhr er hinunter auf den lehmigen Boden und atmete tief ein. Nach der langen Fahrt tat die frische Brise gut. „Es riecht ein bisschen nach Meer, findest du nicht?“
Lina strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Jep, und nach Kuhfladen“, ergänzte sie. „Komm, wir schauen uns die Bude mal an.“
Unsichtbare Augen
Die blau gestrichene Eingangstür war ebenerdig. Lina klingelte. Theo glaubte, von drinnen her Stimmen zu hören, aber niemand öffnete.
Lina drückte erneut auf den Klingelknopf, diesmal etwas ausdauernder.
Theo vernahm ein Rumpeln. Er fuhr so dicht wie möglich an die Tür heran und lauschte.
„Einen Moment“, vernahm er die Stimme seiner Mutter. Etwas leiser sagte sie: „Mama, was machst du denn?“
„Ich wollte nur mein Strickgarn aufheben … Autsch, nicht so fest!“
„Kannst du dich nach hinten schieben?“
„Au. Ich fürchte, nein, Kindchen, ich stecke fest.“
„Mama?“, rief Theo. „Alles klar bei euch?“
„Ach, das sind nur die Kinder“, vernahm er die Stimme von Oma Lilo. „Lass sie doch erst mal rein.“
Kurz darauf wurde die Tür geöffnet. „Hallo, ihr beiden.“ Ein Lächeln huschte über die Gesichtszüge von Mechthild Marquardt. Ihre von einigen grauen Strähnen durchzogenen braunen Locken fielen ihr wirr ins Gesicht, und an ihrem T-Shirt hingen Staubflusen.
„Was ist denn mit dir los?“, fragte Lina. „Machst du einen verspäteten Frühjahrsputz?“
„Nicht ganz. Kommt rein.“ Mechthild umarmte erst Lina und dann Theo. Sie hatte den gleichen zierlichen Körperbau wie ihre Tochter, aber sie wirkte zerbrechlicher. Die feinen Fältchen in ihrem Gesicht zeugten von sorgenvollen Tagen, und ihrem Blick haftete meist etwas Melancholisches an. „Eure Großmutter hat sich offensichtlich vorgenommen, dieses Haus erst einmal auf allen Ebenen zu untersuchen.“
„Unsinn, ich wollte bloß mein Strickgarn aufheben“, tönte es dumpf aus dem Wohnzimmer.
Theo folgte den beiden Frauen nach nebenan und erblickte ein großes helles Sofa, unter dem ein in einen blauen Faltenrock gehülltes Hinterteil hervorragte.
„Oma? Was … machst … du … da?“, fragte er ungläubig.
„Wie gesagt, ich wollte bloß mein Strickgarn aufheben, und nun … stecke ich fest.“
„Kannst du nicht einfach ein Stück nach hinten rutschen?“, schlug Lina vor, wobei es ihr offensichtlich nicht ganz leichtfiel, ernst zu bleiben.
„Auf den ersten Blick scheint dies die richtige Strategie zu sein“, kam es unter dem Sofa hervor. „Das Problem ist, dass schon die kleinste Bewegung einen stechenden Schmerz in meiner Hüfte verursacht. Ich würde mal sagen, da ist das Gelenk in der Pfanne verrückt. Aber wenn ich mich nicht bewege, bin ich nahezu schmerzfrei.“
„Mama, du weißt, dass du eine Hüftgelenksdysplasie hast“, sagte Mechthild kopfschüttelnd. „Warum also kriechst du auf dem Boden herum und bittest mich nicht einfach um Hilfe?“
„So unglaublich es klingen mag: Ich habe das hier nicht geplant, Kindchen. Jetzt weiß ich auch, dass das keine besonders pfiffige Idee von mir war.“
Lina prustete los, und auch Theo hatte Mühe, sich das Lachen zu verkneifen.
„Ich habe schon versucht, sie rauszuziehen, aber das klappt leider auch nicht.“ Mechthild konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
„Ich plaudere wirklich gerne mit euch“, meldete sich die Stimme unter dem Sofa erneut zu Wort. „Aber auf Dauer ist es hier unten doch etwas unbequem.“
„Also gut“, Lina wischte sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel, „wenn wir Oma nicht unter dem Berg hervorkriegen, dann müssen wir eben den Berg von Oma wegbekommen. Mama, fasst du mal mit an?“
Gemeinsam hoben die beiden Frauen das eine Ende des Sofas so weit an, dass sich Oma Lilo aufrichten konnte. Vorsichtig ließen sie es wieder herunter und stützten die alte Dame rechts und links, sodass diese aufstehen und sich anschließend auf dem Sofa niederlassen konnte. „Ah, das tut gut. Danke, Kinder.“ Sie umarmte ihre Enkelin. „Hallo, Linchen.“ Dann blickte sie zu Theo und streckte den Arm aus. „Lass dich drücken, mein Junge.“
Theo fuhr zu ihr, und sie zog ihn in eine großmütterliche Umarmung. Ihr Parfüm gab ihm ein Gefühl von Geborgenheit.
„Oma Lilo, du bist wirklich immer für eine Überraschung gut.“
„Ich tue mein Bestes.“
„Müssen wir dich zum Arzt bringen?“, fragte Lina.
„Ach, lass nur.“ Die alte Dame winkte ab. „Das renkt sich schon wieder ein.“
„Mama, mit einer Hüftgelenksdysplasie ist nicht zu spaßen“, mischte sich nun auch Mechthild ein.
„Mein Physiotherapeut hat mir ein paar Tricks gezeigt. Ich versuche, das selbst hinzubekommen, und wenn es nicht klappt, können wir immer noch zum Arzt fahren. Sei so gut und bring mir das Hundespielzeug aus meiner Tasche.“
Mechthilds Brauen schossen nach oben. „Hundespielzeug?“
„Ja, so einen Gummiball, etwas größer als ein Tennisball.“
Kopfschüttelnd nahm ihre Tochter das Spielgerät aus der Tasche und reichte es ihr.
„Da muss ich mich jetzt draufsetzen und bestimmte Übungen machen“, erklärte Oma Lilo, während sie sich in Position brachte.
„Na gut.“ Lina stand auf. „Dann hole ich mal Theos Sachen aus dem Auto.“
Irgendwie bekam es die alte Dame schließlich hin, ihre Bewegungsfähigkeit wiederherzustellen.
Sie aßen gemeinsam Abendbrot, und dann machte sich Lina auf den Heimweg.
„Fahr vorsichtig“, mahnte Mechthild ihre Tochter.
„Immer. Du kennst mich doch.“
„Eben.“
Lina drückte erst ihrer Mutter, dann Oma Lilo einen Kuss auf die Stirn. Theo bekam einen Knuff gegen die Schulter.
„Halt mich auf dem Laufenden!“, rief er ihr nach.
Lina winkte vom Auto aus und wendete den Bus. Schon bald sah Theo sie, eine große Staubwolke aufwirbelnd, an den Feldern entlangbrausen.
Zu dritt erledigten sie den Abwasch. Anschließend machte es sich Großmutter mit einem Buch im Sessel gemütlich.
Theos Mutter legte ihrem Sohn die Hand auf die Schulter. „Ich gehe noch etwas an den Strand, möchtest du mitkommen?“
„Klar.“
Draußen zog sich der Himmel allmählich zu und Wind kam auf. Nur wenige Spaziergänger waren noch unterwegs. Theo hatte Mühe, seinen Elektrorollstuhl über den sandigen Pfad zu manövrieren. Er war froh, als er es bis zum Holzsteg geschafft hatte, der auf das Meer hinausführte.
Die Wellen rauschten in stetem Rhythmus an den Strand. Möwen zogen ihre Kreise, und ihre Schreie trugen einen Hauch von Wehmut in sich.