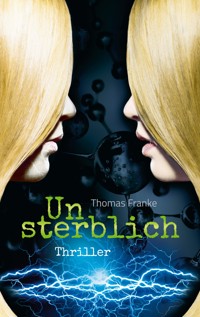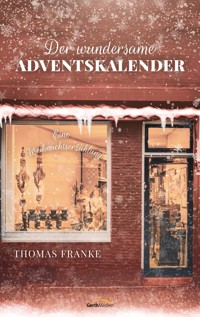Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Bei Grabungen in Frankreich macht der Archäologe Leon Weber eine erstaunliche Entdeckung: Er stößt auf das Tagebuch einer Adeligen aus der Zeit der Französischen Revolution, die auf ihre Hinrichtung wartet. Irritiert stellt er fest, dass dieses Tagebuch ein Eigenleben zu führen scheint: Es verschwindet immer wieder - um dann mit neuem Inhalt aufzutauchen ... Nach seinem erfolgreichen Debüt "Das Haus der Geschichten" legt Thomas Franke erneut einen vielschichtigen Roman vor. Zum einen geht es um die tiefe Auseinandersetzung mit den großen Glaubensfragen. Doch zugleich entspinnt sich ein atemberaubender Handlungsstrang mit zwei Menschen aus verschiedenen Zeitaltern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Franke
Das
Tagebuch
Roman
Inhalt
Prolog
Menetekel
Zwei Glas Wein und ein Blitzschlag
Das vierte Gebot und ein Kissen
Louis-Antoine de Soissons
Drei Stände
Der Hohlraum
Die Bestie vom Gévaudan
Die Fälschung
Der Götze
Zorn
Allein
Die Botschaft
Im Wald
Fährtensucher
Die Hebamme
Der verrückte Graf
Der Pilger
Paris
Die Toten
Der Verdacht
Place de Gréve
Die Tabelle
Heimkehr
Finsternis und Hoffnung
Das Genie und der Coach
Mordkomplott
Bertrand
Der Entschluss
24. Dezember 1793
Die Wasser der Loire
Der Stall
Hasenragout
Der Kommandant
Die Schlacht
Rache
Licht nach der Dunkelheit
Epilog
Danksagung
Anmerkungen
Prolog
Sie kommen! Ich kann ihre Schritte hören, ihre groben Scherze und das Lachen …
Gefesselt wie einen gefährlichen Verbrecher werden sie mich vor das Tribunal führen. Dann wird der Schlächter vortreten und sein Urteil sprechen. Es steht jetzt schon fest.
Vielleicht wird man mich erschießen, wahrscheinlich aber werden sie mich auf eine dieser schrecklichen Barken führen und ersäufen. Die trüben Wasser der Loire werden sich über mir schließen, ein letzter vergeblicher Kampf um Luft und Leben wird einsetzen und dann? Ich habe Angst – schreckliche Angst!
Ihre Schritte sind nun ganz nah. Ich höre die Riegel, wie sie mit dumpfem Knallen zurückgeschoben werden.
Der Tod ist bereits hier. Er sitzt in meiner Zelle und sieht mich an mit Augen voller Schwärze. Ich spüre seine lauernde Kälte und das klebrige Gespinst seiner gestaltlosen Finger. Und wenn ich herumfahre, um zu schauen, wer nach mir greift, dann ist da nichts, nur dieses schreckliche grinsende Fragezeichen.
Oh Sacré-Cœur – heiligstes Herz Jesu –, hast du aufgehört zu schlagen? Bist du verstummt, als man dich auf Uniformen bannte? Ich kann dich nicht spüren. Dein Platz in mir ist finster und leer. Ist denn mein Glaube erstickt im schrecklichen Würgegriff der Furcht?
Sie holen alle! Ich höre das leise Flehen und das verzweifelte Schreien. Doch ich darf nicht in Furcht erstarren und nur an mich denken – sie dürfen diese Zeilen nicht finden …
Menetekel
»Einen Augenblick, ich verbinde.« Die Stimme der Frau klang kühl.
Leon schluckte. Die Warteschleifenmusik setzte ein und ihn traf ein dicker Regentropfen. Er trat einen Schritt zurück unter die schützenden Planen, die sie über die Grabungsstätte gespannt hatten, und im gleichen Augenblick begann es in der Leitung zu knistern. Seufzend setzte er sich wieder dem herannahenden Unwetter aus. Obwohl sie sich unweit der Stadt Nantes befanden, war der Handyempfang hier im Château de Chamilot eine problematische Angelegenheit. Sein Assistent Pawel, der die Logistik übernommen hatte und für die Computer zuständig war, fluchte ständig über die unzuverlässige Internetverbindung. Leon sah zu, wie der Himmel sich verdüsterte. Der nahe Atlantik konnte innerhalb weniger Minuten ein ausgewachsenes Unwetter bescheren.
»Dr. Weber?«, vernahm er den tiefen Bass Prof. Degenhardts.
Leon zuckte innerlich zusammen. »Ja, am Apparat. Sie hatten um Rückruf gebeten?«
»Es ist verdammt schwer, Sie zu erreichen, wissen Sie das?«
»Ja, das haben wir auch schon festgestellt«, rief Leon gegen das Trommeln des stetig zunehmenden Regens an. »Wir haben des Öfteren kein Netz. Das Château de Chamilot befindet sich offenbar in einer Art Funkloch.«
»Reden Sie deutlicher, Mann, ich verstehe kein Wort.«
»Wir haben Netzprobleme!«, brüllte Leon in den Hörer. Ein Dickhornschaf, das sich, träge wiederkäuend, auf dem grasbewachsenen Hügel direkt neben der Ruine niedergelassen hatte, schaute verdutzt zu ihm herüber.
Der Professor am anderen Ende der Leitung hielt offenbar die Hand vor den Hörer und gab barsch irgendeine Anweisung an jemanden in seinem Büro. Der Regen trommelte immer heftiger auf die Planen, und in der Ferne donnerte es. Das Wasser rann Leon kalt in den Nacken, doch als er sich erneut einen halben Meter unter die schützende Plane zurückwagte, wurde die Verbindung abrupt schlechter. Hastig trat er wieder vor.
»… es bei Ihnen läuft?« Er bekam nur noch den zweiten Halbsatz des Professors mit.
»Nun, äh … die Grabungen kommen nur schleppend voran«, setzte Leon an. »Wir haben einige logistische Probleme und –«
»Kommen Sie mir nicht mit Ausflüchten«, fuhr ihn der Professor an. »Haben Sie nicht zugehört? Das DAI bombardiert mich mit Fragen, und mir fallen bald keine Ausreden mehr ein. Und unser privater Finanzier ist auf dem Absprung.«
Leon seufzte innerlich. Das Deutsche Archäologische Institut trug nur knapp ein Viertel der Kosten. Den überwiegenden Teil zahlte ein reicher Amerikaner, der sein Vermögen in verschiedene wissenschaftliche Projekte zur König-Artus-Forschung steckte. Wenn er absprang, war das Projekt gestorben. »Ich kann Ihnen versichern –«
»›Für Sie habe ich ein sehr vielversprechendes Projekt in Wales auf Eis gelegt‹, sagte er mir gestern erst«, unterbrach ihn der Professor erregt. »Sie haben uns nicht mehr und nicht weniger als eine Sensation versprochen, Dr. Weber!«
»Ich weiß, aber –«
»Man hat Ihnen vertraut, weil Sie einen ausgezeichneten wissenschaftlichen Ruf genießen. Aber eins kann ich Ihnen sagen: Das Eis unter Ihren Füßen wird immer dünner. Sie haben es nur meinem Einfluss zu verdanken, dass Ihrem Projekt bislang nicht der Geldhahn zugedreht wurde.«
»Und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar –«
»Sie haben Zeit bis Donnerstag, um irgendeinen brauchbaren Hinweis zu liefern, dass Ihre Theorie mehr ist als das Hirngespinst eines fantasiebegabten Mannes.«
Ein Blitz zuckte über den Himmel und spiegelte sich in den erschrockenen Augen des Dickhornschafs, das seine lustlosen Kaubewegungen unterbrach. Gleich darauf krachte der Donner, und das Tier sprang erschrocken auf und stürmte über die hügelige Weide davon. Unter der düsteren Wolkendecke war es kaum mehr als ein bleicher Schemen.
»Bis Donnerstag«, wiederholte Leon fassungslos. »Aber das ist nicht mal mehr eine Woche!«
»Mehr kann ich nicht für Sie tun. Sie wissen, wie das läuft. Sie haben Ihre ganze wissenschaftliche Reputation in die Waagschale geworfen, um dieses Projekt durchzusetzen. Wenn ich mich nicht irre, sagten Sie: ›Die archäologische Überprüfung des Château de Chamilot wird alles, was ich bisher über den bretonischen Artus geschrieben habe, auf ein gänzlich neues wissenschaftliches Fundament stellen.‹ Sehen Sie zu, dass es für Sie nicht zum Menetekel wird.«
Leon hatte das Gefühl, als würde alle Kraft aus ihm schwinden. Bis Donnerstag! Damit hatte der Professor seinem Projekt im Grunde den Todesstoß versetzt.
»Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Dr. Weber. Auf Wiederhören.«
»Wiederhören«, murmelte Leon und steckte das Handy in seine Jackentasche. Er senkte den Blick. Minutenlang starrte er in den Regen, der die verfluchte Erde der Vendée allmählich in Schlamm verwandelte. Der Professor hatte keine Ahnung, was seine Worte wirklich bedeuteten. Hier ging es nicht nur um seine wissenschaftliche Karriere. Leon hob den Kopf und ließ den kalten Atlantikregen auf sein Gesicht prasseln. Dieses Projekt war alles, was er noch hatte.
Nach einem letzten Blick auf die düsteren Weiden ging Leon zu seinem Camper. Er zog sich trockene Sachen an und warf sich dann ein Regencape über. Er durfte sich nichts anmerken lassen. Wenn die Studenten erfuhren, dass das Projekt so gut wie gestorben war, würde die Stimmung kippen. Niemand würde sich mehr Mühe geben, und er konnte im Grunde genommen gleich alles zusammenpacken lassen. Aber solange alle motiviert weiterarbeiteten, bestand eine kleine Chance, dass sie doch noch Erfolg hatten.
Er stapfte zurück zur Grabungsstelle und ging zu den Stelltischen, auf denen seine Studenten die magere Ausbeute der letzten Stunden zusammengetragen hatten.
Leon holte tief Luft, nahm eine Keramikscherbe zur Hand, reinigte sie mit dem Pinsel von Erdresten und betrachtete sie unter dem Licht des Scheinwerfers. Schon eine halbe Minute später ließ er sie frustriert fallen. Das Fragment war neuzeitlichen Ursprungs, wahrscheinlich Anfang des 18. Jahrhunderts. Nun griff er nach einem rostigen Eisenteil, das vermutlich zum Zaumzeug eines Pferdes gehört hatte. Die ganze Zeit über versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen, aber anscheinend war er kein allzu guter Schauspieler.
Emma, seine französische Kollegin von der Universität Nantes, stützte sich auf ihren Spaten und betrachtete ihn stirnrunzelnd. Sie war groß gewachsen und hatte einen athletischen Körperbau. Ihr Trizeps zeichnete sich sehr deutlich an ihren muskulösen Armen ab.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sie sich.
Leon brummte eine unverbindliche Antwort.
Emma rammte ihren Spaten in den Boden und schlenderte zu ihm herüber. Sie trug Jeans und ein ausgebleichtes T-Shirt und interessierte sich ganz im Gegensatz zu allen Vorurteilen über Französinnen in etwa so viel für Mode wie eine Kellerassel für die Aktienkurse an der Pariser Börse. Allerdings war sie eine hervorragende Triathletin und eine der angesehensten Expertinnen für spätantike und frühmittelalterliche Geschichte Mittel- und Westeuropas.
»Was bedrückt dich?«
Leon stützte die Hände auf den Tisch und starrte an ihr vorbei auf eine kleine Silbermünze, einen Denier aus dem 16. Jahrhundert. »Die Frage ist doch eher: Warum bist du nicht bedrückt?«, gab Leon zurück.
Emma lächelte. »Noch haben wir die Grabungen nicht beendet.«
»Ja, aber das ist pure Dickköpfigkeit. Wir haben nichts, absolut nichts!«
Emma setzte sich auf den Rand des Tisches und ließ die Beine baumeln. »Ich liebe meinen Beruf«, sagte sie. »Wir dürfen Menschen begegnen, die alle anderen auf diesem Planeten längst vergessen haben. Wir können in ihr Leben eintauchen und ein wenig an ihren Gedanken teilhaben. Wir lernen ihre Sorgen und ihre Träume kennen, und wir haben die Chance, von ihnen zu lernen, ein Privileg, das ihnen andererseits leider nicht vergönnt ist.«
»Emma, auch ich liebe meinen Beruf, aber –«
»Wirklich?«, unterbrach sie ihn. »Dieser ganze Ort atmet Geschichte, und du bist so gehetzt, dass du seinen Geruch nicht einmal wahrnimmst.«
Leon versuchte, den aufkeimenden Zorn zu unterdrücken. »Vielleicht hast du recht, ich bin nicht annähernd so tiefenentspannt wie du, aber das mag daran liegen, dass ich für die Finanzierung dieses Projekts verantwortlich bin. Natürlich atmet dieser Ort Geschichte, aber es ist der falsche Atem, verstehst du?« Dann zischte er ihr zu, so leise, dass die Studenten ihn nicht hören konnten: »Dieses ganze Projekt ist ein einziges Desaster, und das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist ein romantischer Vortrag über die Schönheiten unseres Berufstandes. Hier geht es ums nackte Überleben!«
»Was ist passiert?«
Er seufzte. »Ich habe gerade mit Professor Degenhardt in Berlin telefoniert –«
»Doktor Weber!« Die Stimme des jungen Studenten klang aufgeregt.
»Ja?« Leon warf seiner Kollegin einen kurzen Blick zu. »Wir reden später.« Er ging um den Tisch herum zu einer der Grabungsstellen. Das Château de Chamilot war eine sehr alte Burg, deren erste Bauten bereits im 5. Jahrhundert errichtet worden waren. Und das machte sie für Leon so spannend. Im Lauf der Jahrhunderte hatte sie eine wechselvolle Geschichte erlebt. Während der Hugenottenkriege Ende des 16. Jahrhunderts brannte ein Großteil der Burganlagen nieder. Nur ein Teil wurde wieder aufgebaut. Der Vendéekrieg, der zur Zeit der Französischen Revolution tobte, besiegelte dann das Schicksal der Festung. Sie diente als Stützpunkt und später auch als Gefängnis der Truppen des Nationalkonvents, bevor sie bei einem Eroberungsversuch der Vendéer vollständig zerstört wurde. Leon vermutete, dass der mächtige Burgfried das Munitionsdepot der Festung gewesen war. In jedem Fall war das Gebäude in einer gewaltigen Explosion regelrecht zerfetzt worden. Nur die Fundamente und letzte Überreste der Grundmauern waren erhalten geblieben. Und darauf konzentrierten sie ihre Forschung.
Die untersten Räume des Turms, ehemalige Vorratslager, waren später als Gefängniszellen genutzt worden.
Einer der Studenten kniete vor einer etwa ein Meter hohen Mauer und zog knapp über dem Boden behutsam einen lose sitzenden Stein heraus.
»Was haben Sie gefunden?«, fragte Leon. Sein Herz begann zu klopfen, als er zusah, wie der junge Mann einen weiteren Stein aus der Wand löste. Emma trat hinter ihn und lugte ihm über die Schulter. Auch die anderen Teammitglieder waren neugierig geworden.
»Hier ist ein Hohlraum.«
»Können Sie schon etwas erkennen?«, wollte Emma wissen.
Der Student nahm einen der Scheinwerfer und leuchtete in den Spalt. »Da ist irgendetwas!«
Emma warf Leon einen raschen Blick zu und lächelte ermutigend.
Der Student löste mit einem Schraubenzieher einen weiteren Stein. Er ging sehr behutsam und methodisch vor, eigentlich eine sehr lobenswerte Eigenschaft bei einem angehenden Archäologen. Dennoch verspürte Leon mehr als nur einen Hauch von Ungeduld. Schließlich handelte es sich hier nicht um zerbrechliche Knochenstücke oder poröse Papyri, sondern um massiven Granit.
Schließlich zog der junge Mann den Stein heraus und beugte sich vor.
»Und?«, rief einer seiner Kommilitonen.
»Eine Kiste oder so etwas Ähnliches. Ich zieh sie jetzt heraus.«
Leon schluckte. »In Ordnung.«
Mit größter Vorsicht brachte der junge Mann einen kleinen dunklen Kasten zum Vorschein, der ungefähr die Größe eines Schuhkartons hatte. Eine poröse dunkle Schicht bedeckte den Kasten, und man konnte Linien aus grünen, etwa daumennagelgroßen Metallköpfen erkennen.
»Was ist denn das für ein Zeug?«, fragte einer der Studenten, als etwas von der porösen Schicht abbröckelte.
»Leder«, entgegnete Leon und gab sich keine Mühe, die Bitterkeit in seiner Stimme zu verbergen. Er spürte die Enttäuschung wie einen Schlag in die Magengrube. »Verdammte Scheiße«, murmelte er.
Emma warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Sie sprang über die flache Mauer, kniete neben dem Studenten nieder und untersuchte behutsam den kleinen Kasten. »Das ist ein messingbeschlagener Koffer, vermutlich Eiche mit Leder überzogen, schätzungsweise aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.«
»Klingt eher nicht nach einem Hinweis auf die bretonische Besiedelung«, kommentierte eine junge Studentin lapidar.
»Vielleicht haben wir ja Glück und irgendein Graf hat sein Gold darin versteckt!«, rief ein anderer.
Emma hob den kleinen Koffer an. »Wohl kaum«, erwiderte sie mit schiefem Grinsen.
»Dann wenigstens einen guten Wein?«, bemerkte ein anderer.
Leon hörte dem Gespräch nicht länger zu. Ihm war nicht nach Scherzen zumute. Emma erwiderte irgendetwas, doch schon im nächsten Augenblick verstummte das Geplänkel.
Mehrere Dinge ereigneten sich kurz hintereinander. Zunächst hatte Leon das Gefühl, als würde der Boden unter seinen Füßen zittern. Ein mächtiger Donnerschlag zerriss die Luft, und das Licht ging aus. Zeitgleich streifte etwas seine Hüfte, und ein seltsamer Moschusgeruch drang ihm in die Nase. Er vernahm ein Geräusch, das er nicht einzuordnen wusste. Es ging unter im Trommelfeuer des Regens, der auf die Planen prasselte, und gleich darauf setzte aufgeregtes Stimmengewirr ein. »Was zur Hölle war das denn? … Ein Erdbeben? … Nur das Gewitter! … Der Blitz hat eingeschlagen …«
»Ist irgendjemand verletzt?«, rief Leon über den Lärm hinweg.
»Ich bin okay«, meldete sich eine Stimme.
»Ich auch«, sagte ein anderer.
Eine Taschenlampe leuchtete auf, und der Lichtstrahl huschte über blasse, erschrockene Gesichter.
»Alle sind in Ordnung«, meinte Emma und blickte von einem zum anderen.
»Gut«, sagte Leon. »Offenbar hat ein Blitzeinschlag die Stromleitungen lahmgelegt. Pawel, wir sollten am besten den Generator anschließen. Der Rest begibt sich bitte in die Wohnwagen. Das Gewitter ist direkt über uns, und ich will nicht, dass hier noch jemand vom Blitz erschlagen wird.«
Aufgeregt tuschelnd zerstreuten sich die Studenten. Emma stellte den Koffer auf den Tisch unter die schützenden Planen und sah zu Leon hinüber. »Ich komme mit euch!«
Er zuckte die Achseln. Die drei traten in den strömenden Regen hinaus. Draußen war es so düster wie in einem Kohlenkeller, und auch die Lichter der nächstgelegenen Gehöfte waren erloschen. Offenbar hatte der Stromausfall die gesamte Gegend getroffen. Hastig stapften sie durch den Matsch. Leon war dankbar, dass er daran gedacht hatte, sich ein Regencape überzuwerfen, denn die beiden anderen waren binnen weniger Augenblicke bis auf die Haut durchnässt. Als sie den LKW erreicht hatten, kletterten sie auf die offene Ladefläche, auf der noch immer sorgfältig verpackt der Generator stand.
»Ohne Kran kriegen wir das Ding nicht herunter«, meinte Pawel.
Leon seufzte. Der Kran befand sich am zweiten, größeren LKW, und der war derzeit Richtung Lyon unterwegs, da sie sich den Fuhrpark mit zwei weiteren Ausgrabungsprojekten teilten, um Kosten zu sparen.
»Dann lassen wir ihn eben hier auf der Ladefläche.«
»Geht das?«, fragte Emma.
Beide sahen Pawel an. Er war für die Logistik zuständig, kannte sich jedoch bedeutend besser mit Computern aus als mit den Maschinen fürs Grobe. »Ich wüsste nicht, was dagegen spricht –«, sagte der junge Mann zögernd. Dann brach er plötzlich ab und schien noch einmal eine Spur blasser zu werden.
»Alles in Ordnung?«, fragte Emma.
»Ihr werdet das schon hinbekommen«, meinte Leon, der sich schon halb zum Gehen gewandt hatte. »Ich hole inzwischen die Leitung für den Verteiler, während ihr den Generator auspackt.«
»Ähm … einen Moment noch, Leon!«
»Was ist denn?« Genervt wandte Leon sich um. Es war kalt und nass, das ganze Projekt ging den Bach hinunter, und seine Stimmung war auf dem Tiefpunkt angelangt. Zumindest glaubte er das in diesem Moment. Gleich darauf sollte er jedoch eines Besseren belehrt werden.
»Äh … es ist so …«, stammelte Pawel. »Im Grunde haben wir den Generator nur sicherheitshalber mitgenommen – und dann stellte sich ja schon bald heraus, dass wir ihn eigentlich nicht brauchen, weil wir den Strom über das nächste Gehöft beziehen können. Nun ja … es war natürlich nicht vorauszusehen, dass –«
»Worauf willst du hinaus?«, unterbrach Leon ihn.
»Die Benzinkanister sind zusammen mit dem Lastwagen unterwegs nach Lyon.«
Leon stellte fest, dass seine Stimmung noch einmal beträchtlich tiefer sank. »Unterwegs nach Lyon«, wiederholte er mit Grabesstimme.
»Es tut mir leid.«
Leon presste die Lippen zusammen. Was konnten sie jetzt noch tun? Der Toyota fuhr mit Diesel. Sie hatten also nicht einmal die Möglichkeit, etwas aus dem Tank abzuzapfen.
»Jetzt guck nicht so. Es konnte doch niemand ahnen –«, mischte sich nun auch Emma ein.
»Wisst ihr was«, unterbrach Leon sie, »vergesst es einfach. Ich fahre rüber zu Mathéo und frag, ob er einen Kanister für uns hat. Wenn wir ihm schon den Strom abkaufen, warum nicht auch etwas Benzin?«
»Es tut mir wirklich sehr leid«, beteuerte Pawel.
Leon brachte ein klägliches Lächeln zustande und klopfte seinem Kollegen auf die Schulter. Dann stapfte er zum Geländewagen, ließ sich auf den Fahrersitz sinken und schlug die Tür hinter sich zu. Endlich allein! Ihm war nach Schreien zumute, aber er schrie nicht. Stattdessen stützte er die Hände aufs Lenkrad und starrte durch die Windschutzscheibe, über die in Bächen der Regen lief, in die Dunkelheit hinaus. Am Horizont flammten Blitze auf, und das Donnergrollen ließ den Boden des Wagens vibrieren. Der Duftbaum am Rückspiegel verströmte das Aroma von Limetten, und der Aschenbecher stank nach kaltem Rauch. Eigentlich war er seit gut drei Jahren Nichtraucher, aber vor ein paar Wochen hatte er wieder damit angefangen. Dieses Projekt war eine einzige Katastrophe. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen.
Schon während seines Studiums hatte Leon sich auf die romanisierten Kelten Galliens und Britanniens spezialisiert. Er hatte seine Doktorarbeit über die historischen Hintergründe der Artussage geschrieben und diese mit der geschichtlich verbürgten Person des Riothamus in Verbindung gebracht, die Mitte des 5. Jahrhunderts gelebt hatte. Dieser Name war eigentlich ein Titel, der so viel wie »höchster Anführer« bedeutete. Sehr wahrscheinlich war der Mann der letzte Heerführer Britanniens gewesen, der seine Truppen nach römischer Art organisierte. Dann wurde seine Hilfe auf dem Kontinent benötigt. Er kämpfte in Gallien gegen den Hunnen Attila und später gegen den westgotischen König Eurich. Im Allgemeinen ging man davon aus, dass er nach verlorener Schlacht in dem kleinen burgundischen Städtchen Avallon verstorben war.
Leons Doktorarbeit hatte breite Anerkennung gefunden. Beflügelt durch diesen Erfolg, hatte er sich dieser mysteriösen historischen Gestalt intensiver gewidmet. Bei seinen Nachforschungen war er auf eine glaubwürdige Quelle gestoßen, derzufolge Artorius, genannt Riothamus, sich als König der Bretonen an der französischen Atlantikküste niedergelassen hatte, und zwar sehr weit südlich, etwa auf der Höhe des heutigen Nantes. Dort hatte er die Feste Camelot erbaut. Als Leon den Hinweisen nachging, fiel ihm sofort die Namensähnlichkeit mit der Burgruine Château de Chamilot auf. Als er dann noch herausfand, dass man ganz in der Nähe britisch-römische Münzen gefunden hatte, die auf die Mitte des 5. Jahrhunderts datiert werden konnten, hatte er sich auf diese Entdeckung gestürzt und weitere Hinweise gefunden. Aber verifizieren konnte er seine Theorie nur, wenn er die Ruine genauer erforschte. Zwei Jahre intensiver Überzeugungsarbeit hatte es gekostet, bevor das Projekt Wirklichkeit wurde. Er hatte seine gesamte wissenschaftliche Reputation als Kenner der britisch-bretonischen Geschichte in die Waagschale geworfen. Und nun? »Gewogen und für zu leicht befunden«, murmelte er leise.
Eine plötzliche Bewegung riss ihn aus seinen Gedanken. Er glaubte, im Aufleuchten des Gewitters ein Tier vorbeihuschen zu sehen. Überrascht blickte er dem Schatten nach. Ein weiterer Blitz erhellte grell den Himmel, und er konnte eine große, zottige Gestalt hinkend im niedrigen Buschwerk verschwinden sehen. Ein Hund? Leon runzelte die Stirn. Das Biest war riesig gewesen, und seines Wissens gab es hier keine frei laufenden Hunde, aber seine Hand würde er dafür gewiss nicht ins Feuer legen. Er startete den Motor und wendete den Toyota. Die großen Räder des vierradgetriebenen Geländewagens wühlten im Schlamm, spritzten Matsch in hohem Bogen umher und kämpften sich hinauf zu dem mit riesigen Pfützen bedeckten Weg, der zu Mathéos Gehöft führte.
Zwei Glas Wein und ein Blitzschlag
Der herabtrommelnde Regen und der raue Wind ließen die graue Masse des schlammbedeckten Weges fast wie das Gewimmel formloser Lebewesen erscheinen. Das Unwetter verwandelte die friedliche Landschaft der Vendée in eine wilde und urtümliche Gegend. Ein Schauer überlief Leon, als die Scheinwerferkegel seines Wagens die Düsternis zerschnitten. Es hätte ihn nicht sonderlich überrascht, wenn plötzlich ein bretonischer Krieger aus dem 5. Jahrhundert oder ein grimmiger Normanne aus dem 9. Jahrhundert vor ihm aufgetaucht wäre.
»Du hast zu viel Fantasie, Leon Weber«, brummte er zu sich selbst. Professor Degenhardt hatte nicht unrecht. Seine bisherigen Erfolge waren nicht nur auf wissenschaftliche Genauigkeit zurückzuführen, sondern auch auf seine ausgeprägte Imagination. Sie hatte ihm gute Dienste geleistet und einen verträumten Abiturienten und Mittelalterfan über einige Projekte der experimentellen Archäologie zum Studium der Geschichtswissenschaften in Berlin und Tübingen und schließlich zum Studium der Archäologie römischer Provinzen an der Universität Köln geführt. Habilitiert hatte er an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Fantasie hatte ihn ungewöhnliche Wege gehen lassen. Er hatte einen, wie er glaubte, untrüglichen Instinkt entwickelt, der ihn spüren ließ, welche Quellen vertrauenswürdig waren und welche nicht. Und nun hatte ihn dieser Instinkt direkt in den Schlamm der verregneten Vendée geführt. Wie ein Terrier hatte er sich in die Idee eines bretonischen König Artus mit einem frühmittelalterlichen Camelot südlich von Nantes verbissen. Selbst jetzt, wo es mehr als wahrscheinlich war, dass er im Irrtum war, fiel es ihm schwer loszulassen. Aber vielleicht lag es nur daran, dass ihm dann in aller Deutlichkeit bewusst werden würde, wie leer sein Leben eigentlich war.
In diesem Moment tauchte Mathéos Haus zum ersten Mal im Licht seiner Scheinwerfer auf; ein kleines, verwachsenes Bauernhäuschen aus grauem Feldstein, umgeben von mehreren hundert Jahre alten Ahornbäumen. Aus einem der Fenster schien ein schwacher Lichtschein zu kommen. Da er um die tiefen Schlaglöcher wusste, drosselte Leon sein ohnehin schon langsames Tempo und fuhr im Schritttempo auf den Hof. Als er ausstieg, wurde er vom Blöken einer Kuh, herabtrommelndem Regen und dem Gestank von Dung empfangen. Geduckt hastete er zum Haus hinüber und klopfte an die Tür. »Mathéo?!« Leon pochte erneut gegen das dicke Holz, diesmal ein wenig kräftiger. Etwas blaue Farbe platzte ab und blieb an seinen Fingerknöcheln kleben.
Er erinnerte sich daran, wie er vor einigen Monaten zum ersten Mal an diese Tür geklopft hatte. Leon war damals mit Emma vorausgefahren, um alle nötigen Vorbereitungen für das Projekt zu treffen. Sie hatten bereits bei einem halben Dutzend anderer Bauernhöfe in der Umgebung vergeblich um Unterstützung gebeten. Dabei hatte Leon von Beginn an einen stattlichen Preis für Stromversorgung und logistische Unterstützung geboten. Die meisten hatten nicht einmal die Tür geöffnet, und diejenigen, die es getan hatten, hatten ihr Missfallen über die Ankunft der Archäologen mit sehr deutlichen Worten zum Ausdruck gebracht. Leon war auf alle möglichen Reaktionen gefasst gewesen, als er an diese Tür gepocht hatte, aber nicht auf die, die dann folgte. Mathéo hatte die Tür geöffnet und ein nicht unfreundliches »Bonjour« gemurmelt. Dann, so jedenfalls hatte es Leon in Erinnerung, war sein Gesicht plötzlich leichenblass geworden. Er hatte den Archäologen angestarrt, als sähe er ein Gespenst.
»Alles in Ordnung, Monsieur?«, hatte Leon verwirrt entgegnet, doch der alte Bauer hatte ihnen schon die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Aber einige Sekunden später, als die beiden Wissenschaftler sich seufzend abgewandt hatten, war die Tür wieder aufgegangen. »Kommt rein!«
Seinem mürrischen Gebaren zum Trotz hatte sich Mathéo sehr kooperativ gezeigt. Er war in dieser Gegend ihr einziger Verbündeter und schließlich sogar so etwas wie ein Freund geworden. Über sein anfängliches Erschrecken hatte er nie ein Wort verloren.
Nun konnte Leon einen schwachen gelblichen Lichtschimmer durch einen Spalt nach draußen dringen sehen. Gleich darauf wurde die Tür geöffnet, und das faltige, von einem wirren grauen Haarschopf gekrönte Gesicht des alten Bauern wurde sichtbar. Er trug eine Öllampe in der Hand, die nur spärliches Licht von sich gab. Vermutlich lächelte er, denn sein mächtiger Schnurrbart zuckte ein wenig, bevor er »Herein« brummte.
Für Leon war Mathéo der fleischgewordene Archetypus eines alten Kelten – urwüchsig und fest mit seinem Land verwurzelt, voll zäher Kraft, humorvoll und wortkarg. Zuweilen lag ein Funkeln in seinen Augen, das es Leon schwermachte, ihn einzuschätzen. Aber er ahnte, dass sich mehr hinter dem knurrigen alten Bauern verbarg, als es den Anschein hatte.
»Wie ich sehe, ist bei dir auch der Strom ausgefallen«, sagte Leon und hängte sein triefnasses Regencape an einen Haken im Flur. Mittlerweile wusste er, dass es keinen Zweck hatte, gleich mit seinem Anliegen an Mathéo heranzutreten. Die keltische Gastfreundschaft gebot es, zunächst zusammen ein wenig Wein zu trinken.
Mathéo nahm zwei Gläser aus dem Schrank und stellte sie auf einen Tisch, der aussah, als hätte ihn sein Urgroßvater aus einer tausendjährigen Eiche geschnitzt. »Herrliches Wetter«, meinte er, und wieder einmal wusste Leon nicht, ob der alte Mann das ernst meinte oder einen Scherz machte. Er setzte sich auf einen der mit Leder bezogenen Stühle, die weitaus gemütlicher waren, als sie aussahen.
Langsam goss der alte Mann Wein in die Gläser. Vermutlich stammte dieser hier aus der Gegend, aber Leon war alles andere als ein Weinkenner. Er konnte nichts anfangen mit Fachbegriffen wie »schwer, aber mit blumiger Note«, »körperreich mit viel Nachhall« oder »samtig und astringierend«. Mathéos Weine schmeckten gut und stiegen ihm nicht gleich zu Kopf; das genügte ihm.
Eine Weile saßen sie sich schweigend gegenüber und nippten an ihren Gläsern. Dann fragte Mathéo: »Hast du inzwischen gefunden, was du gesucht hast?«
»Nein.«
»Vielleicht suchst du ja an der falschen Stelle?«
Leon schüttelte den Kopf. »Leider nein.« Er verzog die Lippen zu einem bitteren Lächeln. »Nichts gegen deine Heimat, aber es sieht so aus, als würde der schlammige Boden der Vendée zum Grab meiner wissenschaftlichen Karriere werden.«
»Ich bin nur ein Bauer«, erwiderte Mathéo, »von solchen Dingen habe ich keine Ahnung. Aber du hast dir einen fruchtbaren Boden ausgesucht. Ich habe hier schon so manches begraben und es ist Gutes daraus gewachsen.«
Leon hob fragend die Brauen.
»Noch etwas Wein?«, fragte der alte Bauer.
»Nein danke.« Leon lächelte; sein Glas war noch halb voll. Genüsslich lehnte er sich zurück. Da die Öllampe nur ein schwaches Licht verströmte, lag ein Teil des Zimmers im Halbdunkel. Er konnte jedoch entdecken, dass auf einer Kommode eine weitere Öllampe stand und dass daneben eine alte Steinschlosspistole lag, die zwar hervorragend zum uralten Mobiliar, aber nicht so recht zu dem raubeinigen alten Bauern passte. Mathéo war weder Jäger noch Waffennarr. Bei Gelegenheit musste Leon ihn einmal fragen, wie er an diese Pistole gekommen war. Leons Blick wanderte ein wenig höher. Über der Kommode hingen einige gerahmte Bilder. Sie zeigten einen weit jüngeren Mathéo mit einer lachenden jungen Frau im Arm. Leon wusste nicht, ob der alte Bauer verheiratet gewesen war; Kinder hatte er jedenfalls nicht, das hatte er einmal aus einem Nebensatz herausgehört.
»Fühlst du dich nicht manchmal furchtbar einsam, so ganz allein auf diesem Hof?«, platzte es unvermittelt aus ihm heraus. So etwas Persönliches hatte er eigentlich gar nicht fragen wollen, schließlich war er eigentlich nur hier, um seinen generator wieder in Gang zu kriegen.
Mathéos Schnurrbart zuckte. »Es stimmt, ich bin oft allein, aber ich bin nicht einsam.« Er strich mit seinem wulstigen Zeigefinger über den Rand des Weinglases, dann sah er auf und blickte Leon in die Augen. »Warum fragst du?«
Leon zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
Mathéo wandte sich um und sah ebenfalls auf das Bild, an dem Leons Blick hängen geblieben war. »Und du?«, fragte er, als er sich wieder zurückwandte. »Bist du einsam?«
»Mein Leben ist ausgefüllt.«
»Das habe ich nicht gefragt.«
Leon seufzte. »Ich war verlobt, über zwei Jahre lang. Diesen Sommer wollten wir heiraten. Dann gab es eine Planänderung – zumindest von ihrer Seite.« Er hob das Glas an die Lippen und trank einen Schluck.
Der alte Mann musterte ihn unter seinen buschigen grauen Augenbrauen hindurch.
»Sie hieß Nele, war Kunsthistorikerin«, fuhr Leon fort. »Wir hatten uns als Studenten auf einer völlig misslungenen Erstsemesterparty kennengelernt. Mir fielen sofort ihre Haare auf. Sie hatte lange rote Locken, die sich nicht bändigen lassen wollten, und grüne Augen.« Er schnaubte. »Ich weiß noch, meine erste Assoziation war: wie eine piktische Druidin – stolz und geheimnisvoll. Nun ja, anfangs war es auch so, aber nachdem wir acht Jahre zusammen waren, gab es nichts Geheimnisvolles mehr. Wer weiß, vielleicht ist das so eine Art magische Zahl. Kennst du Erich Kästner? ›Als sie einander acht Jahre kannten (und man darf sagen, sie kannten sich gut), kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Wie andern Leuten ein Stock oder Hut‹1, zitierte er. Aber ins Französische übersetzt klang es irgendwie albern. Er trank sein Glas leer. »So gesehen war unsere Trennung keine dramatische Sache. Ich meine, keiner von uns hatte eine Affäre oder so etwas. Wir haben uns schlicht auseinandergelebt, wie man so sagt. Jetzt hätte ich gerne noch ein Glas Wein.«
Mathéo schenkte nach. »Du bist traurig«, bemerkte er.
Leon nippte an seinem Glas und stellte es sacht wieder ab. »Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Bin ich traurig? Würde ich Nele dann nicht vermissen? Müsste ich dann nicht in Erinnerungen schwelgen und meinen Verlust beweinen? Aber so ist es nicht. Ich fühle mich nicht traurig. Manchmal … leer. Aber ich kann nicht einmal genau sagen, ob das etwas damit zu tun hat, dass sie mich verlassen hat – verrückt, nicht wahr? Verstehst du, was ich meine?« Leon biss sich auf die Lippen und verstummte. Warum erzählte er das eigentlich?
Mathéo sah ihn an, und in seinem Blick stand wieder so etwas Seltsames, schwer Deutbares.
Es ist, als würde ich manchmal ganz dicht an einem Abgrund stehen, wollte Leon fortfahren. Die meiste Zeit ahne ich nicht einmal, dass er da ist. Ich bin viel zu beschäftigt, lebe mein Leben. Aber ab und zu, wenn der Nebel des Alltags aufreißt, sehe ich den Abgrund und erstarre. Das Gestein ist porös; ich weiß, dass es bröckelt, und doch bin ich nicht in der Lage, mich von der Stelle zu bewegen. Ich blicke in die bodenlose Tiefe, ohne mich zu rühren, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Doch er sprach es nicht aus, starrte stattdessen auf die Maserung des alten Eichentisches und schwieg.
Der alte Franzose verkorkte die Weinflasche und stellte sie zurück ins Regal. »Ja«, sagte er schließlich.
Leon blickte auf, für einen Moment verwirrt.
Dann wurde das Zimmer mit einem Schlag beinahe taghell, und ein gewaltiger Donnerschlag krachte hernieder. Gleich darauf war ein merkwürdiges Knacken und Knirschen zu vernehmen. Leon sprang auf und starrte aus dem Fenster.
»Ach, du Scheiße!«, entfuhr es ihm. Einer der uralten Ahornbäume war vom Blitz getroffen worden. Der mächtige Stamm war gespalten worden, und eine Hälfte war umgeknickt. Ein schwerer Ast hatte die Stalltür halb eingedrückt, und die gewaltige Hitze des Blitzeinschlags ließ Flammen aus dem Holz schießen. In diesem Augenblick drang aus dem Stall auch schon panisches Brüllen zu ihnen herüber.
Mathéo war bereits an der Tür, und Leon folgte ihm. Der Regen hatte etwas nachgelassen, dafür war der Wind jedoch umso heftiger. Flammen fauchten im brausenden Wind, Qualm und Wasserdampf stiegen zischend auf. Das Gewitter war noch immer sehr nahe, und Donnergrollen ließ die Luft erzittern. Im Stall lärmten die Tiere in Todesangst. Es war ein Inferno.
»Wir müssen die Flammen löschen, bevor sie auf den Stall übergreifen!«, schrie ihm Mathéo durch den Lärm zu.
Leon nickte. Da der Strom ausgefallen war, funktionierte natürlich auch die Wasserpumpe nicht. Aber Leon erinnerte sich, dass sich im Geländewagen ein Feuerlöscher befinden müsste. Er rannte in weitem Bogen um den brennenden Baum herum zu seinem Wagen. Der alte Franzose eilte indessen zu seinem kleinen Werkzeugschuppen, der neben dem Wohnhaus stand. Leon riss den Kofferraum auf. Im schummrigen Licht der Innenraumbeleuchtung wühlte er in dem Chaos, das sich mittlerweile dort angefunden hatte. Zwischen Plastikflaschen, Werkzeugen, alten Decken, Planen und Materialkisten fand er schließlich einen winzigen Handfeuerlöscher. Er hatte jedoch noch nie einen bedient und versuchte, im Halbdunkel die Gebrauchsanweisung zu entziffern. Zunächst musste er einen Plastiksicherungsring entfernen. Mit hektischen Fingern zerrte er an dem kleinen Ring und riss ihn ab, dann schnappte er sich zusätzlich eine der Decken und eilte zurück.
Mathéo hatte inzwischen begonnen, mit einem Zinkeimer schlammiges Wasser aus den Pfützen im Hof zu schöpfen, um die Flammen am Stall von der anderen Seite her zu ersticken. Durch Qualm und Flammen hindurch war er kaum zu erkennen. Leon zog den Hebel des Feuerlöschers durch und begann, Schaum auf den brennenden Ast zu spritzen. Zuerst zielte er zu hoch, und der Schaum spritzte nutzlos gegen die Stallwand. Als er den Dreh heraushatte, zeigte der Löschschaum Wirkung. Es gelang ihm, die Flammen, die dem hölzernen Tor am dichtesten waren zu ersticken; der hintere Teil brannte allerdings munter weiter. Leon warf den leeren Löscher fort und tastete nach der Decke, die er in den Matsch hatte fallen lassen. Zwischen Qualm und sturmgepeitschten Ästen tauchte das bärtige Gesicht Mathéos auf: »Wir müssen den abgeknickten Teil fortziehen!«
Leon nickte. Wenn der schwere Ast weit genug vom Stall entfernt war, konnte er ausbrennen, ohne Schaden anzurichten.
»Traktor?«, brüllte er gegen den Sturm an.
»Im Stall!«, schrie Mathéo zurück und hustete.
»Verdammt!« Leon warf dem alten Mann die triefnasse Decke zu. »Bin gleich wieder da!« Er rannte zurück zum Auto, wühlte erneut im schummrigen Kofferraum und fand schließlich das Abschleppseil. Dann hastete er zurück.
»Wende du den Wagen!«, keuchte Mathéo, als er das Seil nahm. Das Wüten der Tiere im Stall klang mittlerweile verzweifelt.
Leon nickte. Zuerst würgte er den Motor ab, dann blieb er beinahe im Schlamm stecken, aber schließlich hatte er den Wagen dicht genug herangefahren, sodass der alte Franzose das Seil befestigen konnte.
»Los!«, schrie dieser.
Leon gab Gas. Der Motor dröhnte, und die Räder drehten durch. »Verfluchte Scheiße!« Der Archäologe hieb mit der Faust gegen das Lenkrad. Das Gesicht Mathéos erschien am Seitenfenster. Es war fast schwarz von Ruß und Schlamm. Langsam, signalisierte er ihm.
Erneut stieß Leon einen Fluch aus. Dann nahm er den Fuß vom Gas. »Los, Mann, konzentrier dich!«, befahl er sich selbst. Er versuchte, das Brausen des Sturms, das Prasseln der Flammen und das verzweifelte Brüllen der eingeschlossenen Tiere auszublenden. Für einen Moment schloss er die Augen und atmete tief ein. Behutsam ließ er die Kupplung kommen, versuchte, die Kraft des Motors zu spüren, und ließ sie ganz vorsichtig kommen. Der Wagen fuhr mit einem Rucken an. Das Seil spannte sich. Beinahe körperlich spürte Leon den Widerstand des Baums hinter sich. Er unterdrückte den Impuls, die volle Kraft des Motors zu entfesseln. Millimeter um Millimeter drückte er das Gaspedal weiter durch, doch schon bald drehte ein Reifen durch. Sofort nahm er das Gas etwas zurück und versuchte es noch einmal. Er warf einen kurzen Blick durch das Seitenfenster. Mathéo war nicht zu sehen. Erneut gab er Gas. Der Wagen zog an, plötzlich gab es einen Ruck. Der Ast hatte sich ein Stück bewegt. Wieder drehte ein Rad durch, und Leon zwang sich selbst zur Ruhe. Stück um Stück arbeitete er sich voran.
Schließlich rief Mathéo neben ihm: »Stopp! Das reicht!«
Leon drehte sich um und blickte durch das Heckfenster. In der Düsternis sah er, wie der alte Mann an der Stalltür zerrte. »Warte, ich helfe dir!« Er sprang aus dem Wagen. Doch in diesem Moment flog auch schon die Stalltür auf, und Mathéo wurde zu Boden geschleudert. Ein mächtiger dunkler Schatten stürmte aus dem Stall hervor – der Zuchtbulle des alten Bauern. Das Tier brüllte, stieg auf, als es die Flammen sah. Dann wandte es sich ab und stürmte auf die Weiden zu. Das war, wie Leon feststellen musste, genau in seine Richtung. Der Wissenschaftler sprang zur Seite und presste sich gegen die Karosserie des Geländewagens. Das verängstigte Tier stürmte so dicht an ihm vorbei, dass Leon die spitzen Hörner im Licht des Feuers aufblitzen sah. Das zerfaserte Ende eines Seils schlug ihm ins Gesicht, als der Bulle hinaus in die Nacht floh.
Inzwischen war Mathéo schon wieder auf den Beinen. »Bleib beim Wagen!«, rief er Leon zu. Dann verschwand er im Stall, aus dem noch immer panisches Muhen und Blöken drang. Kurz darauf stürmten die Kühe des Bauern nach und nach heraus und hetzten in einem Tempo, das Leon den schwerfälligen Tieren niemals zugetraut hatte, auf die Weide.
Kurz darauf kam auch Mathéo aus dem Stall. Er stützte sich auf eine Mistforke und humpelte. Leon eilte zu ihm hinüber. »Was ist passiert?«
Der alte Bauer winkte ab. »Chloé hat mir in ihrer Panik einen Tritt verpasst, aber es ist halb so wild. Du hast da Blut im Gesicht.«
»Ja?« Leon wischte sich über die Wange. Er spürte keinen Schmerz und zuckte mit den Achseln. »Deine Kuh heißt Chloé?«
»Warum nicht? Das ist ein alter, ehrwürdiger Name«, erwiderte Mathéo.
»Ohne Zweifel«, sagte Leon und beobachtete nicht ohne Sorge das Humpeln des alten Mannes. »Soll ich dich zum Arzt fahren?«
Mathéo schüttelte den Kopf. »Ich will hier im Hof bleiben, falls noch etwas Unvorhergesehenes passiert.«
»Dann leiste ich dir Gesellschaft«, bot Leon an.
Der alte Bauer hinkte zurück zum Geländewagen und setzte sich auf die Stoßstange. Leon hockte sich neben ihn. Schwer atmend starrten sie in die Flammen.
»Danke für deine Hilfe.«
»Gern geschehen.«
Sie sahen schweigend zu, wie der Regen seine Arbeit verrichtete. Es war gut, dass der Wind nachließ und die Glut nicht noch zusätzlich anfachte. Zischend erloschen die Flammen nach und nach.
»Was ist mit deinen Schafen?«, erkundigte sich Leon.
»Die sind nachts ohnehin auf der Weide. Jacques kümmert sich um sie.« Jacques war der Border Collie des alten Mannes, ein erstaunlich intelligentes Tier.
Das Gewitter war weitergezogen.
Mathéo erhob sich ächzend. »Ich denke, nun besteht keine Gefahr mehr.« Nur noch an vereinzelten Stellen war ein rotes Glühen in dem rauchenden Stamm auszumachen.
»Soll ich mir deine Wunde einmal ansehen?«, fragte Leon.
»Nicht nötig.« Mathéo winkte ab. »Was hat dich eigentlich zu mir verschlagen?«
»Ach, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich wollte dich fragen, ob du uns etwas Benzin für unseren Generator verkaufen kannst.«
»Dafür bist du extra hergekommen?«
»Ja.«
»Na ja«, der alte Mann räusperte sich, »ich hab nur Diesel.«
Leon starrte ungläubig auf das verschmierte bärtige Gesicht seines Gegenübers. »Das ist jetzt nicht wahr, oder?«
Mathéo hob die Schultern. »Tut mir leid. Aber morgen früh haben wir sicherlich wieder Strom. Wir sind hier ja nicht in Kamtschatka.«
Leon verspürte ein merkwürdiges Kitzeln in seinem Zwerchfell. Es wanderte über Bauch und Lungen in seinen Kehlkopf und brach sich schließlich als albernes, gicksendes Gelächter Bahn.
Mathéo runzelte die Stirn, was nur zur Folge hatte, dass Leon noch hysterischer lachen musste. »Entschuldige, bitte«, keuchte er.
Mathéos Schnurrbart zuckte, und schließlich musste auch er lachen.
Als er sich einigermaßen beruhigt hatte, sagte Leon: »Okay, ich denke, das reicht jetzt.« Er wischte sich die Tränen aus den Augen und reichte Mathéo die Hand. »Brauchst du Hilfe beim Eintreiben des Viehs?«
»Nicht nötig, die Tiere kommen von allein zurück.« Er erwiderte den Händedruck fest. »Gute Nacht, mein Freund.«
»Gute Nacht.«
Während der Rückfahrt wurde Leon sein albernes Verhalten zunehmend peinlich. Er war froh, dass keiner seiner Studenten dabei gewesen war. Wenn ruchbar würde, dass er anfing, hysterisch zu werden, würde dies auch noch den letzten Rest der ihm verbliebenen wissenschaftlichen Autorität zu Grabe tragen.
Als er den Wagen schließlich am Ausgrabungsort abstellte, war es bereits nach zwei Uhr morgens. Er nahm die Taschenlampe aus dem Handschuhfach und stieg aus. Die Wohnwagen waren dunkel, keine Kerze brannte. Alles war still. Auf dem Weg zu seinem eigenen Camper stellte Leon fest, dass er viel zu aufgekratzt war, um jetzt schlafen zu können. Da konnte er genauso gut überprüfen, ob das Unwetter irgendwelchen Schaden angerichtet hatte. Er schlenderte hinüber zur Grabungsstelle. Zumindest die Gesamtkonstruktion hatte gehalten. Einer seiner Studenten war lange Jahre bei den Pfadfindern gewesen und hatte hier sehr solide Arbeit geleistet. In der Nähe der Grabungen am Burgfried war eine Plane gerissen. Wasser war eingedrungen und im sandigen Boden versickert. Ein paar Computerausdrucke waren vom nahen Tisch gefallen und vollkommen durchweicht. Als Leon sie aufhob, fielen sie auseinander. Aber das war kein Problem, alle Daten waren ja noch in der EDV. Gerade als er sich wieder erheben wollte, entdeckte er etwas, das ihn stutzig machte. Er beugte sich tiefer und beleuchtete den Boden. Vorsichtig strich er mit dem Finger über eine Vertiefung in der nassen Erde. Es war der Abdruck einer Pfote, ein ziemlich großer Abdruck. Er konnte unmöglich von einer Katze stammen. Leon erinnerte sich an den Hund, der vorhin an seinem Auto vorbeigehuscht war. Wenn das Tier sich so nah heranwagte, war es vielleicht krank und möglicherweise nicht ganz ungefährlich. Er richtete sich auf und machte sich in Gedanken eine Notiz, Mathéo bei nächster Gelegenheit nach streunenden Hunden in dieser Gegend zu fragen.
Bei seinem weiteren Rundgang entdeckte er keine weiteren nennenswerten Schäden. Wenigstens etwas, dachte er sich. Kein Erfolg, aber auch keine größeren Schäden. Seufzend betrachtete er die magere Ausbeute an Fundstücken auf dem Tisch. Sein Blick blieb an dem Lederkoffer hängen. Der Wissenschaftler ging näher und strich vorsichtig über den porösen Bezug. Die Messingnieten kitzelten unter seinen Fingerspitzen. Es war gute Arbeit und sicher nicht ganz billig gewesen. Der schwache Funke der Neugier fing an, kleine Flammen zu schlagen.
»Warum nicht?«, brummte Leon. Er nahm die Taschenlampe zwischen die Zähne und drückte mit den Daumen gegen die Verschlussknöpfe. Einer öffnete sich, aber der andere klemmte. Leon nahm eine kleine Flasche Silikonöl aus der Werkzeugtasche und arbeitete geduldig daran, den Verschluss wieder gangbar zu machen. Schließlich klickte es, und der Koffer ließ sich öffnen. Vorsichtig hob Leon den Deckel an, doch sogleich stieg ihm ein muffiger Geruch in die Nase. Der Koffer hatte vorgefertigte Fächer und war mit Samt ausgeschlagen gewesen – ein Schreibköfferchen? Der Stoff war in miserablem Zustand. Es befand sich nur ein in Wachstuch eingeschlagener Gegenstand darin. Leon schlug vorsichtig das ebenfalls porös gewordene Tuch beiseite. Ein Buch! In Leder gebunden und ohne Aufdruck. Und es verströmte einen leicht muffigen Geruch. Der Einband war sorgfältig gearbeitet worden, aber inzwischen porös und brüchig. Leon schlug behutsam die erste Seite auf, denn das Papier war klamm und gelb vom Alter.
Angélique Maria Pauline de Vantes
stand dort in geschwungener, kindlich anmutender Schönschrift. Er blätterte vorsichtig eine weitere Seite um.
Château de Chamilot, den 24. August 1784
Es war ein wunderbarer fünfzehnter Geburtstag, obwohl Vater in Nantes war. Mutter blieb nach dem Frühstück auf ihrem Zimmer. Sie ließ uns davon in Kenntnis setzen, dass sie unpässlich sei. Thérèse und ich waren jedoch nicht sonderlich enttäuscht darüber. So mussten wir Geschwister eben selbst die Planung des Tages in die Hand nehmen, und wir beschlossen, ans Meer zu fahren.
Victoire begleitete uns, obwohl sie genau genommen nur noch die Gouvernante von Thérèse ist.
Ich liebe das Meer. Nach der langen Kutschfahrt war es herrlich, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Thérèse und ich zogen uns die Schuhe aus, um wie zwei Fischweiber barfuß am Strand herumzutollen und uns von den kalten Wogen des Atlantiks die Zehen umspülen zu lassen. Victoire schimpfte sehr über unser Benehmen, bis der Wind ihr den Hut vom Kopf pustete und quer über den Strand jagte, und wir alle sehr lachen mussten. Jean-Louis wollte natürlich unbedingt den Kavalier spielen. Er schwang sich auf sein Pferd und galoppierte hinterher. Seit er sein Offizierspatent verliehen bekam, hält er sich bereits für einen großen Helden. Der Wind war allerdings geschickter als er und warf den Hut ins Wasser. Als Jean-Louis hinterherwollte, scheute sein kostbares andalusisches Vollblut und warf ihn fast aus dem Sattel. Thérèse musste so lachen, dass sie ein wenig ihre Unterwäsche beschmutzte, wie sie mir später verriet. Schließlich war es der treue Pierre, der die kostbare Kopfbedeckung aus den Fluten rettete.
Victoire allerdings meinte, der Stoff sei ganz verdorben, und wir mussten den Hut wegwerfen.
Wir blieben bis zum Abend. Jean-Louis hatte die großartige Idee, im Windschatten eines Felsens ein Feuer anzünden zu lassen, und wir saßen dort, bis die Sonne den Horizont rötete. Anfangs las Victoire ein paar Zeilen von Georges de Bièvre, und dann saßen wir einfach still beieinander, lauschten dem rhythmischen Brausen der Wellen und dem Schreien der Möwen.
Von Jean-Louis bekam ich einen sehr schönen Brieföffner mit Lilienornamenten am Griff geschenkt. Von Vater erhielt ich eine herrliche Kamee mit einem aus Elfenbein geschnitzten Bildnis der Porcia Catonis, der Ehefrau des Brutus. Thérèse schenkte mir dieses wunderbare Tagebuch. Es wird mich begleiten, wenn ich wieder zurück nach Saint-Georges fahre …
Leon runzelte die Stirn und blätterte behutsam weiter. Warum hatte jemand das Tagebuch einer Fünfzehnjährigen hier unten versteckt? Das machte keinen Sinn.
Er überflog die nächsten Seiten und stellte fest, dass Angélique de Vantes keine Vielschreiberin war. Sie hatte ihr Tagebuch nur sehr sporadisch genutzt und teilweise über mehrere Jahre hinweg gar nichts eingetragen. Als die Handschrift wieder einsetzte, war sie weitaus reifer, schlanker, drängender. Der Historiker blätterte weiter. Die Eintragungen endeten, noch ehe die Hälfte des Buches beschrieben war. Die letzte Seite war nur schwer zu entziffern. Die Zeilen waren verrutscht und gingen fast ineinander über. Die Buchstaben waren ungelenk, als habe jemand sie in fliegender Hast auf das Papier geworfen.
Sie kommen! Ich kann ihre Schritte hören, ihre groben Scherze und das Lachen …
Gefesselt wie einen gefährlichen Verbrecher werden sie mich vor das Tribunal führen. Dann wird der Schlächter vortreten und sein Urteil sprechen. Es steht jetzt schon fest.
Vielleicht wird man mich erschießen, wahrscheinlich aber werden sie mich auf eine dieser schrecklichen Barken führen und ersäufen. Die trüben Wasser der Loire werden sich über mir schließen, ein letzter vergeblicher Kampf um Luft und Leben wird einsetzen und dann? Ich habe Angst – schreckliche Angst!
Ihre Schritte sind nun ganz nah. Ich höre die Riegel, wie sie mit dumpfem Knallen zurückgeschoben werden.
Der Tod ist bereits hier. Er sitzt in meiner Zelle und sieht mich an mit Augen voller Schwärze. Ich spüre seine lauernde Kälte und das klebrige Gespinst seiner gestaltlosen Finger. Und wenn ich herumfahre, um zu schauen, wer nach mir greift, dann ist da nichts, nur dieses schreckliche grinsende Fragezeichen.
Oh Sacré-Cœur – heiligstes Herz Jesu –, hast du aufgehört zu schlagen? Bist du verstummt, als man dich auf Uniformen bannte? Ich kann dich nicht spüren. Dein Platz in mir ist finster und leer. Ist denn mein Glaube erstickt im schrecklichen Würgegriff der Furcht?
Sie holen alle! Ich höre das leise Flehen und das verzweifelte Schreien. Doch ich darf nicht in Furcht erstarren und nur an mich denken – sie dürfen diese Zeilen nicht finden …
Leon starrte auf die Worte. Ein Schauer lief über seinen Rücken. Es war, als wären die Empfindungen der Schreiberin in den Seiten des Buches gefangen gewesen, wo sie in der Dunkelheit ihres Verstecks mehr als zwei Jahrhunderte überdauert hatten, um nun herauszuströmen und in ihn einzudringen. Er glaubte fast, die Todesangst selbst spüren zu können, und ein Nachhall des Schreckens schien noch immer zwischen den Mauern widerzuhallen, die ihn umgaben.
Leon erhob sich und versuchte, die Beklommenheit abzuschütteln. Er stieg über die freigelegten Wände und betrachtete den Hohlraum, in dem sie den Koffer gefunden hatten. Anhand der verbliebenen Grundmauern konnte man erkennen, dass sich auf der einen Seite ein Gang und auf der anderen ein Raum von nicht mehr als eineinhalb mal zwei Metern befunden hatte. War das die Zelle gewesen, in der die junge Frau ihre letzten Stunden verbracht hatte?
Gedankenversunken betrachtete Leon die uralten Mauern. Dieses Tagebuch würde ihm bei seiner Forschung nicht weiterhelfen, so viel stand jetzt schon fest. Interessanterweise war ihm das aber in diesem Moment vollkommen gleichgültig. Seine eigenen Sorgen schienen ihm weit fort zu sein.
Er holte sich eine Flasche Rotwein und einen Becher aus dem Bauwagen, der ihnen als Küche diente. Dann lehnte er einen Spaten gegen den Tisch und hängte die Taschenlampe an den Griff, sodass er sie nicht die ganze Zeit halten musste. Nachdem er sich eingeschenkt hatte, blätterte er zurück und begann, in das Leben von Angélique Maria Pauline de Vantes einzutauchen.
Das vierte Gebot und ein Kissen
Das Licht tanzte flackernd und zögerlich auf den dunklen Sitzen, als frage es sich, ob der Aufwand sich lohne. Das Innere der rumpelnden Kutsche zu erleuchten war eine schwierige Aufgabe. Zuerst hatten die hohen Hecken an den schmalen, unwegsamen Pfaden die Lichtstrahlen abgefangen, nun waren es die uralten, dichten Wälder. Die Vendée war eine raue und unwirtliche Gegend.
Hier und da drang Vogelgesang durch das Stampfen der Hufe und das lästige Quietschen der Achsen. Der würzige Duft des Waldes mischte sich mit dem Geruch von Pferdeschweiß. Angélique stellte fest, dass die Welt nur in den seltensten Momenten vollkommen war. Sie hatte die Vorhänge beiseitegeschlagen und versuchte, jeden noch so zögerlichen Boten des Frühlings zu erhaschen. Noch immer schien die Kälte des Winters zwischen den moosbewachsenen Baumstämmen zu hocken. Aber als sie über eine Lichtung fuhren, ließen helle Sonnenstrahlen ihre Haut kribbeln, und Flecken blühender Buschwindröschen durchbrachen das düstere Braun des Waldbodens.
Sie war auf dem Weg nach Hause, eigentlich hätte sie sich freuen müssen. Aber ihre Stimmung schien ihr beinahe ein vollkommenes Abbild der Natur um sie herum zu sein. Sie war düster, und nur hier und da zeigte sich ein Lichtfleck. Es war nicht einfach gewesen, im Schatten des Château de Chamilot eine fröhliche Kindheit zu verleben. Und nun, wo sie kein Kind mehr war, wo Spiel und Fantasie keine bunten Schutzwälle um sie herum errichten konnten, war jede schöne Stunde in ihrem Elternhaus ein hart erkämpftes Gut. Wenigstens würde sie Thérèse wiedersehen, und das war tatsächlich ein Grund zur Vorfreude.
Angélique lehnte sich zurück auf die gepolsterte Bank und betrachtete müßig ihre Gepäckbündel. Sie hätte sich etwas zum Lesen mitnehmen sollen! Aber außer ihrem Tagebuch hatte sie nichts eingesteckt. Schwester Maria Martha wäre vermutlich erschüttert gewesen, wenn sie das gewusst hätte. Nicht nur, weil Angélique ihre Studien so sträflich vernachlässigte, sondern auch, weil sie etwas so Selbstbezogenes wie ein Tagebuch führte, das nicht einmal den Zweck hatte, der geistlichen Erbauung ihrer Mitmenschen zu dienen. Gewissermaßen aus Trotz gegenüber der alten Ordensschwester griff Angélique in ihr Gepäck und zog das kleine, in weiches Leder gebundene Buch hervor. Sie blätterte zu ihrem letzten Eintrag.
Saint-Georges, den 14. Februar 1785
Ich hatte mir so fest vorgenommen, regelmäßig in mein Tagebuch zu schreiben, und nun muss ich zu meiner Schmach feststellen, dass seit meinem ersten Eintrag ein halbes Jahr vergangen ist. Vielleicht sollte ich mein Tagebuch lieber Halbjahresbuch nennen?
Aber ich habe auch etwas zu meiner Entschuldigung vorzubringen: Ich bin einfach nicht für das Leben im Frauenstift geschaffen! Mutter Agnes scheint der Meinung zu sein, wenn sie uns nicht wenigstens die Weisheit eines Thomas von Aquin und die Frömmigkeit eines Franz von Assisi einbläue, würde sie ihre heiligen Pflichten als Äbtissin sträflich missachten. Ich habe nichts gegen Weisheit, aber die Stundengebete werden mich noch ins Grab bringen. Wie soll man mit wachem Geist lernen, wenn ständig der eigene Schlaf unterbrochen wird?
Heute schlief ich zur Virgil schon wieder ein. Jeanne-Catherine meinte, ich hätte so laut geschnarcht, dass die Lesung des 141. Psalms kaum zu verstehen gewesen sei. Ich halte das für eine Übertreibung, zumal sie kaum in der Lage gewesen sein dürfte, mich intensiv zu beobachten. Der Abdruck ihres Gebetsbuches war noch deutlich auf ihrer Stirn zu erkennen. Ich zweifle, dass es die Inbrunst ihres Gebets war, die ihn dorthin beförderte; vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass sie mit mir um die Wette schnarchte.
In der freien Studienzeit nach der Sext haben wir uns heimlich im leeren Scriptorium getroffen und eine Badinage getanzt. Ich glaube, dass ich nur mittelmäßig dazu begabt bin. Vielleicht lag es aber auch an Maries Flötenspiel. Sie stolpert durch die Takte wie ein betrunkener Dragoner durchs Wirtshaus. Aber wir hatten unseren Spaß, und außerdem wurde uns endlich wieder einmal ordentlich warm. Es ist ein bitterkalter Winter, und der Frost sitzt mir in allen Knochen. Ich freue mich so auf den Frühling.
Oh, es läutet zur Vesper, ich muss Schluss machen! Leb wohl, liebes Tagebuch. Ich hoffe, wir sehen uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder.
»Wir sind da, Comtesse.«
Angélique zuckte zusammen. Rasch steckte sie das Buch zurück in die Reisetasche und ließ sich aus der Kutsche helfen.
Der Burghof gab ihr das Gefühl, klein und völlig bedeutungslos zu sein. Die dunklen, steil aufragenden Mauern sahen gleichmütig auf sie herab. An der steinernen Treppe zum Hauptgebäude wartete bereits ein Bediensteter auf sie. Sie kannte seinen Namen nicht; er war augenscheinlich erst angestellt worden, nachdem Angélique ins Stift gekommen war. Er begrüßte sie mit einer Verbeugung und griff nach ihrem Gepäck. Dass Jean-Louis bei seinem Regiment war, wusste sie. Nun erfuhr sie, dass Thérèse irgendwelche Besorgungen machte und Vater in der Stadt war. Ihre Stimmung sank. Sie ließ ihr Gepäck aufs Zimmer bringen und stieg die Stufen zum Salon empor. Der weiche Teppich schluckte ihre Schritte. Die Stille war bedrückend. Angélique kam es so vor, als habe sie ein Mausoleum betreten.
Als sie die Tür zum Salon öffnete, erwartete sie dort bereits reglos wie eine Statue eine bleiche, hohlwangige Gestalt. Es dauerte einige lange Atemzüge, bevor sie in ihr die Mutter wiedererkannte. Deren Haar war bereits von grauen Strähnen durchzogen, und anfangs schien sie Angélique auch kaum wahrzunehmen. Nur langsam hob sie den Blick.
»Angélique Maria Pauline«, murmelte sie schließlich, nachdem sie ihre Tochter eine volle Minute lang angestarrt hatte.
Angélique hatte keine warmherzige Begrüßung erwartet, aber diese Reaktion brachte sie aus der Fassung. Nicht nur, weil es schien, als müsse sich ihre Mutter den Namen ihrer Tochter erst mühsam ins Gedächtnis rufen. Das ganze Auftreten ihrer Mutter, die sie mit stechendem Blick betrachtete, war befremdlich.
»Ich grüße Euch, Mutter.« Angélique schluckte trocken.
Das Glühen in den Augen wurde noch intensiver, und Angélique erkannte in einem eisigen Moment des Schreckens, dass nackte Abscheu in diesem Blick lag. Dann wandte ihre Mutter das bleiche Gesicht ab, ihre Lippen bewegten sich flüsternd.
»Ist … ist Euch nicht wohl?«, fragte Angélique.
Die Herrin von Chamilot hob die Brauen. Einige Atemzüge lang herrschte Schweigen. Dann trat sie ein paar Schritte zur Seite und legte die schlanken weißen Finger auf eine geschnitzte Stuhllehne. »Bist du treu in deinen Gebeten?«, wollte sie wissen.
Angélique starrte sie einen Moment mit offenem Mund an. Dann fasste sie sich und erwiderte: »Natürlich, Mutter.«
»Das ist gut«, entgegnete diese in einem Tonfall, der deutlich machte, dass sie starke Zweifel daran hegte. Ihre Hände legten sich fester um die Stuhllehne. »Denk immer daran: Das Fleisch ist schwach, du musst es töten! Denn der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge.«
Angélique schluckte. Das Glühen in den Augen ihrer Mutter machte ihr Angst. Sie nickte stumm, während irgendwo in ihrem Hinterkopf eine Stimme, die verdächtig nach der Schwester Maria Marthas klang, sie darauf hinwies, dass hier gleich drei Bibelstellen völlig aus dem Zusammenhang gerissen und vermischt worden waren.
»Vermutlich wird … dein Vater uns heute Abend mit seiner Anwesenheit beehren. Wasch dir den Staub aus dem Gesicht und sei pünktlich zum Abendessen.«
»Ja, Mutter.«
Die bleiche Gestalt löste sich abrupt vom Stuhl und wandte sich zum Gehen. Auf dem Weg zur Tür schien sie ihre Tochter bereits vergessen zu haben. Sie murmelte leise etwas vor sich hin. Angélique verstand nicht jedes Wort, aber die Worte klangen wie: »… verfluchten Augen. Selbst im Gesicht dieses Kindes … sie verfolgen mich.«
Angélique blickte ihr nach, unfähig, sich zu rühren. Die Luft schien mit einem Mal zu dünn zum Atmen. Kühle und Gleichgültigkeit war sie gewohnt, aber dieser kaum verhohlene Hass schnürte ihr förmlich die Kehle zu.
Schließlich riss die Ankunft von Thérèse sie aus ihren Gedanken. Ihre jüngere Schwester lächelte, aber dann zeigte sich Besorgnis auf ihrem Gesicht. »Was ist? Was hast du?«
Angélique schloss Thérèse in die Arme und drückte sie fest an sich. »Ich bin so froh, dich zu sehen.«
»Ich freu mich auch«, keuchte diese. »Allerdings würde ich auch gerne wieder atmen.«
»Entschuldige.« Angélique lockerte ihren Griff, und ihre Schwester löste sich ein wenig von ihr. »Ich bin Mutter begegnet.«
»Ich verstehe.« Thérèse nagte an der Unterlippe. »Es wird von Woche zu Woche schlimmer.«
»Ich hatte den Eindruck, dass sie kaum bei Sinnen zu sein schien. Ist sie krank?«
Thérèse zuckte die Achseln. »Wenn du Hass und Bitterkeit eine Krankheit nennen willst.« Sie zeigte ein humorloses Lächeln, das zu alt für ihr mädchenhaftes Gesicht war. »Ich kenne keinen Arzt, der so etwas heilen könnte. Eigentlich sollte die Religion hilfreich sein – aber mir scheint, je mehr sie von diesem Heilmittel schluckt, desto ärger wird es. Sie hat schon ganz wunde Finger vom Rosenkranz, und ständig ist dieser Pfaffe da.«
Die letzten Worte hatte sie mit einer solchen Verachtung hervorgestoßen, dass Angélique ihre kleine Schwester kaum wiedererkannte. Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete Thérèse mit neuen Augen. Sie war schlank geworden, ihr Gesicht hatte die kindliche Fülle verloren; und sie war dabei, zu einer schönen jungen Frau zu erblühen. Aber Angélique vermisste die Unbekümmertheit in ihren Augen.
»Wollen wir ein wenig spazieren gehen?«, fragte sie.
Thérèse schüttelte den Kopf. »Jetzt nicht! Du bist nach der langen Reise sicher müde. Geh doch auf dein Zimmer, und ruh dich aus. Wir werden später reden.«
Der Nachmittag kroch träge dahin. Die Zeit der Vesper rückte heran. Instinktiv suchte Angélique Trost in den vertrauten Gebeten, aber ihr Geist blieb ruhelos. Von welchem Pfaffen hatte Thérèse gesprochen? Was ging nur vor in diesem Haus?
Irgendwann läutete es zum Abendessen. Sie saßen bereits zu Tisch, als Angéliques Vater zu ihnen stieß. Er begrüßte sie freudig, aber schon bald wirkte sein Lächeln angespannt, und die Unterhaltung stockte.
Nach einer Vorsuppe gab es gedünstete Lammfilets in einem Bett aus pürierten Erbsen und sehr kunstvoll dekorierte Gratins. Angélique bekam kaum einen Bissen davon herunter. Ihre Mutter löffelte ein winziges Schälchen Haferschleim, angeblich der Gesundheit wegen. Die Art und Weise, mit der sie die auserlesenen Speisen auf den anderen Tellern begutachtete, machte jedoch deutlich, dass es ihr in Wahrheit darum ging, aller Fleischeslust mit Verachtung zu begegnen – und sei es der harmlose Genuss einer Mahlzeit. Zumindest Angélique verdarb sie damit erfolgreich den Appetit. Ihr Vater und ihre Schwester hingegen schienen gegen diese Blicke bereits immun zu sein, oder zumindest kämpften sie tapfer dagegen an. Falten um seine Augen zeugten von Anspannung, als der Vater sich Wein nachschenken ließ. Und Thérèse verlangte eher verbissen als hungrig nach einer zweiten Portion.
»Wie ich hörte, hat uns der Abt von Saint-Christophe erneut beehrt.« Der Vater lächelte, und seine Stimme klang ruhig, als er das Gespräch eröffnete.
Die Mutter nahm einen Schluck Wasser und löffelte ungerührt ihren Haferschleim. Es schien, als habe sie die Worte gar nicht vernommen.
Der Porzellanteller gab ein hässliches Kreischen von sich, als der Vater sein Filet zerschnitt. »Ich habe Euch eine Frage gestellt!«
»Ach ja? Ich habe keine Frage vernommen. Es schien mir lediglich eine Bemerkung zu sein.«
»War er hier?«
»Victor Barrère kümmert sich aufopferungsvoll um die Mitglieder seiner Gemeinde«, entgegnete Mutter.
»Der Abt kümmert sich vor allem aufopferungsvoll um die Ausdehnung seiner Macht«, erwiderte der Vater. »Insofern erfüllt es mich durchaus mit Sorge, ihn so häufig in meinem Haus zu wissen.«
»In Eurem Haus?«, fragte Mutter sanft.
Des Vaters Wangen röteten sich. Er war das Haupt der Familie, also war dies inzwischen auch sein Haus. Aber in den Augen seiner Frau hatte er es ihren Ahnen gestohlen, als er sie heiratete.
»Ich frage mich, was es so viel zu bereden gibt«, sagte er mit kalter Stimme. »Da ich ja mit einer Beinahe-Heiligen den Bund der Ehe eingegangen bin, kann es nicht die Beichte sein, die solch immense Zeit in Anspruch nimmt.«
»Ihr redet von Dingen, die Ihr nicht versteht!«