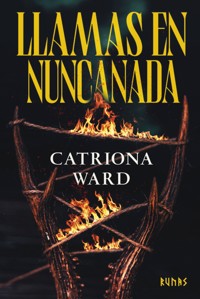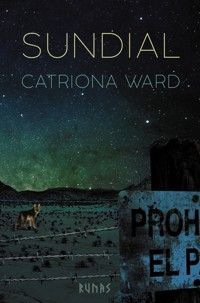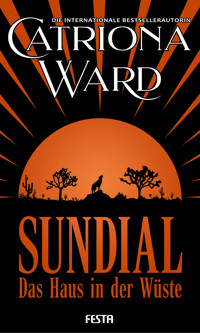7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit Generationen sucht ein Fluch die Familie heim, der die Villarcas jung und unter mysteriösen Umständen sterben lässt. 1910. Iris und ihr Vater sind die letzten der Villarca-Linie. Weil Iris an einer vererbten Krankheit leidet, leben sie streng isoliert in Rawblood, einem einsamen Haus im Dartmoor. Denn sollte eine Villarca lieben, sollte sie ein Kind erwarten – wird sie erscheinen. Sie ist bleich und mit Narben übersät. Und sie bringt den Tod. Doch Iris will sich nicht länger vor der Welt verstecken. Sie wagt es sogar, sich zu verlieben. Und nun offenbart sich der wahre Schrecken des Villarca-Fluchs … Dieser experimentelle Gothic-Roman der Bestsellerautorin von Das letzte Haus in der Needless Street erinnert an die großen Meister des Unheimlichen und gewann zahlreiche Preise, darunter den British Fantasy Award. Perfekt für Fans von Shirley Jackson, Susan Hill und Laura Purcell. Adam Nevill: »Ein wichtiger Beitrag zur britischen Literatur des Fantastischen ... Diese unheimliche und ergreifende Geschichte, die Generationen umspannt, hat einen Hauch von Ted Hughes, Emily Brontë und M. R. James.« Simone St. James: »Voller Zauber, der sowohl erschreckt als auch fesselt. Mit jeder Schicht, um die das Geheimnis gelüftet wird, kommt eine weitere erschütternde Wahrheit ans Licht. Diese Gothic-Geschichte über Angst, Familie, Herkunft und Liebe lässt den Leser atemlos zurück.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Englischen von Heiner Eden
Impressum
Die englische Originalausgabe Rawblood
erschien 2015 im Verlag Weidenfeld & Nicolson.
Copyright © 2015 by Catriona Ward
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Joern Rauser
Titelbild: Mihai Costea
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-165-3
www.Festa-Verlag.de
Für meine Eltern
Isabelle und Christopher
Iris
1910
So kommt es dazu, dass ich meinen Vater töte. So fängt es an.
Ich bin elf. Wir finden die Stute kurz nach dem Mittag. Lange kann sie noch nicht da sein; die Füchse sind noch nicht gekommen. Die Fliegen dafür schon. Sie glänzt und ist prall.
»Warum?«, frage ich.
Toms knochige Schultern heben sich gleichgültig. Manchmal sterben Dinge einfach. Das hat er genau begriffen. In den letzten paar Monaten.
Die Mähne der Stute liegt schwarz auf dem ausgedörrten Rasen. Kniend strecke ich einen Finger nach ihr aus. Er zieht mich von dem Kadaver weg. Ich erwarte einen Rüffel, doch er sagt nur: »Da.«
Ich sehe es nicht, und dann sehe ich es doch, in einem Gestrüpp aus Farn, zehn Schritte weiter. Klein und dunkel in den grünen Schatten. Ein Neugeborenes.
»Was wirst du tun?«, frage ich.
Er fährt sich mit der Hand durch sein Haar.
»Sei kein Plagegeist, Iris. Was soll ich denn deiner Ansicht nach machen?«
Das tut weh. »Ich bin kein Plagegeist«, antworte ich. »Ich versuche bloß zu helfen.«
Er schubst mich sanft. »Plagegeist.« Seit dem Tod seiner Mutter im März ist Toms Stimme ohne Klang.
Wir sehen zu, wie sich das Fohlen hinlegt und den Kopf einzieht. Es seufzt. Seine dünne, flauschige Flanke hebt sich. Das Fell ist an manchen Stellen noch immer glitschig. Es ist zu klein, um zu leben, doch wie es scheint, weiß es das nicht.
»Wir könnten es füttern«, schlage ich vor.
Er wirft mir einen Blick zu, der sagt, dass ich in einem großen Haus wohne, in dem die Böden mit Bienenwachs gebohnert und die Decken hoch sind, wo die Luft in einer weißen Stille emporsteigt und die Laken mit Lavendel und Teerose parfümiert werden. Morgens esse ich Haferbrei mit Rahm und trinke Milch aus meinem Silberkrug, wenn ich lieb bin. Toms Knie stoßen durch die verschlissenen Flicken seiner Hose. Er wohnt mit seinem stillen Vater in dem zugigen Gehöft mit dem löchrigen Dach. Jeden Morgen ist er auf den Feldern, noch bevor die Sonne aufgeht. Es gibt kein wir.
Ich krümme mich. Meine Stiefel sind eng, meine Füße so blutleer wie das Fleisch eines ausgenommenen Fisches. Ich habe meine Strümpfe irgendwo an den Berghängen des Bell Tor ausgezogen. Unter meinem Rock sind meine bloßen Beine vom Ginster zerkratzt und von feinen Blutperlen überzogen.
»Hat noch nie geklappt«, ruft er schließlich. »Sie nehmen’s einfach nicht. Oder sie werden davon krank. In der Kuhmilch muss etwas sein, das sie nicht vertragen.«
»Ich möchte aber nicht, dass es stirbt.«
»Du bist ein Mädchen. Du verstehst das nicht.«
Und so weiß ich, dass auch er nicht möchte, dass es stirbt.
In einem Märzsturm trat Charlotte Gilmore auf eine Falte ihres Rocks. Jeden Tag sehe ich, wie sich dieser Moment in Toms Augen widerspiegelt: die kalte Luft, die ihr ins Gesicht schlägt, als sie die 20 Stufen der Treppe hinunterstürzt; ihr Kleid, das sich wie eine abgeworfene Blüte aufbauscht; der Donner, der das Geräusch übertüncht, als ihr Genick bricht.
»Komm jetzt.« Immer wenn er verärgert ist, klappert seine Stimme wie eine schlecht sitzende Schublade.
Unsere langen Schatten gleiten über das Gras. Suchend hebt das Fohlen den Kopf. Tom packt es. Es krümmt und windet sich und tritt mit seinen kleinen Hufen nach ihm. Tom hebt das Fohlen über seine Schulter und legt es dort ab. Die schmächtigen Vorderbeine und Hinterbeine stecken fest in seinen Fäusten. Der kleine buschige Schweif schlägt empört um sich. So gehen sie los, zurück zur Farm.
»Sie werden dich schon vermissen«, ruft er mir über seine Schulter hinweg zu. »Geh jetzt lieber nach Hause. Plagegeist«, fügt er noch hinzu.
»Warte«, sage ich. »Warte!« Ich renne auf festen Füßen hinter ihm her.
Henry Gilmore lehnt an dem Gatter zur Farm. Sein Blick ist groß und von nichts erfüllt. Tom steht aufrecht vor seinem Vater. Auf seiner Schulter zuckt das Fohlen mit seinen kleinen Ohren. Noch einmal stellt Tom die Frage.
»Maisie hat ihr Fohlen vor zwei Tagen abgestillt«, antwortet Henry Gilmore. Seine Worte kommen langsam. Er wirft Tom seinen zurückweichenden Blick zu. Früher mal hat er einem noch geradewegs in die Augen geblickt. Jetzt nicht mehr. Er hat seinen Blick vor vier Monaten im Grab von Toms Mutter zurückgelassen.
»Wird sie …« Tom zögert.
Henry Gilmore zuckt die Schultern. »Kann schon sein. Lass sie zufrieden. Wenn sie es nicht mag. Lass sie tun, was sie tut.«
Er streckt seine Hand nach dem Maul des Fohlens aus. Die Nüstern des Tieres zittern, reiben sich an seiner Haut, riechen seine Trauer.
»Es wird sowieso sterben«, meint er. »Ist besser, wenn’s schnell passiert.«
»Vielleicht aber auch nicht«, antwortet Tom. Die Luft zwischen ihnen wird dick.
»Aus dir wird kein Farmer.« Mit einer gedankenverlorenen Hand berührt Henry Gilmore die Schulter seines Sohns. Er lässt uns allein und verschwindet durch das Gatter ins Blau. Tom, das Fohlen und ich sehen ihm hinterher. Mit jedem Schritt lässt ihn die Entfernung kleiner werden und schmälert seine Gestalt zu einem dunklen Strich, der über die Knochen des Hügels kriecht.
Aus dem Stall lugt Maisie durch eine Stirnlocke, die die Farbe von schmutzigem Schnee hat. Ein Gewirr aus Lehmklumpen klebt an ihrem Unterleib. Sie hebt ihre breiten Lippen in unsere Richtung und zeigt uns ihre buttergelben Zähne.
»Du gehst da nicht rein«, bestimmt Tom. »Hast du das verstanden, Plagegeist? Ganz egal was passiert.«
Über seinem Auge zuckt es. Eine Augenbraue stottert vor Kummer. Das Maul des Fohlens streicht ihm über die Wange. Tom packt seine klebrigen Beine noch fester.
»Du musst es festhalten«, ordnet er an. »Kannst du das? Wenn du … Ja, so.« Ein Getrappel aus kleinen Hufen, und das Fohlen kreischt wie eine Katze. Schließlich schmiegt es sich in meinen Arm. Sein pochendes Herz, die dünnen, jungen Knochen.
Tom sagt: »Wir müssen dafür sorgen, dass sie gleich riechen.«
Aneinandergedrängt zittern das Fohlen und ich unter der Sonne. Ich kann nicht sehen, wohin Tom gegangen ist. Seine Stiefel knacken auf dem trockenen Boden, dann folgt ein vielschichtiges Rätsel aus Holz, Metall, Riegeln, Schlössern und Türen. Er ist schnell zurück.
»Das sollte reichen.«
Die Blechdose wirkt gedrungen und dickleibig. Er stemmt den Deckel mit seinem Messer auf und schiebt seine Hand hinein. Heraus kommt eine glänzende, in Melasse getünchte Pranke. Dunkel funkelnde Fäden. Damit schmiert er den Kopf und den Widerrist des Fohlens ein. Dann trägt er das Zeug auf dessen Hinterbeine auf, streicht es über die bebenden Flanken und den Bauch. Als er damit fertig ist, sind meine Arme schraffiert, als wären Schnecken über sie hinweggekrochen.
»Sie wird ihm nicht wehtun«, erklärt Tom. Seine Hand krault den Kiefer des Fohlens. Es schließt seine Augen. Lange Wimpern an rußigen Augenlidern.
»Wird sie nicht«, wiederholt er, aber damit meint er nicht mich.
Drüben an der Stalltür schüttelt Maisie ihren riesigen Kopf, blinzelt verschämt und hebt ihre gummiartige Lippe.
»Nein«, bestätige ich. »Das wird sie nicht. Gute Maisie.«
Die äußere Erscheinung des Zugpferdes ist überwältigend. Maisies Flanken kräuseln sich wie ein ruhiges Meer. Tom sieht sie an. Seine Augen zeigen die blaue, von Weiß umgebene Iris.
»Bringt jetzt nichts zu warten«, sagt er zu sich selbst oder zu mir. Maisie begegnet seiner klebrigen Hand mit aufgeblähten Nüstern. »Jup«, sagt er zu ihr. »Das alles. Bald.« Er schlüpft in den Stall und schiebt den Riegel vor. Seine Hände bewegen sich hin und her zwischen dem Licht und der nach Stroh duftenden Finsternis. Sie bedecken Maisies Kopf und Maul mit der Melasse. Rückwärts arbeitet er sich an ihrer gewaltigen Skulptur entlang, hinein in die Dunkelheit, bis er nicht mehr zu sehen ist. Sie bleibt stehen, folgt ihm und der glasigen braunen Spur aber mit dem Kopf.
Ich hebe das Fohlen hoch. Wie ein Sack liegt es in meinem Arm. Es hat sich aufgegeben. Seine Hufe sind kaum größer als Shillings. Das dumpfe Pochen seines Herzens an meinem Handgelenk. Es riecht scharf nach frisch zertretenen Nesseln.
»Wird es ihm gut gehen?«
Tom sagt nichts. Ich trage das Fohlen zur Stalltür. Es ist still und bleiern. Er greift nach dem Tier und nimmt es durch den Spalt mit in die Dunkelheit. Dann kommt er heraus. Er blinzelt in dem plötzlichen, honigfarbenen Licht des Tages. Seine dunklen Augenbrauen beben. Ich lege meine Fingerspitzen an mein Handgelenk. Das Fleisch dort hält noch immer die Erinnerung an den Herzschlag des Fohlens, verflochten mit meinem eigenen. Schweigend warten wir.
»Ich kann’s nicht«, gesteht Tom.
Also sehe ich nach.
In dem schwachen Licht zeichnen Maisies Nüstern die Umrisse des Fohlenkörpers nach. Sie leckt die Melasse von seinem Maul und seinen Augen. Ihre Zunge wischt eine breite Fahne über seine gesamte Länge. Das Fohlen maunzt eine hohe Klage. Maisie schiebt ihre Nase unter seinen Bauch und drückt es damit in die Höhe. Ihr behäbiger Kopf ist genauso lang wie sein Körper, ein Gebilde aus Zähnen und Knochen. Das Fohlen streckt sich. Sein Hals reckt sich mehr, als es ihm möglich ist, in einer anmutigen Linie nach oben. Es reicht aber nicht. Wieder macht es das hohe Geräusch. Maisie beugt die Beine und lässt sich seufzend auf dem Stroh nieder. Ihre Augen schließen sich. Das Fohlen saugt; eine kleine, entschlossene Gestalt an ihrem kolossalen Leib. Der Schweif bewegt sich hin und her. Maisie atmet. Spreu wirbelt in dem schräg einfallenden Licht empor.
»Es geht ihm gut«, stelle ich fest. Doch ich bekomme keine Antwort.
Toms Lippen bewegen sich lautlos. Ich stupse einen Finger in seine Rippen. Ich lege meine klamme Hand um sein dünnes braunes Handgelenk. Tom reißt seine Hände von den Ohren, auf die er sie gepresst hat, bis es wehtat. Er geht zur Stalltür.
»Gut«, sagt er hastig. »Gut. Oh, und gut gemacht, Plagegeist.«
»Nenn mich nicht mehr Plagegeist«, antworte ich. »Das mag ich nicht.«
»Ich weiß«, gibt er zurück. »Tut mir leid. Ich meine es nicht so, Iris. Du bist kein Plagegeist. Es ist nur … Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, als die Hunde deine Ratte erwischt haben?«
Trauer überkommt mich, und dann auch noch heißer Zorn.
Tom nickt. »So fühle ich mich jetzt die ganze Zeit«, erklärt er. »Jeden Tag.«
Ich denke darüber nach. »Also gut«, sage ich. »Du kannst mich nennen, wie du willst. Es macht mir nichts aus.«
Zum ersten Mal seit seine Mutter gestorben ist, nimmt Tom meine Hand in seine. Wir sehen der Stute und dem Fohlen zu. Bienen summen in dem vergehenden Nachmittag. Geräusche strömen in den Tag zurück.
»Komm jetzt«, sagt Tom schließlich. »Ab nach Hause mit dir.«
»Nein.« Ich bin noch nicht bereit, Papa gegenüberzutreten.
»Wir kriegen Ärger, wenn du nicht gehst.«
Den kriege ich sowieso, aber das sage ich ihm nicht. »Ich kenne den Weg nach Hause nicht«, bemerke ich triumphierend.
»Das sagst du immer.«
»Bestimmt lande ich in Belgien.«
»Ist ja schon gut, ich begleite dich«, sagt er genau so, wie ich wusste, dass er es sagen würde. »Zurück zum Haus des plagenden Plagegeists!«
»So heißt es nicht.« Ich springe ihn an und bearbeite ihn mit meinen Fäusten. »Und ich heiße auch nicht so!«
»Ich dachte, es macht dir nichts mehr aus!«, ruft er durch meine Hiebe. »Plagegeist! Autsch, nein, Beißen gilt nicht, Plagegeist!« Fröhlich rollen wir über den staubigen Hof.
Ich schlüpfe durch die Hecke. Meine Augen tränen von dem Sonnenlicht und von der Brise. Aber zwischen den Eibenwänden herrscht Stille. Der Geruch von Lavendel hängt in der Luft.
Auf dem Grün träumt mein Vater. Graue und dunkelrote Wolken säumen ihn in seinem schwarzen Anzug. Auf dem Tisch neben ihm liegt aufgeschlagen ein modriges Buch mit ausgefranstem Rücken. Daneben steht ein limettengrüner Krug, in dem glasklares Wasser funkelt. Neben dem Krug liegt ein Beutel aus weichem Leder halb geöffnet auf dem warmen Holz. Darin sehe ich Metall schimmern, scharf und einladend. Ich wende den Blick ab. Ich darf mich dem Beutel meines Vaters nicht nähern und ihn schon gar nicht berühren. Das ist eine der Regeln. Hinter ihm erhebt sich das Haus warm und grau.
Rawblood. Zuhause. Es klingt wie eine Schlacht, wie tiefe Trauer, doch eigentlich ist es eher ein freundlicher Name. ›Raw‹ kommt von ›Sraw‹, was ›fließen‹ bedeutet, denn der Dart River fließt ganz in der Nähe. ›Blood‹ kommt von ›Bont‹, das ist eine Brücke. Alte Worte. Das Haus an der Brücke über dem fließenden Wasser. Es gehört schon seit ewigen Zeiten meiner Familie. Rawblood, das sind wir, und wir, die Villacars, sind Rawblood.
Es ist ein aufgeblähtes, unansehnliches Ding. In unregelmäßigen Abständen ragen an seinen Seiten Fenster hervor. Das warme Schieferdach leuchtet in verrückten Winkeln purpurfarben im Sonnenlicht. Es ist alt, und jeder, der hier gelebt hat, hat einmal etwas daran angebaut oder wieder etwas davon weggenommen. Genau wie sein Name hat es sich im Laufe der Zeit verändert. Doch das Haus besitzt so etwas wie einen eigenen Willen. Es hat sich in aller Stille und ohne viel Aufhebens seine U-Form erhalten. Wenn ich versuche, an Rawblood zu denken, es mit Worten zu zeichnen, erscheint nur ein dämpfendes Weiß vor mir. Ich kann es nicht besser beschreiben, als ich meine eigenen Knochen oder meine Augen beschreiben kann. Es ist einfach da. Wie eine Erblindung steht es ständig im Vordergrund von allem.
Dies sind ein paar der ersten Dinge, soweit ich mich erinnere, die mir mein Vater beigebracht hat: dass ich mich ruhig verhalten soll und mich nicht unter Mengen von Leuten mischen oder Städte besuchen darf, wegen der Krankheit; und dass Rawblood in uns geschrieben steht. Manchmal glaube ich, dass Tom von dieser Krankheit weiß. Manchmal sieht er mich auch so an, als wüsste er etwas. Vielleicht könnte ich ihm sogar davon erzählen und er würde trotzdem mein Freund bleiben. Aber ich habe keine Lust, es auszuprobieren.
Ich trete an meinen Vater heran, um ihm beim Schlafen zuzusehen. Sein Kopf nickt zu einer inneren Musik. Seine Augenlider zittern. Ich bin nahe genug, um zu sehen, wie die Sonne jedes silbergraue Barthaar wie einen Faden aus Stahl hervorhebt.
In der Luft zwischen uns entfaltet sich eine Hand. Sie greift meinen Unterarm und zieht mich heran. Sie kommt so schnell und geschmeidig wie die Peitsche aus Baumtrieb.
»Was habe ich erwischt?«, murmelt er, die Augen noch immer versteckt. »Was kann es sein? Ein Löwe?« Er spannt seine langen Finger an, und ich kreische und sage: »Nein, nein, ich bin kein Löwe.«
»Ich glaube es aber nicht. Du musst ein Löwe sein. Immerhin bin ich ein berühmter Löwenfänger.«
Wie zur Schau betastet er meinen Arm, sucht nach Tatzen, sucht nach Krallen. »Na gut. Kein Löwe. Wie wär’s damit?« Er summt. »Dann eben ein Dachs. Ein gestreifter, dickschnäuziger Dachs.«
»Nein!«
»Ein Fisch. Ein entzückender silbriger Fisch für mein Abendessen.« Seine Finger gleiten über meine Rippen, so schnell wie über ein Akkordeon, und vor lauter Lachen bekomme ich kaum Luft.
»Ein Mensch, ich bin ein Mensch!«
Er öffnet die Augen. »Das bist du offenbar. Na gut, dann werde ich dich wohl gehen lassen müssen.«
Doch er lässt mich nicht gehen. Er betrachtet mich eingehend von oben bis unten. Ich hatte nicht daran gedacht, wie ich aussehe. Ich bin mit Melasse, Pferdehaaren und Dreck bedeckt. Mein Pinafore-Kleid ist mit Grün und Schwarz überzogen. Der Wind hat meine Haare zu Wuscheln und Hörnern zerzaust.
Mein Vater sagt: »Ist das etwa … Pferd, wonach du riechst? Was hast du getan, Iris? Wo bist du gewesen?«
Ich wurde erwischt. Also erzähle ich alles. Von dem Fohlen, von Maisie, von der Farm, von hinten nach vorn, mit Worten, die übereinanderstolpern.
Er tunkt sein Taschentuch in den Wasserkrug und wischt mit dem kühlen feuchten Stoff sanft über meine Arme. Der Ring an seinem Finger glitzert rot und weiß und golden. Die Abdrücke seiner Finger prangen wie weiße Geister an meinem Handgelenk.
»Gilmores Junge, der kein Farmer ist«, sagt er. »Iris.«
Ich warte. Die Haare auf meinen Armen stehen stramm.
Er sagt: »Gilmore kommt nicht zurande. Nein. Überhaupt nicht.« Er nimmt mein Kinn in den weißen Flügel seiner Hand und schaut. Seine großen Augen leuchten wie lasiertes Holz. Jetzt wird er mir gleich sagen, dass ich es nicht darf. Er wird erklären, dass ich es wegen der Regeln nicht darf … Ich kann das aber nicht ertragen. Der Lavendel hängt wie Ruß in der Luft und in meiner Lunge. Wenn Papa und ich streiten, dann immer wegen Tom.
»Sag bitte nicht, dass ich ihn nicht zum Freund haben darf«, bitte ich ihn.
»Doch, genau das sage ich, aber offensichtlich hat es keine Wirkung«, erwidert er. »Du bist unbedacht und du wirst erwachsen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dich einsperren? Wir können darüber nicht unterschiedlicherer Meinung sein, nein …« Das Taschentuch fällt auf den Tisch. Ich fühle mich so jung, klamm und sauber. Ich löse mich aus seinem Griff und setze mich neben ihn auf den Rasen.
Mein Vater rügt mich nicht und sagt auch nichts zu meinem Kleid. Wieder legt er seine Hand an meinen Kopf, sanft und gutmütig. Sie streichelt mich und zupft behutsam Farn und Stroh und Kletten aus meinem rebellierenden Haar. »Schmuddelkind«, sagt er zu sich selbst. Das weiche Gras kitzelt mich an meinen strumpflosen Waden. Ganz in der Nähe zanken sich Spatzen im Rhododendron. Vor der im Schatten liegenden Hecke durchbricht ein einziges Gänseblümchen das makellose Grün des Rasens. Morgen wird es verschwunden sein.
Ich hebe das auseinanderfallende Buch auf. Eigentlich ist es ein Kassenbuch, eines, wie ich es schon mal für die Haushaltskonten gesehen habe. In meinen Händen klappt es auf. Ein scharfer Geruch steigt aus seinen zerfledderten Seiten empor. Sie sind nasskalt und fühlen sich fettig an. Verblasste, handgeschriebene Zeilen. Sie beunruhigt mich nicht; die Tatsache ist so schlicht, dass ich vielleicht schon verdammt bin. Andere Dinge suchen mich in meinen Träumen heim. Ein kleiner Segen, einem Dämon ausgehändigt.
»Was soll das heißen?«, frage ich.
Papas Finger trommeln auf dem Papier, ein leiser Zapfenstreich. Er sagt: »Höchst ungeeignet.« Er nimmt das Buch und legt es von mir weg auf den Tisch. Etwas daran wirkt beängstigend. Ich wische mir die Finger an meinem Kleid ab.
Mein Vater sagt: »Also.«
Ich blicke auf, fragend. Vor der Sonne ist er ein Riese.
»Wenn er gut mit Pferden kann, dann ist es beschlossen. Wir brauchen noch einen Stallburschen; Shakes wird auch nicht jünger. Wir werden den jungen Nichtfarmer nehmen. Und«, seine Hand legt sich um meinen Nacken, »Millers Wolfshund hat sechs Welpen. Ich werde am Morgen mit dir hingehen, damit du dir einen davon aussuchen kannst. Er wird am Fuß deines Bettes schlafen. Wie gefällt dir das?«
Sanfte Finger in meinem Haar. Unaufmerksam, sonnenbenebelt, die Worte wollen sich zuerst nicht zu einem Sinn verbinden. Warum würde Tom am Fuß meines Bettes schlafen? Dann verstehe ich. Ich reibe mit der Hand über meine Augen, über das Gras.
»Nein«, antworte ich.
»Nein?«, fragt er. »Ich habe dir zwei Geschenke gemacht, und alles, was du mir daraufhin sagst, ist ein Nein?«
»Danke schön, Papa. Ich möchte die Geschenke nicht.« Ich weiß, das wird alles durcheinanderbringen, auch wenn die Gründe dafür gerade so weit entfernt sind, dass ich sie nicht zu fassen bekomme.
Milde betrachtet er mich. »Iris, ich bin von dir überrascht. Es wird dem Jungen guttun, und die Gilmores haben Mäuler zu stopfen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Aber du musst den Welpen nicht nehmen, wenn du nicht möchtest.«
»Er ist mein Freund«, erkläre ich.
»Und jetzt ist er dein Stallbursche«, hält Papa dagegen. »Und als solchen wirst du ihn behandeln.«
»Ja«, antworte ich ihm, denn das ist es, was man zu Papa sagt. Ich bin benommen, in meinen Ohren klingelt es. »Aber dann habe ich ja niemanden. Es wird schwer sein, mich daran zu erinnern, dass wir keine Freunde mehr sind …«
»Du wirst dich schon daran gewöhnen«, erwidert er. »Wir sind so anpassungsfähig wie Tiere. Wenn du ihn erst ein paarmal ›Gilmore‹ gerufen hast, wird es dir ganz natürlich erscheinen. Und wenn er erst mal ein Jahr lang oder so dein Stallbursche gewesen ist, dann wirst du dich nicht erinnern, dass er jemals etwas anderes war.«
»Papa …«
»Du bist ungehorsam, Iris, und du zwingst mich zu handeln. Du bist nie still, und du bleibst weder unter meinem Dach noch unter meinem wachsamen Auge. Du forderst die Krankheit heraus und hältst dich nicht an die Regeln.« Seine Hand streicht über die weiche Ledertasche. Seine Augen haben die mittlere Entfernung gefunden.
Ich stehe auf, um Papa allein zu lassen, warm und fest auf der Bank, das silbergraue Haupt schon nickend. Ich weiß um meine Liebe für ihn. Aber von meinem Hass bin ich überrascht. Er kommt wie ein Splitter aus einer weichen Holzmaserung.
Horror autotoxicus. Die Krankheit. Papa sagt es nicht, doch ich denke, dass sie uns tötet, die Villarcas, und dass wir deshalb die letzten beiden sind.
1908
Ich lerne Tom an dem Tag kennen, als Papa mir von der Krankheit erzählt und die Regeln aufstellt.
Ich bin neun Jahre alt. Noch nie bin ich allein von Rawblood weg gewesen. Das würde Papa auch nicht gefallen. Doch er schläft im Garten, eine Hand schwer in der sonnenhellen Luft baumelnd, der Zwicker klebt am Ende seiner glänzenden Nase. Wie Wasser schlängle ich mich davon. Der Weg nach Manaton ist still, gesprenkelt und von der Hitze des ausklingenden Tages erfüllt. Die Hecken sind hoch und von Grün und einem geheimnisvollen Licht durchdrungen.
Meine Hände klammern sich um zwei große zerbrechliche Stücke Apfelkuchen, vom Küchentisch gestohlen. Der süße, warme Duft. Ich bin allein auf der Welt. Entfernt von Rawblood, dort, wo Papas Blicke mich nicht finden. Meine Arme schwingen lang und frei. Sommerlicht. Schläfriges Vogelgezwitscher, so klar wie Glas. Der sandige Schiefer fest unter meinen Stiefeln. Ferne Stimmen von den benachbarten Feldern. Die Ernte ist fast vorüber.
Langsam laufe ich, trete mit den Zehen in den Boden und ziehe das Bein hinter mir her, wie ein verletzter Vogel seinen Flügel hinter sich herzieht. Ich stupse eine Wolke aus feinem Kies in die Luft und kneife meine Augen zusammen. Der Rhythmus meiner Füße, die schleifen – schschsch – und treten … Mich überkommt das starke Gefühl zu träumen, auch wenn ich weiß, dass ich wach bin. Leise singe ich ein Lied vor mich hin, das ich mir selbst ausgedacht habe. Ein Lied über Dachse. Es hat keine feste Melodie. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mir einen Stein suchen und mich hinsetzen, oder ich werde in einen Baum klettern, und dann werde ich die beiden Stücke Apfelkuchen essen. Aber noch nicht … Der Rhythmus meiner Füße auf der Straße.
Ich halte an. Ich bin nicht mehr allein. Hinter mir ist ein Mädchen, wie aus dem Nichts gekommen steht sie in der Kurve. Ich nehme an, dass sie mir gefolgt ist. Sie ist dürr, größer als ich, aber mit einem sorgenvollen Gesicht, als hätte sie zu Hause etwas vergessen. Zwei braune Hasenzähne lugen zwischen weißen Lippen hervor. Wir starren uns an.
»Hallo«, sage ich.
Sie macht ein Geräusch und steckt ihre Hände in ihre Schürzentaschen.
»Möchtest du etwas?«, frage ich und reiche ihr meine Faust. Apfelstücke rutschen durch meine Finger. Vielleicht wird sie meine Freundin.
Das Mädchen blickt auf den Kuchen in meiner Hand. Ihre Zähne ziehen an ihrer Unterlippe. Mit misstrauischen Augen blickt sie mich an und deutet den Weg entlang. »Wo kommste her?«, fragt sie. »Kommste von dort?«
»Rawblood«, antworte ich. Ich versuche, es nicht mit zu viel Stolz zu sagen. Ich blicke auf die beiden Kuchenstücke in meiner Hand. »Für jeden eines«, sage ich mit etwas Bedauern.
»Von dort«, sagt sie. »Ist bestimmt Gift drin.« Ihr Blick richtet sich auf den Kuchen. »Ist da Gift drin?«
»Nein«, sage ich beleidigt und hebe die Hand an meinen Mund. Süße, bröckelnde Kruste. Säuerlich, grün, zuckrig.
Das Mädchen beißt sich auf die Lippe und starrt weiter. Dann beugt sie sich schnell hinunter und tastet im Sand. Etwas fliegt in einem Bogen durch die Luft. Die scharfe Kante des Kieselsteins trifft meinen Augenwinkel, und alles platzt auf. Etwas anderes trifft meine Schläfe mit einem Knacken. Die Welt schwingt zurück und verliert ihre Balance. Das Mädchen wirft und beugt sich herunter und wirft mit höchster Konzentration. Schnell füllt sie ihre Hände auf der Straße. Jeder Wurf ein Treffer. Einige sind klein und spitz. Andere sind groß und schlagen dumpf gegen mein Fleisch und klirren an meinen Knochen. Ich zeige dem Mädchen meinen Rücken und ziehe den Kopf ein. Steine treffen mit Wucht auf meine Nieren, Rippen und Wirbel. Etwas erwischt mich unten am Schädel und taucht meine Augen und meinen Kopf in ein Weiß. Alles schmeckt nach Blech.
Meine Wange schlägt dumpf auf die Straße. Wie eine Landschaft breitet sie sich vor mir aus. Über dem Pochen in meinen Ohren höre ich das leise Knirschen der Straße, als das Mädchen näher kommt. Ich versuche aufzustehen. Meine Arme und Beine sind wie mit nassem Sand gefüllte Eimer. Sie kommt mit leisen Schritten. Heißes Zeug tropft warm und rot von meiner Kopfhaut hinunter auf mein Kinn. Die Geräusche, die ich von mir gebe, klingen wie ertrinkende Kätzchen.
Ihr Schatten. Ihre Füße sind vor mir, fest mit Lumpen verschnürt. Keine Schuhe. Sie beugt sich herunter. Ihre schmutzigen, zitternden Finger öffnen meine Faust und heben den Rest des Kuchens aus der einen Hand, dann aus der anderen. Ich versuche, sie zu beißen. Meine Zähne schrammen über ihren Arm. Sie dreht sich schnell um, die Hecke bebt, und dann ist sie verschwunden.
Ich sitze auf der warmen Straße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht nach Hause gehen; Papa wird das Blut und die Kratzer sehen und wissen, dass ich ungehorsam war. Ich hätte niemals einfach so weggehen dürfen … Ein Zahn sitzt locker. Ich weine und schluchze stoßweise.
Hinter der Kurve Schritte. Ich schiebe mich in die Hecke, durch den Weißdorn, durch die Sträucher, bis zu der kalten grauen Mauer in ihrer Mitte. Scharfe, unwirsche Zweige zerren an meinem Kleid. Etwas Lebendes kriecht in mein Ohr. Ich halte den Atem an. Es ist still. Die Ringeltauben gurren. Eine Brise trägt den ersten Duft des Abends zu mir heran.
Die Schritte machen vor mir halt.
»Bisschen Blut«, sagt eine Stimme zu sich selbst. Bei den Konsonanten stottert sie ein wenig, wie eine schlecht sitzende Schublade. »Alles gut dadrin?« Etwas schiebt sich wie ein Monster durch das Blattwerk. Ich beiße. »Autsch«, sagt die Stimme. Sie zieht sich zurück. »Nein, autsch.« Es tut mir ein bisschen leid. Und ich hasse und fürchte die dunkle Hecke. Also komme ich heraus.
Der Junge steht auf der Straße, die Hand fest auf die rote Stelle an seinem Arm gelegt, wo ich ihn gebissen habe. Er ist ungefähr so groß wie ich, hat bloße, schmutzige Füße und eine Angelrute. »Du kannst ganz schön zubeißen«, sagt er. »Warum bist du voller Blut?«
»Dieses Mädchen hat mir meinen Kuchen weggenommen«, sage ich. »Es war Apfelkuchen.« Ich zeige ihm meine Hände, die nach Krümeln duften.
Er nickt ernst. »Oh, jup«, sagt er. »Was für ’n Miststück.«
»Miststück«, wiederhole ich entzückt. »Wie heißt du?«
»Tom«, sagt er. »Du?«
»Iris.« Es ist das erste Mal, dass ich den Namen jemandem sage. Es fühlt sich seltsam und auch ein bisschen beeindruckend an.
»Ist bestimmt noch Geschmack dran«, sagt er. Und so setzen wir uns an den Straßenrand und lecken meine klebrigen Finger ab. Erde und kleine Fetzen von Baumrinde haben sich daruntergemischt, doch es schmeckt noch immer nach Apfel. Bisher habe ich nie etwas geteilt. Seine Zunge kitzelt. Ich lache. Es tut weh.
Er sieht es. »Hast ganz schön was abgekriegt«, sagt er.
Ich sage: »Ich möchte nicht, dass Papa das Blut sieht.«
»Ist schon gut«, antwortet er. »Komm mit.« Er nimmt meine Hand.
Der Bach fließt glänzend über fette Steine in einen kleinen Teich aus tiefem Grün. Ebereschen beugen sich über ihn. Die Ufer sind mit Brombeerbüschen bedeckt. Mücken tanzen in der kühlen Luft.
Das kalte Wasser ergreift unsere Körper. Wir schreien und paddeln. Kaulquappen und Elritzen nehmen vor unseren weißen Füßen, die wie Leichen in dem Flusswasser liegen, Reißaus. Das Blut fließt in einer Spirale von mir herunter in den Bach. Wir essen glänzende Brombeeren, bis wir voll mit blauroten Flecken sind. Wir waschen sie ab. Mein Kleid trocknet zerknüllt in der Sonne, während Tom fischen geht. Er fängt nichts.
»Eine Forelle zum Vorzeigen wäre nicht schlecht gewesen«, sagt er. »Wäre nicht so schlimm, wenn ich eine Forelle hätte.«
»Du bist davongelaufen«, erwidere ich. »Genau wie ich.«
»Sollte eigentlich das Heu einfahren«, antwortet er. Er erzählt mir von seinem Dad, seiner Ma, wo sie leben, nämlich auf einer Farm mit Kühen.
»Ich liebe Kühe«, erkläre ich. »Große Augen und lange Wimpern.«
»Sie treten«, sagt er. »Ständig.«
Als sich die Mücken über uns versammelt haben und der Horizont sich zu einem milchigen Grau abgekühlt hat, sagt Tom: »Nach Hause, nehme ich an.«
Ich sage: »Komm mit zu mir!«
»Geht nicht«, antwortet er, und ich spüre seine Besorgnis.
»Zu mir, zu mir«, singe ich, »komm mit zu mir …« Ich tanze um ihn herum und zupfe an den Büscheln seines dunklen Haars. Ich tanze und singe laut, denn ich möchte nicht allein auf dem düsteren Weg sein.
»Plagegeist«, antwortet er. »Na ja, dann bring ich dich eben nach Hause.«
Papa sieht uns, als wir im letzten Licht des Tages den Hügel herunterkommen. Wie ein Bulle stürmt er aus der Tür. »Iris, was hast du dir nur gedacht, einfach so zu verschwinden? Lauf nicht davon, niemals! Nebel hätte aufziehen können!« Er bebt.
»Da ist kein Nebel, Papa! Ich schwöre es.« Er glaubt immer, dass ein Nebel aufzieht, und das macht ihm eine Heidenangst.
Papa sieht mich an, die Schrammen und die blauen Flecke, das verdreckte Kleid. Er packt Tom beim Genick und hebt ihn in die Höhe. Knöpfe reißen von Toms Hemd ab, als Papa ihn schüttelt.
»Was ist mit ihr geschehen?«, fragt Papa. »Sprich. Wer hat ihr das angetan?«
»Ich war’s nicht«, antwortet Tom, während Papa ihn schüttelt, und ich rufe: »Nein, nein, er war’s nicht!«
»Wer sind deine Leute?«, fragt Papa. »Sie werden davon hören. Und jetzt eine Tracht Prügel, die schlimmste deines Lebens.«
»Tom Gilmore«, sagt er. Seine Zähne klappern vom Schütteln. »Trubbs Farm.«
Ich zerre an Papas Ärmel. »Er hat mir geholfen«, erkläre ich. »Papa! Es war die andere, die Steine geworfen hat …«
Papa lässt Tom wie einen Sack Weizen fallen.
Tom sitzt verwundert auf dem Boden.
Papa bedeckt das Gesicht mit den Händen. »Tom Gilmore«, spricht er. Tom sagt aber nichts. Wie es scheint, versucht er zu erraten, welche Antwort ihm Ärger einhandelt.
Ich sage: »Bitte, Papa, lass ihn zufrieden.«
Papa macht ein Geräusch. »Ich habe es vergessen«, antwortet er. »Ich habe es versprochen, und ich habe es vergessen.« Er starrt Tom an. »Du darfst ihm etwas zu essen geben, Iris. Aber hier draußen. Nicht im Haus.« Er wendet sich ab und läuft zurück in Richtung Rawblood. Sein Rücken zittert von unten bis oben.
Tom und ich blicken ihm hinterher. »Er weint«, sagt Tom.
»Ich weiß.« Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist nicht ungewöhnlicher als die anderen Dinge, die heute geschehen sind.
»Vielleicht ist noch etwas von dem Kuchen übrig«, bemerke ich, und dieser Gedanke verdrängt alle anderen.
Papa verarztet mich mit einer Jodtinktur. Der Geruch ist stark und rot. Mein Schlafzimmer macht einen sehr behaglichen Eindruck. Das Feuer brennt, so als wäre ich krank. Es lodert eifrig und prasselt im Kamin und wärmt unsere Gesichter. Die Nacht ist draußen. Wir sind drinnen.
»Warum hast du geweint, Papa?«
»Ich habe mich an ein Versprechen erinnert, das ich einmal gegeben habe«, erwidert er. »Deiner Mutter. Ich hatte es vergessen, was sehr schlimm ist, denn Versprechen muss man halten. Aber das war nicht alles. Ich bin zornig gewesen, Iris, denn ich sorge mich um dich. Ich habe immer ein Auge auf dich gehabt, stimmt das nicht? Ich habe versucht, dir das Richtige beizubringen, so wie ein Vater es tun sollte, nicht wahr?«
»Ja«, antworte ich ergriffen. »Aber warum, Papa? Warum hat das Mädchen die Steine geworfen? Warum hat es geglaubt, dass der Kuchen vergiftet ist?«
»Die anderen fürchten uns«, erklärt Papa. »Unsere Familie. Mein Herz, sie werden dir wehtun, wenn sie können. Wir haben … eine Krankheit. Genau wie Rawblood gehört sie schon immer zu unserer Familie. Wie ein schlummernder Widersacher ruht sie in uns. Ihr Name ist Horror autotoxicus. Auch deshalb arbeiten Dienstboten nicht gern auf Rawblood. Darum haben wir nur Shakes, und auch der wohnt nicht auf Rawblood, sondern über dem Stall. Kein Dienstbote schläft je im Haus.« Einen Moment lang ist sein Blick ganz leer und weit entfernt, aber dann fährt er fort: »Horror autotoxicus ist eine ungewöhnliche Krankheit. Sie wird nicht durch eine Infektion oder ein Virus ausgelöst, sondern durch Gefühle.«
»Das ist wirklich seltsam«, sage ich und denke an die Erkältung, die ich im letzten Sommer hatte. »Was macht sie mit einem?«
»Sie macht einen sehr krank«, antwortet Papa. »Sie macht einen ganz heiß vor Fieber, und sie verursacht Wahnvorstellungen von schrecklichen Dingen. Man rutscht in einen Traum hinein, in dem Monster umherstreifen. Und schließlich verliert man den Verstand, bis man die Orte nicht mehr kennt, die man liebt, oder die Gesichter der eigenen Familie. Manchmal bringt sie einen dazu, anderen wehzutun.«
»Nein! Ich werde mich immer an dein Gesicht erinnern, Papa, und ich werde mich immer an Rawblood erinnern …«
»Ich wünschte, es wäre so, Iris. Du musst dich zu allen Zeiten ganz ruhig verhalten und ein stilles Leben führen, denn Horror autotoxicus kann dich packen, wenn du erregt oder verärgert bist. Sollte dich jemals ein starkes Gefühl überkommen, das du nicht beherrschen kannst, musst du Papa sofort davon erzählen. Es könnte das erste Anzeichen sein.«
»Alle meine Gefühle sind stark«, antworte ich. »Ich kann dir doch unmöglich von allen erzählen!«
»Du musst es wenigstens versuchen«, antwortet er und trocknet mir das Gesicht ab. »Aber verzage nicht. Wir können es verhindern. Du bist nicht in Gefahr, solange du still auf Rawblood lebst und nicht davonläufst. Es ist eine rationale Sache, der wir mit Vernunft begegnen können. Ich verstehe nun, dass ich zu viel von dir verlangt habe, Iris. Dein Ungehorsam zeigt mir, dass ich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen vertrauen darf. Darum habe ich Regeln aufgestellt, die du befolgen wirst und die dich schützen werden.«
Papa holt ein Stück Papier aus seiner Tasche. Er liest die Regeln laut vor, und dann heftet er sie an meine Schlafzimmertür.
Andere Kinder: keine Freunde.Dienstboten: keine Freunde.Die Krankheit: ein Geheimnis.Papas Medizinbeutel: verboten. Wenn Papa seine Medizin nimmt: raus aus dem Zimmer.Acht Uhr morgens bis zum Mittag: lesen mit Papa.Nachmittage: im Garten spielen. Nicht außerhalb des Gartens.Bett: um sieben.Bücher: so gut wie Menschen.Erzähle Papa alles.»Diese Regeln sind wie Versprechen, Iris, verstehst du das?«
Ich nicke. Die Lieblichkeit der Sonne und des Wassers und der Gedanke an Tom lösen sich zu einer Müdigkeit auf, und überall tut es mir weh. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir mein Körper so wehtun kann. Ich habe keine Lust mehr, die Welt zu entdecken. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ein freundlicher Ort ist. Horror autotoxicus … Sogar der Name ist schrecklich. Aber mir wird es gut gehen. Dafür wird Papa schon sorgen.
»Ich werde die Regeln befolgen«, erkläre ich. »Aber Tom werde ich behalten! Das nennt man einen Handel, Papa.«
Papa betrachtet mich lange. »Du bist wahrhaft die Tochter deiner Mutter«, antwortet er. »Aber es geht nicht, Iris.« Er wiegt meinen Kopf in seiner langen weißen Hand. Er hält mich sanft und doch so fest wie in einem Schraubstock und sieht mir in die Augen. »Sag sie mir auf«, fordert er. »Die Regeln.«
Ich winde mich. »Papa, zu eng …«
»Sag sie auf, Iris. Ich muss sichergehen, dass du sie verstehst.«
»Andere Kinder«, sage ich. »Keine Freunde …« Ich sage die Regeln auf, immer und immer wieder.
Schließlich lässt Papa von mir ab und legt mir seine Hand auf den Kopf, und ich weiß, dass er mir jetzt vergeben hat. Er sagt: »Na gut, lass uns lesen.«
»Hervor!«, sage ich.
»Immer Hervor. Solch eine Vorliebe für Gewalttätigkeiten. Nun gut.« Er nimmt das Buch, das aufgeschlagen neben dem Bett liegt. Wir lesen.
Es heißt nicht wirklich Hervor, sondern Das Erwachen von Angantyr. Es geht so. Hervors Vater, Angantyr, stirbt und wird mit einem berühmten Schwert namens Tyrfing begraben. Das bedeutet ›Vermesser des Schicksals‹ oder manchmal auch ›Der Fluch der Schwerter‹. Hervor ist eine Kriegerin. Sie will das Schwert bekommen. Deswegen ist sie wirklich schlecht gelaunt. Das gefällt mir, denn allzu oft erscheint es mir, als wären die Menschen in den Geschichten zu gut.
Hervor begibt sich zum Grab ihres Vaters und öffnet es wie eine Tür. Sie betritt eine Unterwelt, die ein düsterer Ort voll Feuer ist. Sie weckt Angantyr aus seinem Schlaf. Das ist ein weiterer Grund, warum mir die Geschichte so sehr gefällt. Wenn mein Papa stirbt, würde ich ihn auch erwecken. Angantyr ist zornig, weil er aufgeweckt wurde. Er sagt, dass Tyrfing ein schreckliches und verwunschenes Schwert sei. Es tue nämlich Böses. Und beide Seiten der Klinge sind vergiftet – wenn man es also berührt, stirbt man. Hervor sagt: »Ich bin deine einzige Tochter. Das Schwert steht mir als Erbe zu. Ich werde es nehmen und mich an der Klinge schneiden. Ich werde all diese Feuer durchschreiten. Ich werde das Risiko des Fluchs auf mich nehmen. Ich fürchte mich nicht.« Der Vater ist von ihrem Mut tief beeindruckt. Er gibt es ihr und sagt, sie müsse vor Tagesanbruch in die Welt der Lebenden zurückkehren. Wenn das Tor zum Reich der Toten bei Sonnenaufgang noch immer offen steht, werden die Toten für ewig verschwinden. Wohin? Das weiß niemand.
Sie eilt mit Tyrfing zurück durch die wütenden Feuer, quer durch das schwarze Land. Sie erreicht das Tor, gerade als die Sonne ihre ersten Strahlen auf den Boden wirft. Sie schlägt die Tür hinter sich zu. Ihr Vater ist in Sicherheit. Sie besitzt das Schwert. Alles ist gut.
Danach bereist sie als Mann verkleidet die ganze Welt und reitet auf den Pferden des Meeres. Sie besteht viele Abenteuer. Ich sehne mich nach Abenteuern.
Papas Stimme, das warme Feuer. Ich liebe die Geschichte noch immer, doch seit heute verstehe ich, dass ich nicht Hervor bin und dass Bücher und das Leben nicht dasselbe sind.
1912
Ich bin 13.
In dem rosafarbenen Licht der geschlossenen Vorhänge ist Henry Gilmores Haut grau wie Birkenrinde, seine rissigen Lippen zittern über gelben Zähnen. Die ganze Zeit macht er Geräusche wie ein Kessel, der fast überkocht. Es wird die Farmerlunge genannt oder auch Heukatarrh. Das, was einem das Land nach einem Leben voller Arbeit zurückzahlt. Es besteht kein Zweifel, dass er im Sterben liegt.
Ich blicke zu meinem Vater hinüber, der neben dem Bett steht. Er gibt mir kein Zeichen. Ich weiß nicht, was als Nächstes geschieht.
»Ich hoffe, dass es Ihnen bald wieder besser geht«, sage ich zu Toms Vater und stelle den Korb mit den Pflaumen auf das Bett. Dort landet er mit einem leisen, dumpfen Pochen. Henry Gilmore zuckt zusammen und atmet ein brodelndes Geräusch. Er legt sich auf sein Kissen zurück. Strähnen seines gelblichen Haars kleben wie Wasserpest an seiner Stirn. Ein schmaler Sonnenstrahl fällt auf seine eingesunkene Wange. Sein Atem müht sich durch die geöffneten Lippen. Seine trüben blauen Augen richtet er auf mich. In seinem Blick liegt etwas Hartes, etwas Suchendes. Einen Moment lang kann ich sein jüngeres Gesicht erkennen, tief vergraben unter dem alten wie ein dunkles Spiegelbild auf einem Gewässer. Seine Knochen schimmern fein und ansehnlich in dem Licht des Nachmittags. Henry Gilmore und ich sehen uns an, und dabei streckt sich die Luft zwischen uns, die Zeit verengt sich und zieht sich in die Länge.
»Weißt du«, sagt Henry Gilmore, »dass du den Teufel zum Vater hast? Dein Vater ist der Teufel in der Nacht.«
Etwas berührt mich zwischen den Schulterblättern, nur einmal, ganz leicht. Papa steht hinter mir. »Geh jetzt«, sagt er.
Ich gehe durch das staubige Innere des Hauses, die halsbrecherische Treppe hinunter. Ich gehe schnell, die Augen fest verschlossen, und lausche nach dem Geist von Charlotte Gilmore.
Ich warte und trete nach der fetten weißen Ente, die über den Hof wackelt. Meine Haut kribbelt. Der Teufel in der Nacht.
Ich gehe um die Ecke des Hauses zu den Viehställen. Am Ende, hinter den Milchkühen, lugt ein samtiges Maul über die Stalltür. Die Ponystute macht ein leises Geräusch. Sie glaubt, ich wäre Henry Gilmore.
Als ich näher komme, legt sie ihre Ohren eng an ihren Kopf. Zitternd zieht sie sich zu der hinteren Wand zurück. Sie ist groß geworden. Anmutig und robust. Aber mich hat sie noch nie gemocht, nicht seit dem Tag, als wir sie ihrer toten Mutter weggenommen haben. Was bedeutet, dass sie mich seit dem Tag ihrer Geburt hasst. Dafür respektiere ich sie, wenn auch widerwillig; die Kraft, die Beständigkeit ihrer Verachtung für mich.
Ich strecke meine Hand nach ihr aus und zirpe. »Ich habe dein Leben gerettet«, sage ich zu ihr. »Tom und ich sind es gewesen. Er, Mr. Gilmore, hätte dich zurückgelassen.« Mit aufgeblähten Nüstern starrt mich die Stute an. Ich denke an Tom, und schmerzvolle Tränen sammeln sich an meinen Augenrändern.
Als ich weine, fühle ich das samtige Maul der Ponystute auf meinem Arm. Sie ist behutsam, ihre Lippen liebkosen meinen Ärmel. Ich spüre die warme Güte ihres Atems, den Trost, die seltsame Verlässlichkeit ihrer Gegenwart. Ihr seidiges Gesicht. Ich habe genug Zeit, um all das wahrzunehmen, bevor ihr stumpfes Maul meinen Unterarm wie ein Schraubstock packt und einquetscht. Ich fühle jeden einzelnen ihrer schmalen Zähne. Sie schüttelt mich und beobachtet meinen Schmerz. Ich schlage ihr auf die Stirn, ganz fest zwischen die Ohren. Sie lächelt und beißt noch fester zu. Ihre dunklen Pferdeaugen leuchten hell, während ich auf ihren Kopf einschlage.
Mein Vater wirft einen mitleidigen Blick auf die kaputten Zäune, schreitet bedächtig um die Kuhfladen herum, die das Kopfsteinpflaster dunkel und übel riechend bedecken. Er geht zum Pferdewagen und verstaut eine Kiste unter dem Rücksitz. Dann ruft er mich zu sich, als wüsste er nicht mehr so recht, wie ich heiße. Seine Augen sind düster und mit etwas beschäftigt.
»Was ist in der Kiste?«, frage ich ihn. »Die du gerade weggestellt hast.«
»Geld«, sagt mein Vater.
»Warum?«
»Um seine Schulden zu begleichen.«
»Warum machst du das?« Ich bin aufgebracht. »Nach dem, was er gesagt hat …«
»Beachte es nicht weiter, Iris. Er liegt im Sterben. Und ich habe ihm unrecht getan, früher einmal. Es tut gut«, erklärt er, aber nicht zu mir, »Frieden zu schließen, wenn es möglich ist.«
Ich habe gesehen, wie sich Henry Gilmores ausgezehrtes Gesicht plötzlich verändert hat. Ich kenne diesen Blick, diese blaue Verachtung. So etwas hatte ich schon einmal gesehen, in einem anderen Augenpaar. Von uns hat Henry Gilmore keinen Frieden bekommen.
Auf dem Pferdewagen schweigen wir. Mein Arm summt wegen des großen dunklen Blutergusses, den das Maul des Ponys mir verpasst hat. Ich öffne meinen Mund für den Wind. Er strömt hinein, kalt und trocken, nimmt mir den Geschmack des heißen Krankenzimmers und Mr. Gilmores letzte Worte. Überall in mir ist Angst. Krankheit.
»Es wird dir nichts tun, Iris.« Papa liest meine Gedanken, wie immer. »Es wird dir nichts tun, solange du den Regeln gehorchst.«
In dem Schwarz finden meine Füße den schmalen Sims unter meinem Fenster. Leichter Schnee fällt auf meine Hände und mein Gesicht. Ich krabble über den Schiefer. In der Stallung vor mir wirft ein Fenster ein schwaches, den Weg weisendes Licht zu mir herüber.
Mit festgekrallten Fingern bewege ich mich hinüber. Unter mir sind erst der tiefe Abgrund und dann die Steinplatten. Er zerrt wie die Gezeiten an mir. Die Welt befindet sich in einer seltsamen Schräglage.
Am zweiten Giebel greife ich nach dem First und werfe ein Bein darüber. Etwas rutscht unter meinem Fuß weg, und dann schlittere ich mit großer Geschwindigkeit auf den Abgrund zu. Das Nachtland strömt herbei. Ein kalter Zug rast mir den Rücken hinunter.
Meine Stiefel treffen auf eine nachgebende Oberfläche. Ich komme zum Stehen. Stechende Schmerzen in meinen Fingerspitzen, die rissig und nass sind. Die wacklige Regenrinne ächzt. Ich stehe bis zu den Knöcheln in altem Mulch und den Knochen von toten Vögeln.
Am Fenster greifen seine Hände nach mir. Ich schiebe mich über die Fensterbank hinein. Etwas trommelt feucht in meinem Ohr. Ein Herz.
Tom flüstert mir zu: »Hast ’nen ordentlichen Krach gemacht.«
Wir sind still. Ich denke an Shakes am anderen Ende des Stalls. Ich denke an meinen Vater und die Regeln. Unter meinen durchnässten Schuhen stöhnt ein Bodenbrett. Die Ställe seufzen unter uns. Warme Bewegungen im Stroh, das geduldige Atmen der Pferde. Mäuse huschen leise durch das Gesims. Eine Spirale aus Schnee bauscht sanft durch das Fenster. Niemand kommt.
»Wirst langsam zu groß für so was«, sagt Tom schließlich.
»Keine Sorge«, sage ich. Ich bin immer noch schwach und wacklig auf den Beinen. »Und das musst du gerade sagen.« Tom überragt mich schon um einen ganzen Kopf. Seine Handgelenke sprießen wie Weinreben aus seinen Ärmeln.
»Blut«, sagt er mit Unbehagen. »Kann’s riechen.«
»Das Dach. Hab mich ein bisschen gekratzt.«
Er nimmt meine Hand in seine.
»Nur die Finger«, sage ich. »Es ist …« Er kneift mir in den Arm, damit ich still bin, und ich halte inne. Er geht zur Ecke und macht etwas. Leise Geräusche. Dann: Etwas legt sich kühl um meine Hände. Seine Finger verschränken sich mit meinen. Ein Geruch wie frisch geschnittenes Gras. Pferdebalsam.
Tom lebt über den Ställen von Rawblood. Unsere Freundschaft hat sich vom Tag in die Nacht verschoben. Das Dach zu überqueren ist wie in ein anderes Land zu gehen. So wie jetzt breche ich die Regeln in jeder Nacht.
Ich möchte ihn fragen: Macht es dich traurig? Wärst du lieber noch immer zu Hause? Doch das tue ich nicht. Was hätte es für einen Sinn? Tom hat keine Mutter und ich habe keine Mutter. Bald schon wird sein Vater sterben, und dann hat er niemanden mehr. Ich weiß nicht viel über die Welt und so weiter, doch das eine weiß ich: Die Waage neigt sich schon jetzt sehr zu meinen Gunsten, und das wird sie nur noch weiter tun.
Zu viel bleibt in letzter Zeit zwischen uns unausgesprochen. Es gibt zu viele Unwahrheiten. Mein Vater, die Krankheit … Ich werde in entgegengesetzte Richtungen gezogen. Starke, vielschichtige Bindungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und so probiere ich sie alle aus. Ich setze mich über meinen Vater hinweg. Ich belüge Tom. Ich missachte die Regeln und fordere die Krankheit heraus. Eines Tages wird sich etwas ergeben, doch was?
Tom sagt: »Mief.«
Ich sage: »Was?«
»Warte.«
Nun, da er es ausgesprochen hat, kann ich es riechen. Der Gestank des Verfalls. An meinen Stiefeln kleben Matsch und der Moder aus der Regenrinne.
Etwas raschelt. Er reicht mir eine muffige Handvoll Stroh und nimmt sich einen Lappen. Ich stehe da wie ein Reiher auf einem Bein. Er geht vor mir in die Hocke. Ich beuge mich hinunter, und wir schrubben mit gerümpften Nasen. Ich schwanke, meine Hände suchen nach einem Halt. Ich klammere mich mit beiden Fäusten an Toms Haar. »Lass das, lass los, Plagegeist. Wir fliegen noch beide hin. Lass los.« Zusammen kippen wir beide leise und zittrig lachend auf den Boden. Meine Finger kräuseln sich schwach durch sein Haar.
Auf dem Weg nach draußen gibt es keine Probleme. Wir bewegen uns durch den dunklen Stall ins Freie hinaus. Als wir weit genug entfernt sind, am Fuße von Sheepstor, rufen wir. Unsere Stimmen sind hoch und klingen albern. Die Luft gleicht feinen Nadeln. Die letzten Wolken verziehen sich. Die Sterne stehen am Himmel, der Mond ist aufgegangen. Er zeigt das gesenkte, weiß bestäubte Land.
»Forelle?«, frage ich. »Sie steigen bestimmt.«
Tom sagt: »Hab meine Angelschnur nicht dabei.« Seine kalten Finger finden meine. Sie zucken erst, dann sind sie still. »Komm«, sagt er. »Ich möchte dir was zeigen.« Wir gehen höher hinauf. Über uns liegen die Felsen flach und schwarz vor dem Himmel.
»Hier.« Tom zieht mich in einen flachen Pass zwischen den Felsbrocken. Ein schmaler, mit Gras bedeckter Pfad schlängelt sich durch den bauchigen Granit. Die Welt ist ganz weit oben. Hier ist es klamm und gefroren, und die Felsen schließen sich wie Zähne.
»Was denn?«, frage ich.
»Hier unten«, sagt er und verschwindet. Ich folge ihm, doch es ist, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Meine Hand gleitet am glatten Gestein entlang, den Pfad hinunter. Ich drehe mich und stolpere. Mein Schienbein stößt gegen einen harten, kalten Stein. Mein Atem schwebt weiß vor meinem Gesicht. Ich denke: Ich bin allein, er ist weg, und mein Herz hämmert, als wollte es platzen.
Ein schwarzer Schlitz tut sich vor mir auf, düster vor dem Wirrwarr aus Stein. Eine Hand streckt sich aus der Öffnung. »Hier ist es«, sagt er und führt mich hinein.
In der Höhle flackert das Streichholz weit hinauf bis zu einem Punkt, wo die Wände wie bei einem kleinen Kirchturm zusammenlaufen. Die Luft riecht nach umgegrabener Erde und dem alten, schwachen Duft von Füchsen. Die Wände sind hellgrün und von Moos bedeckt, das in dem Licht leuchtet und sich bewegt, als würde es gestreichelt werden. Die Kammer ist groß genug, dass sich fünf Männer lang ausgestreckt auf den blassen Boden legen können. Weiter hinten, im Schatten, steht ein großer, schiefer Stein wie ein Altar. Auf dem dunklen Stein liegt ein kleiner Knopf, grellrot. Ein verschlissener Kinderschuh. Ein Holzlöffel. Ein Hufeisen und etwas, das alt und schimmelig ist und vielleicht mal ein Laib Brot war. Dahinter schimmert etwas in dem schräg abfallenden Schatten, etwas Weißes, Unförmiges. Es zittert. Mein Herz ist eiskalt.
Natürlich ist das eine optische Täuschung. Ein alter Quarzklumpen, der sich im Kerzenlicht badet. Doch einen Augenblick lang sieht es wie Knochen und totes Fleisch aus. Ein Leichnam, am Fuße des Altars zusammengerollt.
Toms Gesicht wird von tanzenden Schatten überzogen. Er grinst. Das Streichholz zischt. Er sagt: »Hör doch.«
Hinter den Wänden, in den Felsen, wüten schrille Stimmen in unbekannten Sprachen, Hämmer, die Stahl zum Klingen bringen, das Geräusch eines fernen Gemetzels. Dünnes Schluchzen, ein pfeifendes Kreischen, dann Geflüster, so sanft wie ein Atmen. Die Geräusche umhüllen uns.
»Es ist der Fluss«, verkündet Tom, »der durch den Untergrund fließt. Er wird uns nichts tun.« Doch es hört sich nach allem Unglück dieser Welt an. Das Streichholz flackert auf und stottert.
»Lass es nicht ausgehen«, sage ich. »Tom …«
»Warte«, erwidert er. »Ich habe … Warte.« Er greift in seine Tasche, und die kleine Flamme tanzt immer schwächer. Schatten schießen empor, die Finsternis kommt. Was geschieht mit dem weißen Stein, wenn es dunkel wird? Vielleicht ist er nicht immer ein weißer Stein.
»Tom«, beginne ich noch einmal, doch dann springt die Flamme von dem kleinen Kerzenstummel empor und wirft ihr wackeres Licht in alle Richtungen. Die Wände treten wieder zum Vorschein, grün und leuchtend. Er macht sich daran, die Kerze auf den Altar zu stellen.
»Nein!«, halte ich dagegen. »Nicht dorthin.« Wir setzen uns Seite an Seite auf den Boden der Höhle. Er ist sandig und angenehmer als erwartet.
»Wer macht denn so etwas?«, frage ich.
»Niemand hat es gemacht. Es ist einfach hier, das ist alles.«
»Aber es kommen doch Menschen her«, widerspreche ich. Der kleine Schuh liegt still auf dem Stein hinten.
»Alte Leute«, sagt Tom. Er rollt die Vokale und zieht sie, wie es in Devon üblich ist, in die Länge. »Dreh deinen Mantel auf links, um Saint Nick fernzuhalten. Lauf dreimal gegen den Uhrzeigersinn im Mondlicht um den Hügel von Bexley herum.« Er schnieft, zuckt die Schultern und zeichnet mit dem Finger einen Kreis in den sandigen Boden um die Kerze. »Sehet!«, sagt er mit einer hohen Stimme wie der von Mrs. Brewster, die mit dem Metzger in Dartmeet verheiratet ist. »Ich habe eine Linie in den Sand gezogen, und nun darf niemand diese Kerze berühren, sonst wird er sterben.« Er sieht mich an und grinst. »Jetzt kann niemand sie ausmachen. Kapiert, Plagegeist? Magie.«
»Was ist das für ein Lärm?« Ein Kratzen, ein schwaches Geräusch in der Ferne, als würden Steine aneinanderreiben.
»Der Fluss«, antwortet Tom. »Hab ich doch schon gesagt.«
Doch es ist anders. Verstohlen. Ich blicke auf und umher. Schatten flackern. »Wie wirkt es?«, frage ich und betrachte den schiefen Altarstein und den funkelnden Quarz dahinter. Aus irgendeinem Grund mag ich meinen Blick nicht von ihnen lösen.
»Nun, Plagegeist, du kannst Geschenke herbringen, damit die, die du liebst, niemals sterben müssen.« Tom spricht noch immer mit Mrs. Brewers Stimme. Er holt eine braune Glasflasche aus seiner Manteltasche und trinkt. Er verzieht das Gesicht, dann steht er auf und geht zum Altar. Er legt etwas Zerknülltes darauf. Wir sitzen da und betrachten den Handschuh seines Vaters, der schmutzig und mit schlaffen Fingern auf dem Granit liegt.
Tom sagt: »Nur für alle Fälle.« Kräftig reibt er sich das Gesicht. Seine Wange wird unter seiner Handfläche ganz rot. »Es ist Unsinn«, sagt er, »wie alle solche Sachen.« Doch er lässt den Handschuh liegen, wo er ist.
Ich sage: »Wir besuchen ihn alle zwei Wochen.«
»Ich weiß«, antwortet Tom. »Tom, der Stallbursche, spannt die Pferde ein und hievt den alten Shakes hoch auf den Bock der Kutsche. Ich weiß alles, was du machst, Plagegeist.«
»Nenn mich nicht so«, sage ich wie von selbst. Seine Worte haben seltsam wenig Gewicht. Die Grenzen zwischen unserem Tages-Ich und unserem Nacht-Ich verschwimmen und verschieben sich. Ich bekomme Kopfweh. Es ist so schwermütig, das Geräusch. Steine, die aneinanderreiben.
»Was ist das«, fragt Tom, »zwischen den beiden? Zwischen deinem Vater und meinem?« Klirrend fällt die Flasche auf den Boden.
»Ich weiß es nicht«, gestehe ich.
»Böses Blut«, antwortet Tom. »Geheimnisse! Machenschaften!«
»Flüche«, füge ich hinzu. »Uraltes Unrecht.« Unsere Ausgelassenheit ist spröde und rau, der Witz nur eine Feder breit von der Wahrheit entfernt. Es ist so aufregend, als würde man über die dünnste Stelle einer klaren Schicht Eis auf dem Teich laufen.
»Im Dorf sagt man sich Dinge«, bemerkt Tom. »Über ihn, dich. Rawblood.«
»Was?«, frage ich. Das klare Eis, und darunter – was? Die kalte, tiefe Finsternis.
»Auf Rawblood liegt ein ermordetes Mädchen begraben.« Er fährt mir mit leichten Fingern auf der Rückseite meines Arms entlang. Ich bekomme eine Gänsehaut, was nicht gänzlich unangenehm ist.
Ich stupse ihn weg. »Hör auf. Wo? Das stimmt doch nicht.«
»Manche sagen, sie liegt unter dem Kellerboden«, verrät Tom. »Andere sagen, sie könnte auf dem Dachboden sein, jedenfalls Teile von ihr, in einer Truhe mit Eisenbeschlägen … Doch wahrscheinlich liegt sie unter der Zeder begraben. Die Wurzeln ernähren sich von ihrem Leichnam.« Die Haare auf meinem Arm richten sich auf wie winzige Finger. »Man kann es aus einem bestimmten Fenster von Rawblood sehen. Das Grab. Es ist immer frisch ausgehoben. Nasse Erde. Man sieht es, kurz bevor man stirbt.«
»Pfui Teufel«, rufe ich. Seine Finger streicheln mich und lösen ein sanftes Kribbeln aus.
»Jup, das ist alles Blödsinn«, antwortet Tom. Er rutscht ein wenig auf dem sandigen Boden weg von mir. Ich reibe mir meine kribbelnden Arme. »Ich weiß von jemandem, der wirklich …« Er hält inne und beginnt von Neuem. »Mein Onkel Rob war ein Butler. Der Butler von Rawblood, um genau zu sein.«
»Wir haben aber keinen Butler«, halte ich dagegen.
»Nein«, sagt Tom in einem Tonfall, den ich nicht deuten kann. »Nicht jetzt. Mein Dad war älter als Rob, fast 20 Jahre. Er hat sich um ihn gekümmert. War mehr ein Vater als ein Bruder für ihn, glaube ich. Er redet kaum mit mir, Dad. Doch er erzählt gern Geschichten über Onkel Rob. Jedenfalls muss Rob eines Morgens nicht hinunter zum Frühstück der Dienstboten gekommen sein, und als sie dann hinauf in das Dachgeschoss von Rawblood gingen, um nach ihm zu sehen, lag er dort, kalt und tot in seinem Bett. Die Augen groß wie Kieselsteine, als hätte er etwas gesehen. Mein Dad bekommt es deswegen noch immer mit der Wut zu tun. Törichte Ideen. Sagt, dass Rawblood ihn umgebracht hat. Dass Rob sein Leben geben musste, weil er etwas getan hat, etwas, das deinem Vater nicht gefiel …« Tom erschrickt, sammelt sich und sieht mich mit großen Augen an. Ich zucke die Schultern. Mein Herz pocht.
Tom sagt: »Ich sehe aus wie er. Wie Onkel Rob.« Nun macht sich der Schnaps ein wenig in seiner Stimme bemerkbar. »Abgesehen von seinem roten Haar. Und jetzt denkst du bestimmt: ›Oh, deshalb können sie nicht miteinander: Es macht den alten Mann traurig zu sehen, dass sein Sohn seinem Bruder so ähnlich ist, jetzt kapier ich’s.‹ Doch damit liegst du falsch, Plagegeist. Das ist nicht der Grund, warum er mich hasst. Es ist viel schlimmer, denn es gibt gar keinen Grund dafür. ›Rawblood ist das Unheil der Gilmores.‹ Wie oft habe ich das von ihm gehört? Und trotzdem hat er mich hierhergeschickt.« Die Flasche klirrt leise im Sand. »Hat mich verschachert wie ein Pony.«
Ich nehme seine Hand. Die Kerze flackert. Die Schatten rühren sich. Toms Worte hängen in der Finsternis zwischen uns und vermischen sich mit anderen Dingen, die ich gehört habe. Er hat etwas getan, das deinem Vater missfallen hat. Der Teufel in der Nacht. Ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge: Robert Gilmore, den ich nie zu Gesicht bekommen habe. Im ersten Moment ganz schnell und im nächsten tot. Vielleicht war es die Krankheit. Vielleicht hat sie ihn umgebracht. Das Eis ist dünn, dünn …
Tom verpasst mir einen Klaps gegen den Hinterkopf. »Dachte schon, dass du den Schwanz einziehst, Plagegeist«, bemerkt er, »als du reingekommen bist.« Er ist angespannt und unbeschwert zugleich. »Hast Augen gemacht wie eine Schleiereule.« Seine Hand hält meine ganz fest.
»Hab ich nicht«, antworte ich voller Erleichterung. Die Welt bebt und setzt sich selbst instand. Die dunklen Gezeiten ziehen sich zurück.
»Nein«, sagt er. »Nur zu wahr. Das hast du nicht. Hier.« Die Flüssigkeit brennt in meiner Kehle. Es ist, als würde man aus einer Gaslaterne trinken. Ich huste und trinke noch einmal. Das Kerzenlicht, wunderschön und ruhelos, fällt auf alles.
»Mir gefällt’s«, sage ich und meine die Höhle, den Schnaps, das Moor draußen, das Licht darin. Ich meine die Wärme an meiner Seite, dort, wo er sitzt. Sein Wuschelkopf, um den das Kerzenlicht einen Heiligenschein legt. Ich bin ganz aufgedreht wegen der Gnadenfrist – für was? Ich spiele mit Toms Schnürsenkel und stelle mir den Fuß in seinem Stiefel vor. Formen tanzen auf den schimmernden grünen Wänden. Das dunkle Dach über uns wirkt unendlich.
»Wie wäre es wohl«, frage ich, »nicht zu sterben, niemals, wie auch immer? Wenn es ginge, wenn man nur einen Handschuh auf einen Stein legen müsste. Vielleicht wäre es schrecklich.«
»Menschen sollten nicht sterben«, gibt Tom zurück. »Sie sollten es einfach nicht.« Als ich ihn anblicke, sehe ich, dass etwas mit ihm geschieht. Er ist starr, blass, hat die Arme um sich geschlungen. Er zittert stark. »Mach das Licht aus, Iris.« Das Weiße in seinen Augen funkelt.
»Magie«, sage ich. »Schon vergessen? Ich kann es nicht ausmachen.« Ich will die Finsternis nicht. Plötzlich fühle ich mich sonderbar. Als würde mein Verstand wachsen und sanft gegen meine Schädeldecke drücken. Das Geräusch. Als würde sich die Erde bewegen. Als wollte sie uns unter sich begraben. Oder als würde der Fels atmen. Das gefällt mir nicht.
»Bitte … mach es einfach aus.« Seine Stimme ist wie mit Wolle belegt, sein Mund nach einer Seite verzogen wie bei einem Kind. Die Kerze zischt unter meinem abgeleckten Daumen. Die Finsternis legt sich wie ein Gewicht auf uns. Er ist verschwunden, die Höhle ist verschwunden; bin ich verschwunden? Hinter uns, in dem Felsen, wütet die Schlacht. Gurgelnde Stimmen, die lange Beschwörungsformeln sprechen. Unter ihnen macht Tom kleine Geräusche, während er weint.
»Ich hätte mich um die Farm kümmern sollen.« Er sagt nicht mein Zuhause. »Ich hätte dort sein sollen, all diese Jahre lang, und lernen müssen, wie man sich darum kümmert. Doch das war ich nicht, und nun sind Pferde alles, womit ich mich auskenne, was heißt, dass ich nichts tauge.«
Ich strecke meine Hand in die Finsternis. Sie bleibt auf seinem Gesicht liegen, das heiß und feucht ist. Als ich näher heranrücke, finde ich vereinzelte Teile von ihm – einen Kragen, einen Ellbogen – und halte sie ganz fest.
Die Traurigkeit strömt wie Atem aus ihm heraus.