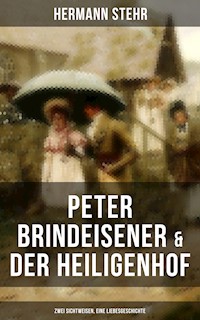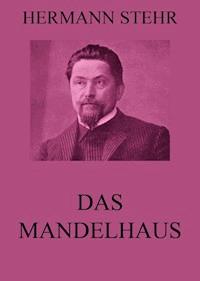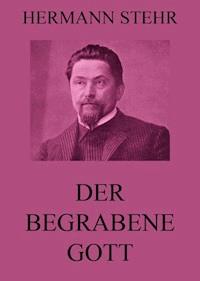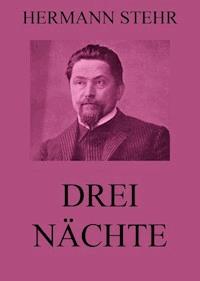1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Hermann Stehrs Buch 'Der begrabene Gott' taucht der Leser in einen düsteren Psychothriller ein, der sich mit tiefgreifenden Fragen über Glauben, Wissenschaft und menschliche Natur auseinandersetzt. Stehr's literarischer Stil vereint gekonnt Spannung und intellektuelle Tiefe, während er geschickt die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lässt. Der Autor webt geschickt mystische Elemente in die Handlung ein, die den Leser bis zur letzten Seite in Atem halten. Der Roman fügt sich nahtlos in die Tradition des deutschen Expressionismus ein, indem er existenzielle Ängste und moralische Dilemmata auf eine fesselnde Weise erforscht. Hermann Stehr, ein Meister des Psychothrillers, hat mit 'Der begrabene Gott' ein weiteres Meisterwerk geschaffen. Seine Faszination für die menschliche Psyche und das Übernatürliche durchdringt jede Seite des Romans und zieht den Leser in einen Sog aus mysteriösen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Stehrs Hintergrund als Psychologe verleiht seiner Darstellung der Charaktere und ihrer Motivationen eine unvergleichliche Authentizität, die das Leserlebnis noch intensiver gestaltet. Seine einzigartige Fähigkeit, komplexe psychologische Profile zu zeichnen, macht ihn zu einem der bedeutendsten Autoren seines Genres. 'Der begrabene Gott' ist ein Buch, das jeden Liebhaber von Psychothrillern in seinen Bann ziehen wird. Mit meisterhafter Spannung und faszinierenden Charakteren entführt Hermann Stehr den Leser in eine Welt voller Geheimnisse und Abgründe. Dieses Buch bietet eine fesselnde Lektüre, die sowohl Unterhaltung als auch tiefgründige Reflexion bietet - ein absolutes Muss für alle, die sich für die dunklen Seiten der menschlichen Seele interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der begrabene Gott
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
1
Drei Stunden von Glatz südöstlich, abseits vom Verkehr liegt in einer Quermulde der Vorberge des Eisengebirges das kleine Gebirgsdorf Steindorf. Am Fuße des kleinen und großen Hedwigsteines lagert das eigentliche Dorf, eine geringe Anzahl niedriger Hütten und Gehöfte, die unter Obstbäumen versteckt liegen. An den Rändern der umliegenden Berge, in den Löchern hängen und hocken seine Kolonien.
»Unse Dorf hat fimf Anteele!« rühmt sich jeder Steindorfer; aber niemand wird darum reicher. Mühsam rang man dem Steingeröll die mageren Feldbreiten ab, dann schichtete man es zu Wällen auf, die sich zwischen den Äckern hinziehen. Sie sind grau, verwittert, von Moosen und Flechten überzogen, mit Hirschholder und Heckenrosen bewachsen, wie Mauern einer verfallenen Stadt, wie vergessenes Material eines großen Bauwerkes, dessen Plan verlorengegangen ist.
Die letzten Oktobertage bringen morgens und abends tiefe Nebel über Steindorf. Diese steigen von den Tälern des Kessels der Grafschaft Glatz herauf, an dessen südöstlichem Rande das kleine Dorf liegt. Der erschöpfte Wind treibt sie schläfrig herauf, gleich unförmigen grauen Riesentieren. Dann ziehen sie träge heran, stoßen sich an den steilen Schwarzwaldhängen des Rollenberges und des Hedwigsteines, versuchen über ihn hinwegzuklimmen, fallen aber träge zurück und rollen ihre plumpen Leiber hinab in das Tal, das bald angefüllt ist mit ihren wolligen, unruhigen Rücken. Der Wind, ihr Hirt, geht noch eine Weile auf den Kämmen der Berge hin und her, lobt die Ruhe seiner grauen Riesenherde mit hohem, zufriedenem Singen oder brüllt sein Mißfallen in rauhen Aufschreien ins Tal und wühlt sich endlich spät in der Nacht mit knurrenden Lauten zu kurzer Ruhe in den Waldhöhen ein.
In solchen Nebelnächten des Spätherbstes hört dann das Leben auf der Straße von Steindorf noch eher auf als sonst. Auch das Glockentürmchen auf dem Freirichtergute, das sonst immer als standhafter Wächter über die Dächer späht, verkriecht sich gar zeitig irgendwohin. Ganz stille schläft es. Nur beim wilden Aufschrei des zornigen Windes wacht es auf, und sein Glöckchen schlägt stotternd einigemal an, wie ein furchtsames Herz pocht, das sich seiner Pflichtvergessenheit bewußt wird. Dann eilt das Türmchen jedesmal auf das hohe, steile Dach des Wohnhauses, zerteilt mit seiner Fahne die schlafenden Nebel, lugt das Dorf hinauf und hinab und hüpft beruhigt wieder in sein Nest tief in der Finsternis.
Die Häuslein Steindorfs sind eine gar artige Schar. Sie gehen auch an hellen Abenden zeitig zur Ruh; in diesen Nebelnächten aber lassen sie ihren Bewohnern kaum soviel Zeit, die Geschirre des Abendessens vom Tisch zu räumen, rufen sie auf ihr Lager und löschen die Lichter aus.
August Klose, der Schuster-Guste genannt, aber hat ein waches Häuslein. Das erträgt das Licht des Lämpchens immer am längsten im Dorfe.
Alle Bewohner sind darüber ungehalten.
»Der Schuster ist eben nie gescheide! Was macht er denn aso lange? Beim teuern Lichte sitzen und Faxen aus a Bichern lesen, mehr wird ebens nie«, räsonieren sie.
Allein ihnen zum Trotze bleibt der Schuster oft bis um zehn Uhr nachts, sogar noch länger auf.
Heute aber hat er Gesellschaft in seiner niedrigen Stube. Die zerlesenen Schwarten liegen unberührt auf dem Wandbrett über der Holzbank, die um den Tisch läuft, und er sieht, die Ellenbogen gemächlich aufgestützt, durch den kleinen Lichtkreis auf sein Gegenüber.
Er sieht gespannt hinüber, mit jener Leidenschaftlichkeit in den Mienen, wie sie die Armut trägt, die ein Recht verteidigt.
»Nee, da darfst du nich erst kommen, dummer Kerle«, ruft er erregt, »dorte hat's Wasser. Verlaß dich of mich, ich bin mit'm Forstassessor Winkelmann vermessen gegangen, wer weeß wieviel Wochen. Ich kenn de Steene; aus m Grunde kenn ich se! Und dadruf alleene kommt's an. Bei dir aber is der beste Steen of Gotts Erdboden für een Born. Was denkst du denn! Plenter – Unterlage! 's hat ja nischt Scheeneres! Das is dir ein Steen, harte wie ne Ofenplatte. Zehn Jahre kann ein Troppen Wasser drauf stehn und sinkt nich ein.
Kurasche! Schaufel und Axt und druf! Eh's einwintert, bist du fix und fertig.«
Sein Gast hatte bei der Rede still dagesessen, den Kopf auf die Brust geneigt, die Hände zwischen die Knie geklemmt.
Nun hob er sein Gesicht, starrte über den Tisch und nickte mit seinem großen Kopfe nachdenklich ein paarmal. Dann erwiderte er: »Und wenn ich 's Geld neistecke und 's bleibt aus ...«
Schuster-Guste strich sich ärgerlich den gelben, harten Schnauzbart: »Nu, Karl, wenn du, und du gleebst's eben nie, da kann dir niemand helfen! Da bleibt dir eben weiter nischt ibrig, du verkeefst dei Wirtschaftl; denn ein Haus ohne Wasser is wie ein Kopf ohne Maul. Keefer findste ja. Der Freirichter paßt ja bloß druf. Verkeefs, zieh fort und pfeif of de Marie.«
Karl Exners bartloses Gesicht ward mürrisch wie ein Astknorren.
»Du sollst mir den Namen nich ins Maul nehmen!« schrie er ärgerlich.
»Ich wer dir se nich abspenstig machen. Wenn ich auch wollte. Da bin ich viel zu ein armer Teifel. Die will een, der mit'm Daumen fort kann. Das weeß ma schon.«
Mit einer bitter-ernsten Miene sah er vor sich nieder, indem er an seinem Schnurrbart kaute.
Mit tiefem Atemzuge, als schüttle er etwas ab, begann er von neuem.
»Na, die kann ja auch, wie die just is. Wie ne Pekunichruse und Haare wie geradewegs vom Goldschmiede. Die Marie!!«
Exners Backen ballten sich grimmig; er schluckte gewaltsam. Plötzlich hieb er auf den Tisch, daß es dröhnte.
Hinter der kleinen Tür an der rechten Wand regte es sich, und leise wankende Worte, einer Seele heimlich entflohen, stumm eine Strecke in die Luft gewandelt, wurden laut um sie. Gestaltloses Sprechen, das aus jener Stube zu rühren schien, in der die alte Mutter des Schusters schlief, und doch so klang, als ob der geformte Atem, fern von den Lippen, denen er entstammt, sich willkürlich zur Hörbarkeit rühre.
»Hörst's!« stotterte Exner. »Hörst's denn nie?« fragte er dringender in Angst, da der Schuster gleichmütig blieb.
»O ja«, antwortete er endlich, »de Mutter redt im Traume.«
Die Uhr holte zum Schlage aus und schlug sogar »zwölf«.
»Guste, 's is Mitternacht. Das is a Anzeechen«, redete Exner noch immer in tiefem Schrecken und starrte ins Leere.
»Wer denn? De Mutter? Nu, ja, 's a Anzeechen, daß se glei wach sein wird, wenn mr noch lange hier sitzen und plappern.«
»Treib kee Geheie, Schuster!« ermahnte Exner den Spötter. Der aber ward ärgerlich.
»Esel! mecht ma sprechen. Gleebst du denn wirklich an solche Tummheet?« fragte er geringschätzig. Dann kam er hinterm Tische hervor und streckte ihm die Hand entgegen.
»Aber gegraben wird!« mahnte er noch einmal. »Was will ich denn sonst anders machen!« antwortete Exner, noch immer aus einer Betäubung heraus und ging, ohne zu grüßen.
Draußen hing der dichte Nebel zwischen den Bäumen, daß es vollkommen finster war.
Exner wurde von dem Vorgefallenen noch ganz beherrscht und tat einige Schritte aufs Geratewohl vorwärts. Als er das weiche Gras unter seinen Füßen fühlte, erinnerte er sich, daß er nach Hause wolle, suchte in der Finsternis vergeblich nach dem Wege und blickte, um sich zurechtzufinden, in die Höhe. Da sah er zwischen den dunkleren Baumkronen die Richtung, die er zu nehmen hatte, als einen blassen Streifen stehen. Diesem folgte er, mit den Füßen auf der steinigen, steil ansteigenden Straße weitertastend. Je höher er hinaufstieg, desto heller wurde das bleiche Band über ihm, und desto deutlicher hoben sich eine Menge schimmernder Flecken darin ab. Nun trat er aus dem Nebel heraus, und spitz glitzerten über ihm in der tiefen Bläue der Nacht die Sterne. Darunter schwamm die milchweiße, schmale Sichel des Mondes wie der schimmernde Scherben eines zerschlagenen Bechers. »Derheeme«, murmelte er erleichtert, als gleich darauf ein einsames Gehöft an dem Walde im Dunkel sichtbar wurde.
Düster wie der Hintergrund, von dem es sich abhob, hatte es weit und breit keinen Gefährten. Verschlossen und stumm lag es da. Wie gierige Augen starrten seine kleinen glitzernden Fenster auf seine Wiesen und Äcker umher. Auch am Tage trat es nur wenige Stunden aus dem Dämmern des Waldes in das frohe, friedliche Licht der Erde.
Im Bannkreis dieses Geistes war Exner aufgewachsen, und nicht umsonst, er trug sein Vaterhaus in seiner Seele umher.
Vor zwanzig Jahren war er ein lustiger, wilder Junge gewesen. Kein Stein war ihm zu hoch, kein Graben zu tief: er hatte den Sprung gewagt. Da hatte er eines Tages, stundentief im Walde, auf seinen waghalsigen Streifereien den Fuß gebrochen. Lange hatte er hilflos allein gelegen und geschrien, bis aus seinem wunden Halse nur noch ein rauhes Stöhnen gedrungen war. Gegen Abend hatten ihn heimkehrende Holzmacher gefunden und auf einer Nähre aus grünen Tannenzweigen nach Hause getragen. Als der Vater den Knaben sah, geriet er in Wut, hieb ihn zur Hilfe durch und ging ärgerlich hinaus. Am andern Tage erbarmte er sich wohl seiner und sah sich den Fuß an, der nur mehr ein blutunterlaufener Klumpen war. »Kamillen und laues Wasser druf«, knurrte er mühsam und entfernte sich, ohne noch einmal zurückzusehen. Nach einem halben Jahre ging der Knabe aufrecht in der Stube; aber sein Fuß war klumpförmig verkrüppelt. Die Mutter weinte, als sie ihn so über die Diele humpeln sah. Der Vater erblaßte bis an die Zähne und verließ eilig das Zimmer.
Karl aber saß stundenlang auf einem Fleck und starrte stumm vor sich nieder. Wenn man ihn ängstlich aufriß, damit er »sich nicht versinne«, blickte er mit einem harten Ausdruck im Gesicht auf seine Umgebung. Die wilde Lustigkeit war seit dem Unglück ganz aus ihm geschwunden, er wurde mürrisch und wortkarg und zog sich von dem Verkehr mit gleichalterigen Knaben zurück. Seine Scheu und Verschlossenheit brachten ihn seinen Kameraden immer ferner, daß sie der Stimme ihres Mitleids kein Gehör schenkten und sein Gebrechen zur Zielscheibe des Spottes machten. Sie gaben ihm verschiedene Umnamen, blieben aber, nach wochenlangem Schwanken zwischen der Bezeichnung »Hipapi« und »Klumpen«, bei der letzten, weil in ihr nicht nur sein Fehler, sondern vor allem auch das Plumpe und Grobe seines ganzen Wesens mitgetroffen wurde. Karl Exner wehrte sich mit dem schrankenlosen Zorn seiner einsamen Seele gegen diese Lieblosigkeit, schlug seine Quäler bis zur Grausamkeit, spie und kratzte, stach mit Messern und hieb mit Peitschen. Es nutzte nichts, der Name »Klumpen« blieb ihm für sein ganzes Leben. Wie mit einem Ruck trat er aus der Gemeinschaft mit seinen Mitschülern ganz aus. Selbsteinsam, stumm ging er seine Wege, saß an gemiedenen Stellen an der Sonne, spielte an versteckten Orten und sah auf das lachende, laute, bunte Reich der anderen Kinder aus Augen, die der Neid bohrend, die Gehässigkeit verkniffen und geheime, dumpfe Trauer starr machten. Nie mehr versuchte er zu hüpfen oder zu laufen, weil dadurch sein Mangel nicht nur andern, sondern auch ihm deutlicher vorgeführt wurde. Mit krankhafter Peinlichkeit mühte er sich ab, das zuckende Niederrucken seines Körpers zu verhindern, sobald er das rechte Bein niedersetzte, an dem der Klumpfuß war. So hatte er die Gewohnheit, beim Gehen, das immer stät und gemessen blieb, den Kopf nach der linken Seite zu hängen, weil er dadurch die Empfindung eines gleichmäßigen Schrittes genoß, der ihn nicht von andern Menschen unterschied. Das glaubte er; in Wirklichkeit aber sah sein Gang sehr komisch aus.
Um sich nicht lächerlich zu machen, mied er auch die Spiele in den Pausen der Schulstunden. Dann versteckte er sich wohl und sah mit brennenden Augen und erbleichenden Wangen dem Hüpfen der Mitschüler zu, ging aber sofort gleichgültig weiter, wenn er sich beobachtet glaubte.
Einst überraschte ihn der Lehrer auf diesem Beobachtungsposten und versuchte ihn mit milden Worten und sanfter Gewalt dem lauten Jubel seiner Kameraden zuzuführen. Karl senkte stumm den Kopf, starrte vor sich hin und stemmte sich gegen den Druck des Lehrers, der ihn doch langsam vorschob. Plötzlich warf er sich zur Erde, heulte wie nach Hilfe grell auf, verzog das erschreckte Gesicht wie im Krampfe, schlug mit Füßen und Händen um sich wie ein Toller und schrie nur immer sein qualvolles, anklagendes: »Nee, nee, nee! Laßt mich, laßt mich!«
Seit diesem Tage war er auch in der Schule wie umgewandelt. Mißtrauisch und versteckt belauerten seine Augen den Lehrer. Seine Gleichgültigkeit gegen die Schularbeit nahm immer mehr zu und wich endlich, trotz der Anwendung des Stockes, vollständiger Abneigung gegen jede geistige Arbeit. Die härteste Strafe brachte zuletzt nichts als kalte Wut auf seinem Gesicht hervor, die in kurzer Zeit immer in eine verächtliche Miene überging. Deswegen begannen die Mitschüler, ihm furchtsam aus dem Wege zu gehen, da sie ihn mit Kräften ausgerüstet sahen, die auch dem Mutigsten unter ihnen fehlten.
Seine Eltern gingen zu sehr in ihrer Arbeit auf, es fehlte ihnen auch die leise, weiche Seele, ihn diesem Verlieren entreißen zu können. Sie sahen wohl, daß »der Junge ganz komisch« geworden war, ließen es aber in ihrem bäuerlichen Fatalismus gehen, denn »was soll da eens machen«? Und der kleine Klumpen ward, weil er doch Menschen brauchte, bei denen er niedersitzen konnte, ohne sich lächerlich zu machen, der Besucher in den Auszugshäusern bei den alten verhutzelten Weibern und den tapprigen, stumpfäugigen Greisen. Aber seinem Eintreffen ging nicht das entzückende Spiel verlangender Scheu und schämiger Zärtlichkeit voraus, womit die Kinder um die Neigung Erwachsener werben, noch lohnte er die gewährte Liebe mit der rührenden, vollen Hingabe, sondern stumm, mit niedergeschlagenen Augen, drang er in die dunklen Stübchen zu den Alten, grüßte verdrossen, als spucke er nur aus, setzte sich schweigend hin, blieb wortlos sitzen, verschloß sich allen Fragen, ging nach Stunden ebenso, wie er gekommen war, wiederholte seine Besuche und blieb dann ohne Grund ganz aus. Er nahm von den Runzelhänden weder Honigschnitten noch übersüßen Kaffee, er wartete nur versunken, bis die greisen Leute von ihrem Leben sprachen. Sie redeten keuchend davon, mit dünner, wehklagender Stimme, in jener verzückten Wirrheit, wie Märchen sich erzählen, schwiegen dann, wackelten mit den kahlen Köpfen und tasteten mit den fleischlosen Händen über den Tisch, als griffen sie nach dem Verlorenen. Der Klumpen saß auf verborgenem Platz, sog all den Aberglauben dieser heimkehrenden Menschen wie im Durst ein und ging dann geräuschlos hinaus. Die Verzücktheit seines Auges war sein einziger Dank.
Auf seinen einsamen, verborgenen Gängen fügte er sich aus jenen verwunschenen Geschichten eine weltabgewandte, lebensfeindliche Lehre zusammen; aber sie blieb sein Geheimnis. Nur manchmal glomm sie heiß aus seinen Augen und zuckte um seine unschönen, schmalen Lippen. So wuchs er auf: fern, ernst und einsam.
Später fand sich zu seinen unglücklichen Eigenschaften noch eine Geldliebe, die an Geiz grenzte. Keinem borgte er. »Der Klumpen hat kee Geld zum Wegborgen.« Auf diese Weise fertigte er Darlehnssucher ab.
Nur Schuster-Guste konnte von ihm verlangen, was er wollte; nie bat er umsonst. Denn stets hatte er in der Schule leidenschaftlich und laut schreiend für ihn Partei ergriffen, wenn andere ihn verhöhnten; und noch heute verteidigte er ihn, so gut es ging. Darum hing der Klumpen mit Inbrunst an ihm. Dieser einzige war seine ganze Menschheit. Für die andern blieb er öde und unwirtlich wie ein Stein. Mit der Zeit freilich hatte sich auch dieses Verhältnis gelockert.
So war er fünfundzwanzig Jahre alt geworden. Da lächelte er seit seinem Unglück zum ersten Male recht aus Herzensgrund.
Es war in der Nacht. Man riß ihn aus dem Schlafe und rief ihn nach unten. Sein Vater lag im Sterben.
»Komm her, Karle«, sprach der Kranke, als er des Klumpen ungleichen Schritt auf der Diele hörte. »Du bist lahm, aber ich bin schuld – ich alleene«, vollendete ei mit furchtsamer, ausgehender Stimme.
Der Klumpen wurde bleich und blieb still.
»Komm her, Karle«, tönte es wieder bittend.
Er ging naher und schlug mit dem Klumpfuß hart auf. Davon fuhr der Sterbende wie von einem unvorhergesehenen Schlage zusammen und stöhnte, noch eindringlicher bittend: »Gib mr die Hand! – Bist de noch beese of mich?«
»Nee.« Es klang trotzig, gehässig; er dehnte das Wort zwischen den Zähnen.
»Du bist gestraft durch mich«, mit diesen Worten erholte sich der Kranke von einer Ermattung. »Du sollst auch 's Beste haben. – Bei Freirichters Pusche – de Wirtschaft – is deine. – Ich ha se dir – schon verschreiben lassen. – Bis fleißig wie immer und bet fir mich...« Da rasselte es in der Brust des Alten. Es war auf ewig vorbei mit ihm.
Der Bruder wand die Hände. Die Weiber warfen sich weinend zur Erde. Der Lahme stand starr wie aus Stein da und lächelte.
Das sollte wohl heißen: »Jetze fängt's an.«
Und heute lächelte er wieder, da er sich spät in die Decke einwickelte. Er schloß die Augen, um besser sehen zu können. Licht und weich, wie in den fernen Tagen seiner freudevollen Kindheit, strich es über sein Herz. In stummer Seligkeit erbebte sein Inneres vor dieser wunderbaren Heimsuchung, und lächelnd sank er endlich in Schlaf.
2
Exners Denken lag im Blut; er tat, was er mußte. Langsam, mechanisch, widerstrebend, wie eine Zange erfaßte sein Geist einen Vorsatz und ließ ihn nie wieder los. Wenn so sein Wollen Instinkt geworden war, dann sah er nur vorwärts, und nicht eher gab es ein Ausschnaufen für ihn, ehe nicht die Erfüllung hinter ihm lag. Nach kurzer Ruhe war er am andern Morgen auf den Beinen. Seine Schwester ging eben mit dem Melkgerät und der Laterne über den Hof, als er der kleinen Ausgangstür zuschritt, den Kopf wie immer seitwärts und nach vorn hängend, ernst und verschlossen, ohne zu grüßen. Er schritt die Dorfstraße hinab und bestellte den alten Freiwald, einen guten, weisen Greis, mit dem er schon früher manches besprochen hatte, auf sein Anwesen am Freibusch, damit endlich mit dem lange geplanten Bau des Brunnens begonnen werde.
Um sieben Uhr, eben da die Sonne einen roten Qualm, das Licht ihrer unmittelbaren Nähe, durch die schwarzen Baumkronen vor sich heraustrieb, langten die beiden auf der Arbeitsstelle an.
Nach langer Beratung, die mit allerhand geheimnisvollen, sehr umständlichen Messungen seitens des alten Freiwald verbunden war, hieben zwei Rodehauen in den Rasen an der linken Ecke des Wohnhauses, nicht allzu weit von der Eingangstür. Nach dem dritten Schlage aber schüttelte der Alte den Kopf und wandte sich an den Klumpen: »Aber das is ja ein Born, wie 'n ein Bauer nich größer braucht.«
Der Klumpen sah ihn eine Weile mißmutig an und antwortete dann mit schlecht verhehltem Ärger: »Ich denk halt, zu viel Wasser is besser als zu weng.« »Aber sieh och...« »Hack, Freiwald, hack du och!«
So schüttelte er den unnützen Frager von sich ab und schlug dann mit Wucht seine Spitzhaue in den Boden.
»Ein rauhes Geschmeiß is er schon«, dachte der Brunnenbauer bei sich und setzte auch die Arbeit wieder fort.
Noch mehreremal versuchte er ein Gespräch mit dem Lahmen einzuleiten, um bei dieser Gelegenheit eine gemächliche Pause zu erlangen, aber sein Arbeitgeber war taub vor Fleiß. Nur hin und wieder richtete er sich auf und sah verstohlen auf sein Haus.
Das ähnelte seinem Vaterhause. Nichts unterschied es in der Bauart von den andern Wirtschaftsgebäuden des Dorfes: Wohnung und Stallung unter einem Dache, der eine Teil aus vierkantig behauenen Balken, der andere aus Steinen. Eine schmale Flur, von der eine steile Stiege nach dem Boden, »der Bühne«, führte, schied beide Teile innen voneinander.
Rechts von der Flur führte eine Tür in die Wohnstube; ein kleines Türchen links war der Eingang zur Stallung, über der der Heuboden, neben der ein kleiner Holzschuppen noch Platz unter dem gemeinsamen Dach gefunden hatte.
Es war ein sauberes Häuschen mit seinen weiß getünchten Ballen und den braun gestrichenen Wechseln dazwischen. Aber es lag der gleiche Geist der Unwirtlichkeit und Freudlosigkeit darum. Anstatt seine Fenster nach der Straße zu kehren, um in behaglicher Neugier das spärliche Leben zu betrachten, das auf dem Wege zwischen Steindorf und Erlengrund sich entwickelte, starrten die kleinen Öffnungen in mürrischer Öde in den nahen Wald, der sich in Steinwurfsweite vor der nach Osten gekehrten Front des Hauses hinzog. Dazu erhob sich nach der Straße zu ein meterhoher Wall aus Rodesteinen, eine Mauer, wie die Steindorfer sagen, der jeden neugierigen Blick von oben abhielt und nur dem Dach eine Umschau gestattete.
Aber so gefiel es dem Klumpen eben. Und jedesmal überkam ihn tiefe Heimsicherheit, wenn er, auf dem schmalen Zufahrtswege herabschreitend, durch die Lücke der Mauer in sein Reich trat. Schmunzelnd sah er dann die schmale, lange Feldflur auf und nieder.
Hier nahm sein einsames Brüten Gestalt an, und in seinen Augen glomm es, um seine Lippen zuckte es. Die Besitzung war schuldenfrei, und tausend Taler hatte er noch ausstehen. War es da denn nicht möglich, daß die Grenzen hinausrückten und seine Kühe über die Mauer stiegen, um jenseits zu grasen, weil das Land hier auch sein geworden war?! Dann wuchs vor seinen sehenden Augen an Stelle des engen Hauses ein behäbiger Bauernhof mit Mauern umschlossen wie eine Stadt, einem Taubensöller neben dem riesigen Düngerhaufen und einem zweiflügeligen Tor als Einfahrt. Dann wird sich kein Mensch mehr trauen, ihm den häßlichen Spitznamen zu geben oder Späße über ihn zu machen.
Doch zu niemand sprach er von seiner Sucht. Seine Geschwister, seine Mutter, selbst der Schuster waren Fremdlinge in der Welt seiner Seele. Er aber säugte sie mit all seinen stummen Stunden, daß sie endlich zu einem klaren, peitschenden Plan geworden war.
Indessen war es zehn Uhr geworden. Sie standen schon bis an die Hüften in der Erde. Der Klumpen hieb die Haue in die Steine und richtete sich auf. Freiwald stellte die Tätigkeit auch sofort ein und sah ihn verwundert an.
»Wird's Wasser haben?« fragte der Lahme. Der Alte fuhr mit dem Rücken seiner Hand über den Mund und schickte sich mit einem überlegenen Lächeln zu einer umständlichen Darlegung an:
»Born is nicht Born«, begann er dann, »'s sein'r zweeerlee: Grundborne und Quetschborne. Der Grundborn is der richtige, der hat Seelenwasser, direkt aus der Erde ruf. Der Quetschborn is ja auch gut. Denn ei der Erde drunten, da is nischte tot, da is lebendig ei der Nacht, und Wasser gehn hin und her, 's fließt, macht Tümpel, allerhand. Bei eem Quetschborne geht's Wasser bloß durch; regnet's viel, hat's viel; is 's dirre, bleibt der Born leer.«
»Nach und mei Born?« fragte der Klumpen ungeduldig dazwischen.
»Das is eben«, setzte Freiwald unbeirrt seine langwierige Erklärung fort, »das is eben. Es is ein Quetschborn, der de 's Wasser vom Rollberge kriegt; aber wenn mr den gelben Steen, of dem mir jetzte sein, durchschlagen, kommt der weiße und zuletzt der blaue, auf dem steht das Seelenwasser. Siehste, Kl... Karle, Seelenwasser. Das is aso, deine Seele is das Inwendigste. Deswegen und weil das Grundwasser aus dem Allertiefsten kommt, dort wo, ma mecht fast sprechen ...«
Das dauerte dem Lahmen doch zu lange. Er stieß des Alten schöne Weisheit gleichsam mit dem Fuße fort, indem er fragte: »Also, wird's Wasser haben oder nich?«
»Freilich, freilich; aber tief wird's halt sein«, gab der Greis zurück und lächelte mitleidsvoll über den Klumpen. –
In rauhem, rücksichtslosem Fleiße trieb der Lahme so den Alten durch die Tage. Der ward immer verdrossener, da dieser viehische Eifer seiner Tätigkeit die ganze Seele nahm und nichts als leere Handgriffe übrigließ, die ihn ermüdeten und quälten. Mit Wut hieb er darum drauf zu, um so schnell als möglich in eine Tiefe zu kommen, wo das Tageslicht aufhörte und er nur allein arbeiten konnte. Und als er nun wieder in der dumpfen Nacht mit dem roten Lichtlein in der Laterne allein war, erwachten alle rätselhaften Betrachtungen und Geschichten, mit denen er seine gemächliche Geschäftigkeit zu begleiten gewohnt war. Er füllte den Korb mit dem losgeschlagenen Gestein, und auf ein Zeichen ward die Last von dem Lahmen an einem Seil, das über eine Welle lief, heraufgedreht. Nun trat auch wieder ein freundlicheres Verhältnis zwischen den beiden ein, wenn der Klumpen auch oft grob in das Loch hinunterschimpfte, da das Signal zum Emporwinden nach seiner Meinung oft zu lange ausblieb. Freiwald gab sich dann den Anschein, als höre er das in seiner Tiefe nicht, und der Klumpen gewöhnte sich, die langen Pausen mit seinen verheimlichten Träumen auszufüllen. Oft stand er still und lauschte auf das Pochen der Haue, das von Tag zu Tag schwächer zu hören war. Hin und wieder tönte auch das Husten des Alten herauf. Aber das Wasser blieb aus, obwohl schon zwei Feuerleitern hatten aneinandergebunden werden müssen.
Eines Tages übermannte den Klumpen der Zorn. Denn er hatte sich die Ausgaben zusammengerechnet und schrie hinunter:
»Bist'n bale of'm Plenter?« – »Wudelsack!« setzte er leiser hinzu. »He!« gurgelte er noch wütender, weil er keine Antwort erhielt, und wiederholte seine Frage unter Aufwendung einer solchen Lungenkraft, daß seine Stimme überschnappte.
»Ach was, Plenter!« murmelte es höhnisch herauf. Exmer hielt einen faustgroßen Stein in der Hand und warf ihn ärgerlich hinab, als er das hörte.
»Karle, laß die Tummheet! 's ging grade am Arm runter. Wenn de das noch amal machst, komme ich ruf und laß dr den Krempel liegen«, schrie Freiwald erbost.
»Hol dich der Teufel«, knurrte der Klumpen, hockte sich auf die Winde und begann abermals mühselig seine Ausgaben für den Born zusammenzuzählen. Es wurde nicht weniger, ob er die kleinen Posten voran und die großen ans Ende stellte oder es umgekehrt machte, und mißmutig blickte er umher. Der Frost hatte begonnen, eine schneelose, grimmige Kälte, in der das heraufgewundene, feuchte Gestein sogleich zusammenfror. Wenn och der Schnee noch bliebe, dachte der Lahme. Aber über dem Rollenberge standen schon seit gestern grauweiße schwere Wolken. Die Luft durfte sich nur erwärmen, dann ging das Schneetreiben los, und die Arbeit mußte bis zum Frühjahr ruhen.
Endlich, nach zwei Tagen, schrie es hohl aus dem Brunnen: »Wasser, Wasser!«
Die Leitern klapperten, und schweres Stampfen kam höher. Der Klumpen warf in glücklichem Schrecken weg, was er in der Hand hielt, stürzte an den Born und rief hinunter: »Bring Wasser mit! Wasser! Wasser!«
Nach einer Weile tauchte Freiwald auf und reichte ihm eine Flasche mit schmutzigem Wasser hin, bei deren Anblick der Lahme zurückprallte. Der Alte lachte: »Nu, nu, nimm se och schon! Zuerst is 's Wasser halt nie anders. Das setzt sich schon, wenn's ruhig wieder zu sich gekommen is. Nimm's und verlaß dich of mich, 's schmeckt reen!«
Der Lahme kostete. Das Wasser war dumpfig und lehmig. Aber über sein fahles Gesicht ging ein Schimmer, denn er schluckte den Trank seiner Zukunft.
»Wird's aushalten?« fragte er nachher, sich wieder verdüsternd.
»Auch nu, ma denkt doch«, antwortete der Greis zögernd und richtete nach kurzem Überlegen sein Auge ernst auf den Frager. »Ich für mich kann sagen: ja. Aber was nützt das. Ich hab'm rausgeholfen, und es kam, denn mei Hand is reen und mei Gemüte gut. Ob's aber dableibt, steht bei Gott und dir. Viel Glücke!«
In treuherziger Ergriffenheit streckte er dem Klumpen die Hand hin. Während sie fortgingen, begann sich die Luft mit seinen, weißen Stäubchen zu füllen, die wie winzige Nadeln stachen, wenn der heftige Wind sie gegen die Haut trieb. »Über Nacht wird's weiß werden«, sprach der Alte.
»Mir schmeißt's nischt mehr um«, erwiderte der Klumpen in verhaltener Freude. Danach trennten sie sich stumm voneinander.
3
Seit Neujahr diente auf dem Freirichtergute bei Herrn Wende eine neue Magd. Ihr Zuzug fiel in den Winter. Deswegen kam sie wenigen des Dorfes zu Gesicht.
Ihre Anwesenheit erregte vor allem die liebefähigen, jungen Burschen von Steindorf, und die Forschesten unter ihnen näherten sich ihr, um eine tagesübliche Liebschaft anzubandeln. Nach kurzer Zeit nannten sie das Mädchen eine »tumme Gans« und fluchten laut.
Zu Beginn des Frühjahrs wußte man noch nicht mehr, als daß sie Marie Alke heiße und aus Schlesien stamme. Man nahm ihr das herrische Wesen übel und nannte sie die »schlesche Marie«. Das war ein Schimpfname, denn der Grafschafter meint, alles, was aus Schlesien stamme, sei herzlos und grob.
Marie kümmerte sich nicht im mindesten um diese Treibereien. Sie behandelte das Mitgesinde als ihrer nicht ebenbürtig und sprach zu ihnen, wie aus einem anderen Stande heraus, mit einer zurückhaltenden Freundlichkeit, die ihr den Haß und die Verfolgung der Dienstboten eintrug. Die größten Grobheiten ließen sie anscheinend ruhig.
»Ihr seid ebenst noch awing siehr weit zuricke«, sagte sie achselzuckend und ging.
Als aber das feindselige Treiben der Mitdienenden gemeine Formen annahm, trat sie kurz entschlossen vor den Freirichter und erklärte, den Dienst verlassen zu müssen, wenn er ihr nicht Ruhe schaffe. Wende fuhr mit wütendem »Kreuzverflucht« unter sie. Seitdem wagte sich niemand mehr an sie heran, die, ohne aufzusehen, ihre Arbeit weiterverrichtete und in nichts einen Hohn merken ließ. Sie strengte sich nur noch mehr an und ließ sich von ihrem verdoppelten Fleiße nicht abhalten, obwohl ihr das Titel wie: »Herrnaas« oder »Schlange« einbrachte. Konsequent schloß sie sich von allen Vergnügungen aus, die ihre Mitmägde aufsuchten. Wenn diese nach Beendigung der Arbeit sich mit den Knechten laut lachend in der verrauchten Gesindestube balgten, saß sie an dem mächtigen Tisch und brachte sich beim Schein der kleinen Hängelampe ihre Kleider in Ordnung oder wusch Wäsche.
Nahmen Rede und Spaß dann abstoßend sinnliche Formen an, so verließ sie schweigend den halbdunklen Raum und legte sich zu Bett oder ging auf den Hügel hinter dem Hof, von wo aus man über das Tal hin die tiefe Einschluchtung des Warthapasses sehen konnte.
Stiegen an klaren Abenden aus dem seinen Dunste der Ferne die schattenhaften Umrisse ihrer Heimat auf, dann ward ihr großes, blaues Auge glänzend, und sie beugte sich nieder, brach eine Blume ab und steckte sie sich ins Haar, als müsse sie sich bei den Gedanken schmücken, die dann über sie kamen. Sie sah an solchen Abenden mehr als fernes Land, es stieg mit jener weitabliegenden Gegend ein Leben für sie auf, wonnig und süß, das einst das ihre gewesen war und anders ausgesehen hatte als dies Dasein in der Zwangshöhle der Knechtschaft.
Sie entstammte einer reichen Bauernfamilie des Frankensteiner Kreises. Ihr Vater war von dem Millionenrausch der siebziger Jahre gepackt worden, hatte die ehrliche Lederhose ausgezogen und die kurze Pfeife aus dem Munde gerissen. Fensterwagen und betreßte Kutscher, Jagdvergnügen, Weinjubel; er ritt auf den rollenden Talern durch die tollen Gärten des Genusses, und hinter ihm machte sich schweigend der Konkurs auf und verfolgte ihn. Nach ein paar lärmenden Jahren ward er von ihm eingeholt, und unter dem Hammer zerstoben jäh die Schemen seiner kurzen Lust.
Er verschwand spurlos, und seinem kleinen, zierlichen Weibe grub indessen der Gram in einem Winkel des Friedhofes ein Grab. Als er damit fertig war, an einem dämmerigen Abend war es, kam er von dem Totenacker herein, machte leise die Tür auf und klopfte an ihre linke Brust. Das müde Herz gehorchte eilig und hing sogleich still wie eine verstummte Glocke. Ihr Gesicht lächelte, und die Seele breitete geräuschlos ihre Schwingen aus und floh zum Vater. Der Wind des Schicksals streute die Kinder umher und pflügte in ihre jungen Gemüter mit den Stacheln trüber, freudearmer Jahre herbe Erinnerungen.
Marie, das zweitälteste Kind, war zu jener Zeit erst sieben Jahre, voll der Sonne. Sie fand bei einem Bruder ihres Vaters, einem harten, geizigen Manne, Unterkunft, der sie um der Schuld des Bruders willen verachtete und unterdrückte. Er tat es, um den Leichtsinn aus ihr zu vertreiben, wie er sagte. Das aber war nur ein Vorwand, um ihr das Essen öfters entziehen und sie mit Arbeit überladen zu können. Allein der Stumpfe wußte nicht, daß Kinder von ihrer Seele leben, die auch in der schmutzigsten Ecke ihre schimmernden Paläste errichten kann. So gedieh das Kind trotzdem zu immer größerer Schönheit und Kraft. Diese Schönheit war mit den Jahren noch gewachsen, und Marie hatte all ihr Hoffen auf sie gebaut. Sie sollte ihr in das Leben ihrer frühen Kindheit verhelfen, das ihr wohl nur deswegen so gar begehrenswert erschien, weil sie es nicht bewußt kennengelernt hatte. Darum hütete sie die langen, schweren Goldflechten ihres Haares, setzte das seine, frische Gesicht nie der brennenden Sonne aus und schmückte sich mit all dem billigen Glanz, der von Hausierern feilgehalten wird.
Mit verlangendem Herzen stand sie in dem Winkel ihrer niedrigen Stellung und harrte des Erlösers. Wenn sie mutlos werden wollte, dann durfte sie nur heimlich im Lichte der Dachluke auf ihrer Kammer das Gesicht in dem kleinen Spiegel betrachten, so war sie ihrer Sicherheit wieder gewiß, daß eines Tages der reiche, schmucke Bauer zu ihr treten und sie als Weib in seine Fülle führen werde. Sie kannte ihn nicht, aber er war vorhanden und verlangte geheim nach ihr, und sie machte sich ihm kostbar mit dem Stolz, dem Entbehren aller gewöhnlichen Vergnügen, der Freude an ihrer Schönheit und dem nie erlahmenden Fleiß. Mitten im Sommer sah sie den Mann, an den das Schicksal sie ketten wollte.
Es war zur Zeit, da die Sonnenstrahlen die reifenden Kornähren in ihrer Glut wiegten, eines Sonntagnachmittags. Die Heimchen fühlten schon die Dämmerung und begannen verstohlen zu zirpen; der Wald stand unbeweglich versunken; das Leben lag auf dem Raine und schlief. Da ging Marie zwischen den Feldern hindurch, mutterseelenallein, und sah immer vor sich nieder, wie einer, der erwartet, daß das Glück ihm über den Weg laufe, eilig und unvermutet wie ein weißes Wieselchen. Plötzlich sank ein Schatten in die stillen Halme neben ihr, und als sie erschreckt herauffuhr, stand ein großer, starkknochiger Mann vor ihr, dessen ungewöhnlich langen Beine in blanken, bis an die Knie reichenden Schaftstiefeln steckten. Seine Arme hingen straff an dem kurzen Leibe nieder, als würden sie durch das Gewicht der übergroßen Hände angespannt. In dem fahlen Gesicht stand eine hilflose Freude, die leeren Augen starrten ratlos aus dem gelblichen Weiß, und obwohl um die ganze Gestalt etwas Beklemmendes, Furchterweckendes lag, war Marie doch gegen das Klopfen ihres geängstigten Herzens einen Augenblick angenehm berührt, wegen der stummen Bewunderung, die durch all dieses der häßliche Mensch ihrer Schönheit zollte. Eine seltsame Pein verhinderte, daß sie so schnell, wie sie wollte, an ihm vorüberschreiten konnte. Von einem rätselhaften Krampf befallen, vermochte sie ihren Blick nicht von ihm zu wenden. Erst als das Glimmern seines Auges, kleine Falten um die Lippen und ein unverständliches Murmeln ihr klar bewiesen, daß er sie anreden wolle, fand sie die Kraft, weiterzuschreiten, bemerkte aber noch, wie er einigemal mit dem Kopfe nickte, daß die Schildmütze über seine Stirn fuhr. Diese Bewegung verwandelte plötzlich den ganzen Vorgang für sie in ein komisches Ereignis.
Den stummen Gruß des Mannes vorsichtigerweise leise erwidernd, huschte sie fort. Endlich wagte sie, sich umzublicken. Zwischen den Kornbreiten, schon so weit von ihr entfernt, daß sein Leib nur noch zur Hälfte aus dem reifen Getreide ragte, sah sie ihn sich eigentümlich ruckend fortbewegen. Sein Kopf aber hing dabei auf die linke Seite.
Sie atmete erleichtert auf und lächelte, da sie sich wieder vorstellte, wie er vor ihr gestanden und mit dem Kopf genickt hatte, daß ihm die Schildmütze auf die Nase gefahren war. Es befreite sie jedoch nicht von einem rätselhaften Klammern, einer Furcht, die, so grundlos sie auch sein mochte, doch nicht von ihr wich. Sie zu verscheuchen, bemühte sie sich, an ihre »scheene Zeit« zu denken, an den »langen Sonntag«, wie sie ihre Zukunft nannte. Allein die Bilder, die sie rief, standen nicht auf, die Lieder, die sie ersehnte, klangen nicht. Vom Dorfe herüber hörte sie Kühe brüllen, Kinder zetern, ein Schubkarren quietschte, Hunde bellten, und dazwischen fuhr in Absätzen das Schreien eines zornigen Mannes. Traurig ging sie nach Hause.
4
Die Steindorfer hängen wie fast alle Grafschafter am Katholizismus. Dieser ist nicht nur alleinseligmachend, sondern gewährt auch auf der beschwerlichen Reise zum Himmel manchen Tag, an dem man seinen Arbeitskittel ausziehen kann, den Sonntagsflausch umhängt, gemächlich sich eine Zigarre anraucht, ein Spielchen macht und einen Schnaps dazu trinkt. Was hatte man sonst von dem mühseligen Leben, wenn neben den Sonntagen, die ohnedies sind, nicht noch ein paar Feiertage wären!
Aber wenn man die Finger nimmt und sie herzählt, die schönen Tage, die mitten in der Woche kommen, einem leise die Hacke aus der Hand nehmen, den Pflug oder den Rechen, wie ein lieber Freund, der einem gern eine Freude bereitet, und recht ordentlich sagen: »Mein Guter, halt! halt! Verschnauf und laß deine Seele auch einmal Atem holen«; wenn man das zählt, bleiben leider noch einige Finger an den beiden Händen übrig, an denen kein Sonnenschein hängt.
Darum kann's niemand einem guten Christenmenschen übelnehmen, daß er dieser fehlerhaften Einrichtung etwas nachhilft und auf eigne Faust mitten in den Trubel der Woche so einen lachenden Tag pflanzt. Heilige hat es genug, so wird es nicht allzu schwer. Diese vernünftige Ansicht fand auch in Steindorf Anhänger, und obwohl der kleine Ort keine Kirche und darum auch keine Chorsänger hat, feiert man am 17. November jedes Jahres das Fest der heiligen Cäcilia.