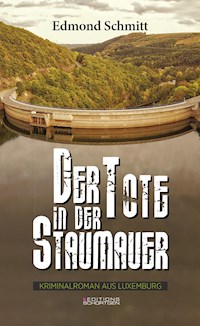Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Schortgen SARL
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriegsjahr 1943. Unweit der deutsch-polnischen Grenze? Der luxemburgische Waisenjunge und Zwangseingezogene Erny Pickard ist auf der Heimreise aus dem Arbeitsdienst. Da gerät er auf dem Bahnhof Frankfurt/Oder in den verheerenden Luftangriff anglo-amerikanischer Fliegender Festungen. Mit bloßen Händen gräbt er mühevoll aus einem Bombentrichter, zwischen Gestein, Schlacken und ausgerissenen verbogenen Eisenbahnschienen, eine verletzte und bewusstlose junge Frau aus? und findet ein vergoldetes Medaillon mit dem eingravierten Namen Antoinette. Jahre später begibt er sich auf die Suche nach Antoinette - nicht wissend ob sie damals mit dem Leben davongekommen war. DAS MEDAILLON ist ein Roman mit Schmerz, Leidenschaft und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prolog
Oktober 1932... Ein trüber Freitagnachmittag. Leichter Nieselregen geht über den ausgedehnten Wäldern am Rande des lothringischen Grenzstädtchens Longwy nieder. Langsam tastet sich ein Lastwagen mit luxemburgischer Kennnummer über die nasse und frisch makadamisierte Landstraße.
In der Einbuchtung, die der Straßenbauverwaltung für die Dauer ihrer Arbeiten als Lager- und Abstellplatz des Materials dient, hält er an.
Ein Mann um die vierzig, groß, hager, in blauer Arbeitskleidung, steigt aus. Vorsichtig schaut er sich um. Dann fasst er ein Barrikade- und ein Umleitungsschild, wirft beide auf die Ladefläche seines Fahrzeuges, ein brauner Ford, Baujahr 1927.
Schnell setzt er sich wieder hinter das Lenkrad. Der Motor heult auf. Das Gefährt verschwindet hinter einer unübersichtlichen Kurve.
Ein paar Kilometer weiter, da wo eine schmale Nebenstraße nach rechts abbiegt, stellt er das Fahrzeug entlang des dichten Mischwaldes ab.
Wieder steigt der Mann aus. Mit wenigen geübten Handgriffen montiert er die polizeilichen Autokennzeichen ab.
Dann klettert er, einen Feldstecher in der Hand, auf eine leichte Anhöhe seitlich der Fahrbahn. Von hier hat er freie Sicht auf die langgezogene Hauptstraße, auf der um diese Zeit nur wenig Verkehr herrscht.
Eine knappe halbe Stunde mag er hier verweilt haben, als in der Ferne ein Kastenwagen auftaucht. Aufgeregt dreht er an der Einstellung seines Fernglases, bis er das dunkelgrün gestrichene Fahrzeug scharf im Blickfeld hat.
‚Das ist er!‘, raunt er halblaut vor sich hin, springt von dem Hügel herab und zerrt die beiden Schilder von der Ladefläche.
Das rot-schwarze ROUTE BARRÉE stellt er mitten auf die Hauptstraße, um die Durchfahrt zu unterbinden - das mit der Beschriftung DÉVIATION und dem nach rechts zeigenden Pfeil dicht daneben, um den Verkehr auf die Nebenstraße zu lenken.
Dann reißt er seine beiden Hosenbeine bis ans Gesäß auf, beschmiert Schenkel und Arme mit blutroter Farbe, knotet einen Wollschal vor das Gesicht, und holt vom Lieferwagen ein altes halbverrostetes Fahrrad. Das wirft er auf die enge Fahrbahn und legt sich daneben.
Nun ist der Moment da, dessen Szenario er sich in den vergangenen zwei Jahren ausgedacht und so oft vorgestellt hatte, seitdem der für Geldanlagen zuständige Beamte einer französischen Großbank ihn überredete, in Aktien einer afrikanischen Eisenbahngesellschaft zu investieren.
Als die in einer großangelegten Publizitätskampagne so warm empfohlene und solide Rendite versprechende Gesellschaft kurze Zeit später Konkurs anmeldete, hatte er von einem Tag zum andern seine schwer erwirtschafteten Ersparnisse buchstäblich in den Sand gesetzt und fast sein gesamtes Vermögen verloren. Zusätzlich musste er noch das Honorar seines Anwalts bezahlen sowie auch die Kosten des Gerichtsprozesses, den er gegen die Bank angestrengt und verloren hatte.
Durch diese Fehlspekulation - für die er die Bank verantwortlich macht - steht er seitdem vor dem finanziellen Ruin. Deshalb will er sich jetzt sein Geld auf diese Weise vom Bankinstitut zurückholen.
Nur deswegen hat er den Überfall seit langem geplant und minutiös vorbereitet.
Es ist ihm bekannt, dass jeden Freitag ein Geldtransporter der Bank zu den verschiedenen Filialen fährt, um die im Lauf der Woche eingegangenen Gelder abzuholen und zur Hauptkasse zu bringen. Wochenlang hat er die Strecke abgefahren und die genauen Uhrzeiten des Spezialfahrzeuges exakt notiert.
Soviel er feststellen konnte, wird das Fahrzeug mit den eingesammelten Geldern jedesmal von den gleichen zwei Angestellten gefahren - die unbewaffnet sind.
Zur Durchführung seines Vorhabens hat er sich schlussendlich für diese Stelle in der bewaldeten vallée de la chiers entschieden.
Noch keine zwei Minuten liegt er regungslos auf dem nasskalten Asphalt. Dann hört er herannahendes Motorengeräusch und gleich darauf das Kreischen der Bremsen.
Nur kurz vor ihm kommt der Kastenwagen zum Stehen.
„Das war knapp!“, entfährt es dem erschrockenen Lenker.
„Oje. Schau dir das an. Den hat es aber schwer erwischt“, seufzt der Beifahrer.
„Was nun? Er liegt mitten auf der Fahrbahn. Ich komme nicht vorbei.“
„Da bleibt nur eins: wir müssen aussteigen und ihn zur Seite legen!“
„Aussteigen ist gegen die Vorschriften!“
„Ich weiss. Aber was willst du sonst tun? Zurückfahren?“
„Dann verlieren wir zuviel Zeit. Also gut. Steigen wir aus!“
Behutsam beugen sich die beiden über den regungslos am Boden Liegenden - und erbleichen, als sie unverhofft in den Lauf seiner Pistole starren.
„Hände hoch!“, befiehlt drohend der angeblich Schwerverletzte und springt auf.
Sogleich hallt ein Schuss durch die Stille des Waldes. Zischend entweicht die Luft aus dem linken Vorderreifen des Geldtransporters.
„He Mann. Mach doch keinen Mist!“, stammelt verängstigt der Ältere. „Ich habe Familie mit drei Kindern.“
„Dann macht beide genau was ich euch sage!“, bellt der Vermummte. „Stellt zuerst die beiden Schilder so auf, dass der Verkehr wieder normal geradeaus läuft und diese Straße gesperrt ist. Und dann öffnet ihr die Panzertür und ladet das ganze Geld auf meinen Laster und legt die Abdeckplane darüber! Und kommt nur nicht auf dumme Gedanken!“
Eiligst stellen die beiden Bankangestellten die Barrikadenschilder um.
In diesem Moment dreht sich der Schlüssel im Sicherheitsschloss des Geldtransporters. Langsam öffnet sich die Tür.
Da dröhnt wieder ein Schuss!
Entsetzt starrt der Maskierte in Richtung Tresorraum. Während sich seine Arbeitsjacke in Höhe der Brust rot färbt, hebt er seine schwere Armeepistole und drückt ab. Dann beginnt er zu wanken und fällt rücklings zu Boden. Neben ihm bildet sich eine Blutlache.
Fast gleichzeitig erscheint torkelnd in der geöffneten stählernen Tresortür ein uniformierter Mann - ebenfalls einen Revolver in der Hand. Auch er bricht zusammen und fällt herab - auf den Straßenbelag. Aus seiner klaffenden Kopfwunde rieselt Blut.
Zitternd starren die beiden Fahrer auf die zwei vor ihnen am Boden liegenden bewegungslosen Körper.
„Ist er... sind sie tot?“, stottert der jüngere, leichenblass.
„Ja!... Alle beide!“, murmelt sein Kollege.
„Mein Gott. Und das gleich am ersten Tag, an dem uns ein bewaffneter Begleiter zugestellt worden ist, so als hätte die Direktion einen Überfall vorausgesehen.“
1.
Der Tag war dem Abend gewichen. In Pfaffenthal, dem idyllisch am Ufer der träge fließenden Alzette und zwischen den trutzigen Verteidigungsanlagen der einstigen Festung Luxemburg eingebetteten Vorstadtort, hatten die meisten Häuser bereits die Klappläden geschlossen oder die Jalousien heruntergelassen, um Nässe und Kälte abzuhalten.
Von der Oberstadt her ritten auf der um diese Zeit fast menschenleeren Straße zwei Gendarmen ins Tal.
Vor einem alleingelegenen Haus und dem angebauten Schuppen mit dem großen Emailleschild Léopold Pickard Kohlen & Briketts, zügelten sie ihre Pferde.
„Hier ist es!“, sagte der ältere und zog die Kette der Hausglocke.
Meine Mutter erschrak heftig, als sie die Haustür öffnete und im Schein des aus dem Flur fallenden Lichtes zwei Uniformierte vor sich stehen sah.
„Verzeihung. Sind Sie Madame Pickard?“, fragte einer der Gendarmen und hob die rechte Hand zum Salut an seine Kappe.
„Ja. Weshalb?“
„Ich bin Leutnant Schneider von der Berittenen Gendarmerie“, stellte er sich vor. „Das ist Adjutant Metzeler“, und zeigte auf seinen jüngeren Kollegen.
„Ist etwas passiert?“, fragte meine Mutter aufgeregt.
„Dürfen wir hineinkommen, Madame?“
„Selbstverständlich. Ist etwas mit meinem Mann?“
Inzwischen war ich, damals erst zehn Jahre alt, durch die fremde und ungewohnt laute Männerstimme aufgewacht. Vorwitzig ging ich die Treppe hinunter. Ich wollte hören, was gesprochen wurde.
„Mama. Weshalb sind die Gendarmen hier?“, fragte ich leise meine Mutter.
Da sah der Gendarmeriechef mich an. „Und wer bist du?“
„Erny Pickard“, antwortete ich höflich.
„Erny, wir wollen mit deiner Mutter reden. Aber allein. Bitte geh wieder hinauf in dein Zimmer!“
Ich gehorchte und stieg, wenn auch nur ungern, nach oben. Dort blieb ich am Treppengeländer stehen und lauschte angestrengt, was die beiden Gendarmen zu sagen hatten.
„Madame Pickard, ist Ihr Mann zuhause?“, begann Leutnant Schneider zu fragen.
„Nein.“
„Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte?“
„Er hat am Nachmittag Kohlen und Briketts ausgefahren. Aber er ist noch nicht wieder zurück.“
„Was für einen Lastwagen besitzt ihr Mann?“
„Eine braune Camionette Ford. Weshalb fragen Sie?“
„Wir haben einen luxemburgischen Führerschein auf den Namen Léopold Pickard gefunden in einer Camionette, an der die Kennnummern abmontiert waren“, erwiderte der Gendarm und hielt meiner Mutter das amtliche Dokument mit dem aufgeklebten Foto entgegen. „Ist das Ihr Mann, Madame Pickard?“
„Ja! Das ist Léopold, mein Mann! Wo haben Sie die Camionette gefunden?“
„In der Gegend von Longwy.“
„Longwy? Was machte denn mein Mann in der Gegend von Longwy? Nun sagen Sie mir schon was los ist!“
„Es gab eine Schießerei.“
„Schießerei? Was hat das mit meinem Mann zu tun?“
„Madame Pickard“, sagte Leutnant Schneider mit gedämpfter Stimme. „Ich habe Ihnen eine traurige Nachricht zu überbringen. Ihr Mann ist tot.“
„Tot? Léopold tot, sagen Sie.“
Am ganzen Körper bebend ließ sich meine Mutter auf einen Stuhl fallen.
„Ja! Es tut mir Leid.“
Oben am Geländer stehend, hatte ich jedes Wort mitbekommen. Ich war geschockt von dem was ich hörte. Ich musste mich festhalten. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich lief die Treppe hinab, stieß die nur angelehnte Tür zum Wohnzimmer auf und warf mich meiner Mutter, die bleich und bebend auf dem Stuhl hockte, in die Arme.
„Madame Pickard“, hob Leutnant Schneider nochmals an. „Ich muss Sie bitten morgen vormittag auf das Kommissariat zu kommen. Meine Kollegen von der Mordkommission haben noch Fragen an Sie. Außerdem müssen Sie den Toten identifizieren.“
Dann salutierten die beiden Beamten, drehten sich um und verließen das Haus.
Ich merkte wie meine Mutter krampfhaft eine Hand auf ihr Herz drückte.
„Mama! Ich bringe dir deine Pillen“, sagte ich laut schluchzend. Schnell holte ich ein Glas Wasser und die immer griffbereit auf dem Küchenschrank liegende Medikamentenschachtel, was ich meiner Mutter brachte.
Die Zeitungen hatten anderntags ausgiebig den Überfall auf den Geldtransporter mit dem tragischen Ausgang beschrieben. In unserem Stadtviertel war das Geschehen zum Tagesgespräch geworden.
Zwei Tage danach fand die Beerdigung der beiden Toten statt.
Auf dem kleinen Friedhof seines unweit Longwy gelegenen Heimatortes hatten Hunderte Menschen dem toten Dienstmann die letzte Ehre erwiesen. Kränze und Blumengebinde lagen vor dem offenen Grab, wo der Pfarrer in seiner bewegenden Ansprache die zunehmende rücksichtslose Gewalt anprangerte und der Witwe mit ihren Kindern sein Beileid ausdrückte. Eine große Tageszeitung veröffentlichte tagsdarauf sogar ein Foto von der bewegenden Trauerzeremonie.
Hingegen hatten sich am Grab meines Vaters nur wenige Verwandte eingefunden. Kaum hatte der Kaplan die Gebete der Kirche gesprochen, ließen die Gemeindearbeiter den Sarg in die Grube hinab. Ohne meiner Mutter und mir zumindest mit einem stillen Händedruck sein Mitgefühl auszusprechen, wandte sich der Priester ab und schritt mit den beiden Messdienern davon.
„Entwürdigend!“, hörte ich meine Mutter seufzen, wobei ihr Tränen über das blasse Gesicht kullerten.
Auch dem sich anschließenden Totenamt in unserer heimatlichen Kirche wohnten nur wenige Leute bei. Es war offensichtlich, dass sich die Mitbürger und sogar die Nachbarn aufgrund des Geschehens von uns distanzierten.
Bis zum Tag der Tragödie war ich ein glücklich heranwachsendes Kind, umsorgt von einer liebevollen Mutter und einem arbeitsamen Vater, dessen sehnlichster Wunsch es war, dass ich nach der Primärschule das Gymnasium besuche, damit ich später einmal den Beruf eines höher gestellten Beamten in gesicherter Position ausüben könnte.
Bescheiden und sparsam hatten wir gelebt, da mein Vater meiner an Herzbeschwerden leidenden Mutter einen langen Aufenthalt in einem ausländischen Sanatorium ermöglichen wollte, für dessen Kosten seine Krankenkasse nicht aufkam. Außerdem hatte er beabsichtigt, eines Tages das Haus, das wir zur Miete bewohnten, zu kaufen, weil er der Meinung war, dass es klüger sei die hohen Pachtkosten in ein Eigentum zu investieren.
Doch nun war auf einmal unsere Familie, das traute Familienglück, zerstört. Alle Pläne waren von einer Minute zur andern brutal zunichte geworden.
Meine Mutter galt fortan als die Frau eines Verbrechers und Mörders - und ich war sein Sohn.
Nachbarn und Bekannte mieden sie, grüßten nicht mehr, oder wechselten sogar bei einer Begegnung auf die andere Straßenseite.
Ich verstand nicht, dass sich meine Schulkameraden von mir abwandten und der Lehrer nach fadenscheinigen Gründen suchte, mir eine Strafarbeit aufzutragen oder der Kaplan mich mehrmals während der Unterrichtsstunden zwang vor der großen Wandtafel zu knien, damit ich Buße tun sollte für die Todsünde meines Vaters.
Meine Mutter litt schwer unter den Demütigungen. Dazu kam, dass unser Geschäft von Tag zu Tag schlechter ging. Viele langjährige treue Kunden blieben aus. Sie proviantierten sich fortan bei der Konkurrenz, sodass unser Vorrat liegen blieb. Einnahmen gab es fast keine mehr.
Eines Abends setzte ich mich auf den Schoß meiner Mutter und wollte wissen, weshalb mein Vater den Sicherheitsmann erschossen habe.
Sie nahm sich viel Zeit mir den Werdegang unseres bevorstehenden Ruins zu erklären, der mit dem verhängnisvollen Kauf von Aktien einer afrikanischen Eisenbahngesellschaft seinen Anfang genommen hatte. Sie sagte mir, dass der Überfall die Verzweiflungstat meines Vaters gewesen sei, sein verlorenes Geld, wofür er die Bank und ganz besonders den verantwortlichen Aktienverkäufer verantwortlich machte, zurückzuholen.
„Aber du darfst niemals glauben, dass dein Vater ein schlechter Mensch gewesen ist, auch wenn es Leute gibt, die das jetzt behaupten“, schärfte sie mir ein. „Er war ein guter und treusorgender Mann und Vater, der immer nur das Beste gewollt hat. Was er getan hat, das war sicherlich falsch und er hätte das auf gar keinen Fall tun dürfen. Er hat den Geldtransporter nur deswegen überfallen, weil er fest davon überzeugt war, dass der Anlageberater der Bank ihn zum Kauf der Aktien überredet hatte um noch einen fetten Anteil an dem Geschäft einzustecken, obschon diesem bereits bewusst war, dass die heruntergewirtschaftete Bahngesellschaft kurz vor dem Bankrott stand.“
Erschöpft goss sie sich ein Glas Wasser ein und griff nach ihrer Medikamentenschachtel.
„Versprich mir“, schluchzte sie, „dass du deinen Vater dein ganzes Leben lang als einen anständigen Menschen in Erinnerung behalten wirst, ungeachtet dessen, was auch geschehen ist und was andere Leute reden!“
„Das verspreche ich, Mama“, antwortete ich und war gerührt.
Meine Mutter litt sehr unter dem Verlust ihres geliebten Gatten. Sie wurde immer blasser und magerer. Ihre Herzbeschwerden nahmen zu.
Des öfteren, wenn ich abends noch wach in meinem Bett lag, hörte ich sie weinen. Dann ging ich in ihr Zimmer, legte mich zu ihr und schmiegte mich fest an sie.
2.
Eines Tages überbrachte der Postbote einen Einschreibebrief. Absender war der Hauseigentümer. Ahnend, dass es eine weitere unangenehme Mitteilung sei, setzte sich meine Mutter zuerst an den Tisch. Dann schnitt sie mit zittrigen Fingern den Umschlag auf. Der Text des Schreibens war kurz und unmissverständlich:
Madame Pickard!
Ich teile Ihnen mit, dass ich Ihren Mietvertrag mit sofortiger Wirkung kündige, da ich das Haus in Zukunft selbst bewohnen werde.
Sie sind hiermit aufgefordert, das Wohnhaus und den Schuppen zum 31. dieses Monats zu räumen und zu verlassen.
Der Eigentümer
Es folgten die Unterschrift und das Datum.
Ich merkte, dass meiner Mutter sofort Tränen in die Augen stiegen.
„O mein Gott!“, stöhnte sie. „Auch das noch! Haben wir nicht schon Leid genug?“
„Was ist denn, Mama?“, fragte ich besorgt.
Sie reichte mir das Schreiben, dessen Bedeutung ich damals als Zehnjähriger nicht in vollem Umfang zu begreifen imstande war.
„Ich hatte gehofft, dass der Kohlenhandel mit der Zeit wieder anheben würde und wir ein zum Leben notwendiges Einkommen hätten“, erklärte sie mir schluchzend. „Aber jetzt hat uns der Vermieter auch diese Hoffnung zunichte gemacht. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als eine neue Wohnung zu finden - und ich muss mir eine Arbeitsstelle suchen. Beides wird nicht einfach sein.
Denn wer will schon eine Mieterin oder eine Hausgehilfin, deren Mann einen Geldtransporter überfallen und dabei einen Familienvater erschossen hat?“, seufzte sie schweratmend und steckte eine Pille in den Mund, die sie mit Wasser hinunterschluckte.
Schon zwei Wochen hatte meine Mutter ergebnislos die Stadt auf der Suche nach einer für unsere Verhältnisse bezahlbaren Mietwohnung und einer für sie geeigneten Arbeitsstelle abgeklappert.
Müde und deprimiert war sie eines späten Nachmittags heimgekehrt.
Da läutete es an der Haustür. Sie öffnete.
„Levy... Nathan Levy“, stellte sich ein gutgekleideter weißhaariger älterer Herr vor.
„Guten Tag, Herr Levy. Was kann ich für Sie tun?“
Der Besucher lächelte charmant. „Darf ich eintreten, Madame Pickard? Drinnen bespricht es sich besser“, sagte er.
„Selbstverständlich!“, entgegnete meine Mutter und führte den ihr Unbekannten in die Stube, wo sie ihm einen Stuhl anbot.
„Lassen Sie mich, wenn auch mit etwas Verspätung, Ihnen mein herzlichstes Beileid zum Tod Ihres Gatten ausdrücken“, begann Herr Levy das Gespräch. „Mehr als zehn Jahre lang hat Herr Pickard mir zweimal jährlich Kohlen für die Heizung und Briketts für den Küchenherd fein säuberlich in den Keller geliefert. Ich kannte ihn als einen reellen Geschäftsmann und zuvorkommenden Menschen, den ich sehr geschätzt habe. Ich weiß aber auch um die Beweggründe, die ihn zu seiner unglücklichen Tat geführt haben, die ich zwar in dieser Form nicht billige, aber nur zu gut verstehe. Denn auch ich habe diesem skrupellosen Bankberater vertraut und ebenfalls eine Menge Geld verloren.“
„Warum sagen Sie mir das, Herr Levy?“
„Nun. Ich habe gehört, dass Sie sich momentan... verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin... in einer prekären finanziellen Situation befinden und Ihnen zudem fatalerweise die Wohnung mit Lager gekündigt wurde und Sie deshalb auf der Suche nach einer Arbeit sind.“
„Woher wissen Sie das?“
„Ich habe einen großen Bekanntenkreis und so etwas spricht sich herum“, erwiderte Herr Levy. „Deshalb bin ich gekommen, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.“
„Mir? Ein Angebot?“
„Meine Frau ist siebzig und nach einem Wirbelbruch, den sie sich bei einem Treppensturz zugezogen hat, schwer behindert. Sie kann sich nicht mehr um den Haushalt kümmern und ich eigne mich sowieso nicht dafür. Deshalb habe ich eine Frage an Sie, Madame Pickard: Wollen Sie für meine Frau und mich arbeiten, den Haushalt führen und kochen? Finanziell würden wir uns schon einig werden, denke ich. Und wohnen könnten Sie mit Ihrem Jungen bei uns, in einer abgeschlossenen Vierzimmerwohnung, und zwar unentgeltlich. Unser Haus ist sowieso viel zu groß für uns beide, seitdem unser Sohn, unser einziges Kind, verstorben ist.“
Meine Mutter war überrascht von diesem unerwarteten und vor allem großzügigen Angebot.
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr Levy. Warum wollen Sie das für mich tun?“
„Weil ich weiß, dass Sie ohne eigene Schuld in diese ausweglose Situation geraten sind.“
„Aber Sie kennen mich doch gar nicht.“
„Ich habe mir erlaubt, ganz diskret, Erkundigungen über Sie und Ihren Jungen einzuziehen. Die waren alle positiv! Sie sehen also, dass ich genau informiert bin. Deshalb würden meine Frau und ich uns sehr freuen, wenn Sie unseren Vorschlag annehmen würden. Ach ja… fast hätte ich vergessen: ich könnte Ihnen behilflich sein, den Stock an Kohlen und Briketts zu verkaufen.“
„Sie…?“
„Ich habe einen Studienfreund, dessen Schwiegersohn ebenfalls ein Brennmaterialgeschäft führt. Wenn Sie wollen, könnte ich intervenieren, dass er Ihren gesamten Lagerbestand aufkauft. Sie müssten ihm natürlich preislich entgegenkommen.“
„Das ist kein Problem! Wir werden uns ganz bestimmt einig!“
„Heißt das, dass Sie einverstanden sind in unsere Dienste einzutreten?“
„Ich denke schon.“
„Oder wollen Sie es sich noch überdenken?“
„Nein! Das brauche ich nicht. Ich bin einverstanden und ich danke Ihnen recht herzlich für das Vertrauen das Sie mir entgegen bringen, und auch Erny, meinem Sohn.“
„Dann sind wir uns also einig!“, sagte Herr Levy und reichte meiner Mutter die Hand zum Zeichen der gegenseitigen Abmachung. „Kommen Sie morgen vormittag bei uns vorbei, damit Sie auch meine Frau kennenlernen und wir alles im Detail besprechen können. Hier ist meine Adresse.“ Er gab ihr seine Karte.
Zwei Wochen später zogen wir um. Unsere Vierzimmerwohnung mit Zentralheizung und Bad lag im zweiten, dem oberen Stockwerk.
Wir hatten uns schnell eingelebt und fühlten uns wohl und geborgen in dem vornehmen Haus der Familie Levy, das von einer gepflegten Gartenanlage umgeben war.
Von unserem kleinen Balkon, auf dem ein viereckiger Tisch und zwei Korbsessel standen, hatten wir einen weiten ungehinderten Blick auf das darunterliegende Petrusstal mit seinen bizarren Felsformationen, jahrhundertealten Bastionen, Türmen, Wehranlagen, Steintreppen, in die Felsen gehauenen Kasematten sowie dem sich dazwischen schlängelnden kaum einen Meter breiten Petrussbach. Besonders fasziniert war ich von der Adolphe-Brücke, die sich in einem gewaltigen Bogen über das Tal schwingt und das Bahnhofsviertel mit der Oberstadt verbindet.
Meine Mutter, die keine Arbeit scheute, kochte für die Eheleute Levy und sorgte in deren im Parterre und in der ersten Etage gelegenen geräumigen Wohnung für peinlichste Sauberkeit. Sie war der behinderten Hausherrin - die schon bei geringen Beanspruchungen größere Schmerzen verspürte - bei der täglichen Körperpflege behilflich, führte sie im Rollstuhl spazieren und erledigte für sie alle Besorgungen.
Trotz des bedeutenden Altersunterschiedes verstanden sich die beiden Frauen prächtig.
Herr Levy, der bis zu seiner Pensionierung an einem Gymnasium Geschichte und Geographie gelehrt hatte, machte sich eine Freude daraus mir - da ich ein aufmerksamer Schüler war - bei den Hausaufgaben behilflich zu sein. Durch ihn lernte ich die Regeln der Mathematik besser zu verstehen. Er half mir mein Deutsch und Französisch aufzubessern.
Schon nach kurzer Zeit war er für mich wie ein vorsorglicher Großvater geworden, der mich nach bestem Können auf den Ernst des Lebens vorbereitete.
Eines Tages, als ich mit meinen Schulheften und Lehrbüchern neben ihm in seinem Wohnzimmer saß, hatte ich Herrn Levy auf die an den Wänden hängenden Gemälde mit meist Ansichten des Petrusstals und der Altstadt angesprochen.
Nicht ohne Stolz sagte er mir, dass es ausnahmslos seine eigenen Werke seien, die er während Jahrzehnten in seiner Freizeit angefertigt hatte. Da er merkte, wie sehr ich von den teils in Öl, teils mit Wasserfarben gemalten Bildern angetan war, erläuterte er mir mit großer Sachkenntnis anhand der verschiedenen Gemälde die tausendjährige Geschichte der Stadt und Festung Luxemburg.
„Es war im Jahre 963“, begann er mit seiner tiefen angenehmen Stimme, „als ein unbedeutender Ardennergraf namens Siegfried auf dem Bockfelsen, den er durch ein Tauschgeschäft mit seinen in Feulen gelegenen Gütern erworben hatte, eine Burg errichtete: Lucilinburhuc…, auch Lützelburg genannt. Im Laufe der Zeit ist daraus Luxemburg geworden, das unter dieser Bezeichnung sowohl als Stadt als auch als Land in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Die eher bescheidene Burg auf dem Bockfelsen ist der Stammsitz der Grafen von Luxemburg, die im Laufe der Jahrhunderte zu einer der einflussreichsten Familien aufstieg und im 14. und 15. Jahrhundert vier deutsche Kaiser1 auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation sowie vier Könige von Böhmen und einen Kurfürsten stellte…“
„Was ist ein Kurfürst?“, unterbrach ich.
„Ein Kurfürst war damals ein mächtiger Kirchenmann mit weltlicher Macht“, erklärte er mir. „Ab dem 13. Jahrhundert bis 1806 waren die Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln auch Kurfürsten, die das alleinige Recht hatten deutsche Könige und Kaiser zu wählen.“
Herr Levy hielt inne um mir Zeit zu geben, das Gesagte aufzunehmen.
„Mit Sigismunds Tod im Jahre 1457 erlosch die Manneslinie des Hauses Luxemburg, dessen Territorium damals das vierfache des heutigen Großherzogtums betrug. Es begann die Zeit der Fremdherrschaft, die bis 1815 andauerte“, fuhr er fort. „Doch kommen wir zurück auf die Burg auf dem Bockfelsen. Wegen der außerordentlich günstigen strategischen Lage der anfangs doch bescheidenen Burg entstand daraus im Lauf der Zeit eine der gewaltigsten Festungen Europas. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie derart ausgedehnt, dass man fünf Tage benötigt hätte, um zu Fuß alle Festungswerke abzuschreiten.“
Wiederum hielt Herr Levy kurz inne, damit ich das Gesagte besser aufnehmen konnte. Dann fuhr er mit seinen Ausführungen weiter:
„Zur Zeit der spanischen Herrschaft, ab 1644, sind die ersten Kasematten von Hand in die Sandsteinfelsen gehauen worden. Rund 40 Jahre später haben die Franzosen - nach Plänen von Vauban - die unterirdischen Anlagen auf eine Gesamtlänge von 23 Kilometern ausgebaut, stellenweise sogar dreigeschossig, mit Unterkunftsmöglichkeiten für Hunderte Soldaten und Pferde.
Trotz seiner Einmaligkeit ist das Gibraltar des Nordens