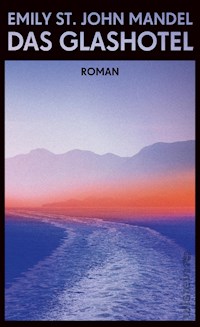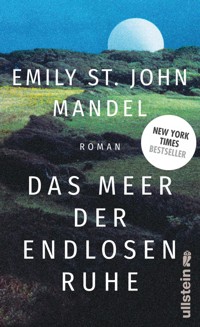
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Werden wir die Erde vermissen? Die Menschheit kommt nicht zur Ruhe. 1912 wird Edwin St. Andrew, Adelsspross aus England mit einer ketzerischen Haltung zum britischen Imperialismus, in die britische Kolonie Kanada exiliert und sucht dort sein Glück. 2203 bricht die berühmte Schriftstellerin Olive Llewellyn eine weltweite Lesereise ab, um zurück zu ihrer Familie auf den nun kolonialisierten Mond zu fliegen, als erste Meldungen über eine Pandemie laut werden. 2401, es gibt inzwischen Kolonien auf den Monden des Saturns, soll Gaspery-Jacques Roberts durch die Zeit reisen, um einer Anomalie nachzugehen, die vermuten lässt, dass die gesamte Geschichte der Menschheit nichts weiter ist als eine Simulation. Mit erzählerischer Brillanz und Leichtigkeit verwebt Emily St. John Mandel so große Themen wie die Kolonialisierung der Erde und des Weltraums, Pandemie und Technologie zu einem organischen Ganzen. Ein Roman, der ebenso lustvoll zu lesen ist wie er zum Nachdenken – auch und insbesondere über unsere Gegenwart – anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Meer der endlosen Ruhe
Die Autorin
Emily St. John Mandel ist die Autorin von sechs Romanen, zuletzt Das Meer der endlosen Ruhe. Zu ihren früheren Romanen gehören Das Glashotel, das von Präsident Barack Obama zu einem seiner Lieblingsbücher des Jahres 2020 gewählt wurde, auf der Shortlist für den Scotiabank Giller Prize stand und in 23 Sprachen übersetzt wurde, und Station Eleven, das in die Endauswahl für den National Book Award und den PEN/Faulkner Award kam, 2015 unter anderem mit dem Arthur C. Clarke Award ausgezeichnet wurde, in 36 Sprachen übersetzt ist und als limitierte Serie von HBO Max ausgestrahlt wurde. Sie lebt in New York City.
Das Buch
Die Menschheit kommt nicht zur Ruhe. 1912 wird Edwin St. Andrew, Adelsspross aus England mit einer ketzerischen Haltung zum britischen Imperialismus, in die britische Kolonie Kanada exiliert und sucht dort sein Glück. 2203 bricht die berühmte Schriftstellerin Olive Llewellyn eine weltweite Lesereise ab, um zurück zu ihrer Familie auf den nun kolonialisierten Mond zu fliegen, als erste Meldungen über eine Pandemie laut werden. 2401, es gibt inzwischen Kolonien auf den Monden des Saturns, soll Gaspery-Jacques Roberts durch die Zeit reisen, um einer Anomalie nachzugehen, die vermuten lässt, dass die gesamte Geschichte der Menschheit nichts weiter ist als eine Simulation.
Mit erzählerischer Brillanz und Leichtigkeit verwebt Emily St. John Mandel so große Themen wie die Kolonialisierung der Erde und des Weltraums, Pandemie und Technologie zu einem organischen Ganzen. Ein Roman, der ebenso lustvoll zu lesen ist wie er zum Nachdenken – auch und insbesondere über unsere Gegenwart – anregt.
Emily St. John Mandel
Das Meer der endlosen Ruhe
Roman
Aus dem Amerikanischen vonBernhard Robben
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Sea of Tranquility bei Alfred A. Knopf, New York.
ISBN 978-3-8437-2908-6
© 2022 by Emily St. John Mandel
© der deutschsprachigen Ausgabe
2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach einer Vorlage von Abby Weintraub
Umschlagmotiv: © Stephen Coll / plainpicture / Millennium Images UK
Autorenfoto: © Sarah Shatz
E-Book-Konvertierung powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
I Nachgeborene / 1912
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II Mirella und Vincent / 2020
1
2
3
III Die letzte Lesereise auf der Erde / 2203
1
IV Böse Geister / 2401
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V Die letzte Lesereise auf der Erde / 2203
2203
VI Mirella und Vincent / fehlerhafte Datei
1
2
3
4
5
VII Nachgeborene / 1918, 1990, 2008
1
2
3
4
5
VIII Anomalie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anhang
Anmerkungen und Danksagungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I Nachgeborene / 1912
Widmung
Für Cassia und KevinI Nachgeborene / 1912
1
Edwin St. John St. Andrew, achtzehn Jahre alt, schleppt das Gewicht seines doppelheiligen Namens auf einem Dampfschiff über den Atlantik, steht auf dem Oberdeck, die Augen gegen den Wind zusammengekniffen: Mit behandschuhten Fingern umklammert er die Reling, erhofft ungeduldig einen ersten Blick auf das Unbekannte und versucht – endlich! – irgendetwas jenseits von Himmel und Meer zu erkennen, sieht aber nur Schattierungen von endlosem Grau. Er ist unterwegs zu einer neuen Welt. Er ist mehr oder weniger auf halber Strecke zwischen England und Kanada. Man schickt mich ins Exil, denkt er, weiß aber, wie melodramatisch das klingt, und dennoch, ein Hauch von Wahrheit schwingt darin mit.
Wilhelm der Eroberer zählt zu Edwins Vorfahren. Wenn sein Großvater stirbt, wird sein Vater Earl, und Edwin war auf zwei der besten Schulen des Landes, doch hat es für ihn daheim in England eigentlich nie eine Zukunft gegeben. Für einen Gentleman kommen nur wenige Berufe infrage, und Edwin hat sich für keinen davon interessiert. Der Landsitz der Familie geht an Gilbert, seinen ältesten Bruder, folglich wird er selbst nichts erben. (Niall, der mittlere Bruder, lebt bereits in Australien.) Vielleicht hätte sich Edwin noch ein wenig länger in England halten können, doch vertritt er insgeheim radikale Ansichten, die ihm während einer Dinnerparty unerwartet über die Lippen kamen, was den Lauf seines Schicksals beschleunigt hat.
In einem Anfall von unbändigem Optimismus ließ Edwin auf der Schiffspassagierliste unter Beruf »Landwirt« eintragen. Während eines beschaulichen Augenblicks an Deck fällt ihm später ein, dass er in seinem Leben noch nie einen Spaten in der Hand gehalten hat.
2
In Halifax findet er eine Unterkunft am Hafen, eine Pension, in der er sich im ersten Stock ein Eckzimmer mit Blick über den Kai sichern konnte. Am ersten Morgen erwartet ihn vor seinem Fenster ein herrlich lebenspraller Anblick. Ein großes Handelsschiff ist eingetroffen und er ihm so nahe, dass er die gut gelaunten Flüche der Männer hören kann, die Fässer entladen, Säcke und Kisten. Wie eine Katze verbringt er einen Großteil des Tages damit, aus dem Fenster zu schauen. Er hatte vor, umgehend in den Westen aufzubrechen, aber es fällt so leicht, eine Weile in Halifax zu bleiben, und ihn überkommt eine Schwäche, die er schon sein Leben lang kennt: Edwin ist zu Taten durchaus fähig, neigt aber zu Tatenlosigkeit. Er sitzt gern am Fenster. Draußen sind Menschen und Schiffe in ständiger Bewegung. Er will nicht fort, also bleibt er.
»Ach, ich glaube, ich überleg mir nur meinen nächsten Schritt«, erklärt er der Besitzerin, als die behutsam nachfragt. Sie heißt Mrs Donnelly und stammt aus Neufundland. Ihr Akzent verwirrt ihn. Sie klingt, als sei sie aus Bristol und aus Irland, gleichzeitig, manchmal aber meint er auch, Schottland herauszuhören. Die Zimmer sind sauber, und sie ist eine ausgezeichnete Köchin.
Matrosen drängeln in Wellen an seinem Fenster vorbei. Sie blicken nur selten hoch. Er genießt es, ihnen zuzusehen, wagt es aber nicht, sich ihnen zu nähern. Außerdem haben sie ja sich. Sind sie betrunken, legen sie einander einen Arm um die Schulter, und ihn packt quälende Eifersucht.
(Könnte er zur See fahren? Natürlich nicht. Er verwirft den Gedanken, sowie er aufkommt. Er hat einmal von einem Nachgeborenen gehört, der sich als Matrose neu erfand, aber Edwin ist durch und durch ein Mann des Müßiggangs.)
Er liebt es, die ankommenden Schiffe zu beobachten, Dampfschiffe, die in den Hafen einlaufen und deren Decks noch ein Hauch Europa anhängt.
Morgens unternimmt er einen Spaziergang und einen weiteren am Nachmittag, geht in die ruhigen Wohngegenden, durchstöbert auf der Barrington Street die Läden mit ihren gestreiften Markisen. Gern fährt er mit der Elektrischen bis zur Endstation und verfolgt auf der Rückfahrt den Wechsel von kleineren zu größeren Gebäuden bis hin zu den Geschäftshäusern der Innenstadt. Er liebt es, Dinge zu kaufen, die er eigentlich nicht braucht: einen Laib Brot, ein oder zwei Postkarten, einen Strauß Blumen. Und er ertappt sich bei dem Gedanken, dass es sich so leben ließe. So einfach könnte es sein. Keine Familie, keine Arbeit, nur einige schlichte Vergnügungen und saubere Laken, in die man am Ende des Tages sinkt, regelmäßige Unterhaltszahlungen von daheim. Ein Leben in Einsamkeit kann überaus angenehm sein.
Er macht es sich zur Gewohnheit, jeden Tag Blumen zu kaufen, die er auf seine Anrichte in eine billige Vase stellt. Er verbringt viel Zeit damit, sie zu betrachten, wünscht sich, er wäre ein Künstler, könnte sie zeichnen und lernte dabei, sie deutlicher zu sehen.
Könnte er zeichnen lernen? Er hat Zeit und Geld. Die Idee ist so gut wie jede andere. Er beginnt, Erkundigungen einzuziehen, und er fragt Mrs Donnelly, die ihrerseits eine Freundin fragt, und kurze Zeit darauf befindet er sich im Salon einer Frau, einer gelernten Malerin. Er verbringt ruhige Stunden damit, Blumen und Vasen zu zeichnen, lernt Schattierungen und Proportionen. Die Frau heißt Laetitia Russell. Sie trägt einen Ehering, der Verbleib ihres Gatten ist jedoch unklar. Sie wohnt in einem sauberen Holzhaus mit drei Kindern und ihrer verwitweten Schwester, einer unaufdringlichen Anstandsdame, die in einer Ecke des Zimmers endlos Schals strickt, weshalb Edwin bis an sein Lebensende beim Klicken von Stricknadeln ans Zeichnen denkt.
Als Reginald eintrifft, wohnt er seit einem halben Jahr in der Pension. Wie er rasch merkt, neigt Reginald nicht zur Tatenlosigkeit. Reginald verfolgt Pläne, will gleich in den Westen aufbrechen. Er ist zwei Jahre älter als Edwin, dritter Sohn eines Viscounts, ebenfalls Eton-Absolvent, und er hat schöne Augen, dunkelgraublaue Augen. Wie Edwin denkt er daran, ein Leben als Landwirt und Gutsbesitzer zu führen, im Unterschied zu Edwin aber hat er bereits konkrete Schritte unternommen, sein Ziel auch zu verwirklichen, und korrespondiert mit einem Mann, der eine Farm in Saskatchewan verkaufen möchte.
»Sechs Monate«, wiederholt Reginald beim Frühstück und kann es kaum fassen. Er bestreicht seinen Toast mit Marmelade, hält aber einen Moment inne, fast, als sei er sich nicht sicher, ob er richtig gehört hat. »Sechs Monate? Sechs Monate hier?«
»Ja«, antwortet Edwin unbekümmert. »Sechs überaus angenehme Monate, wie ich ergänzen möchte.« Er versucht, Mrs Donnellys Blick aufzufangen, doch die konzentriert sich ganz und gar darauf, Tee einzuschenken.
»Interessant.« Reginald verstreicht wieder Marmelade. »Ich nehme nicht an, wir hoffen, bald wieder nach Hause gerufen zu werden, oder? Klammern uns an den Rand des Atlantiks, bleiben König und Vaterland so nahe wie möglich?«
Das versetzt ihm einen leichten Stich, weshalb Edwin, als Reginald sich eine Woche später auf den Weg in den Westen macht, seine Einladung annimmt und ihn begleitet. Sich regen bringt Segen, denkt Edwin, als der Zug die Stadt verlässt. Sie haben Erste Klasse in diesem reizvollen Zug gebucht, in dem es ein Postamt und einen Friseur gibt, weshalb Edwin eine Karte an Gilbert schreibt und sich das Haar schneiden lässt sowie eine warme Rasur genießt, während er vor dem Fenster Wälder und Seen und kleine Städte vorbeiziehen sieht. Als der Zug in Ottawa hält, steigt Edwin nicht aus, sondern bleibt an Bord und skizziert die Umrisse des Bahnhofs.
Die Wälder und Seen und kleinen Städte weichen Prärien. Die Prärien sind anfangs interessant, dann ermüdend, dann beunruhigend. Es gibt zu viele davon, das ist das Problem. Der Maßstab stimmt nicht. Der Zug kriecht wie ein Tausendfüßler durch endloses Gras. Edwin kann von Horizont zu Horizont sehen und fühlt sich schrecklich exponiert.
»Das ist das wahre Leben«, sagt Reginald, als sie endlich angekommen sind und er in der Tür seines neuen Farmhauses steht. Die Farm liegt einige Kilometer außerhalb von Prince Albert. Sie ist ein Meer aus Schlamm. Reginald hat sie ungesehen von einem resignierten Engländer Ende zwanzig gekauft – noch ein Nachgeborener, wie Edwin unwillkürlich annimmt –, der hier gründlich gescheitert und zurück nach Ottawa zu einem Schreibtischjob gefahren ist. Edwin merkt Reginald an, dass er sich große Mühe gibt, nicht an diesen Mann zu denken.
Kann ein Haus vom Scheitern heimgesucht sein? Als Edwin das Farmhaus betritt, fühlt er sich gleich unbehaglich, also bleibt er auf der vorderen Veranda. Es ist ein gut gebautes Haus – der Vorbesitzer war einmal vermögend –, doch auf eine Weise bedrückend, die Edwin nicht recht erklären kann.
»Hier … gibt es ziemlich viel Himmel, nicht?«, wagt Edwin sich vor. Und ziemlich viel Schlamm. Eine wirklich erstaunliche Menge Schlamm. Er glitzert in der Sonne, soweit das Auge reicht.
»Nur Weite und frische Luft«, erwidert Reginald und schaut zum grässlich ungebrochenen Horizont. Verschwommen in der Ferne vermag Edwin ein weiteres Farmhaus zu erkennen. Der Himmel ist von einem aggressiven Blau. An diesem Abend essen sie hart gekochte Eier – das Einzige, was Edwin zubereiten kann –, außerdem Pökelfleisch. Reginald wirkt bedrückt.
»Ist ziemlich harte Arbeit, so ein Leben als Landwirt, oder?«, sagt er nach einer Weile. »Körperlich anstrengend.«
»Davon gehe ich aus.« Edwin hat sich in der Neuen Welt stets als Landwirt und Gutsbesitzer gesehen – eine grüne Landschaft mit, nun ja, irgendeinem nicht weiter spezifiziertem Getreide, ordentliche, aber riesige Flächen –, in Wahrheit aber hat er nie viel darüber nachgedacht, was für Arbeit genau dazugehört. Sich um Pferde kümmern, nahm er an. Ein bisschen Gartenarbeit. Felder umgraben. Aber was dann? Was passiert eigentlich mit Feldern, wenn man sie umgegraben hat? Wonach gräbt man?
Er glaubt, sich auf den Rand eines Abgrunds zuzubewegen. »Reginald, alter Freund«, sagt er, »irgendeine Ahnung, was man anstellen muss, um in diesem Haus etwas zu trinken zu bekommen?«
»Man erntet«, sagt sich Edwin nach dem dritten Glas. »Das ist das richtige Wort dafür. Man gräbt um, dann sät man aus, dann erntet man.«
»Man erntet was?« Reginald hat so eine angenehme Art, wenn er betrunken ist, beinahe als wäre er durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, lächelt in die leere Luft.
»Tja, das genau ist die Frage, nicht?«, sagt Edwin und schenkt sich ein weiteres Mal ein.
3
Nachdem sie einen Monat lang zusammen gezecht haben, lässt Edwin Reginald auf seiner neuen Farm allein und fährt weiter nach Westen, um sich mit Thomas zu treffen, einem Schulfreund seines Bruders Niall, der diesen Kontinent in New York betrat und gleich weiter nach Westen zog. Die Zugfahrt durch die Rocky Mountains ist atemberaubend. Wie ein Kind presst Edwin die Stirn ans Fenster und schaut mit offenem Mund. Was er sieht, ist überwältigend. Vielleicht hat er es drüben in Saskatchewan mit dem Trinken ein wenig übertrieben. Er beschließt, in British Columbia ein besserer Mensch zu werden. Das Sonnenlicht schmerzt in den Augen.
Nach all der wilden Pracht ist es ein eigenartiger Schock, die friedlichen, hübschen Straßen von Victoria zu sehen. Überall sind Engländer, als er den Zug verlässt, ihn umgibt der Akzent seiner Heimat. Hier, denkt er, könnte ich es eine Weile aushalten.
Edwin trifft Thomas im Stadtzentrum in einem sauberen kleinen Hotel, in dem er das beste Zimmer belegt hat; unten im Restaurant bestellen sie Tee und Scones. Sie haben sich drei, vier Jahre nicht gesehen, aber Thomas hat sich kaum verändert. Dieselbe rötliche Haut wie schon als Kind, die ihn immerzu aussehen lässt, als käme er gerade vom Rugbyfeld ins Haus. Er versucht, in Victorias Geschäftswelt Fuß zu fassen, bleibt aber unbestimmt, als Edwin ihn fragt, in welcher Sparte er sich versuchen will.
»Und wie geht’s deinem Bruder«, fragt Thomas, womit er das Thema wechselt. Niall ist gemeint.
»Der probiert es in Australien«, sagt Edwin. »Ist offenbar ganz zufrieden, jedenfalls den Briefen nach zu urteilen.«
»Nun, das ist mehr, als die meisten von uns behaupten können«, sagt Thomas. »Zufrieden zu sein ist nicht gerade wenig. Was treibt er denn da unten?«
»Versäuft seine Unterhaltszahlungen, nehme ich an«, sagt Edwin, was nicht gerade gentlemanlike, aber vermutlich die Wahrheit ist. Sie sitzen an einem Tisch am Fenster, und sein Blick wandert immer wieder hinaus zu den Geschäften entlang der Straße, zur unergründlichen Wildnis – in der Ferne sichtbar – und zu den am Stadtrand dräuenden, düster aufragenden Bäumen. Dass diese Wildnis zum britischen Königreich gehören soll, ist ein irgendwie lächerlicher Gedanke, den er rasch wieder unterdrückt, da er ihn an seine letzte Dinnerparty in England erinnert.
4
Die letzte Dinnerparty begann durchaus reibungslos, Ärger kam erst auf, als sich das Gespräch wie immer und jedes Mal der unvorstellbaren Pracht Britisch-Indiens zuwandte. Edwins Eltern waren auf dem Subkontinent geboren worden, Indien-Babys, englische Kinder, erzogen von indischen Kindermädchen – »Wenn ich mir auch nur noch ein Wort über ihre gottverdammte Ayah anhören muss«, hatte Edwins Bruder Gilbert einmal gebrummelt, den Satz aber nie beendet – und mit Geschichten über ein fernes Großbritannien aufgewachsen, das sie, wie Edwin unterstellte, ein wenig enttäuschend fanden, als sie es mit Anfang zwanzig zum ersten Mal mit eigenen Augen sahen. (»Mehr Regen als gedacht«, war alles, was Edwins Vater dazu sagte.)
Es war noch eine weitere Familie bei dieser letzten Dinnerparty zugegen, die Barretts, ähnlicher Hintergrund: John Barrett war Kommandant der Royal Navy gewesen, und Clara, seine Frau, hatte ihre ersten Jahre ebenfalls in Indien verbracht. Sie wurden von Andrew begleitet, ihrem ältesten Sohn. Den Barretts war durchaus bekannt, dass Britisch-Indien bei einem Abend mit Edwins Mutter zu den unvermeidlichen Themen gehörte, als alte Freunde wussten sie aber auch, dass sich das Gespräch gewiss anderem zuwendete, sobald sich Abigail Britisch-Indien von der Seele geredet hatte.
»Wisst ihr, ich muss oft daran denken, wie schön Britisch-Indien war«, sagte die Mutter. »Diese Farben, wirklich erstaunlich.«
»Die Hitze aber war doch recht bedrückend«, erwiderte Edwins Vater. »Jedenfalls gehört sie zu dem, was ich nicht vermisse, seit wir hergezogen sind.«
»Ach, so schrecklich bedrückend fand ich die eigentlich nie.« Edwins Mutter hatte diesen entrückten Ausdruck im Gesicht, ihre Britisch-Indien-Miene, wie Edwin und seine Brüder sie nur nannten. Abigail verströmte dann eine gewisse Vagheit, die verriet, dass sie nicht länger unter ihnen weilte; vermutlich ritt sie auf einem Elefanten, schlenderte durch einen Garten mit tropisch-üppiger Blumenpracht, bekam Gurken-Sandwiches von ihrer gottverdammten Ayah serviert oder weiß der Himmel was.
»Die Einheimischen wohl auch nicht«, wandte Gilbert sanft ein, »ich schätze, das Klima dort ist eben nichts für jeden.«
Was veranlasste Edwin, in eben diesem Moment den Mund aufzumachen? Noch Jahre später fragte er sich das, im Krieg, im Todesgrauen und der Langeweile der Schützengräben. Manchmal weiß man erst, dass man eine Granate werfen wird, wenn man den Sicherungsstift bereits gezogen hat.
»Es deutet vieles darauf hin, dass sie die Briten weitaus bedrückender als die Hitze finden«, sagte Edwin. Er warf einen Blick hinüber zu seinem Vater, doch der wirkte wie erstarrt, das Glas auf halbem Weg zwischen Tisch und Mund.
»Darling«, sagte seine Mutter, »was um alles in der Welt soll denn das bedeuten?«
»Sie wollen uns dort nicht«, sagte Edwin. Er sah sich am Tisch um, sah die stumm starrenden Gesichter. »Fürchte, da gibt es nicht viel zu deuteln.« Mit Verwunderung lauschte er der eigenen Stimme, die von weit her zu kommen schien. Gilbert fiel die Kinnlade herunter.
»Junger Mann«, sagte sein Vater, »wir haben diesen Leuten nur ein wenig Zivilisation gebracht …«
»Und doch drängt sich der Eindruck auf«, erwiderte Edwin, »dass sie im Großen und Ganzen wohl ihre eigene vorgezogen hätten. Ihre eigene Zivilisation, meine ich. Sind ja auch eine Weile gut ohne uns zurechtgekommen, nicht wahr? Mehrere Tausend Jahre sogar.« Ihm war, als läge er gefesselt auf dem Dach eines dahinrasenden Zuges! Eigentlich wusste er nur wenig über Indien, erinnerte sich aber daran, wie schockierend er als Junge Berichte über den Aufstand von 1857 gefunden hatte. »Will uns denn irgendwer irgendwo?«, hörte er sich fragen. »Wie können wir nur glauben, dass uns diese weit entfernten Länder gehören?«
»Weil wir sie erobert haben, Eddie«, sagte Gilbert nach kurzem Schweigen. »Man darf annehmen, dass auch die Eingeborenen Englands vor zweiundzwanzig Generationen nicht einhellig von der Ankunft unseres Urururgroßvaters begeistert waren, aber nun, die Geschichte gehört nun mal den Siegern.«
»Wilhelm der Eroberer, das war vor tausend Jahren, Bert. Wir bemühen uns doch gewiss, ein wenig zivilisierter als dieser irrsinnige Enkel eines brandschatzenden Wikingers aufzutreten, nicht wahr?«
Edwin hörte auf zu reden. Alle am Tisch starrten ihn an.
»›Dieser irrsinnige Enkel eines brandschatzenden Wikingers‹«, wiederholte Gilbert leise.
»Man muss allerdings, denke ich, dankbar dafür sein, dass wir eine christliche Nation sind«, sagte Edwin. »Man stelle sich nur vor, was für ein Blutbad wir in den Kolonien angerichtet hätten, wenn wir keine Christen wären.«