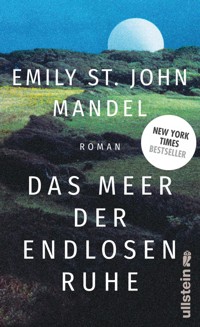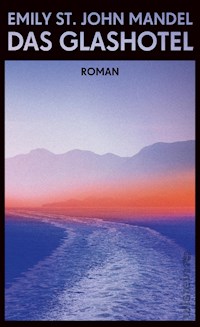
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Glashotel ist ein eindringliches und erfüllendes Leseerlebnis, das den Spielraum der Fantasie innerhalb der Grenzen unserer Wirklichkeit auslotet … Revolutionär." The Atlantic "Ein Roman, der so vereinnahmend ist, so perfekt komponiert, dass er seine Leser mit sich fortreißt und ihren Möglichkeitssinns erweitert." NPR "Elegant und verführerisch." The Guardian Ein Luxushotel an der westlichen Küste Kanadas, jenseits der großen Fenster das Meer, Inseln, die Vegetation des Nordens. Ein Refugium für gestresste Städter, für die junge Barkeeperin Vincent aber ein Ort mit schmerzhaften Erinnerungen. Als eine alle Anwesenden erschütternde Botschaft auf eine der Scheiben der Lobby geschmiert wird, ergreift sie die Gelegenheit und geht mit dem Investor Jonathan Alkaitis nach New York. Was sie nicht weiß: Alkaitis Vermögen beruht auf Betrug, und als er untergeht, reißt er seine Anleger mit hinab in die Tiefe, und Vincents Leben wird ein weiteres Mal in unvorhergesehene Fahrwasser gelenkt. Mit Das Glashotel hat Emily St. John Mandel einen Roman über die Odyssee des modernen Menschen geschrieben, einen Roman über Entwurzelung und Wandel, über das Ergreifen von Gelegenheiten und scheiternde Pläne und nicht zuletzt über unsere lebenslange Suche nach jenem Ort, den wir Heimat nennen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Glashotel
Die Autorin
EMILY ST. JOHN MANDEL wurde in Kanada geboren und studierte Tanz in Toronto. Mit ihrem letzten Roman Das Licht der letzten Tage war sie für den National Book Award nominiert und feierte einen weltweiten Publikums- und Presseerfolg. Auch Das Glashotel wurde begeistert aufgenommen und rezensiert und stand wochenlang auf der The New York Times-Bestsellerliste. Emily St. John Mandel lebt mit Ehemann und Tochter in New York.»Mandel ist eine vollendete, fast schon verschwenderische Erschafferin von Welten.« THE WASHINGTON POSTBERNHARD ROBBEN übersetzt aus dem Englischen, u.a.: Ian McEwan, John Burnside, John Steinbeck, John Williams und Philip Roth. 2003 erhielt er den Übersetzerpreis der Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ledig-Rowohlt-Preis geehrt.
Das Buch
Vincents Leben ist geprägt vom Unterwegssein. Früh verlässt sie ihre Heimat, Vancouver Island, nachdem ihre Mutter von einem Kanuausflug nicht mehr nach Hause kommt. Sie wächst bei ihrer Tante in Toronto auf. Als auch ihr Vater stirbt, kehrt sie zurück und beginnt als Barkeeperin im Hotel Caiette zu arbeiten. Dort lernt sie Jonathan Alkaitis kennen, einen New Yorker Investor. Sie ergreift die Gelegenheit und folgt ihm an die Ostküste der USA, spielt seine Ehefrau, lebt im Luxus, ohne sich darin zu verlieren. Dann schlägt die Finanzkrise zu, Alkaitis steht vor dem Nichts, wird zu 170 Jahren Gefängnis verurteilt, und Vincents Leben wird ein weiteres Mal in unvorhergesehene Fahrwasser gelenkt.»Mandel sucht jene Orte auf, wo das Gewöhnliche auf das Wunderliche trifft, wo ganz normale Menschen innehalten und sich fragen, wie sie hierhergekommen sind. Sie besingt das plötzliche Erwachen im falschen Film.« THE NEW YORKER
Emily St. John Mandel
Das Glashotel
Roman
Aus dem Englischen vonBernhard Robben
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel The Glass Hotelbei Alfred A. Knopf, New York© 2020 by Emily St. John Mandel© der deutschsprachigen Ausgabe2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgUmschlagmotiv: ShutterstockAutorinnenfoto: © Sarah ShatzE-Book powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2560-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
TEIL EINS
1 Vincent im Ozean
2 I always come to you
3 Das Hotel
4 Ein Märchen
5 Olivia
TEIL ZWEI
6 Das Gegenleben
7 Seefahrerin
8 Das Gegenleben
9 Ein Märchen
TEIL DREI
10 Der Bürochor
11 Winter
12 Das Gegenleben
13 Schattenland
14 Der Bürochor
15 Das Hotel
16 Vincent im Ozean
Anhang
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
TEIL EINS
Widmung
für Cassia und Kevin
TEIL EINS
1 Vincent im Ozean
Dezember 2018
1
Beginne am Ende: Der Sturz an der Schiffswand hinab ins wilde Dunkel des Sturms, der Schock des Fallens verschlägt mir den Atem, meine Kamera fliegt durch den Regen davon …
2
Fegt mich weg. An ein Fenster gekritzelte Worte, ich war dreizehn. Ich trat zurück, ließ den Stift aus der Hand fallen und kann mich noch gut an die überschäumende Lebensfreude jenes Augenblicks erinnern, an ein Gefühl in meiner Brust wie blitzendes Licht auf zerstoßenem Glas …
3
Bin ich wieder zur Oberfläche aufgestiegen? Die Kälte ist tödlich, es gibt nur noch diese Kälte …
4
Eine merkwürdige Erinnerung: Am Strand in Caiette, ich bin dreizehn, in der Hand kühl und fremd die brandneue Kamera, mit der ich die Wellen in fünfminütigen Videos filmte; und während ich filme, höre ich mich flüstern: »Ich will nach Hause; ich will nach Hause; ich will nach Hause«, nur wenn ich dort nicht zu Hause war, wo dann?
5
Wo bin ich? Nicht im Ozean, nicht außerhalb des Ozeans. Ich spüre die Kälte nicht länger, spüre eigentlich überhaupt nichts mehr, bin mir aber einer Grenze bewusst, doch kann ich nicht sagen, auf welcher Seite ich bin, und es scheint, als könnte ich mich zwischen Erinnerungen bewegen, als ginge ich von einem Zimmer ins andere …
6
»Willkommen an Bord«, sagte der Dritte Maat, als ich zum ersten Mal die Neptune Cumberland betrat. Als ich ihn sah, traf es mich wie ein Schlag, und ich dachte: Du …
7
Mir bleibt keine Zeit mehr …
8
Ich will meinen Bruder sehen. Ich kann hören, wie er mit mir redet, und meine Erinnerungen an ihn wühlen mich auf. Ich konzentriere mich mit aller Macht, bis ich plötzlich auf einer schmalen Straße im Dunkeln stehe, im Regen, in einer fremden Stadt. In sich zusammengesackt liegt mir gegenüber ein Mann in einem Hauseingang, und obwohl ich meinen Bruder zehn Jahre nicht gesehen habe, weiß ich, dass er es ist. Paul blickt auf, lang genug, dass ich registrieren kann, wie schrecklich er aussieht, erschöpft und abgemagert; er sieht mich an, ein Blinzeln, dann ist die Straße verschwunden …
2 I always come to you
1994 und 1999
Ende 1999 studierte Paul Finanzwissenschaft an der Universität Toronto, für ihn im Grunde ein Triumph, nur fühlte sich nichts daran richtig an. Als er noch jünger gewesen war, hatte er geglaubt, er würde einmal Komposition studieren, aber während einer schlimmen Phase vor ein paar Jahren hat er das Keyboard verkauft, und für ein unpraktisches Studium hatte seine Mutter nichts übrig, was er ihr, nach mehreren Runden Entziehungskur, auch kaum verübeln konnte, weshalb er beschloss, sich für Finanzwissenschaften einzuschreiben, denn er sagte sich, beweise er damit doch eine praktische und beeindruckend erwachsene, zukunftsorientierte Einstellung – Seht her, ich lerne etwas über Geldfluss und Marktgeschehen! –; der entscheidende Fehler in diesem brillanten Plan aber war der, dass er sein Studium hoffnungslos uninteressant fand. Das Jahrhundert ging zu Ende, und es gab für ihn so manchen Anlass zur Klage.
Er hatte erwartet, wenigstens ein paar anständige Leute kennenzulernen, doch wenn man aus der Welt fällt, besteht das Problem eben darin, dass sich die Welt auch ohne einen weiterdreht, und während er seine Zeit mit betäubenden Drogen oder mit geisttötenden Minijobs verbrachte, bei denen er sich Mühe gab, nicht an Drogen zu denken, und sich zudem noch eine Weile in Krankenhäusern und Entzugskliniken aufhielt, wurde Paul dreiundzwanzig, sah aber älter aus. In den ersten Studienwochen ging er auf Partys, nur war er noch nie gut darin gewesen, mit Fremden ins Gespräch zu kommen, und überhaupt fand er alle so unglaublich jung. Bei den Zwischenprüfungen schnitt er schlecht ab, weshalb er gegen Ende Oktober oft in der Bibliothek hockte – wo er las und sich Mühe gab, für Finanzwissenschaft Interesse aufzubringen, das Steuer rumzureißen – oder auf seinem Zimmer saß, während es in der Stadt um ihn herum immer kälter wurde. Er lebte in einer Einzimmerwohnung, denn zu dem wenigen, worin er mit seiner Mutter einer Meinung war, gehörte, dass es katastrophal wäre, wenn Paul sich die Wohnung mit jemandem teilte und dieser jemand wäre drogenabhängig, also blieb er fast immer allein. Das Zimmer war so klein, dass er Platzangst bekam, wenn er nicht unmittelbar vorm Fenster saß. Begegnungen mit anderen Menschen waren selten und meist oberflächlicher Natur. Am Horizont drohte die dunkle Wolke des Examens, aber dafür zu lernen war hoffnungslos. Er versuchte, sich auf Wahrscheinlichkeitstheorie und zeitdiskrete Zufallsprozesse zu konzentrieren, nur wanderten seine Gedanken immer wieder zu jener Klavierkomposition, von der er wusste, dass er sie nie zu Ende bringen würde, dieses – von einigen kleineren, verstörenden Mollläufen einmal abgesehen – gänzlich schnörkellose C-Dur-Stück.
An einem Tag Anfang Dezember verließ er die Bibliothek zur selben Zeit wie Tim, der in zweien seiner Kurse war und ebenfalls die letzte Bank im Vorlesungssaal bevorzugte. »Heute Abend schon was vor?«, fragte Tim. Es war lange her, dass Paul von jemandem angesprochen worden war.
»Ich wollte irgendwo Livemusik hören.« Er hatte gar nicht daran gedacht, ehe er den Mund aufmachte, doch schien es ihm für den Abend genau das Richtige zu sein. Tims Miene hellte sich auf. Ihre bislang einzige Unterhaltung hatte sich um Musik gedreht.
»Ich wollte mir diese Band ansehen, Baltica«, sagte Tim, »muss aber eigentlich für die Abschlussprüfungen büffeln. Schon mal von gehört?«
»Von Abschlussprüfungen? Klar, ich werde mit fliegenden Fahnen untergehen.«
»Nein, von Baltica.« Tim blinzelte verwirrt. Paul fiel wieder ein, was er früher schon bemerkt hatte, dass Tim nämlich keinerlei Sinn für Humor zu haben schien. Es war, als redete man mit einem Anthropologen von einem anderen Stern. Eigentlich, fand Paul, müsste das doch Möglichkeiten zu einer Art Freundschaft eröffnen, nur konnte er sich einfach nicht vorstellen, wie man unter solchen Umständen ein Gespräch beginnen sollte – ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du dich ebenso fremd fühlst wie ich mich – wollen wir nicht unsere Notizen vergleichen? –, außerdem verschwand Tim bereits im dunklen Herbstabend. Aus dem Zeitungsständer der Cafeteria nahm Paul ein paar Ausgaben der alternativen Wochenblätter mit und ging zurück auf sein Zimmer, wo er sich zur Gesellschaft Beethovens Fünfte auflegte, um dann die Anzeigen zu studieren, bis er jene der Band Baltica fand, die für einen späten Gig an einem Veranstaltungsort angekündigt war, von dem er noch nie gehört hatte, irgendwo Queen Street Ecke Spadina Avenue. Wann war er das letzte Mal losgezogen, um Livemusik zu hören? Paul zerzauste seine Haare, glättete sie wieder, änderte seine Meinung und zerzauste sie erneut, probierte drei Shirts an und lief, von der eigenen Unentschlossenheit angewidert, aus dem Zimmer, ehe ihn die Versuchung überkommen konnte, es sich erneut anders zu überlegen. Die Temperatur war weiter gesunken, doch hatte die kalte Luft etwas Reinigendes, und Bewegung war ein therapeutischer Rat, den er allzu oft missachtet hatte, weshalb er entschied, zu Fuß zu gehen.
Zum Club führten einige Stufen hinab zu einem Kellergeschoss unter einem Gothic-Shop. Als er das sah, wartete er einige Minuten auf dem Bürgersteig, da er fürchtete, der Club wäre nur für Gothic-Fans – dann würden alle über seine Jeans und sein Poloshirt lachen –, aber der Türsteher schien ihn kaum wahrzunehmen, und das Publikum bestand nur gut zur Hälfte aus Vampiren. Baltica war ein Trio: ein Typ mit Bassgitarre, ein zweiter, der mit einer Reihe mysteriöser, an ein Keyboard angeschlossener Elektronikgeräte hantierte, und eine Frau mit E-Geige. Was sie auf der Bühne fabrizierten, hörte sich eigentlich nicht nach Musik, sondern wie ein verzerrter Radiosender an, voll verrückter statischer Explosionen und zusammenhangloser Noten, genau die Art diffuser Ambientmusik, der Paul, sein Leben lang Beethoven-Fan, absolut nichts abgewinnen konnte; die Frau aber war schön, also machte es ihm nichts aus, denn auch wenn ihm die Musik nicht gefiel, genoss er es doch, der Frau zuzusehen. Sie beugte sich zum Mikro vor und sang: »I always come to you«, nur war da ein Echo, der Typ mit dem Keyboard hatte aufs Pedal gedrückt, weshalb es sich anhörte wie:
I always come to you, come to you, come to you
– was ziemlich schräg klang, ihre Stimme untermalt von Keyboardtönen und statischen Entladungen, dann aber griff die Frau zu ihrem Instrument, und da zeigte sich, dass die Geige das fehlende Element gewesen war. Als sie mit dem Bogen darüberstrich, konnte Paul hören, wie alles zusammenfand, die Geige, die statischen Geräusche und deren schattenhafte Untermalung durch die Bassgitarre; einen Moment lang lauschte er hingerissen, dann ließ die Frau jedoch die Geige sinken, woraufhin die Musik wieder in ihre Bestandteile zerfiel und Paul sich verwundert fragte, wie irgendwem so was gefallen konnte.
Später, als die Band an der Bar saß und trank, wartete Paul einen Moment ab, in dem die Geigerin mit niemandem redete, und drängte sich in die Runde.
»Entschuldigt«, sagte er, »ich wollte euch bloß sagen, dass ich eure Musik toll finde.«
»Danke«, erwiderte die Violinistin und lächelte, wenn auch auf die distanzierte Weise schöner Frauen, die ahnen, was als Nächstes kommt.
»War echt fantastisch«, sagte Paul zum Bassspieler, um ihre Erwartungen zu durchkreuzen und sie ein wenig aus dem Konzept zu bringen.
»Danke, Mann.« Der Bassgitarrist strahlte ihn so an, dass Paul ihn für stoned hielt.
»Ich heiße übrigens Paul.«
»Theo«, sagte der Bassgitarrist. »Und das sind Charlie und Annika.« Charlie, der Keyboarder, nickte und prostete ihm mit seinem Bier zu, während Annika ihn über den Rand ihres Glases hinweg beobachtete.
»Sag, kann ich euch was Verrücktes fragen?« Paul wollte Annika unbedingt wiedersehen. »Ich bin noch neu in der Stadt und find einfach keinen Laden, in dem man richtig gut tanzen kann.«
»Lauf einfach die Richmond Street runter und bieg dann links ab«, sagte Charlie.
»Nein, ich mein, ich war in ein paar von den Läden da unten, aber es ist gar nicht so leicht, was zu finden, wo die Musik nicht nervt; und ich hab gedacht, vielleicht könnt ihr was empfehlen …?«
»Ach so, klar.« Theo trank den letzten Schluck von seinem Bier. »Sicher, versuch’s mal im System Sound.«
»An den Wochenenden ist da allerdings die Hölle los«, sagte Charlie.
»Ja, Mann, geh bloß nicht am Wochenende hin. Dienstagabend ist es da meist ziemlich gut.«
»Ja, Dienstagabend ist es am besten«, sagte Charlie. »Wo kommst du her?«
»Hinterste Vorstadt«, sagte Paul. »Dienstag im System Sound, okay, danke, probier ich mal.« Und zu Annika: »Vielleicht sehen wir uns ja wieder«; mit diesen Worten wandte er sich so rasch ab, dass er ihre Gleichgültigkeit nicht sehen konnte, die ihm wie ein kalter Wind zur Tür folgte.
Am Dienstag nach dem Examen – drei Dreien, eine Drei minus, weshalb die Uni sein Studium zur Bewährung aussetzte – ging Paul in die System Soundbar und tanzte für sich allein. Die Musik gefiel ihm nicht besonders, aber er tanzte gern in der Menge. Die Beats waren kompliziert, und er war sich nicht sicher, wie er sich dazu bewegen sollte, also trat er irgendwie nur vor und zurück, ein Glas Bier in der Hand, und versuchte, an nichts weiter zu denken. Ging es bei Clubs nicht genau darum? Mit Alkohol und Musik das Denken auszuschalten? Er hatte gehofft, Annika würde hier sein, aber in der Menge entdeckte er weder sie noch sonst jemanden von Baltica. Immer wieder blickte er sich um, und immer wieder waren sie nicht da, also besorgte er sich von einer Frau mit pinkfarbenem Haar schließlich ein Tütchen mit hellblauen Pillen, denn E war kein Kokain, zählte also nicht, nur stimmte irgendwas damit nicht, vielleicht auch nicht mit Paul: Er biss eine Pille in zwei Teile und schluckte nur eine Hälfte, da er aber nichts spürte, spülte er mit einem Schluck Bier auch die andere Hälfte runter, und der Saal verschwamm, Paul brach der Schweiß aus, sein Herz hämmerte, und eine Sekunde lang fürchtete er, er müsse sterben. Die Frau mit dem pinkfarbenen Haar war verschwunden. Paul suchte sich eine Bank und lehnte sich an die Wand.
»Hey, Mann, alles okay? Geht’s wieder?« Irgendwer kniete vor ihm. Eine beträchtliche Menge Zeit war vergangen, die Leute verschwunden. Man hatte Licht gemacht, und diese Helligkeit war grässlich. Sie verwandelte die System Soundbar in einen schäbigen Saal mit kleinen, auf dem Boden blitzenden Pfützen einer unbestimmbaren Flüssigkeit. Ein älterer, totäugiger Typ mit vielen Piercings sammelte Flaschen und Becher in einen Müllsack, und nach dem Dröhnen der Musik war die Stille ein Tosen, eine Leere. Der Mann, der vor Paul kniete, gehörte zum Club-Management und trug die vorgeschriebene Jeans plus Radiohead T-Shirt plus Blazer, genau das, was die vom Management alle trugen.
»Ja, geht wieder«, sagte Paul. »Tut mir leid. Ich glaub, ich hab zu viel getrunken.«
»Weiß nicht, Mann, was du dir reingezogen hast, aber es steht dir nicht«, sagte der Management-Typ. »Verschwinde jetzt, wir schließen.« Paul kam unsicher auf die Beine, und erst als er die Straße betrat, fiel ihm ein, dass er seinen Mantel in der Garderobe vergessen hatte, aber die Tür hinter ihm war schon ins Schloss gefallen. Er fühlte sich wie vergiftet. Fünf leere Taxen zogen an ihm vorbei, ehe das sechste anhielt. Der Fahrer war ein überzeugter Abstinenzler und belehrte Paul auf dem Rückweg zum Campus ununterbrochen über die Gefahren des Alkohols. Paul wünschte sich nichts sehnlicher, als ins Bett zu kommen, also ballte er die Fäuste und sagte keinen Ton, bis der Wagen an den Bürgersteig fuhr und hielt, woraufhin er zahlte – kein Trinkgeld – und dem Fahrer sagte, er solle verdammt noch mal aufhören, ihm Vorträge zu halten, und sich lieber wieder nach Indien verpissen.
»Hören Sie, lassen Sie mich das klarstellen«, erklärte Paul zwanzig Jahre später dem Suchtberater einer Entzugsklinik in Utah, »ich habe mich verändert. Ich versuche nur, möglichst ehrlich zu beschreiben, wie ich damals so war.«
»Ich komme aus Bangladesch, du rassistischer Idiot«, fauchte der Taxifahrer und ließ seinen Fahrgast auf dem Bürgersteig stehen, wo Paul vorsichtig in die Knie ging, um sich zu übergeben. Danach torkelte er zurück zum Studentenheim und staunte über das Ausmaß des Desasters. Trotz der vielen Widrigkeiten hatte er einen Platz an einer exzellenten Uni ergattert, im Dezember aber war bereits alles wieder vorbei. Er scheiterte schon im ersten Semester. »Sie müssen sich gegen Enttäuschungen wappnen«, hatte ihm mal ein Therapeut geraten, aber er konnte sich gegen rein gar nichts wappnen, das war schon immer sein Problem.
Zwei Wochen im Zeitraffer, die ereignislosen Winterferien vorgespult – ihre Therapeutin hatte seiner Mutter geraten, sich Abstand zum Sohn und ein wenig Zeit für sich selbst zu gönnen, dem Jungen Gelegenheit zu geben, erwachsen zu werden etc., also war sie, ohne Paul einzuladen, nach Winnipeg gefahren, um Weihnachten bei ihrer Schwester zu verbringen. An Heiligabend saß er allein in seinem Zimmer und rief seinen Dad an, kein leichtes Gespräch, bei dem er über alles log, genau wie früher; und so zog sich die Zeit bis zum 28. Dezember hin, dem Tiefpunkt dieser toten Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, ein weiterer Dienstag, an dem er sich abends für die System Soundbar das Haar nach hinten gelte und ein Hemd anzog, das er eigens für diesen Abend gekauft hatte. Er trug dieselben Jeans wie bei seinem letzten Besuch im Club und wusste nicht mehr, dass in einer der vorderen Taschen noch das Tütchen mit den blauen Pillen steckte.
Er ging ins System, und da standen die Mitglieder der Band Baltica, Annika, Charlie und Theo, zusammen an der Bar. Anscheinend hatten sie in der Nähe einen Gig gehabt, bestimmt ein gutes Omen. War Annika seit ihrer letzten Begegnung noch schöner geworden? Durchaus möglich. Sein Leben als Student schien fast vorbei, doch wenn er sie so sah, konnte er für sich eine neue Version der Realität erahnen, eine andere Art Leben. Er wusste, er war, ganz objektiv betrachtet, kein schlecht aussehender Mann. Er besaß ein gewisses Talent für Musik. Und vielleicht machte ihn seine Vergangenheit ja interessant. Jedenfalls gab es eine Version dieser Welt, in der er mit Annika ausging und in vielerlei Hinsicht erfolgreich war, selbst wenn er sich für ein Leben an der Universität nicht sonderlich eignete. Er könnte zurück in den Einzelhandel gehen, das Ganze diesmal ernster nehmen und genug für ein anständiges Leben verdienen.
»Sehen Sie«, wird er dem Berater in Utah zwanzig Jahre in der Zukunft sagen, »ich hatte natürlich viel Zeit, um über all das nachzudenken, und natürlich weiß ich, dass meine Überlegungen damals verrückt und egozentrisch waren, aber Annika war so schön; und ich habe gedacht: Sie ist meine Chance, von hier fortzukommen, meine Gelegenheit, mich nicht länger wie ein Versager zu fühlen …«
Jetzt oder nie, dachte Paul, und getragen von plötzlichem Überschwang, näherte er sich der Bar.
»Hey«, sagte Theo. »Du bist doch dieser Typ!«
»Ich habe mich an euren Rat gehalten«, sagte Paul.
»Was denn für einen Rat?«, fragte Charlie.
»System Soundbar am Dienstag.«
»Ach so«, sagte Charlie, »richtig, ja natürlich.«
»Gut, dich zu sehen, Mann«, sagte Theo, und Paul spürte, wie ihm warm wurde. Er lächelte alle an, insbesondere aber Annika.
»Hi«, sagte sie, gar nicht mal unfreundlich, doch immer noch mit einer gewissen irritierenden Skepsis, so als rechnete sie damit, dass jeder, der sie sah, mit ihr ausgehen wollte, was natürlich exakt das war, was Paul vorhatte.
Charlie sagte irgendwas zu Theo, der sich leicht vorbeugte, um ihn besser hören zu können. (Kurzes Porträt von Charlie Wu: Kleiner Typ mit Brille und normalem, büroadäquatem Haarschnitt, dazu weißes Hemd und Jeans, stand da mit den Händen in den Taschen, und in seiner Brille spiegelte sich das Licht, weshalb Paul seine Augen nicht sehen konnte.)
»Hör mal«, sagte Paul zu Annika. Sie sah ihn an. »Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich finde, du siehst wirklich toll aus, und ich frage mich gerade, ob du nicht irgendwann einmal mit mir essen gehen magst.«
»Nein, danke«, sagte sie. Theos Aufmerksamkeit wanderte von Charlie zu Paul, und er musterte Paul aufmerksam, fast, als fürchtete er, einschreiten zu müssen, und Paul begriff: Ihr Abend war schön gewesen, bis er, Paul, gekommen war. Er war das Problem. Charlie putzte sich die Brille, wirkte ganz selbstvergessen, wie er die Gläser polierte, und nickte im Takt zur Musik.
Paul zwang sich zu einem Lächeln. »Okay«, sagte er, »kein Problem, nichts für ungut, dachte nur, kann ja nicht schaden, mal zu fragen.«
»Kann nie schaden«, gab Annika ihm recht.
»Habt ihr Bock auf E?«, fragte Paul.
»… Ich weiß es nicht«, sagte er dem Berater zwanzig Jahre später, »ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich mir damals dachte; ich erinnere mich nur an diese entsetzliche Leere in meinem Kopf; ich hatte wirklich keinen Schimmer, was ich sagen würde, bis ich es dann gesagt habe …«
»Ist nicht so mein Ding«, sagte Paul, weil sie ihn jetzt alle anstarrten, »ich sag das ganz wertfrei, hab einfach nie viel dafür übriggehabt. Die hier sind von meiner Schwester.« Er präsentierte die kleine Türe auf der ausgestreckten Hand. »Würde sie nur ungern verkaufen, ist nämlich auch nicht so mein Ding, aber sie im Klo runterzuspülen, wäre doch Verschwendung, also dachte ich …«
Annika lächelte. »Ich glaube, die hatte ich letzte Woche schon mal«, sagte sie. »Genau dieselbe Farbe.«
»Sie verstehen, warum ich diese Geschichte noch nie jemandem erzählt habe«, sagte Paul dem Berater zwanzig Jahre nach der System Soundbar. »Ich habe echt nicht gewusst, dass es üble Pillen sind. Ich dachte nur, ich hätte schlecht darauf reagiert, vielleicht, weil mein Körper von den Opiaten noch völlig durcheinander war oder so, jedenfalls hab ich wirklich nicht gewusst, dass jedem, der die einwirft, automatisch schlecht wird, schon gar nicht, dass …«
»Egal, ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt«, sagte er zu dieser Gruppe, die ihn, wie all die Gruppen, die er in seinem Leben je kennengelernt hatte, ablehnen würde; und Annika lächelte und nahm das Tütchen aus seiner Hand. »Wir sehen uns«, sagte er in die Runde, vor allem aber zu ihr, denn manchmal bedeutet Nein, danke auch: im Augenblick nicht, aber vielleicht später, wären nur die Pillen nicht gewesen, die Pillen, die Pillen …
»Danke«, sagte sie.
»Also, allein wie sie reagiert hat«, sagte Paul dem Berater. »Mir ist schon klar, was Sie jetzt denken, aber ich habe echt geglaubt, sie hätte genau so eine Pille eingeworfen, in der Woche zuvor, wie sie gesagt hat; und so, wie sie mich anlächelte, habe ich gedacht, sie hatte einen guten Trip, sie mochte diese Pillen, weshalb das, was mir selbst passierte, eindeutig nur eine schräge Reaktion gewesen sein konnte, nichts, wie gesagt, womit man rechnen musste … hören Sie, ich weiß, ich wiederhole mich, aber Sie müssen einfach verstehen, dass ich das wirklich nicht wissen konnte, ich meine, ich weiß schon, wie sich das jetzt anhört, aber ehrlich, ich hatte nicht die geringste Ahnung …«
Nachdem Paul gegangen war, nahm Annika eine Pille und gab die anderen beiden Charlie, dessen Herz auf der Tanzfläche eine halbe Stunde später stehen blieb.
2
Im Nachhinein fällt es leicht, die Hysterie um den Millennium-Bug zu belächeln – falls man sich überhaupt noch daran erinnert –, doch schien die Gefahr eines allgemeinen Zusammenbruchs damals sehr real. Am 1. Januar 2000, so die Experten, käme es Schlag Mitternacht in den Atomkraftwerken zur Kernschmelze, fehlfunktionierende Computer schickten Raketenschwärme über die Ozeane, das Internet bräche zusammen und Flugzeuge stürzten vom Himmel. Für Paul aber war die Welt längst zusammengebrochen, weshalb er drei Tage nach Charlie Wus Tod in der Ankunftshalle des Vancouver Airport in einer Telefonzelle stand und versuchte, seine Halbschwester Vincent zu erreichen. Er hatte genug Geld, um aus Toronto zu fliehen, für alles andere blieb ihm dann allerdings kaum noch was übrig, weshalb sein ganzer Plan darauf beruhte, sich der Gnade seiner Tante Shauna auszuliefern, die laut seinen nebulösen Kindheitserinnerungen ein riesiges Haus mit zahlreichen Gästezimmern besaß. Nur hatte er Vincent seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, seit sie dreizehn und er achtzehn gewesen und Vincents Mutter gerade gestorben war. Und Shauna hatte er nicht mehr gesehen, seit er, was, elf gewesen war? All das ging ihm durch den Kopf, während das Telefon im Haus seiner Tante endlos klingelte. Ein Pärchen mit identischen T-Shirts ging vorbei, auf denen »Party Like It’s 1999« stand, und erst da fiel ihm ein, dass Silvester war. Die letzten zweiundsiebzig Stunden hatten was Halluzinatorisches gehabt. Und er hatte nicht viel geschlafen. Seine Tante besaß offenbar keinen Anrufbeantworter. Auf dem Regal in der Telefonzelle lag ein Adressbuch, in dem er die Anwaltsfirma fand, bei der sie arbeitete.
»Paul«, sagte sie, nachdem er die Hürden der Vorzimmerdame genommen hatte. »Was für eine nette Überraschung.« Ihre Stimme klang sanft, zurückhaltend. Was hatte sie gehört? Er nahm an, dass sein Name über die Jahre in Gesprächen öfter gefallen war. Paul? Ach, der macht doch wieder einen Entzug. Ja, zum sechsten Mal.
»Tut mir leid, dass ich dich im Büro behellige.« Paul spürte, wie ihm die Augen kribbelten. Es tat ihm wirklich leid, unendlich leid, einfach alles. (Angestrengt versuchte er, nicht an Charlie Wu in der System Soundbar zu denken, an Charlie Wu auf der Trage, an seinen Arm, der baumelnd herabhing.)
»Ach, das macht doch nichts. Rufst du nur an, um Hallo zu sagen …?«
»Ich versuche, Vincent zu erreichen«, sagte Paul, »aber aus irgendeinem Grund geht sie bei dir zu Hause nicht ans Telefon, deshalb habe ich mich gefragt, ob sie jetzt vielleicht einen eigenen Anschluss hat …«
»Vincent ist schon vor über einem Jahr ausgezogen.« Die bemühte Neutralität in der Stimme seiner Tante verriet, dass die Trennung wohl nicht gerade einvernehmlich vonstattengegangen war.
»Vor einem Jahr? Da war sie sechzehn, oder?«
»Siebzehn«, sagte seine Tante, als machte das einen Unterschied. »Sie ist zu einer Freundin, die sie noch aus Caiette kannte, irgendein Mädchen, das gerade in die Stadt gezogen war. Von dort aus hatte sie es nicht so weit zur Arbeit.«
»Hast du ihre Nummer?«
Hatte sie. »Falls du sie siehst, sag Hallo von mir.«
»Redet ihr nicht mehr miteinander?«
»Unsere Trennung war nicht ganz einfach, fürchte ich.«
»Ich dachte, du solltest dich um sie kümmern«, sagte er. »Bist du nicht ihr Vormund?«
»Paul, sie ist keine dreizehn mehr. Sie wollte nicht länger bei mir wohnen, sie wollte auch nicht mehr zur Highschool gehen, und wenn du ein wenig mehr Zeit mit ihr verbracht hättest, dann wüsstest du, Vincent zu etwas zu bewegen, was sie nicht will, das ist, als versuchte man, auf eine Ziegelmauer einzureden. Aber wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, gleich beginnt ein Meeting, und ich muss mich beeilen. Pass auf dich auf.«
Paul stand da und lauschte auf den Freiton, in der Hand die Boardingkarte mit Vincents hingekritzelter Telefonnummer. Er hatte sich ausgemalt, in einem der Gästezimmer untergebracht zu werden, der Grund unter seinen Füßen aber geriet immer heftiger ins Schwanken. Die Kopfhörer baumelten um den Hals, also setzte er sie mit leicht zittrigen Händen auf, um dann die Starttaste auf seinem Discman zu drücken, woraufhin die Brandenburgischen Konzerte erklangen. Bach hörte er nur, wenn er dringend Ordnung brauchte. Das ist die Musik, die mich zu Vincent führt, dachte er und machte sich auf die Suche nach einem Bus, der ihn zurück in die Stadt brachte. In was für einer Wohnung Vincent wohl lebte? Und mit wem? Vincents einzige Freundin, an die er sich erinnern konnte, war Melissa, und an die erinnerte er sich auch nur, weil sie da gewesen war, damals, als Vincent das Graffiti schrieb und anschließend suspendiert wurde:
Fegt mich weg. Mit einem Ätzstift ans Nordfenster der Schule gekrakelte Worte; in Vincents behandschuhter Faust hatte der Stift leicht gezittert. Sie war dreizehn und in Port Hardy, British Columbia, einer Stadt am nördlichsten Zipfel von Vancouver Island, die irgendwie nicht ganz so abgelegen war wie der Ort, an dem Vincent eigentlich wohnte. Paul bog um die Ecke der Highschool, kam aber zu spät, um sie daran zu hindern, doch rechtzeitig, um sie dabei zu ertappen; und jetzt schwiegen sie einen Moment, sie alle drei – Vincent, Paul und Melissa –, und sahen zu, wie von mehreren Buchstaben Säuretropfen die Scheibe hinabperlten. Durch sie hindurch war das abgedunkelte Klassenzimmer zu sehen, eine Ansammlung von Schatten, leere Reihen Tische und Stühle. Vincent trug einen ledernen Männerhandschuh, den sie weiß Gott wo aufgetrieben hatte. Jetzt zog sie ihn aus und ließ ihn ins zertrampelte Wintergras fallen, wo er wie eine tote Ratte lag, während Paul einfach nur nutzlos und gaffend dastand. Melissa kicherte nervös.
»Was machst du da?« Paul wollte in strengem Ton mit ihr sprechen, fand aber, dass seine Stimme zu hoch klang, zu unsicher.
»Ist doch bloß ein Spruch«, sagte Vincent. Paul wurde unwohl dabei, wie sie das Fenster anstarrte. Auf der anderen Seite der Schule drückte der Busfahrer auf die Hupe.
»Lass uns im Bus weiterreden«, sagte Paul, aber da sie beide wussten, dass sie kein Wort mehr darüber verlieren würden, klang Paul als Autoritätsperson nicht gerade überzeugend.
Vincent rührte sich nicht.
»Ich sollte besser gehen«, sagte Melissa.
»Vincent«, sagte Paul, »wenn wir den Bus verpassen, müssen wir nach Grace Harbour trampen und ein Wassertaxi bezahlen.«
»Ist doch egal«, sagte Vincent, folgte ihrem Bruder aber zum wartenden Schulbus. Melissa saß vorn beim Fahrer und tat, als hätte sie schon mit den Schularbeiten angefangen, blickte aber verstohlen auf, als sie an ihrem Platz vorbeigingen. Schweigend fuhren sie nach Grace Harbour, wo das Postboot wartete, das sie nach Caiette brachte. Während es die Halbinsel umschiffte, starrte Paul zur riesigen Baustelle, wo das neue Hotel entstand, auf die Wolken, auf Melissas Hinterkopf, auf die Bäume am Ufer, irgendwohin, nur nicht ins Wasser, denn da unten gab es nichts, an das er denken wollte. Als sein Blick auf Vincent fiel, registrierte er erleichtert, dass sie auch nicht aufs Wasser sah. Sie schaute zum dunkel werdenden Himmel auf. An der anderen Seite der Halbinsel lag Caiette, ein Ort, mit dem verglichen Port Hardy geradezu eine Metropole war: einundzwanzig Häuser, eingezwängt zwischen Wasser und Wald, die gesamte Infrastruktur nur eine in zwei Sackgassen endende Straße, eine kleine Kirche aus den 1850er-Jahren, eine Ein-Raum-Post, eine geschlossene Ein-Raum-Schule – seit Mitte der Achtziger gab es für die Schule nicht mehr genügend Kinder – und eine Pier. Kaum hatte das Boot in Caiette angelegt, gingen sie den Hügel hoch nach Hause zu Grandma und Dad, die am Küchentisch auf sie warteten. Normalerweise lebte Grandma in Victoria und Paul in Toronto, aber dies waren keine normalen Zeiten. Vor zwei Wochen war Vincents Mutter verschwunden. Jemand hatte ihr Kanu gefunden, es trieb leer auf dem Wasser.
»Melissas Eltern haben in der Schule angerufen«, sagte Dad. »Und die Schule hat mich angerufen.«
Vincent – sie hatte Mut, das musste man ihr lassen – zuckte nicht mal zusammen. Sie setzte sich an den Tisch, verschränkte die Arme und wartete, während Paul sich unbeholfen ans Ofenrohr lehnte und zusah. Sollte er auch am Tisch Platz nehmen? Den verantwortungsbewussten älteren Bruder mimen etc.? Wie immer und überall wusste er nicht, was er tun sollte. In der Art, wie Dad und Grandma Vincent anblickten, klang alles an, was ungesagt blieb: Vincents kürzlich blau gefärbtes Haar, ihre immer schlechter werdenden Noten und der schwarze Lidstrich, ihr unfassbarer Verlust.
»Warum hast du das ans Fenster geschrieben?«, fragte Dad.
»Weiß nicht«, antwortete sie leise.
»War das Melissas Idee?«
»Nein.«
»Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Sind einfach nur Worte, die mir gefallen.« Der Wind wechselte die Richtung, und Regen rasselte ans Küchenfenster. »Tut mir leid«, sagte sie. »Ich weiß, das war blöd.«
Dad sagte Vincent, dass sie für eine Woche suspendiert worden sei. Es hätte schlimmer kommen können, aber die Schule ließ Nachsicht walten. Vincent nahm es kommentarlos hin, erhob sich und ging auf ihr Zimmer. In der Küche blieben sie stumm. Paul, Dad und Grandma, lauschten Vincents Schritten auf der Treppe und dann, wie sie leise die Tür hinter sich zuzog, ehe Paul sich zu den beiden an den Tisch setzte – an den Erwachsenentisch, wie er unwillkürlich dachte –, und niemand wies auf das Offensichtliche hin, nämlich darauf, dass er aus Toronto zurückgekommen war, um auf Vincent aufzupassen, was idealerweise vermutlich auch bedeutet hätte, dass er sie keine Graffiti an Schulfenster schmieren ließ, die man nicht mehr wegputzen konnte. Wann aber wäre er je in der Lage gewesen, auf andere aufzupassen? Warum hatte er geglaubt, helfen zu können? Auch darauf kam niemand zu sprechen. Sie saßen einfach nur da und lauschten stumm dem Regen, während Vincent noch unter ihnen weilte dank eines Luftschachts, von dem Dad und Grandma offenbar nicht wussten, dass er direkt zu ihrem Zimmer führte.
»Tja«, sagte Paul, der unbedingt auch einen Szenenwechsel wollte, »ich sollte wohl besser mit meinen Hausarbeiten anfangen.«
»Wie läuft’s denn so?«, fragte Grandma.
»Mit der Schule? Bestens«, sagte Paul. »Alles bestens.« Sie glaubten, er brächte ein Opfer, hätte all seine Freunde in Toronto zurückgelassen, um herzukommen, hier den Abschluss zu machen und für deine Schwester da zu sein, doch hätten sie etwas besser aufgepasst oder mal mit seiner Mutter geredet, dann wüssten sie, dass er nicht zurück an seine alte Schule durfte und von seiner Mutter vor die Tür gesetzt worden war. Aber muss ein Mensch denn entweder bewundernswert oder furchtbar sein? Ist das Leben wirklich immer so binär? Manchmal, sagte er sich, kann doch auch zweierlei zugleich wahr sein. Dass man den vermeintlichen Tod der Stiefmutter als Vorwand nutzte, um neu anzufangen, hieß nicht, dass man damit nicht auch etwas Gutes tat und für die Schwester da war oder so. Grandma starrte ihn nur ausdruckslos an – hatte sie vielleicht doch mit seiner Mutter gesprochen? –, aber Dad setzte an, etwas zu sagen, ein umständlicher Prozess, zu dem gehörte, dass er sich räusperte, sich in seinem Sessel rekelte und die Teetasse halb an den Mund hob, um sie dann wieder abzustellen, weshalb Paul und Grandma aufhörten, sich gegenseitig anzustarren, und darauf warteten, dass er das Wort ergriff. Trauer verlieh seiner Stimme ein gewisses Gewicht.
»Ich muss bald wieder zur Arbeit«, sagte Dad. »Und ich kann sie nicht mit ins Lager nehmen.«
»Was willst du damit andeuten?«, fragte Grandma.
»Ich denke daran, sie zu meiner Schwester zu schicken.«
»Mit der hast du dich doch noch nie verstanden. Ihr habt schon angefangen, euch zu streiten, da warst du zwei und sie noch ein Baby.«
»Sie treibt mich manchmal zur Weißglut, aber eigentlich ist sie ein guter Mensch.«
»Sie arbeitet hundert Stunden die Woche«, sagte Grandma. »Wäre es für Vincent nicht besser, du würdest dir eine Arbeit in der Nähe suchen?«
»Es gibt in der Nähe keine Arbeit«, sagte er, »jedenfalls keine, von der ich leben könnte.«
»Was ist mit dem neuen Hotel?«
»Das neue Hotel ist noch mindestens ein Jahr lang Baustelle, und so lange gibt es da für mich nichts zu tun. Aber wisst ihr, es geht nicht nur um …« Er verstummte für einen Moment und starrte in seinen Tee. »Von finanziellen Überlegungen einmal ganz abgesehen, bin ich mir auch nicht sicher, ob dieses Leben hier wirklich so gut für Vincent ist. Immer wenn sie aufs Wasser sieht …« Damit endeten seine Überlegungen. Und Paul fand, es war ihm wirklich hoch anzurechnen, dass er, als Dad das sagte, zuerst an Vincent dachte und nicht an diesen unheimlichen Meeresarm, auf den er tunlichst nicht durchs Küchenfenster hinaussah, dass sein erster Gedanke also dem Mädchen galt, das oben am Luftschacht lauschte.
»Ich sehe mal nach Vincent«, sagte Paul. Ihm gefiel, wie sie ihn ansahen – Paul ist ja so erwachsen geworden! –, nur störte ihn, dass es ihm auffiel. Oben auf der Treppe hätte ihn der Mut fast verlassen, aber dann gab er sich einen Ruck, klopfte leise an und öffnete, als er keine Antwort hörte, die Tür zu Vincents Schlafzimmer. Er war lange nicht mehr hier gewesen, und ihm fiel auf, wie schäbig ihr Zimmer aussah. Dass ihm das auffiel, fand er ebenso peinlich wie die Tatsache, dass Vincent es offenbar nicht bemerkte. Oder doch? Unklar. Ihr Bett war älter als sie selbst, vom Kopfende blätterte Farbe ab. Um die oberste Schublade ihrer Kommode öffnen zu können, musste man an einem Strick ziehen. Die Vorhänge waren mal Laken gewesen. Vielleicht machte ihr das nichts aus. Sie saß mit überkreuzten Beinen vorm Luftschacht, genau wie er es vermutet hatte.
»Ist es okay, wenn ich mich zu dir setze?«, fragte er. Sie nickte. Vielleicht klappt es ja, dachte Paul. Vielleicht könnte ich für sie ja wirklich ein richtiger Bruder sein.
»Du solltest nicht mehr in die Elfte gehen«, sagte sie. »Ich hab nachgerechnet.« Verdammt. Ein Schmerz durchzuckte ihn, den es anzuerkennen galt, hatte seine dreizehnjährige Halbschwester doch etwas bemerkt, was dem eigenen Vater anscheinend entgangen war.
»Ich wiederhole eine Klasse.«
»Du hast die Elfte nicht geschafft?«
»Nein, war letztes Jahr die meiste Zeit gar nicht da, weil ich für eine Weile in eine Entzugsklinik musste.«
»Warum?«
»Ich hatte ein Problem mit Drogen.« Er war stolz auf sich, so ehrlich zu ihr zu sein.
»Hast du ein Drogenproblem, weil deine Eltern sich getrennt haben?«, fragte sie und klang ehrlich interessiert, woraufhin er sich nichts sehnlicher wünschte, als von ihr fortzukommen, sodass er aufstand und sich die Jeans abklopfte. In ihrem Zimmer war es staubig.
»Ich habe kein Drogenproblem, ich hatte eins. Liegt alles längst hinter mir.«
»Aber du rauchst Hasch auf deinem Zimmer«, sagte sie.
»Hasch ist kein Heroin. Ist was völlig anderes.«
»Heroin?« Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
»Egal, ich muss Hausarbeiten machen, hab verdammt viel auf.« Ich hasse Vincent nicht, sagte er sich, Vincent war nie das Problem. Vincent habe ich nie gehasst. Ich habe immer nur die Idee Vincent gehasst. Eine Art Mantra, das er sich in gewissen Abständen aufsagen musste, denn als Paul noch sehr klein gewesen war – damals waren seine Eltern noch verheiratet –, hatte sich sein Vater in diese junge Hippiedichterin am Ende der Straße verliebt, die schon bald mit Vincent schwanger war, und keinen Monat später verließen Paul und Pauls Mutter Caiette, flohen »vor diesem ganzen elenden Kitsch«, wie sie sich ausdrückte, und Paul hatte den Rest seiner Kindheit in Torontos Vorstädten verbracht, war im Sommer und jedes zweite Weihnachten aber immer nach British Columbia gependelt, eine Kindheit im Flugzeug hoch über Prärien und Bergen, um den Hals das Schild »Alleinreisendes Kind«, während Vincent bei beiden Eltern leben durfte, die ganze Zeit, jedenfalls bis vor zwei Wochen.
Er ließ sie vor dem Luftschacht sitzen und ging auf sein Zimmer – er hatte schon als Kind dort geschlafen, allerdings war es während seiner Abwesenheit als Vorratsraum genutzt worden, weshalb es sich nicht mehr wie seins anfühlte –, und die Hände zitterten, Trübsal überkam ihn, er drehte sich einen Joint und öffnete das Fenster, aber der Rauch trieb zurück ins Zimmer, und schließlich klopfte es an die Tür. Als Paul aufmachte, stand Dad vor ihm und musterte ihn mit einem Blick unsäglicher Enttäuschung; am Ende der Woche war Paul zurück in Toronto.
Das nächste Mal sah er Vincent am letzten Tag des Jahres 1999, als er mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt fuhr, die Brandenburgischen Konzerte hörte und Vincents Wohnung in der zweifelhaftesten Gegend fand, die er je gesehen hatte, ein heruntergekommenes Haus, auf der anderen Straßenseite gleich gegenüber ein kleiner Park, durch den Junkies torkelten, als wären sie Komparsen für einen Zombie-Film. Während Paul darauf wartete, dass Vincent die Tür öffnete, versuchte er, nicht zu den Junkies hinüberzusehen und nicht daran zu denken, dass ein Leben auf Heroin doch seine Vorzüge hatte, nicht an das schmutzige Geschäft, sich den Stoff besorgen zu müssen, und nicht daran, wie übel einem vom Entzug wurde, sondern nur an das Eigentliche, an jenen Zustand, in dem alles in der Welt perfekt zu sein schien.
Melissa kam an die Tür. »Oh«, sagte sie, »hey! Du hast dich kein bisschen verändert. Komm rein.« Das war irgendwie beruhigend, da er sich wie gezeichnet fühlte, fast, als wären ihm die Details von Charlie Wus Tod auf die Haut tätowiert worden. Melissa dagegen hatte sich sehr verändert. Sie war offensichtlich tief in die Rave-Szene abgetaucht und trug eine blaue Hose aus Kunstpelz, ein regenbogenfarbenes Sweatshirt und das pinkfarbene Haar zu solchen Rattenschwänzchen geflochten, wie Vincent sie mit fünf, sechs Jahren getragen hatte. Melissa ging vor ihm her, die Treppe hinab in das halb fertige Untergeschoss einer der schlimmsten Wohnungen, die Paul je betreten hatte, einer mit Wasserflecken an den Betonwänden. In einer winzigen Kochnische machte Vincent Kaffee.
»Hey«, sagte sie, »schön, dich zu sehen.«