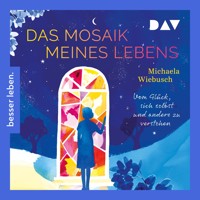9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Die wundervolle Welt in dir Lisa ist im Hamsterrad ihres Alltags gefangen und hat das Gefühl, die Verbindung zu sich selbst und den Menschen, die sie liebt, zu verlieren. Sie fragt sich, was sie wirklich will. Die Suche nach Antworten führt sie nach Griechenland, wo sie ungeahnte Überraschungen erwarten. Lisa entdeckt ein rätselhaftes Mosaik, in dessen Geheimnis sie eine alte Bekannte einweiht, und erkennt, dass sie den Schlüssel zu Glück und Freiheit selbst in der Hand hält. - Eine anregende Erzählung und Einladung zur Selbstreflexion für Frauen in der Lebensmitte - kurzweilig, empathisch, voller Wärme - für die Leser*innen von Tessa Randau und John Strelecky
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Lisa gönnt sich eine Auszeit. Sie will endlich wieder Klarheit über ihren weiteren Weg erlangen. Mit ihrem Mann und den Kindern gibt es oft Streit, beruflich kommt sie nicht voran, sie fühlt sich ausgepowert und unverstanden. Gerne würde sie sich von den immergleichen Gedankenschleifen befreien – nur wie? Als sie bei einem Spaziergang auf die Reste eines geheimnisvollen Mosaiks mit zwölf Frauenfiguren stößt, kommt sie mit einer alten Bäuerin ins Gespräch. Diese erzählt ihr, was es für Suchende bedeutet. In einer Nacht voller Magie erlebt Lisa, wie vielfältig ihre Persönlichkeit ist und wodurch ihre Gefühle und Entscheidungen beeinflusst werden. Sie begreift, je näher sie sich selbst ist, desto besser kann sie sich und auch andere verstehen, und wird so zur Heldin ihres Lebens.
Michaela Wiebusch
Das Mosaik meines Lebens
Vom Glück, sich selbst und andere zu verstehen
Eine Erzählung
Mit Illustrationen von Gisela Goppel
Für Matti, Alina und Malou
»Alles, was wir tun, ist der Versuch,
unserem Glück entgegenzureisen.«
Das Glück von gestern
Wohin verschwinden eigentlich all die schönen Augenblicke, die wir verpassen oder einfach so verstreichen lassen? Man kann sie nicht sammeln oder gar auf später verschieben. Wenn wir diese Momente nicht leben, sind sie unwiederbringlich für uns verloren. Warum lassen wir viele kostbare Zeiten des Glücks und der Schönheit einfach so vergehen, als gäbe es unendlich viel davon?
Immer öfter habe ich mir in den letzten Monaten vorgestellt, dass ich eines Tages wehmütig auf mein Leben zurückblicken und mich fragen werde, warum ich im Laufe der Jahre beinahe all meine Träume aufgegeben habe.
Bevor auch der letzte sich in Luft auflöste, traf ich eine Entscheidung. Ich begab mich auf eine Reise, eine Reise zurück zu mir.
Hier stehe ich nun, und mein Blick schweift in die Ferne. Das Hotel befindet sich inmitten eines Olivenhains und liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Meer entfernt. Jetzt im Herbst sind die Früchte reif zur Ernte. Ihr Anblick und der Duft lassen mich an den würzigen und intensiven Geschmack frischen Olivenöls denken, mit dem ich viele Kindheitserinnerungen verbinde. Es ist der Duft von Freiheit und Glück, ein unglaublich schönes Gefühl aus fernen Tagen. Schon lange vermisse ich diese Magie in meinem Leben. Ich habe sie gegen einen Berg von Verpflichtungen eingetauscht, in dem ich drohe unterzugehen.
Viele Jahre lang habe ich meine Ferien hier an der Küste im schlichten Ferienhaus meiner Eltern verbracht. Daher ist mir die Gegend so vertraut wie eine zweite Heimat. Meine Schwester und ich halfen den Einheimischen oft bei der Olivenernte. An den Abenden saßen wir, erschöpft von der anstrengenden Arbeit und getränkt von der kräftigen griechischen Herbstsonne, an einem langen Esstisch, tunkten genüsslich unser Brot in das golden schimmernde Öl, das aus unserer Ernte gewonnen worden war, und fühlten uns restlos glücklich. Der Duft und Geschmack dieser Abende waren ein Erlebnis für die Sinne, das ich bis heute nicht vergessen habe.
Zum ersten Mal nach vielen Jahren bin ich jetzt an diesen Ort zurückgekehrt.
Als ich eben meinen Mietwagen durch die engen Gassen lenkte und die weiß getünchten Häuser mit den blauen Türen und Fensterrahmen sowie die winzigen Vorgärten mit den Bougainvilleen sah, da schien es mir, als wäre die Zeit stehen geblieben. Noch immer hat der Massentourismus diesen Teil der Peloponnes nicht erreicht. Die wenigen schlichten Hotels und Ferienhäuser, die es gibt, haben das ursprüngliche Dorfleben nicht verändert. Und auch die Einheimischen sind immer noch so gastfreundlich und zuvorkommend wie in meinen Kindertagen.
Leider mussten meine Eltern ihr Ferienhaus vor ein paar Jahren verkaufen, weil sie das Geld brauchten, um ihre Rente aufzubessern. Daher habe ich mir ein Zimmer in einem Hotel gesucht, das direkt in der romantischen Bucht meiner Erinnerungen liegt. Dort angekommen, bezog ich mein spartanisch eingerichtetes Zimmer und trat gleich neugierig auf den Balkon hinaus.
Während der warme Wind mir nun sanft das Gesicht streichelt, stimmen die Zikaden die vertraute Musik des Südens an. Das sanfte Abendlicht überzieht die spiegelglatte Meeresoberfläche mit einem silbern glänzenden Schleier und färbt den Horizont in ein zartes Rosa. Ich würde mich diesem Moment gern hingeben, doch so einfach ist das nicht. Physisch bin ich zwar angekommen, aber mein Geist scheint noch nicht hier zu sein.
Ich hadere mit der Entscheidung, diese Reise allein zu machen. Etwas in meinem Innern sträubt sich dagegen, dass ich hier bin und diesen Moment genießen darf.
Ich muss an meinen letzten Streit mit Fin denken. Kurz vor der Abreise gerieten wir aneinander und taten dann, was wir seit geraumer Zeit in solchen Momenten immer tun: Wir bissen uns in den ewig gleichen Diskussionsschleifen fest. Ja, unsere Streitgespräche sind vorhersehbar geworden. Wir beharren beide auf unseren Standpunkten, halten krampfhaft an unseren Meinungen fest und kämpfen erbittert darum, recht zu haben. Dabei halten wir die eigenen Argumente für die einzig richtigen und die des anderen für gänzlich falsch. Sich in der Schlacht geschlagen geben, will keiner. Und meist bleibt es nicht bei der ursprünglichen Streitfrage. Wir finden andere Gründe, um uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Und je mehr wir uns hochschaukeln, desto zermürbender werden unsere Gespräche – was mich traurig macht und der Grund dafür ist, warum ich an meinem Plan, mir eine Auszeit von meinen beruflichen und familiären Aufgaben zu nehmen, festgehalten habe. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt hier im Paradies stehe und nicht loslassen kann, weil mich mein Gewissen plagt.
Ich frage mich, ob es von mir nicht doch egoistisch war, Fin mit Fabi und Lotte allein zu lassen. Unser Alltag ist auch schon anstrengend genug, wenn wir uns die Arbeit teilen. Gedankenverloren greife ich zum Handy und drücke die Kurzwahltaste.
Fins tiefe Stimme ertönt am anderen Ende der Leitung. »Bist du etwa schon da?«
»Ja, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich gut angekommen bin. Alles in Ordnung bei euch?«
»Alles gut«, entgegnet er knapp.
Im Hintergrund streiten die Kinder lauthals.
»Sekunde«, sagt er, dann höre ich ihn rufen: »Hey! Ich telefoniere hier gerade mit Mama. Könnt ihr mal bitte etwas leiser sein? Ich verstehe sonst kein Wort.«
»Was ist denn da los bei euch?«, frage ich und versuche beiläufig zu klingen, obwohl ich das brennende Verlangen habe, mich einzumischen. Zu Hause würde ich die Situation jetzt übernehmen, damit Fin nicht noch genervter wird, als er es ohnehin schon ist.
»Alles gut«, wiegelt er ab.
Ich höre, wie die Situation im Hintergrund eskaliert. Überhaupt nichts ist gut. Im Gegenteil. Fabi provoziert mal wieder seine jüngere Schwester. Als pubertierender Dreizehnjähriger behandelt er Charlotte wie ein Baby – was sie mit ihren acht Jahren definitiv nicht mehr ist.
»Charlotte! Fabian! Es reicht!«, brüllt Fin. »Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann könnt ihr euer Fernsehen vergessen!«
»Du lässt sie um diese Zeit noch fernsehen?«, frage ich. »Ist das nicht ein bisschen spät?«
Die Kinder haben Fin nicht zugehört, und Fin hat wiederum mir nicht zugehört. Der Streit im Hintergrund geht einfach lautstark weiter.
»Gib mir doch mal Fabi«, fordere ich. »Ich rede mit ihm. Er soll seine schlechte Laune nicht an Lotte auslassen. Er ist schließlich alt genug, um sich gegenüber seiner kleinen Schwester zusammenzureißen.«
»Ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Fin klingt verblüfft, aber auch verärgert.
»Wieso? Ich will dir doch nur helfen.«
»Du hast dich entschieden, ohne uns wegzufahren, weil du dich nur um dich selbst kümmern wolltest. Also tue das bitte auch und lass den Rest meine Sorge sein. Ich muss jetzt auflegen. Du hörst ja, was hier los ist. Gute Nacht.«
Ich spüre seine unterschwellige Wut auf mich und meine Entscheidung. Ohne ein weiteres Wort legt er auf.
Ich ärgere mich. Ein bisschen über mich selbst, aber sehr viel mehr über seine Vorwürfe und seine unfreundliche Art. Leider befördert das Telefonat mein schlechtes Gewissen und vergrößert die Sorge, einen Fehler gemacht zu haben. Ist Fin zu Recht sauer, dass ich ihn allein gelassen habe? Andererseits: Steht es mir nicht zu, mich wenigstens für ein paar Tage nur um mein eigenes Wohlbefinden zu kümmern? Warum glaubt meine Familie, mich rund um die Uhr auf Trab halten zu müssen? Dennoch: Habe ich die drei im Stich gelassen? Ich weiß nicht, ob meine Entscheidung richtig war, und fühle mich deshalb unglücklich.
Um auf andere Gedanken zu kommen, mache ich einen kleinen Spaziergang. Vom Hotel aus führt ein schmaler, gewundener Pfad durch den Olivenhain hinunter zum Meer. Der feinsandige Naturstrand ist umgeben von Felsen. Dort, wo die Steilküste vom Meer unterspült worden ist, hat sich eine große Höhle gebildet, die nicht sehr tief in den Felsen hineinreicht, aber eine beeindruckende Höhe hat.
Der Strand ist menschenleer. Das kristallklare Wasser verführt zum Schwimmen. Ich freue mich auf eine Abkühlung. Während ich mich in der Höhle umziehe, fällt mein Blick auf eine Handvoll Bambusstöcke draußen auf dem Strand, die in Form eines kleinen Zeltes zusammenstehen und ein auf dem Sandboden liegendes Gitter einzäunen. Es gibt an diesem Strandabschnitt rund ein Dutzend dieser seltsam anmutenden Mini-Tipis. Ich weiß, dass sie von Naturschützern aufgebaut werden, um die Nester der hiesigen Schildkröten zu schützen – nicht nur vor kleinen Raubtieren, sondern vor allem vor unbedachten Touristen.
Ich erinnere mich, dass wir als Kinder wach bleiben durften, um die frisch geschlüpften Schildkrötenbabys auf ihrer kurzen Wanderung ins Meer zu beobachten. Oft schliefen wir zwar beim Warten ein, aber wir wollten dieses aufregende Abenteuer jeden Sommer aufs Neue erleben und fühlten uns wie kleine Heldinnen, wenn es uns gelang, die Schildkrötenwanderung mit eigenen Augen zu sehen.
Ich schlendere am Strand entlang und lasse den Blick schweifen. Die Schönheit der Natur auf der Peloponnes ist einzigartig. Warum bin ich in all den Jahren eigentlich nie mit Fin hier gewesen? Hatte ich womöglich Sorge, dass er mir mit ironischen Bemerkungen und schlechter Laune das Idyll meiner Kindheit madig machen könnte?
Mir wird klar, wie grundverschieden wir sind. Unsere Ehe befindet sich seit geraumer Zeit in einer Schieflage. Ich fühle mich von Fin nicht nur alleingelassen, sondern auch unverstanden, besonders wenn es um den alltäglichen Kram geht. Manchmal scheint es mir, als würde das Lebensglück aller ausschließlich auf meinen Schultern lasten. Das macht mich oft wütend, und dann fühle ich mich ohnmächtig.
Will Fin nicht sehen, wie es mir geht? Interessiert er sich einfach nicht dafür? Oder will er sich dem Problem nur nicht stellen, weil das für ihn mit unbequemen Konsequenzen verbunden sein könnte? Ich weiß es nicht. Es müsste sich in unserem Leben etwas ändern, wahrscheinlich müsste auch er sich ändern. Aber Veränderungen behagen ihm nicht. Ich würde ihm das gern klar und sachlich darlegen, aber immer, wenn ich in Diskussionen von meinen angestauten Gefühlen überwältigt werde, fühle ich mich überfordert, und ich kann ihm dann nicht verständlich machen, was mich bedrückt. Regelmäßig scheitere ich bei dem Versuch, unseren Gesprächen eine konstruktive Richtung zu geben, egal ob es um die Erziehung unserer Kinder, die Aufteilung alltäglicher Aufgaben oder unsere finanzielle Situation geht.
Unsere Streitereien werden von Mal zu Mal verletzender. Fin mauert. Er hält meine Bedürfnisse für übertrieben und tut sie als »Psychoquatsch« ab. Unwichtig, ob es unsere Kinder oder mich betrifft, mein Mann will sich einfach nicht mit Gefühlen, geschweige denn mit sich selbst auseinandersetzen. Er arbeitet lieber, als sich mit den emotionalen Wellen und Wünschen seiner Familie zu beschäftigen. »Alles nicht so wichtig«, lautet sein Credo. Schließlich, so argumentiert er dann immer, sorge er maßgeblich dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen da ist. Daher sieht er für niemanden Grund zur Klage. Dass auch ich einen kraftraubenden Beruf habe, aber dazu noch den ganzen alltäglichen Organisationswahnsinn übernehme, übersieht er einfach.
Im Laufe der Jahre habe ich versucht, mich mit seiner pragmatischen Art zu arrangieren, und seine Haltung in vielerlei Hinsicht übernommen – irgendwann sogar mir selbst gegenüber. Wenn ich heute zurückblicke, erkenne ich, wie wenig Aufmerksamkeit ich meinen Wünschen geschenkt und wie sehr ich meine Gefühle dabei ignoriert habe. Mir scheint, das bekomme ich jetzt schmerzlich zu spüren. Wie ein Hamster im Laufrad verrichte ich meine Pflichten. Mein Leben ist ein freudloser Marathon geworden, der mich nicht von der Stelle kommen lässt.
So sind die Jahre vergangen, ohne dass ich jemals mit meiner Familie hierher zurückgekehrt wäre, obwohl diese Gegend für mich in meiner Kindheit und Jugend eine Oase des Glücks war. Hier habe ich gelernt, darauf zu vertrauen, dass das Leben es gut mit mir meint – und ich hatte es verstanden, mich dem Moment hinzugeben.
Ich schaue zum Horizont und frage mich, wo diese Fähigkeiten nur hin sind. Wo ist meine Leichtigkeit geblieben? Warum habe ich die Dinge, die mir einst so wichtig waren, im Laufe meiner Ehe mit Fin aufgegeben? Warum sind meine Wünsche und Träume unter einem Berg von Verantwortung und Pflichten verschüttgegangen? Einem Berg, unter dem ich oft zu ersticken drohe.
Damals, als ich ins Leben startete, wollte ich alles anders machen als meine Eltern. Und jetzt? Ist es mir gelungen? Die Bilanz sieht traurig aus. Viele Vorstellungen, die ich von meinem Leben und von mir selbst hatte, sind heute unscharf und verblasst. Was ist von mir übrig geblieben? Wer bin ich noch nach all den Jahren? Ich hoffe, hier Antworten auf diese Fragen zu finden.
Das Wasser ist für die Jahreszeit erstaunlich warm und dabei herrlich erfrischend. Ich fühle mich wie eine Feder, die vom Meer mit leichter Hand getragen wird. Mein Körper schwebt. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit spüre ich den Hauch der Erinnerung daran, was es bedeuten könnte, loszulassen.
Ich schließe die Augen. Mein Kopf liegt auf dem Meer wie auf einem Kissen, das Wasser umschließt meine Ohren. Es kommt mir vor, als würde mich ein Kokon umgeben. Ich höre meinen Atem und spüre, wie das Blut in meinen Adern pulsiert. Für den Moment stoppt mein Gedankenkarussell, und ich schwebe im Hier und Jetzt.
Doch schon in der nächsten Sekunde hat mich die Panik wieder. Da ist dieser Stein in meiner Brust. Zentnerschwer zieht er mich in die Tiefe. Ich ringe nach Luft und habe das Gefühl zu ertrinken.
Früher habe ich die Stille gemocht – ja sogar gesucht. Heute macht sie mir Angst. Je stiller es um mich herum wird, desto lauter und turbulenter geht es in meinem Innern zu. Das Gefühl, in einem Meer von Gedanken zu ertrinken und keine Luft zu bekommen, kenne ich gut.
Ich muss raus. Sofort! Raus aus dem Meer. Hektisch schwimme ich zurück zum Strand, um dort zu merken, dass die Sonne gleich hinter dem Horizont verschwunden sein wird. Die Felsen werfen lange Schatten. Ich packe meine Sachen zusammen und gehe schnell zurück zum Hotel.
Als ich dort ankomme, fröstelt es mich. Ich bestelle beim Zimmerservice einen warmen Tee und lege mich dann gleich aufs Bett, erfasst von einer plötzlichen, bleiernen Müdigkeit. Als man mir kurz danach den Tee aufs Zimmer bringen will, vernehme ich im Halbschlaf nur noch dumpf und wie von fern ein leises Klopfen an meiner Tür.
Wiedersehen im Haus des Lebens
Ich erwache bei Sonnenaufgang. Der kalte Tee vor meiner Tür erinnert mich daran, dass ich mehr als zehn Stunden geschlafen habe. Offensichtlich hatte ich einiges nachzuholen. Ich fühle mich nicht nur ausgeruht, sondern auch zuversichtlicher als gestern und beschließe, die frühen Morgenstunden mit einem ausgedehnten Spaziergang zu verbringen. Eine gute Idee, wie ich wenig später feststelle. Das Licht am Meer ist traumhaft, die Luft schmeckt wie frisch gesiebt, und zu dieser frühen Stunde habe ich den Strand ganz für mich allein.
Mein Spaziergang endet an einer Felswand. Man kann das Hindernis mithilfe einer alten Holztreppe, die steil auf die Klippe hinaufführt, umgehen. Wind und Wetter haben die Stufen im Laufe der Jahre morsch werden lassen. Es gibt kein Geländer, sondern nur ein dünnes Drahtseil auf einer Seite, an dem ich mich festhalte, während ich einerseits ängstlich, andererseits neugierig die wackeligen Stufen erklimme. »Seltsam«, kommt es mir in den Sinn, »genauso unsicher wie diese Stiegen fühlt sich momentan mein Leben an.«
Oben angekommen, staune ich nicht schlecht. Ein atemberaubendes Panorama tut sich vor mir auf. Von hier aus kann ich nicht nur mein Hotel sehen, sondern auch weite Teile der Küste überblicken. In der Ferne erkenne ich die Umrisse eines Sandsteinhauses, das zu einer Festungsruine gehört. Sie liegt ein Stück landeinwärts, eingebettet in ein Feld aus vertrockneten Gräsern und blühendem Ziertabak auf der einen und Weinstöcken auf der anderen Seite. Die Morgensonne lässt die Sandsteinmauern in einem satten Orange leuchten. Das warme Licht macht mich neugierig, außerdem frage ich mich, warum mir dieses Haus nie zuvor aufgefallen ist. Bisher glaubte ich, jeden Winkel dieser Gegend zu kennen.
Trotzdem kommt mir der Anblick seltsam vertraut vor. So wie über allem hier liegt auch über dem Haus ein längst vergessener Zauber. Ich spüre seine Anziehungskraft und dass der Sog mit jedem Schritt stärker wird. Als ich das Haus erreiche, ist die Holztür nur angelehnt. In einem angebauten Bogen rechts neben der Tür hängt eine rostige Glocke.
»Vielleicht habe ich dieses Haus früher immer übersehen«, denke ich und betrete fasziniert und voller Ehrfurcht sein Inneres. Durch ein kleines, buntes Fenster wirft die Morgensonne einen Lichtkegel auf den kunstvoll mit einem Mosaik verzierten Boden. Es herrscht heilige Ruhe. Die sakrale Atmosphäre raubt mir fast den Atem.
Es gibt nur diesen einen Raum, der bis auf ein paar alte Holzbänke leer ist. Andächtig setze ich mich auf eine der wackeligen Sitzgelegenheiten und schaue mich um. Es ist kühl, und der leicht modrige Geruch von feuchtem Holz und kaltem Weihrauch liegt in der Luft. Ich betrachte das wunderschöne alte Mosaik auf dem Fußboden etwas genauer. Es ist so groß, dass es die Hälfte des Raumes einnimmt, und besteht aus Einzelmotiven, die in einem perfekten Kreis angeordnet sind. Im Zentrum fehlt ein Bild, obwohl auch hier eines gewesen sein muss, denn wie bei den anderen Darstellungen ist die terracottafarbene Umrandung zu erkennen. Auch die Abbildungen des äußeren Kreises sind nicht vollständig erhalten. Es fehlen Steine, manche der einst prächtigen Farben sind verblasst.
Während mir das Motiv im Zentrum ein Rätsel bleibt, sind die anderen Bilder gut zu erkennen. Ich zähle zwölf davon. Es sind allesamt Frauen, auf den ersten Blick mystische Figuren. Göttinnen vielleicht. Als ich zu entschlüsseln versuche, was die Bilder bedeuten könnten, lässt ein tiefes Seufzen mich aufschrecken.
Ich bin nicht allein. Die alte Frau, die im Halbdunkel sitzt und in ein Gebet vertieft zu sein scheint, hatte ich überhaupt nicht bemerkt. Jetzt fühle ich mich ertappt. Ich möchte sie nicht in ihrer Andacht stören und will gehen.
»Wohin so eilig?«, fragt sie freundlich.
Überrascht drehe ich mich zu ihr um. Ihre wachen Augen ruhen auf mir. Dann kommt die Greisin lächelnd auf mich zu. Ihr von der Sonne gegerbtes Gesicht ist von tiefen Furchen durchzogen und erzählt von einem bewegten Leben.
»Meinetwegen musst du nicht gehen«, sagt sie, und ihre hellblauen Augen strahlen mich offenherzig an. Ihre schlohweißen Haare sind zu einem dicken, langen Zopf geflochten. In der einen Hand trägt sie einen Strohhut und in der anderen ein kleines Bündel mit frischem Gemüse. »Außerdem sind wir uns schon mal begegnet«, fügt sie hinzu.
Überrascht blicke ich die alte Frau an. Sie spricht perfekt Deutsch. Nur ein leichter Akzent verrät, dass sie hier heimisch sein muss. Mit ihrer warmherzigen und geerdeten Art strahlt sie große innere Ruhe und Lebenskraft aus. Es umgibt sie diese besondere Aura, wie sie jene Menschen haben, bei denen der Blick länger verweilt, wenn sie einen Raum betreten. Mit ihrem langen Rock und dem Bündel in der Hand scheint sie wie aus der Zeit gefallen.
»Ich wollte Sie nicht in Ihrem Gebet stören«, entschuldige ich mich und strecke ihr meine Hand entgegen. »Ich bin …«
»Lisa«, erwidert sie lachend, ergreift meine Hand und tätschelt sie. »Aber das weiß ich doch! Wir kennen uns schon lange, Lisa.«
»Ach ja? Woher denn?«, frage ich erstaunt.
»Du hast mit deinen Eltern und deiner Schwester hier immer deine Ferien verbracht und uns bei der Olivenernte geholfen.« Sie lacht heiser und gibt dabei ihre vielen Zahnlücken preis. »Das ist zwar schon viele Jahre her, aber ich habe dich nicht vergessen.«
»Das ist tatsächlich eine halbe Ewigkeit her«, sage ich, halb nachdenklich, halb entschuldigend. Obwohl sie mir auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich sehr vertraut scheint, erkenne ich sie nicht. Ihre Augen haben das kristallklare Blau des Meeres, und so wie man manchmal durch das Wasser hindurch bis zum Boden sehen kann, so habe ich gerade das Gefühl, einen kurzen Blick in ihre Seele werfen zu können. Sie scheint ohne Argwohn und Misstrauen.
»Früher hast du mich immer Tante Ju genannt«, hilft sie mir auf die Sprünge.
»Tante Ju?«, wiederhole ich ungläubig und schaue sie völlig konsterniert an. »Meine Tante Ju?«
Sie lacht. »Ja, deine Tante Ju.«
Nun fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Klar, sie ist es, jene Bäuerin, bei der ich viele glückliche Sommer verbracht und die ich damals einfach zu meiner Tante gemacht habe. Ich hätte sie doch sofort erkennen müssen, so nah wie wir uns damals waren. Jetzt kommt die Erinnerung langsam zurück. Eigentlich war ihr Name Judith, und ihr Haus lag nicht weit von dem Ferienhaus meiner Eltern entfernt.
In mir blitzen Bilder der Vergangenheit auf, aber ich kann diese Erinnerungsschnipsel nicht sofort zusammensetzen. Zu viele Jahre sind vergangen. Gesichter, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind, haben alte Bilder verblassen lassen oder sind zu einem neuen Ganzen verschmolzen. Auch an Judith sind die Jahre nicht spurlos vorübergegangen.
Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich in den letzten Jahrzehnten gleich mehrere Leben gehabt, so intensiv wie ich gelebt habe. Einige Menschen habe ich auf meiner Reise mitgenommen, andere wiederum in den jeweiligen Abschnitten zurückgelassen, obwohl sie mir viel bedeutet haben.
Ich verspüre plötzlich das dringende Bedürfnis, Judith in die Arme zu schließen. Aber ich traue mich nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Warum habe ich Judith nie wieder besucht? Und warum treffe ich sie ausgerechnet am ersten Morgen nach meiner Ankunft hier an diesem ungewöhnlichen Ort? Was hat uns zusammengeführt?
»Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, Tante Ju. Als ich eben dieses Haus entdeckt habe, da konnte ich nicht glauben, dass es mir früher nie aufgefallen ist. Vermutlich habe ich es ebenso vergessen wie vieles andere aus meiner Kindheit.«
»Oder du hast es tatsächlich immer übersehen«, überlegt Judith. »Und heute siehst du es zum ersten Mal.«
»Aber warum ausgerechnet heute und nie zuvor?«
»Weil du es früher nicht gebraucht hast?«, fragt Judith lächelnd. »Oder weil du früher nicht danach gesucht hast?«
»Ich habe heute auch nicht danach gesucht«, entgegne ich. »Ich habe mich bei meinem Spaziergang einfach nur treiben lassen, und dabei habe ich es entdeckt.«
»Dann bist du also nicht an diesen Ort zurückgekehrt, weil du etwas suchst?«, hakt Judith nach.
Ich schaue in das kristallklare Blau ihrer Augen und fühle mich ertappt.
Sie bemerkt es. »Also hast du es vielleicht doch gesucht.«
Ich spüre, wie ihr Satz sich in Stille verwandelt und tief in mir nachwirkt.
»Was ist das für ein Haus?«, erkundige ich mich nach einer Weile.
»Es hat eine lange Geschichte und wird das Haus des Lebens genannt.«
Das Geheimnis des Mosaiks
Judith zeigt auf das Bodenmosaik. »In diesen Bildern ist ein Geheimnis verborgen, das seit Jahrhunderten gehütet und stets von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird«, erklärt sie mit Stolz in der Stimme. Ihre Worte hallen erneut in mir nach.
»Dass es nicht nur wunderschön ist, sondern auch rätselhaft, das habe ich mir sofort gedacht«, sage ich. »Aber was ist das für ein Geheimnis? Gibt es ein Buch darüber? Oder kann ich sonst irgendwo etwas dazu nachlesen?«
Judith schüttelt den Kopf. »Die Geschichte wird mündlich überliefert. Die Alten erzählen sie den Kindern. Mir hat meine Großmutter vom Mosaik des Lebens berichtet.«
»Heißt das, Fremde können nicht in dieses Geheimnis eingeweiht werden?«, frage ich.
»Doch, ich sage dir gern alles, was ich weiß«, antwortet Judith und überlegt kurz. »Alles andere musst du sowieso selbst herausfinden.«
Ihre letzte Bemerkung lässt mich zwar stutzen, aber ich hake nicht nach. Ich fühle plötzlich, wie die Zeit einen anderen Takt zu schlagen scheint. Ich habe keine Eile mehr. Nichts treibt mich an oder von hier weg. Vor niemandem brauche ich mich zu rechtfertigen, denn niemand wartet auf mich. Ich darf mit Judith einfach Zeit verbringen und plaudern. Das tun, worauf ich gerade Lust habe. Wow, was für ein Gefühl. Ich hatte ganz vergessen, dass es das gibt. »Gut«, erwidere ich daher nach einem kurzen Moment, »ich bin gespannt darauf zu erfahren, was die Frauen in diesem Mosaik zu bedeuten haben. Hat es einen Grund, dass sie alle im Kreis angeordnet sind?«
»Ja. Sie stellen die zwölf Urbilder unseres Ichs dar, die den Kreis des Lebens bilden. Manche nennen sie auch Urformen des Ichs oder Archetypen. Dieser Begriff kommt übrigens auch von hier, also aus dem Griechischen: ›archē‹ bedeutet Anfang oder Ursprung, ›typos‹ heißt so viel wie Skizze, Bild oder Vorbild. Du siehst hier also unsere zwölf Archetypen.«
»Unsere … Archetypen? Haben denn alle Menschen die gleichen?«
Judith nickt. »Aber jeder Mensch versteht und bewertet das Mosaik auf seine eigene Art und Weise. Nehmen wir mal diese Dame hier …« Sie geht zu einem Bild, das eine Frau mit Zepter und Weltkugel zeigt. Ihr Blick ist stolz, in ihrem Schoß liegt eine Peitsche. »Das ist die Herrscherin in uns.«
»Beeindruckende Erscheinung«, stelle ich fest.
»Ja, sie blendet uns gern mit den Zeichen ihrer Macht. Sie ist eine große Manipulatorin und die härteste Kritikerin in uns.«
»Wieso in uns?«, frage ich.
»All diese Archetypen finden wir in uns«, antwortet Judith. »Jede ist ein Teil unserer Persönlichkeit, eine Grundhaltung unseres Ichs. Und jede von ihnen kann unser Seelenleben beeinflussen und bestimmen, wie wir fühlen und denken oder wie wir mit uns selbst und mit anderen umgehen.«
»Wie soll das funktionieren?«, rätsele ich verwirrt.
»Allen Frauen hier kannst du bestimmte Gefühle und Eigenschaften zuordnen. Außerdem kannst du sie lenken und für deine Ziele einsetzen«, fährt Judith fort.
»Das verstehe ich nicht ganz«, gebe ich zu.
»Wenn wir unseren Eigenschaften Rollen zuweisen, können wir besser mit ihnen umgehen, weil wir in der Lage sind, in einen inneren Dialog mit ihnen zu treten«, erklärt sie und fügt hinzu: »Aber es macht nichts, wenn du dir das noch nicht vorstellen kannst. Das kommt schon noch.« Ihre Worte beruhigen mich. Judith betrachtet das Mosaik konzentriert und deutet dann auf die Gestalt rechts neben der Herrscherin. »Dies ist die Schwarzseherin.«
Eine alte Frau hockt gramgebeugt auf einem Stuhl. Sie trägt ein schwarzes Kleid, ihr graues Haar ist hinten zu einem Dutt zusammengebunden. Ihr Kopf steckt in einer grauen Unwetterwolke. Das Gesicht schimmert durch den Nebel hindurch und ist nur vage zu erkennen. Ihre Augen sind geschlossen.
»Schläft sie?«, will ich wissen.