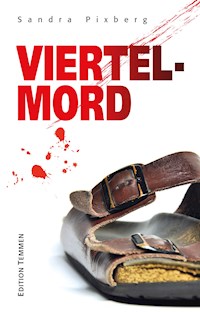Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1824. Johann, preußischer Offiziersbursche, ist nicht nur zu alt und zu schlau für diese Arbeit. Auch verhält sich sein Herr Tassilo von Wrangel leicht unterbelichtet und vertreibt sich die Zeit am liebsten mit Empfängen. Ausgerechnet ihn wählt der König als Voraustrupp aus, nach Sassnitz auf Rügen zu reisen. Damit gehören der Offiziersbursche und sein Herr zu den ersten „Touristen“ in dem Fischerdorf. Zeitgleich wird eine unbekannte Leiche am Strand von Sassnitz entdeckt. Während ihrer Suche nach der Identität der Toten werden sie von den sogenannten Herthafrauen überfallen, die abseits jeglicher Zivilisation in der Stubbenkammer hausen. Die von Sandra Pixberg in historische Fakten eingebettete Geschichte fußt auf einer der berühmtesten Sagen von Rügen und liest sich so spannend wie ein Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Coverbild: © shutterstock.com – Sabine Schmidt, paseven
1. Auflage
© 2022 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-729-9
Inhaltsverzeichnis
Die Tote im Boot
Die grausame Hertha
Der Schuft im Kreidebruch
Traumbild über Lietzow
Das Hertha-Ritual
Ruhe in Frieden
Nächtliches Treiben in der Kaschemme
Mit der Kunst des Fälschers
Die Wilde und der Fürst
Schierling ohne Becher
Ein gutes Omen
Der Idiot
Auf der Suche nach Marie
Der doppelte Johannes
Sommersonnenwende
Mordanschlag im Stall
Der Wermutstropfen
Marthas letzte Nachricht
In der Schlangengrube
Der Suchtrupp der preußischen Armee
Johann wird unehrenhaft entlassen
Walpurgische Reise
Die Herren rücken an
Zwischen Vision und Theater
Der Junge mit dem seltsamen Namen
Anschlag auf dem Kreideball
Die Autorin
Dank
Die Tote im Boot
Eiskalt schwappte die erste Welle in seinen Stiefelschaft. Sofort drang sie bis hinunter zu seinem Fuß. Immerhin war die Ostsee nicht mehr gefroren. Mit jedem Schritt über die glitschigen Steine kam ein neuer Schwall. Johann Fagus Rittberger verlor mehr und mehr das Gefühl in seinen Zehen. Neben ihm teilten zwei Fischer in hohen Watstiefeln das Wasser. Das Grau der Morgendämmerung wollte an diesem Vormittag des Jahres 1824 nicht weichen. Erfolglos hatte Johann probiert, eine trennende Linie zwischen Ostsee und Himmel auszumachen. Vor ihm schwamm eines jener typischen schwarz geteerten Fischerboote mit Rudern und Segelmast. Einer der beiden Männer packte das Seil am Bug.
»Einen Anker hätte sie ja mal setzen können«, rief er.
»Wozu denn? Seit Josefstag weht kein Lüftchen mehr. Nicht mal angelandet ist das olle Boot«, erwiderte der andere.
Große Steine ragten im Küstenbereich aus dem Wasser. Möglich, dass es sich zwischen denen verkantet hatte. Woher es nur gekommen war?
Die Fischer hatten das herrenlose Boot früh morgens entdeckt. Hier gab es niemanden, der ihnen offiziell genug vorgekommen wäre, damit sie ihm einen solchen Fund meldeten: kein Polizeihaus, keinen Bürgermeister – nur eine Handvoll in die Schlucht gedrückter Reethäuser mit Ställen und Dunghaufen daneben. Deshalb hatten sie den ›hohen Herrn‹ aus dem Hotel Bellevue geholt. In einiger Entfernung am Strand warteten jetzt ihre Frauen und Kinder, um einen Blick auf die ›dode fiene Fru ut’m Water‹ zu werfen.
»Schau nach, was mit dieser Frau los ist, Johann«, hatte Offizier von Wrangel seinen Burschen angewiesen, kaum dass sie am Strand angelangt waren.
Zwar lag das Boot nicht weit vom Ufer, aber dennoch hatte sich der Bursche über die schnelle Auffassungsgabe seines Herrn gewundert. Denn außer einem Streifen blassgrünen Organza-Stoff gab es keinen Hinweis darauf, dass sich überhaupt jemand im Boot befand. Wie konnte er da so schnell begreifen, dass es sich bei dem Bündel unter der Ruderbank um einen Menschen handelte – noch dazu um einen weiblichen?
Offenbar hatte sein Herr die besseren Augen. Oder sein höherer Wuchs verschaffte ihm diesen Vorteil. Oder, überlegte Johann, während er sich durch das eiskalte Wasser schob, die schwache Vorstellungskraft seines Herrn ließ einfach keine andere Möglichkeit zu.
Von der Frau auf dem Bootsboden sah er jetzt die gelöste Hochfrisur, das Kleid verrutscht, ihre wächsernen Beine angewinkelt. Sie war tot. Eine Spitze des zart gewebten Tuchs hing über die Reling. Im Einklang mit dem kleinen Wippen des Bootes schwang es wie zum Abschiedsgruß. Die beiden Fischer hielten inne, bekreuzigten sich und blickten einen Moment hinab.
Dann packten sie wortlos das Seil und schleppten das Boot hinter sich her. Neben dem Heck tauchte ein Gegenstand aus dem Wasser auf. Johann glaubte, eine leere Flasche zu erkennen. Er bewegte sich darauf zu, als sich das Boot an einem der Steine verkeilte.
»He, die Schaluppe klemmt!« Die beiden Männer hatten sich umgedreht und sahen ihn erwartungsvoll an.
Also ging er achtern und lavierte das Boot zwischen den Steinen hindurch. Als er sich umsah, konnte er auf der Oberfläche keinen Gegenstand mehr ausmachen. Wo genau war der aufgetaucht? Und was hatte Johann gesehen – wirklich eine Flasche? Bestimmt gaukelte ihm seine Vorstellungskraft etwas vor. Eine Flaschenpost – die kam in Piratenromanen vor, die er im Bücherregal seines Herrn fand.
Am Strand halfen Männer, das Boot auf die schwarz-weißen Feuersteine zu ziehen. Johann leerte seine Stiefel aus. Seine Zehen waren vom gleichen Wachsgelb wie die Haut der Toten.
Tassilo von Wrangel gab sich bei so viel Publikum allen Anschein der Seriosität. Er nahm Haltung an und befahl in zackigem Ton, die Tote herauszuheben. Unter einigem Gestöhne hievten sie drei Männer hoch. Johann nahm sie, zusammen mit einem weiteren Fischer, auf der Landseite in Empfang. Unter dem enganliegenden Kleid lagen ihre Schultern weich wie Pudding in seinen Händen. Er schauderte. Den einen oder anderen Toten hatte er schon verräumt, aber eine Frau – das war etwas anderes.
Der Offizier beugte sich über sie.
»Eine Dame in den besten Jahren, Gott habe sie selig«, nuschelte er, zu niemand Bestimmtem. Sein Blick tastete die Spitze des Kleides, die dazu passenden Handschuhe, die Strümpfe ab.
»Erlesen und entschieden edel«, wisperte er anerkennend, »sie scheint direkt von einem gesellschaftlichen Ereignis in diese Lage geraten zu sein.«
Mit einem ungelenken Ruck zog ein Fischer das Kleid über ihre Beine. Johann nahm das Tuch vom Bootsrand und bedeckte ihren Körper damit.
Einer der Fischer fragte vage in von Wrangels Richtung: »Was sollen wir jetzt damit machen?«
Der schaute ihn ausdruckslos an, als habe er nicht gehört, dass etwas gesagt worden war.
Mit seinem Zeigefinger tippte der Fischer bekräftigend auf das teergetränkte Holz.
»Was sollen wir jetzt damit machen?«, wiederholte er lauter.
Für ein Boot solcher Größe brauchte es bestimmt drei, vier oder fünf Sassnitzer, um hinauszurudern, die Segel zu setzten und den Fang einzuholen.
Von Wrangel wandte sich an seinen Burschen: »Weißt du, was er meint?«
Statt seinem Herrn zu antworten, fragte Johann den Fischer direkt: »Gehört das Boot denn nicht euch?«
»Nein, nein, unsers ist das nicht«, sagte der eine.
»Haben wir noch nie hier gesehen«, ein anderer.
Diese Bekräftigung ließ den Offiziersburschen aufhorchen. Seit wann verloren diese Männer im Beisein von Fremden auch nur ein unnützes Wort? Etwas stimmte nicht, Johann hatte das Gefühl, als verheimlichten sie ihm was. Doch sie ließen die Pause, die entstand, verstreichen und schwiegen.
»Dann sichern wir es gegen Sturm und warten ab. Wenn sich die Besitzer melden, gebt uns Bescheid.«
Von Wrangel stand am obersten Rand des Strandes und beobachtete stumm, wie die Männer das Boot hinaufzogen und es kielaufwärts legten. Dann kamen zwei Sassnitzer mit einem Türblatt zwischen sich den Pfad hinuntergelaufen.
»Warum, um Gottes willen, schleppen diese Männer ihre Eingangstür an den Strand?«, verständnislos sah von Wrangel Johann an.
Der stellte sich neben seinen Offizier, reckte sich und sagte leise: »Für die Aufbahrung.«
»Sehr gut, ich verstehe«, von Wrangel räusperte sich und sagte laut, »transportiere mit den Männern zusammen die Leiche ins Hotel, ich veranlasse alles Weitere. Und: Verliere sie nicht aus den Augen, verstanden?«
Er drehte sich um und entfernte sich über die metallisch klingenden Feuersteine.
Wie um Himmels willen sollte Johann die Tote aus den Augen lassen, wo sie kaum eine Elle vor ihm lag? Drei Fischer und er packten je eine Ecke des Türblattes und hoben es einigermaßen gleichzeitig an. Dann setzten sie vorsichtig einen Schritt vor den anderen. Hinter ihnen bildete sich ein kleiner ›Leichenzug‹, bestehend aus einigen Männern und den Frauen und Kindern, die am Strand zugesehen hatten.
In den besten Jahren, dachte Johann, als er die eigenwillige Bahre an der rechten Schulter der Toten anhob, das konnte auch nur von Wrangel einfallen.
Die Ruhe und Andacht, die normalerweise in einer Trauergemeinde vorherrscht, ging der kleinen Gesellschaft ab. Kaum war der Hochwohlgeborene außer Hörweite, fingen sie an, Johann aufzuziehen.
»Ist dein Offizier in ein Heringsfass gefallen?«, fragte der vom linken Fuß der Toten. Der Angesprochene wusste nicht, was er meinte und antwortete vorsichtshalber nicht.
»Wie meinst du das, Fiete?«, fragte statt ihm der Fischer, der die Ecke an der linken Schulter hielt.
»Also entweder«, Fiete drehte seinen Kopf mit dem kupferfarbenen Haar in Richtung der Leute, »dieser feine Pinkel ist durch eine Salzlake gut konserviert – aber das kann ich mir nicht vorstellen – oder er hat einen vermaledeit alten Burschen.«
Einige im Trauerzug kicherten.
»›Bursche‹, nennst du den? Dem Offizier sein Greis, wär’ wohl richtig«, ergänzte der vom rechten Fuß in unsauberem Deutsch. Er erntete einige Lacher.
Wahrlich zählte Johann nicht zu den Privilegierten, was sein Äußeres betraf. Klein und schmächtig, wenngleich Brust, Arme und Beine auf kindliche Art einen drahtigen Eindruck machten. Doch das Unvorteilhafteste an ihm war sein Gesicht: Es stieß geradezu ab. Sogar im Sommer blieb es ungesund weiß, und die klitzekleinen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Dass die Menschen zuweilen über sein Aussehen offen lachten, das passierte ihm nicht zum ersten Mal.
Zusätzlich hatte sich die Bestimmung in der letzten Zeit einen weiteren Spaß erlaubt: Um seinen Mund und auf der Stirn bildeten sich lange, immer tiefer werdende Falten. Dadurch erschien er älter als er Lenze zählte. Dennoch: Mit dreißig Jahren war er auf jeden Fall zu alt für einen Burschen. Das hatten die Fischer klar erkannt.
In Berlin ließ es ihn kalt, was fremde Leute von ihm dachten. Doch hier in Sassnitz machte es ihm etwas aus.
»Die leckersten Fische sind abgrundtief hässlich«, sinnierte Johann laut vor sich hin, »und Brassen leuchten wie Bernsteinfische und taugen gerade mal für Buletten.«
In seinem Rücken sagte jemand: »Sieh an, der kennt sich aus.« Die drei an den Türecken nickten anerkennend.
»Aber olle Fische schmecken nicht, egal wie sie aussehen«, gab der vom rechten Fuß zu bedenken.
Fiete hievte seine Ecke ein wenig hoch und stellte so die Ebene, auf der die Leiche lag, wieder her.
»Die kriegst du auch nicht ins Netz, Heiner«, sagte er, »die sind viel zu schlau. Haben anderes zu tun. Passen auf, dass alles läuft im Schwarm.«
Der Offiziersbursche sah erstaunt zu der kräftigen Gestalt über dem linken Fuß der Toten. Hatte der Rotschopf gerade wirklich einem Fremden helfen wollen? Unmöglich konnte er nach der kurzen Begegnung von dem Herrn und dessen Burschen wissen, wie sie zueinanderstanden. Dennoch hatte er mit seiner Bemerkung vollkommen recht. Ach, Unsinn, schalt sich Johann. Wahrscheinlich hatte der nur eine Fischerweisheit von sich geben wollen.
Jedenfalls drehte sich das Gespräch jetzt tatsächlich um die Gewohnheiten im Schwarm. Sie hatten die enge Gasse hinter sich gelassen und folgten einem Pfad hinauf zu dem einzigen weiß getünchten Haus, das auf der Hügelkuppe zwischen den kahlen Bäumen thronte.
Die Leute hinter ihnen hatten sich zerstreut. Das Spektakel war vorüber. Die vier Träger keuchten bei diesem letzten enormen Anstieg sichtbar in die kalte Luft. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, arbeiteten sie daran, die Tür so auszubalancieren, dass die Leiche in der Schräglage nicht ins Rutschen geriet.
An dem von zwei Säulen flankierten Eingang des Bellevues kam ihnen ein spindeldürrer Junge mit einem weinroten Pagenhütchen auf dem Kopf entgegen. Schockiert starrte er auf die herabhängenden Haarsträhnen der Frau.
»Ist sie – tot?«, fragte er. Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich ab und rannte voraus, um den Männern den Weg um das Haus herum zum Dienstboteneingang zu zeigen. Dieser Junge ist nicht helle, registrierte Johann trocken. Der Eingang führte in die Küche, wo ein Tisch für die Aufbahrung bereitstand.
»Nix für ungut«, sagte Fiete, strecke dem Fremden die Hand entgegen, während sein Blick über Johanns Schulter in die Weite schweifte. Die Beschaffenheit seiner Hand erinnerte an Trockenfisch. Auch Heiner und der andere Fischer verabschiedeten sich auf diese Art. Johann selbst sah ihnen, während er den Händedruck erwiderte, nicht direkt in die Augen. Zwar war es lange her, dass er in Sassnitz gelebt hatte. Aber daran, dass es hier Sitte ist, beim Abschied wegzusehen, konnte er sich jetzt erinnern.
Die grausame Hertha
Das Bellevue, einziges Hotel in Sassnitz, war alles andere als hochherrschaftlich. Der Dienstboteneingang führte direkt in eine große, aber nur karg bestückte Küche. Durch einen langen dunklen Schlauch gelangte man in das ›Empfangszimmer‹. Das bestand aus einer düsteren Halle mit zusammengewürfeltem Mobiliar. Keine Gardinen verhängten die winzigen Fenster. Und an den schlecht getünchten Wänden fehlte Tapeten, von Bildern ganz zu schweigen. Der Fußboden bestand aus groben Holzbohlen. Besonders grotesk fand Johann die einzige Zierde im ganzen Raum: Auf den Sekretär, der aufgeklappt als Empfangstisch diente, hatte jemand frische dunkelgrüne Efeuranken aus dem nahen Wald gelegt.
Hinter diesem sogenannten Empfangszimmer befand sich ein überdachter Balkon. Über der Brüstung gewährten Fenster zwar einen Ausblick auf das Meer. Aber nicht deswegen war der verglaste Vorbau der ganze Stolz des Hotelbesitzers. »Loggia« stand auf einem handgemalten Schild über der Tür. Der Klang dieses Wortes löste in Johann das Bild eines großzügigen, eleganten Raums aus. Aber von Weltläufigkeit konnte keine Rede sein: Im Gegenteil – jetzt zur Frühstückszeit bewegten sich die Kellner nur mit Schwierigkeiten zwischen den, wenn auch wenigen, besetzten Stühlen und der Wand hindurch. Mit dem Umrunden einer hochtoupierten Blonden hatten sie besonders zu tun.
»Haben Sie vielmals Entschuldigung« murmelte ein Mädchen, das stolpernd gerade noch zwei heiße Schokoladen auf den Tisch brachte. Nur die Sahnehaube verhinderte ein Fußbad auf dem Unterteller.
Offizier von Wrangel stand, an die Holzbrüstung gelehnt, der Dame gegenüber. Offensichtlich genoss er die nicht enden wollende Redesalve.
»Ganz köstlich, werte Frau von Marmulla!«, rief er zwischendurch, »reizend!« oder »nicht zu glauben!« – um sie zu weiteren Geschichten anzuregen.
»Denken Sie nicht, dass die Rüganer im Gottesdienst den Allmächtigen anbeten!«, rief die jetzt. Wegen der Vehemenz, mit der die Dame sprach, fühlte sich Johann angesprochen. Er blieb in der Tür der Loggia stehen.
»Die Kirchen sind hier nur scheinbar ein Ort des christlichen Glaubens. Ein vollkommen desillusionierter Pastor vertraute mir an, dass keiner dieser Barbaren, und ich betone – wirklich keiner –, seinerzeit von den Dänen überhaupt bekehrt wurde. Kennen Sie diesen Teil der Rügener Geschichte überhaupt?«, fragte sie und blickte von Wrangel auffordernd an.
»Nein wirklich, davon habe ich nicht die geringste Ahnung«, antwortete der sehr zu Johanns Erstaunen. Zwar wusste sein Bursche nur zu gut, dass von Wrangel sein Unwissen nicht nur vortäuschte. Aber normalerweise hielt sich sein Interesse gerade für geschichtliche Details in Grenzen.
Nichts schätzte Tassilo von Wrangel mehr als eine geschliffene Plänkelei in guter Gesellschaft. Dennoch hätte er normalerweise mit aller Höflichkeit dafür gesorgt, diesen ›Unsinn aus der Vergangenheit‹ nicht hören zu müssen. Weshalb er sich nun freiwillig eine Lektion in Rügener Geschichte erteilen ließ, dafür konnte es nur zwei Gründe geben: Entweder ihn quälte die Langeweile so, dass ihm jedes Gespräch willkommen war, oder er hegte für diese redegewandte Blonde Sympathie.
Sophia von Marmulla hatte eine Pause eingelegt und blickte dem neuen Bekannten direkt in die Augen. Selbst von der Tür aus konnte sein Bursche sehen, wie viel Freude ihr von Wrangels Antwort bereitete.
»Tausendeinhundertachtundsechzig Jahre«, jede der Silben betonte sie, »nach Christi Geburt. So lange – mehr als tausend Jahre – hat es gedauert, bis die Inselbewohner überhaupt bereit waren, die Dreifaltigkeit anzuerkennen. Das müssen Sie sich vorstellen!« Mit einer schnellen, aber dennoch grazilen Bewegung schüttete sie sich die Schokolade samt der Sahnehaube in den Mund. Kein Tropfen hatte es gewagt, danebenzulaufen, und ihr anschließendes Tupfen um die Mundwinkel mit der Serviette war Koketterie.
»Und freiwillig traten sie auch dann nicht zum Christentum über. Die dänischen Mönche brachten eine Heerschar von Soldaten mit nach Rügen und besiegten die Ranen mit Leichtigkeit. Diese Sprache verstanden die Kulturlosen zwar. Zum Zeichen ihrer Demut steckten sie vor den Siegern ihren hölzernen Götzen in Brand. Aber der Rauch scheint ihnen nicht gut bekommen zu sein.«
Die Stettinerin lachte über ihren letzten Satz. Ihr Gegenüber schaute ratlos, ja beinahe leer vor sich hin. Da legte sie ihren Kopf in den Nacken, um das Lachen anschwellen zu lassen. Damit erntete sie die Aufmerksamkeit des Offiziers zurück.
»Verstehen Sie, lieber Herr von Wrangel? Ich meine, viele sehen in den vier Gesichtern dieses Svantevits nur ein Abbild der Himmelsrichtungen. Aber der werte Herr Pastor, er stammt übrigens wie ich aus Stettin, bemerkte zu Recht, das sei zu kurz gegriffen. Schließlich handele es sich bei diesen Ureinwohnern nicht um Seefahrer, sondern um passionierte Strandräuber.«
Erstaunt blickte von Wrangel sie an und auch Johann, der noch immer in der offenen Tür stand, stutzte. Strandräuber? Das waren liederliche Menschen, die sich nach Havarien an dem Hab und Gut der Schiffbrüchigen bereicherten. Oder noch schlimmer: die in stürmischen Nächten mit falschen Lichtsignalen Schiffe auf Untiefen lockten. Doch die Stettinerin lenkte ihre Gedanken in eine andere Richtung.
»Dazu muss ich sagen, dass der Herr Pastor sein unnützes Wirken ausgerechnet in Garz versucht«, holte sie aus, »ein Örtchen im Süden der Insel. Dort stand eine gewaltige Burg und von da aus verteidigten die Ureinwohner über die Jahrhunderte nach Christi Geburt ihren aberwitzigen Glauben. Sie gewannen jede Schlacht über alle aufrechten Christenmenschen.«
»Ich las darüber vor der Reise«, wandte von Wrangel jetzt wichtigtuerisch ein. Dabei wussten sein Bursche und er, dass das nicht stimmte, »wenn ich mich recht entsinne, gab es noch eine weitere Festung im Norden der Insel. Aber meine Lektüre nannte die Ureinwohner Wenden.«
Immerhin war es nicht gänzlich umsonst gewesen, dass Johann seinem Herrn den Eintrag über Rügen im Lexicon vorgelesen hatte.
Sofia von Marmulla kicherte. »Wenden, richtig, Sie sagen es. Kein Name der Welt würde besser auf sie zutreffen als dieser. Nein, wirklich, es ist ganz und gar köstlich!«
Ihr Blick richtete sich auf ihre leere Tasse. »Im Gegensatz zu dieser Schokolade hier.«
Es dauerte einen Moment, bis von Wrangel begriff und sie nach ihren Wünschen fragte.
»Ich würde einen Likör bevorzugen, gleich welcher Geschmacksrichtung, diesmal jedenfalls ohne Beimischung von Wasser«, entgegnete sie kokett.
Von Wrangel blickte sich um, entdeckte seinen Burschen und schickte ihn los. Als Johann zwei Gläser und eine Karaffe mit dunkler Flüssigkeit auf den Tisch stellte, sagte Sofia von Marmulla gerade: »… dieser ungesunde Rauch hatte ein für alle Mal zur Folge, dass die Vielgesichtigkeit des Gottes diesen Menschen zu Kopfe gestiegen ist. Das ist zumindest die Meinung des armen Pastors. Sie sind arg verschlagen, sagt er, voller Aberglauben. Wenn schwarze Schafe geboren werden, hängen sie eine Hühnerkralle an die Stalltüre. Und wenn jemand ihnen Glück wünscht, dann spucken sie drei Mal über ihre rechte Schulter und dergleichen Unsinn mehr. Aber das größte Übel, meint er, sind die Hexen.«
Offizier von Wrangels Wangen hatten sich rot verfärbt. Das mochte am Likör liegen, den er in schnellen Schlucken in sich hineinschüttete. Jedenfalls wirkte er jetzt wie ein kleiner Junge.
»Hexen auf Rügen? Überaus spannend, erzählen Sie bitte!«
Johann hätte schon längst in den Pferdestall gehen müssen, aber er stand wieder am Eingang der Loggia und lauschte.
»Nun gut«, Sofia von Marmulla genoss die Aufforderung offenbar, »in dem Olymp der Wenden, falls man diese Ansammlung von Phantasiegestalten so nennen kann, gab es eine Göttin namens Hertha. Wenn Sie meine bescheidene Meinung hören wollen – ein scheußliches Frauenzimmer. Unter all den Insel-Götzen ist es vor allem diesem Scheusal zu verdanken, dass kein Kirchenmann einen Fuß auf die Insel gesetzt bekam. Ihr schreibt dieses Inselvolk eine gute Ernte zu. Bis heute, das müssen Sie sich vorstellen! Dabei wissen Sie und ich,«, sie legte ihre Hand vertrauensvoll auf den Unterarm des Offiziers, »dass es den dunklen Erdkrumen und dem kräftigen Sonnenschein auf Rügen zu verdanken ist, wenn die Ernte mehr als üppig ausfällt.«
Von Wrangel ließ bei dem Wort ›üppig‹ einen wohlgefälligen Blick über die Kurven der Dame gleiten. Es war offensichtlich, dass er nicht bei der Sache war. Sein Bursche dagegen war ganz Ohr.
»Nach der Ernte fuhr nun diese Wendenhexe halbnackt, stehend ein Ochsengespann lenkend, kreuz und quer über die Insel und ließ sich bejubeln. Ihr Wagen war zum Bersten gefüllt mit Äpfeln, Birnen, Kürbissen. Und er war über und über geschmückt und verziert mit Blumen und Kornähren. Jeder dieser dummen und glücklichen Bauern legte aus falscher Dankbarkeit noch etwas hinzu, Honig und ebensolchen Wein, eingelegte Beeren, frische Kräuter, und auch Fleisch und Tierfelle türmten sich auf dem Wagen. Von jedem Hof schlossen sich schöne Mädchen und kräftige Burschen dem Gespann an und folgten ihm.« Sofia von Marmulla hatte einen Sinn für Dramatik, denn an dieser Stelle legte sie eine Pause ein und blickte versonnen an Tassilo von Wrangel vorbei auf das Meer. Es entstand eine Stille, die unangenehm zu werden drohte und Johann befürchtete, dass sein Herr als Zuhörer verloren war. Trotz der Gefahr, dass von Wrangel ihn zu den Pferden schickte, trat er aus seinem Winkel heraus und fragte sie: »Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen?«
»Wie überaus aufmerksam,« sagte sie und ja, jetzt sei es wohl an der Zeit für einen englischen Tee. Von Wrangel sah durch seinen Burschen hindurch, als sei er aus Glas. Johann eilte in die Küche. »Was an Kräutern ihr auch immer findet«, rief er den beiden Küchenfrauen zu und huschte zurück zur Schwelle der Loggia – nun zumindest geduldet.
»… und dort im dunklen Wald am Ufer des düsteren Sees, tief in der Stubnitz, sollen sich allerlei anstößige Dinge zugetragen haben.«
Überrascht schaute von Wrangel sie an: »Na, na, meine Liebe.«
Jetzt konnte sich Sofia von Marmulla seiner Aufmerksamkeit sicher sein.
»Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, verehrter Offizier. Sie gaben sich nicht einfach ihrer Lust hin, nein. Vielmehr verstand es das raffinierte Weib, die Position, in der es sich befand, weidlich auszunutzen. All diese armen Geschöpfe mussten sie reichlich verwöhnen, ihre langen Haare ondulieren, den Körper mit duftendem Öl massieren und so weiter. Natürlich gaben sie sich auch gegenseitig hin. Scheinbar zum Vergnügen zog diese Hertha danach die ganze Schar mit sich ins Wasser. Wie von selbst sanken alle diese wunderbaren jungen Leute bis auf den Grund des Sees. Sie müssen übrigens kein Hellseher sein, um zu wissen, dass es sich um den Herthasee in der Stubbenkammer handelt.«
Die Bedienstete fuchtelte gefährlich mit der heißen Flüssigkeit, die sie gebracht hatte, bis sie diese um Sofia von Marmulla herumlaviert und, leicht übergeschwappt, auf den Tisch vor ihr zum Stehen brachte. Verächtlich betrachtete die so Bediente die hellgrüne Brühe vor sich.
»Die Wendengöttin selbst stieg als Einzige nackt und wohlbehalten aus dem Wasser und beobachtete ungerührt, wie der bösartige Strudel ihre Gespielen in die Tiefe riss.« Mit Widerwillen nippte Sofia von Marmulla an ihrem Tee und schloss dann mit einer weiteren Salve über die Gottlosigkeit und den Aberglauben dieses Inselvolkes, wie sie es nannte.
Johann hatte genug gehört. Er verzog sich in den Stall. Dafür musste er die Küche durchqueren, durch den Dienstbotenausgang und dann über einen kopfsteingepflasterten Hof des Strandhotels. Mit einem Wiehern begrüßten ihn Rasmus, der dunkelbraune Hengst des Offiziers und seine eigene Mischlingsstute. Er nahm die Striegel und begann erst Rasmus und dann ›Stute‹ über Mähne, Hals und Rumpf zu streichen. Es kam ihm vor, als hätten die blumigen Ausführungen der Stettinerin etwas, das in seinem Gedächtnis verschollen war, wiederentdeckt. Hertha, dieser Name. Woran erinnerte ihn das noch? Es ging um die Fruchtbarkeitsgöttin der Rüganer, wie die Dame gesagt hatte. Aber da gab es noch etwas anderes. Er kam nicht drauf.
»Heute geht’s zurück nach Berlin«, flüsterte er stattdessen den Pferden zu. Er wusste selbst nicht, warum er gerne geblieben wäre. Rasmus und Stute drehten mit den Ohren. Johann hielt in der Bewegung inne. Sein eigener Unwille war ihm ein Rätsel, einverstanden. Aber was konnten die Pferde dagegen haben, zurück nach Hause zu kommen? Dann hörte er den Grund ihres Missfallens: Über den Hof drangen Schreie zu ihnen.
Er eilte über das unebene Pflaster zum Dienstboteneingang. Sophia von Marmulla lag auf dem Fußboden vor dem Küchentisch, auf dem die Leiche aufgebahrt war. Johann verstand sofort. Angeregt durch die Hertha-Geschichte war sein Herr auf die Idee gekommen, die Dame aus Stettin seinerseits mit etwas Spektakulärem zu überraschen. Er hatte sie gebeten, ihn in die Küche zu begleiten. Und ihr ohne Vorwarnung die Leiche auf dem Küchentisch präsentiert. Typisch Tassilo von Wrangel!
Doch zu seinem Schrecken war das zu viel für die Dame gewesen. Unvorbereitet hatte sie bei dem Anblick der toten Frau zwischen den Küchenutensilien angefangen zu schreien und war endlich zu Boden gesunken.
Der Offizier stand nun linkisch da, während sein Bursche der Dame die Wangen tätschelte und rief: »Gnädige Frau, kommen Sie zu sich!«
Ihre farbig bemalten Augenlider flatterten kurz. Doch sie rührte sich nicht.
Der Schuft im Kreidebruch
Ein atemberaubender Gestank drang in seine Nase und setzte sich darin fest. Es war die Mischung aus sterbendem Waldholz und verendetem Meeresgetier. Über der gesamten Schlucht, die von den Leuten Liete genannt wurde, hing diese Wolke. Die armseligen Hütten duckten sich links und rechts entlang einer Gasse, die sich zum Strand schlängelte. Direkt aus ihren Reetdächern qualmte der unangenehme Rauch. Es war kaum zu glauben, es gab keine Ofenrohre, stellte Johann verwundert fest. Vor vielen Häusern dampften zusätzlich Haufen von Schweine- und Hühnermist. An diesen Gestank konnte er sich beileibe nicht entsinnen. Zusätzlich vernebelte ihm dieser Fischrauch die Sinne. Johann fühlte sich seltsam entrückt, nach all den Jahren wieder hier zu sein.
»Eine gute Idee«, hatte es von Wrangel gefunden, »das schöne Rügen und noch dazu deine Heimat Sassnitz, lieber Johann«, zu besuchen. So drückte er sich im vergangenen Herbst in Berlin aus und ab da hatte sich ›diese gute Idee‹ regelrecht in ihm festgesetzt. Wie das mit seinem Offizier immer so war, ließ der keinen Ball und kein anderes gesellschaftliches Ereignis in Berlin aus, ohne von seiner bevorstehenden Rügen-Reise zu sprechen. Über Umwege kam das schließlich selbst König Friedrich Wilhelm III. zu Ohren. Seine Majestät plante im Sommer ebenfalls diese Insel zu bereisen, von der man Gutes hörte. Doch machte sich der König Sorgen, dass allerlei Krankheiten wie Cholera und Diphtherie auf dem Lande und vor allem auf Rügen grassierten und es zu gefährlich sei für ihn und seine Söhne. Was man seiner Majestät auch immer nachsagte, er liebte die Kinder seiner so plötzlich verstorbenen Frau über alle Maßen. Deshalb beauftragte er postwendend diesen Offizier der Preußischen Armee, Tassilo von Wrangel, damit, eine Erkundungstour auf die Insel zu machen, um »das Terrain zu sondieren«, wie sein Sekretär sich in dem Anschreiben ausgedrückt hatte. Leider war Johann nicht zugegen, als von Wrangel den Brief empfing und zum ersten Mal las. Aber noch als der Teile davon auswendig rezitierte, um seinen Burschen ins Bild zu setzen, stieg ihm vor Aufregung die Röte ins Gesicht.
Die Freude über diese gelungene Mischung aus Auftrag und Wunsch machte ihn ebenso ungeduldig. Und als in Berlin der erste Frühlingshauch zu spüren gewesen war, hatte von Wrangel eine Depesche nach Sassnitz gesandt und dann anspannen lassen für die große Reise. Zu früh, zu überstürzt, wie sich herausstellen sollte, denn Rügens Vegetation lag noch tief im Winterschlaf.
Wenn es umgekehrt wäre, überlegte Johann, und es nach ihm gegangen wäre, würden sie jetzt in das ›schöne Mecklenburg‹, auf das Landgut der Familie von Wrangel, gereist sein. Der Gedanke amüsierte ihn. Da hätte seinen Vorgesetzten bestimmt auch nicht die Abenteuerlust gepackt. Aber sicher, es war etwas anderes. Von Wrangels Mutter hätte allerlei Eingemachtes, Fleischwürste, Schinken und Fruchtwein aus der Kammer holen lassen und ihren Sohn willkommen geheißen. Für sie, die Mutter, hatte ihr Sohn Tassilo natürlich eine sehr erfolgreiche Carriere hinter sich. Hochverdient im Krieg gegen die Franzosen, wo er tatsächlich mutig gekämpft und zuweilen sogar die richtige Entscheidung getroffen hatte. Nun, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, dachte Johann und trat endlich aus der stinkenden Gasse an den Strand.
Neben ihm plätscherte ein Bächlein, an das er sich jetzt dunkel zu erinnern meinte. Wie lange war es her, dass er hier gewesen war? Jedenfalls hatte ihm der Gedanke, nach beinahe zwanzig Jahren zurück nach Sassnitz zu kommen, vor Reisebeginn Unbehagen eingeflößt. Jetzt verspürte er zum ersten Mal, dass ihm dieser Flecken auch gefehlt hatte.
Vor ihm lag die Ostsee unbewegt. Immerhin ließ sich der Horizont jetzt ausmachen, zwei Farben Grau, flüssiges Blei und eine Wolkenschicht wie Asche. Dazwischen ein tiefblauer Streifen, der zu verhindern schien, dass die beiden Grautöne ineinanderliefen. Im Vordergrund die Steine, an denen Johann am Vormittag vorbeigewatet war. Wo hatte er es aufblitzen sehen? Auf Sonnenschein zu hoffen entbehrte jeglichen Sinnes. Es half alles nichts.
Zum zweiten Mal heute musste sein unterer Teil in die Ostsee eintauchen. Bald lief es wieder in die Schäfte seiner preußischen Stiefel. Er registrierte, dass es Dinge gibt, an die man sich nicht gewöhnt. Im Gegenteil, beleidigt krampften sich seine Zehen zusammen, als der erste eiskalte Schwall sie erreichte. Sein Gemächt reagierte noch ungehaltener. Das Wasser reichte ihm jetzt bis zur Hüfte und er umrundete vorsichtig die wenigen gewaltigen Steine, deren obere Teile auch hier noch aus dem Wasser ragten. Wo schwamm nur dieser Gegenstand, den er heute Morgen nah dem Boot gesehen hatte?
Von hier, aus dem Wasser, den Horizont im Rücken, sah alles anders aus. Am Grund lagen kleinere Steine, überzogen von einer grünen, glitschigen Schicht. Es fehlte noch, dass er ausrutsche und ein Eisbad nahm. Langsam schob er sich nach links, zehn, zwölf Schritte – nichts. Nach rechts, zwölf, zwanzig, fünfundzwanzig Schritte – nichts. Zur Orientierung diente ihm das ›Leichenboot‹, das kielaufwärts am Strand lag. Aber bei näherem Hinsehen gab es doch mehr Steine, die aus dem Wasser ragten, als er gedacht hatte.
Da! Oder war es ein Fisch, der kurz die Oberfläche durchstoßen hatte? Nein, etwas schwamm auf und unter dem Wasser, etwas Helles, das kaum von der Wasserfarbe zu unterscheiden war. Glas! Etwas durchsichtiges, das in dem kleinen Rhythmus, den die Ostsee hatte, träge mitschwankte. Mit ausholenden Schritten teilte Johann das Wasser und griff nach der verkorkten Flasche. Darin lag ein Stück helleres Papier, offensichtlich Büttenpapier. Ohne sich länger aufzuhalten, steckte er seinen Fund in die Innentasche seiner Uniformjacke. Plätschernd lief das Wasser aus seinen Stiefeln. Er hatte seine wachsgelben Füße auf die Feuersteine vor sich gestellt. Jetzt hätte er sie ebenso gut auf das Nagelbrett eines ostindischen Fakirs stellen können – er hätte nichts gefühlt. Bis zur Hüfte war seine Hose durchtränkt. Auch seine Uniformjacke hatte gelitten. Zusätzlich beulte die Flasche den Stoff auf der linken Seite aus. Der Offiziersbursche wusste, dass sein Anblick das jämmerliche Spottbild eines preußischen Soldaten abgab. Dennoch verspürte er keine Lust, zum Hotel zurückzukehren. Vielleicht bargen die Ostsee und der Strand noch andere Geheimnisse.
Tassilo von Wrangel hatte doch darauf bestanden, sich persönlich um die ohnmächtige Dame zu kümmern. Auch brachte er eine Depesche auf den Weg, die die Leiche bei der königlich-preußischen Polizei in Berlin ankündigte. Und er hatte den Hotelbesitzer nach einem Vierspanner schicken lassen. Doch musste der erst aus dem fernen Stralsund mit der Fähre auf die Insel gebracht werden. Es würde bis in die frühen Abendstunden dauern, bevor sie losfahren konnten.
Johann stülpte die klitschnassen Stiefel über seine tauben Füße. Nicht weit von der Schlucht am Strand entlang gab es ein Bauerndorf namens Crampas. Anders als die Sassnitzer Fischer hatten die Crampasser ihre Häuser hoch oben auf dem Plateau gebaut. Nur einige steile Fußpfade führten hinunter zum Strand. Man hielt in diesem Dorf nicht viel von Fischen, mit einer Ausnahme: Im Herbst zogen riesige Heringsschwärme an der Küste vorbei. Keiner, der ein seetüchtiges Boot hatte, konnte der Versuchung widerstehen, fischen zu gehen. Es brauchte drei oder vier Burschen, so voll mit ›Silberlingen‹ war das Netz beim Einholen. Aber als Fischer verstanden sich die Crampasser deshalb trotzdem nicht. Insgesamt machten sie immer das Gegenteil von den Sassnitzern. An die ständigen Streitigkeiten zwischen den Bauern und den Fischern erinnerte sich Johann jetzt. Die jungen Mädchen der Crampasser durften von den Sassnitzern nicht angesehen, geschweige denn angesprochen werden. Auch hatte jeder Ort sein eigenes Platt und es schien ihm, als wären die Einwohner stets bemüht, die Sprache durch spezielle Ausdrücke unterscheidbarer zu machen. Eine Art »Räuber-Platt« auf beiden Seiten war das Ergebnis. Ein großer Streit entbrannte jedes Jahr um den Wald. Wo war die Grenze zwischen Crampasser und Sassnitzer Holzeinschlag? Diese alten Bilder heiterten ihn auf. Auch bemerkte er jetzt, dass seine Stiefel bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch von sich gaben. Auch das ließ seine Laune steigen. Rechts ragte das gelbe Ufer weit hinauf, an den Hängen zeigten sich erste fleischige Blätter, die aussahen wie mit Reif überzogen. Huflattich, richtig, jetzt fiel es ihm wieder ein. Die Frauen ernteten sie, wenn aus der Mitte der Pflanzen die struppigen Blumenköpfte ragten. Sie trockneten die Blätter, teils für ihre Männer, wenn denen Schnupf- und Kautabak ausging. Und teils benutzten sie den Huflattich, um das Blut tiefer Wunden zu stillen.
Noch hatte er das Ufer unter Crampas nicht erreicht, als er hinter einer Krümmung ein offenes Boot wahrnahm, in das Jungen und Mädchen schneeweiße Brocken luden. Das musste Kreide sein. Wer kam auf die Idee, die zu ernten? Unter Aufbietung aller Kräfte schoben die Kinder Karren ins seichte Wasser, wo das Boot ankerte. Eins sprang an Bord und ließ sich von zwei anderen die Brocken anreichen, um sie im Bug zu stapeln. Die anderen beiden zerrten die Schubkarre wieder aus dem Wasser. Dann verschwanden sie in einer Liete, einer Schlucht zwischen dem hohen Ufer. Johann ging ihnen nach. Links und rechts ragten hohe Wände aus Lehm und Kreide auf. Die Kinderstimmen hallten, sie befanden sich weiter hinten. Er entdeckte einen Jungen, der auf halber Höhe auf einem kleinen Podest stand. Der schlug mit einer Axt weiße Blöcke aus der Wand.
»Vorsicht ihr da unten!«, schrie er und Johann sah die großen Schweißflecken unter seinen Achseln, als er einen Brocken nach dem anderen nach unten fallen ließ. Der Junge probierte, die Schubkarre zu treffen, die ihm die anderen bereitgestellt hatten. Fasziniert sah der Fremde zu und nahm erst im letzten Moment eine Bewegung im Augenwinkel war. Ein Mann stürzte auf ihn zu. Woher der so plötzlich kam, wusste er nicht. Kurz bevor der Kerl Johann umrannte, blieb er nahe vor ihm stehen. Sein Gesicht wirkte seltsam nackt, keine sichtbaren Wimpern, keine Augenbrauen, von Bartwuchs konnte keine Rede sein.
»Scher dich fort, du hast hier nichts verloren!«
Unschlüssig blieb der so Angesprochene stehen. Bestenfalls scheuchte man so Hunde weg. Unmöglich, dass dieser Wimpernlose ihn meinte.
»Guten Tag«, entgegnete Johann versuchsweise.
Die Kinder näherten sich scheu. Zu Johanns Erstaunen machte der Mann kehrt, schupste auf seinem Weg einen Jungen zur Seite und verschwand zwischen den Hängen in der Liete. Johann sah die Kinder an und zog die Schultern hoch. Da kam dieser Seltsame wieder, teilte brutal die Kinder und zischte: »Dir werd ich’s zeigen.«
Er fuchtelte mit einer Büchse herum, legte sie an und nahm Johann aufs Korn.
»Was willst du hier?«
»Im Auftrage Seiner Majestät«, antwortete dieser zackig, schlug die Hacken zusammen. Gleichzeitig war er sich darüber im Klaren, wie lächerlich er in der nassen Kleidung wirkte. Da war Haltung gefragt. »Die preußische Armee sondiert Rügen nach ansteckenden Epidemien für König Friedrich Wilhelm III. persönlich.«
Es passierte ihm sonst nie, dass ihm keine geeignete Geschichte einfiel und er sich mit der schäbigen Wahrheit begnügen musste. Und seit seiner Flucht und dem anschließenden Krieg ließ er sich eigentlich auch von einem auf ihn gerichteten Gewehr nicht aus der Ruhe bringen. Eigentlich – aber von diesem Mann ging eine ernstzunehmende Bedrohung aus. Er flößte ihm Angst ein. Johann hoffte, der Mann würde seine Ansprache so verstehen, als wäre ein ganzes Heer am Strand, ganz in der Nähe. Die Erwähnung des Königs musste ihm imponieren! Doch den Mann ließ das kalt. Er sagte nichts, aber er nahm auch nicht die Waffe herunter. Johann verspürte das Bedürfnis mehr zu reden.
»Gibt es bei dir im Umkreis jemanden, der an Cholera oder Diphtherie gestorben ist?«, er fragte das mit einem amtlichen Ton. Aber seine Knie zitterten ein wenig. An dieses haarlose Gesicht hatte er keinerlei Erinnerung. Nur ein Gefühl sagte ihm, dass mit diesem Kerl nicht zu spaßen war. Aber dann fragte sich Johann, ob dieses Unmittelbare, das er spürte, nicht doch aus seiner Kindheit in Sassnitz herrührte. Hatte er ihn damals gekannt?
»Hast du noch nichts von den Hexen im Wald gehört?«, fragte der hinter seinem Gewehrkolben. Seine Stimme hatte einen spöttischen Unterton: »Herthafrauen, so nennen sie diese Hohlköpfe in Sassnitz. Die treiben es mit diesen Gewitterziegen und wundern sich, wenn sie krank zurückkommen.« Der Mann grinste und hob den Schießprügel einen Zollbreit höher.
»Die Hexen – die lassen die Puppen tanzen!«, er lachte laut und schoss.
Schräg hinter Johann polterten Lehm und Steine zu Boden. Wahrscheinlich hatte er ohne Absicht danebengeschossen. Johann schob einen Fuß nach dem anderen nach hinten. Den Mann im Blick, bewegte er sich rückwärts aus der Liete heraus. Sein Herz pochte.
Als der Mann das sah, lachte er noch lauter. »Seht euch das an, Kinnings, so was nennt sich Armee! Ein Heer von Feiglingen. Deshalb hat der preußische König, wie hieß der noch mal, lieber ein paar Taler springen lassen, als zu kämpfen wie ein Mann. Der kennt seine Streitmacht! Er würde es niemals ernsthaft wagen, sie einzusetzen!«
Bei allem Wahnsinn, der in diesem Nacktgesichtigen steckte, in dem Punkt hatte er recht. Seit Johann denken konnte, ja, über Generationen, hatten Rügen und Pommern zu den Schweden gehört. Und nachdem die Franzosen Pommern besetzt gehalten hatten, ging die Herrschaft ohne Krieg zu den Preußen über. Dieser Napoleon hatte das ganze Land besetzt, die Leute gebeutelt, versklavt, ihre Dörfer gebrandschatzt. Aber als die Franzosen endlich abzogen, hatten die Preußen nicht gekämpft. Sondern das Land den skandinavischen Widersachern einfach abgekauft – 1,5 Millionen Taler sollen sie, dem Vernehmen nach, dafür bezahlt haben.
Den Schall seines Gelächters zwischen den Felswänden hörte Johann noch, als er wieder am Strand war. Der Junge, der die Kreidebrocken auf dem Boot verladen hatte, stand neben ihm. War es die Erleichterung? Denn beim Anblick des Jungen musste der Offiziersbursche seinerseits lachen. Nasse Hosen zumindest hatten sie beide. Sonst war der Junge klein, dünn, braunhaarig, von ungesunder Gesichtsfarbe. Dagegen leuchteten seine Hände vor Kälte rot, das Leinenhemd war mit weißem Matsch beschmiert. Der Junge hatte Johanns nasse Hose bemerkt und sah an sich selbst herunter. Er lächelte.
»Ich heiße August.«
»Wer ist dieser Mann?«, fragte Johann.
Der Junge winkte ab. »Ach – den vergisst du besser gleich wieder.«
Johann wusste nicht, woran es lag. Das Gefühl der Gemeinsamkeit verschwand auch jetzt nicht.
»Er hat beinahe ein Loch in mich hineingeschossen. Das kann ich so schnell nicht vergessen. Wie heißt er?«
August gluckste. »Falk Küster. Lass man, mit dem ist nicht gut Kirschen essen.«
Wie sprach August eigentlich? Es musste Platt sein, auch wenn Johann der Unterschied zwischen Hochdeutsch und diesem Platt offensichtlich gar nicht auffiel. Ihm war nicht entgangen, dass Tassilo von Wrangel die Fischer am Strand ganz offensichtlich nicht verstanden hatte. In Johanns Ohren dagegen hatten sie glasklar geredet.
Auch dieser Junge ›schnackte‹ haargenau sein Platt. Die Sprache seiner Sassnitzer Kindheit. Würden seine Eltern und Geschwister nur noch leben! Zum ersten Mal, seit er auf Rügen angekommen war, dachte er an seine Familie. Er bekam Sehnsucht nach ›Muddern‹ und ›Vadding‹. Und dieser Falk Küster. Diese wimpernlosen Augen gehörten zu seinen Kindheitserinnerungen. Dass er sich nicht entsinnen konnte, woher er den kannte! Johann seufzte, wenn er daran dachte, wie er von Sassnitz weggekommen war.
Gustav, der Schwedenkönig, hatte seine Kolonien nie über die Maßen gegängelt. Doch dann trieb ihn die Angst vor Napoleon dazu, das zu ändern. Ohne eine einzige Niederlage einzustecken, waren die französischen Truppen immer weiter gen Nordosten vorgerückt. Und Gustav befürchtete zu Recht, die Franzosen könnten über die Ostsee übersetzen und womöglich in Schweden einmarschieren. In seiner Not gründete er eine Landwehr in Schwedisch-Pommern. Das hieß: Alle jungen Männer des Landes, und dazu gehörte Johann damals, wurden mehr schlecht als recht mit Waffen ausgestattet und als menschliches Bollwerk eingesetzt.
Ob adelig oder bürgerlich – jede Familie, die das Geld aufbringen konnte, kaufte ihre Söhne von diesen Diensten frei. Es lag auf der Hand, dass es sich dabei um puren ›Materialverschleiß‹ handelte. Napoleon galt schließlich als unbesiegbar. Er rekrutierte aus allen deutschen Ländern Soldaten, die mit den Franzosen weiterzogen. Als sie im Norden ankamen, sprachen die meisten von ihnen schon kein Französisch mehr. Rheinländer und Männer aus den Großherzogtümern Baden und Berg, unverbraucht und abenteuerlustig, zogen in Horden über das Land. Auch Rügen erreichten sie wie eine Heuschreckenplage. Erbittert probierten sich die miserabel ausgestatteten Landjungs gegen die erfolgsverwöhnten Kriegstüchtigen zur Wehr zu setzen.
Bis hierher hatte Johann das makabre Spiel mitgespielt. Denn kurz bevor seine ›Truppe‹ an die Front zog, war seine kleine Schwester, seine letzte Verwandte in Sassnitz, nach langem Brustleiden gestorben. Heilfroh, den Ort dieser Erinnerung zu verlassen, war er dem Ruf zur Gefechtsstation gefolgt. Doch dann – im Graben liegend – überkam es ihn: Es war Irrsinn, sich hier abschlachten zu lassen!
In der Nacht floh er. Ob er wollte oder nicht, er musste sich bis hinter die preußische Linie durchschlagen. Auf schwedischem Gebiet war ihm der Tod durch Erschießung gewiss. Kein Kriegsgericht der Welt springt anders mit Deserteuren um. Und auch wenn Johann dieses Wort im Zusammenhang mit sich selbst ungern aussprach und sogar vermied es zu denken: Er war eigentlich nichts anderes gewesen als ein Deserteur. Ein Drückeberger vor seiner Pflicht, das Vaterland zu verteidigen. Daran war nichts zu rütteln.
Eine kalte Brise kam auf. August stand noch immer neben ihm und zitterte.
»Begleite mich ein Stück«, forderte Johann ihn auf, zog seine halbwegs trockene Uniformjacke aus und legte sie August um die schmalen Schultern. Zögernd ging der Junge neben ihm am Strand her. Mit Fremden sollte er nicht mitgehen, das war klar. Doch die Jacke mit den runden Metallknöpfen hatte es ihm angetan. Immer wieder schaute er stolz an sich herab, dunkelblau mit roten Aufschlägen, feinster Stoff. Er wagte es nicht, sie mit seinen kreidigen Händen zu berühren.
»Warum arbeitest du für den?«
»Wir müssen ja, irgendein Gesetz, das der König gemacht hat. Mein Vater sagt, früher war es noch schlimmer, wir können froh sein.« August zögerte, dann fügte er hinzu: »Manchmal gibt er uns auch eine Münze dafür.«
Dieser Küster! Johann sagte nichts zu dem Jungen, es ergab ja keinen Sinn. Aber er war sich sicher: Wenn diesem Schinder ein Kind vor Erschöpfung umfiele, wäre es ihm bestimmt nicht schade drum. Geld gab er ihnen garantiert nur, wenn es gar nicht anders ging. Warum berührten ihn diese beiden so? Der eine durch seine Skrupel-, der andere durch seine Schutzlosigkeit. Beileibe war er nicht gefühlsduselig. Dieses Privileg durften getrost andere für sich behalten, allen voran sein Herr.
Sie waren zurück in Richtung Sassnitz gegangen und Johann konnte oben über der Hochuferkante die Loggia des Hotels erkennen. Eine Gestalt stand hinter dem Glas. Sie hatte ein Fernrohr in der Hand und hielt Ausschau. Nach ihm? Oder nach einem Schiff? Johann konnte es nicht erkennen.
August neben ihm schaute ebenfalls hinauf und wirkte erleichtert.
»Ich muss jetzt los. Bitte«, er deutete mit dem Zeigefinger auf die Uniformjacke. Als sie ihm abgenommen wurde, nahm sein kleiner Körper eine stramme Haltung an und er legte eine Hand an die Stirn.
»Danke ergeben und ich muss dann wieder.«
Eilig lief er zurück zu dem Wüterich, der ihn bestimmt schon erwarten würde.
Zum Bedauern kam Johann jetzt nicht, vielmehr beschäftigte ihn der Gedanke, ob und wie er von Wrangel erklären sollte, warum er dem Jungen seine Uniformjacke ausgehändigt hatte. Das war natürlich hochgradig verboten. Der Offiziersbursche schob den Gedanken beiseite. Vielleicht täuschte er sich ja und von Wrangel würde darüber hinwegsehen.
»Gibt es einen Unterschied zwischen dem Volk und der königlich-preußischen Armee, Johann?«, empfing der ihn am Dienstboteneingang des Hotels.
»Ja, Offizier von Wrangel, den gibt es.«
Kopfschüttelnd bemerkte der die nassen Hosen und die Beule in der Uniformjacke seines Burschen. Johann zog die Flasche heraus und hielt sie ihm hin: »Ich habe sie ganz in der Nähe der Leichenfundstelle aus dem Wasser geborgen.«
»Papperlapapp, versuche dich nicht herauszureden. Erst lässt du dir von einem dahergelaufenen Bengel die Uniform abschwatzen und anschließend hast du eine Flaschenpost in der Innentasche. Wie lächerlich! Hast du deinen Kopf auch zum Denken? Das ist ein Kinderspielzeug. Kümmere dich lieber um Rasmus, der Vierspanner muss bald hier sein. Über die andere Sache reden wir noch, da kommst du mir nicht ungeschoren davon. Und vergiss nicht, meine Ausgehuniform zu plätten. Am Ende komme ich noch so herunter wie du. Du bist eine Schande für die preußische Armee. Das alles ist kaum zu glauben.«
Traumbild über Lietzow
Liegend auf dem Brett passte die Leiche gerade zwischen die beiden Sitzbänke der geschlossenen Kutsche. Bedienstete des Hotels hatten sie in Tücher gehüllt.
»Damit ihr nichts passiert, setzt du dich während der Fahrt neben sie«, beschied Tassilo von Wrangel, als alles verstaut war. Zwar war es nicht die erste Leiche, mit der Johann den Raum teilte. Dennoch überlief ihn ein kalter Schauer, als er zu der Toten stieg. Er betrachtete die umwickelte Gestalt direkt neben sich. Was sollte ihr schon passieren? Selbst wenn sie bei widrigen Straßenverhältnissen von ihrer Empore rutschte – sie selbst würde das nicht mehr stören.
Von Wrangel ritt vorneweg auf seinem Rasmus wie bei einem Triumphmarsch. Johann fand das makaber. Das Einzige, was ihn daran beruhigte war, dass das Publikum am Straßenrand fehlte. Und sicherlich blieb das so. Denn es dämmerte schon, als sie endlich in Sassnitz losreisten. Stute trottete, an dem Kremser festgebunden, hinterher. Kein Mond erhellte den Weg, nicht mal einen Stern sah Johann durch das Fenster. Der Kutscher, der den Vierspanner lenkte, kannte den Weg gut.
Nachdem sie den Hügel hinauf nach Crampas und dann weiter nach Lancken gefahren waren, holperte die Kutsche in den Buchenwald hinein. Und obwohl die Bäume noch keine Blätter hatten, war die Dunkelheit hier undurchdringbar. Von Wrangel fiel mit seinem Pferd zurück und blieb hinter dem Kremser. Johann registrierte das dankbar, weil Stute und Rasmus von gesellschaftlichen Schranken nichts hielten und gerne beieinander trabten. Der holprige Weg warf alle Insassen des Wagens hin und her. Links und rechts, in der Dunkelheit hörte Johann immer wieder Geräusche. Im fahlen Licht der Lampe, die der Kutscher an den Bock gehängt hatte, sah er die weißen Spiegel einer Gruppe Rotwild, das sich entfernte. Als sie kurz stillstanden, drangen katzenartige Schreie zu ihm. In die tiefe Nacht hallte der Ruf eines Kauzes. Johann selbst fürchtete sich nicht. Aber wahrscheinlich bereute von Wrangel seinen Entschluss, auf dem Pferd zu reiten. Doch dann lösten Wiesen und Felder den Wald ab und die Sterne warfen ihr blasses Licht darauf.
Der Schein einer Öllampe auf dem Fensterbrett eines reetgedeckten Hauses verriet Johann, dass sie das nächste Dorf erreicht hatten. Hier in Sagard stand die Kirche, zu der die Sassnitzer jeden Sonntag zur Andacht wanderten. Aber nicht nur deshalb erinnerte sich Johann gut an das Dorf und den Weg. Jeden Tag, von Herbst bis Frühling, war er als Einziger auf seinen Kinderbeinen von Sassnitz nach Sagard gelaufen, um sich vom damaligen Küster unterrichten zu lassen. Seine Geschwister und die anderen Fischersöhne kamen ab und zu mal mit. Aber nur in ihm brannte dieses Feuer für jeden Buchstaben, den er lesen, für jede Zahl, die er rechnen konnte. ›Wunderknabe‹ nannte ihn der Küster. Beim Pastor Willich erregte der wissbegierige Junge jedoch keine Aufmerksamkeit. Vielmehr beschäftigte der sich mit dem Ausbau seines Gesundbrunnens für die feine Gesellschaft aus der Stadt. Die neuesten medizinischen Erkenntnisse besagten, dass die feinen Herrschaften neuerdings ein Mal täglich baden sollten. Das sei der Gesundheit und dem Wohlbefinden zuträglich. Das bestätigte auch der Bruder des Pastors, der Arzt Moritz Willich. Täglich!, dachte Johann. Wenn er selbst sich ein Mal im Monat in einem Zuber abschrubbte, dann fürchtete er schon um seine Haut. Aber die feinen Damen und Herrn aus Berlin schienen diese Angst nicht zu teilen. Für sie bedeutete der Sagarder Gesundbrunnen eine willkommene Abwechslung. Im Sommer tauschten sie für einige Wochen ihre Salons der Stadtvillen gegen primitive Behausungen in dem kleinen Rügener Dorf. In dieser Wildnis angekommen, hatten sie damals Bäder in dem eisenhaltigen Wasser aus dem Dorfbach genommen. Darüber hinaus erfuhren sie die Aufmerksamkeit der beiden Brüder. Das Geschäft blühte: Jedes Jahr waren mehr Angehörige der guten Gesellschaft auf die Insel gekommen. Die Sommergesellschaft blieb erst gänzlich aus, als die Franzosen die Ostseeküste erreicht hatten.
Johann schnäuzte sich. Das musste an seinen eigenen unfreiwilligen Bädern in der Ostsee liegen. Nein, wahrhaftig, gesund konnte das nicht sein. Seine Füße hatte er in eine Decke gewickelt, die feuchten Stiefel abgestreift. Der eigentliche Zweck dieser Sagarder Badekuren hatte für diese Leute darin bestanden, sich eine Zeitlang woanders aufzuhalten, neue gesellschaftliche Kontakte zu knüpfen – sich zu zerstreuen und zu vergnügen. Für Menschen dieses Schlages stellte sich das Leben als Müßiggang dar. Bei dem schien es sinnvoll, die Zeit irgendwie totzuschlagen wie eine lästige Stubenfliege. Johann verachtete diese Art des Daseins. Er selbst hätte nicht gewusst, wie das ging: einfach nur so vor sich hinzuleben.
Nachdem sich die Pferde ins Geschirr gelegt hatten, um die Kutsche hangaufwärts ins Dorf hineinzuziehen, klapperten ihre Hufe jetzt auf Kopfsteinpflaster. Daran erkannte Johann, dass sie in der Nähe der Kirche angelangt waren.
Er starrte in die Nacht hinaus, aber falls der Badebetrieb wieder aufgenommen worden war, hätte er es in dieser Dunkelheit nicht erkennen können. Und für die Herrschaften aus den Städten war Rügen sowieso noch zu unwirtlich. Nur ein Tassilo von Wrangel konnte auf die wahnwitzige Idee kommen, Ende März eine Reise an die Ostsee zu machen. Und, setzte Johann im Gedanken hinzu, die ›Drama-Dame‹ aus Stettin, wie er sie für sich getauft hatte. Ob sie aus ihrer Ohnmacht wieder erwacht war, wusste er nicht mit Sicherheit. Wie befohlen hatte er nach seiner Rückkehr stracks den Schrankkoffer des Offiziers gepackt, dessen Uniform gebürstet und schließlich seine eigene Jacke und Hose gesäubert und geplättet. Sofia von Marmulla hatte er nicht mehr gesehen. Man musste jedoch keine höhere Bildung genossen haben, um zu bemerken, dass sie ihre Formen durch feste Einschnürungen um Brust und Bauch bändigte. Das nahm ihr bestimmt häufig die Luft in Momenten, in denen sie mehr davon gebraucht hätte. Zum Beispiel auch, wenn ihr eine Leiche auf einem Küchentisch präsentiert wurde. Wenn der Offizier eine Frau wäre, Johann amüsierte dieses kleine Gedankenspiel, dann würde er wohl sein Korsett auch zu eng schnüren. Nein, wirklich, man konnte sich Tassilo von Wrangel in keiner besseren Gesellschaft denken als in der dieser Drama-Dame.
Draußen schaukelte wieder die düstere Landschaft vorbei. Nach Sagard zog sich der Weg über die Hügel hinweg, Johann erinnerte sich vom Hinweg an die Felder, Weiden und Wiesen links und rechts. Zu erkennen war jetzt nichts. Welche Beweggründe von Wrangel gehabt hatte, seinen Burschen als Leichenaufpasser in die Kutsche zu verfrachten, blieb ungewiss. In einem Punkt lag er ausnahmsweise richtig: Immer wieder machten es Steine auf der Straße, Wendungen des Weges und Schräglagen des Kremsers notwendig, die Leiche daran zu hindern, von dem Brett herunterzurutschen. Auch die Tücher lösten sich hier und da. Kurz vor Lietzow tauchte der Weg in dichten Wald ein, es ging erst steil bergan, schließlich ebenso steil bergab. Die Tote beanspruchte jetzt Johanns ganze Aufmerksamkeit. Seltsamerweise verspürte er kein Grauen, wenn er sie festhielt oder auf dem Brett zurechtschob. Im Gegenteil: Es fühlte sich an, als würde er sich fürsorglich um eine Kranke kümmern.
Der Flecken Lietzow lag auf einer Landzunge zwischen Großem und Kleinem Jasmunder Bodden. Bei so viel Wasser blieb den Bewohnern gar nichts anderes übrig, als vom Fischfang zu leben. Am äußersten Landzipfel stand eine Hütte, in der der Fährmann mit seiner Familie lebte. Johann läutete die Glocke, bis mattes Licht durch die Türritzen drang.
»Warte«, knurrte eine Stimme.