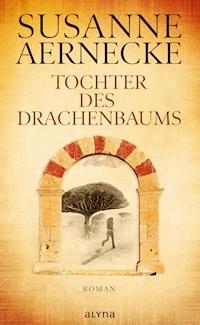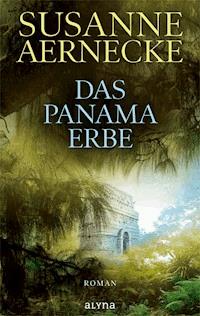
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sina ist die zukünftige Erbin der größten Bank Panamas. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern findet sie wahre Freundschaft und aufrichtige Liebe bei den Kunas, den Ureinwohnern Panamas – und stößt auf das uralte Geheimnis von Amakuna. Als sie sich mit den Kunas gegen die Pläne der Bank ihres Großvaters verbündet, ist ihr Leben in Gefahr. Nur wenn sie die Rätsel der Vergangenheit ergründet, kann sie sich und ihre große Liebe retten …Tamanca kommt im 16. Jahrhundert als Médico in das gerade von Spanien eroberte Panama. Bei sich trägt er ein Heilmittel, das unter allen Umständen geheim bleiben muss. Als er sich auf die Seite der unterdrückten Ureinwohner stellt, ahnt er noch nicht, dass die Nachfahren des von ihm gegründeten Stammes in der Gegenwart eine überaus wichtige Rolle spielen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 785
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
aLYna ist ein Imprint der Europa Verlag GmbH & Co. KG, herausgegeben von Michael Görden
1. eBook-Ausgabe 2017© 2017 aLYna Verlag in derEuropa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin • München • Zürich • WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichLayout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/CommissionePub-ISBN: 978-3-95890-163-6ePDF-ISBN: 978-3-95890-164-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte Vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für die Bewohner von Kuna Yala
Eines Tages, nachdem wir Herr der Winde, der Wellen, der Gezeiten und der Schwerkraft geworden sind, werden wir uns die Kräfte der Liebe nutzbar machen. Dann wird die Menschheit, zum zweiten Mal in der Weltgeschichte, das Feuer entdeckt haben.
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
PROLOG
Laute Stimmen. Eine Frau mit langem kastanienfarbenem Haar zieht mich weg von der Tür, hinter der heftig gestritten wird. Es sind die Stimmen meiner Eltern. Ich höre die Verzweiflung meiner Mutter, den Zorn meines Vaters. Ich glaube zu verstehen, dass er wegwill. Weg von der Insel. Weg von unserem Zuhause. Plötzlich habe ich Angst. Unglücklich sehe ich zu der Frau mit dem Kastanienhaar auf. Ich will Schutz, aber wovor? Sie ist starr vor Spannung. Ihr Blick ist nur auf die Tür gerichtet. Ihre Finger krallen sich immer tiefer in meine Schultern, bis es wehtut. Ich stoße einen leisen Schmerzenslaut aus, und sie lässt mich los. Als das Gespräch hinter der Tür abbricht und sich Schritte nähern, nimmt sie mich rasch bei der Hand, zieht mich eine Holztreppe hinauf in den zweiten Stock und schiebt mich in mein Kinderzimmer.
Kurz darauf öffnet mein Vater die Tür und sagt mir in kurzen Sätzen, dass ich meinen kleinen Rucksack packen soll. Nur das Nötigste und nur zwei Spielsachen, auf keinen Fall mehr. Ich tue es, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Ich packe meine Malbücher ein, die Buntstifte, meine Puppe mit den Schlummeraugen, die Dolores heißt, und Pedro, den Bären. Dann fällt mein Blick auf Juanito, den grauen, schon etwas abgewetzten Stoffesel. Ich weiß, dass ich ihn zurücklassen muss, denn mein Vater hat mir ausdrücklich nur zwei Spielsachen erlaubt. Aber ich möchte ihn so gerne mitnehmen. Ich zögere noch einen kurzen Augenblick. Dann höre ich meinen Vater von unten nach mir rufen. Ich packe den Esel doch schnell mit ein, schnüre den Rucksack zusammen und laufe die Treppen hinunter.
Mein Vater bittet die Frau mit dem kastanienfarbenen Haar, schon mal mit mir zur Bootsanlegestelle zu gehen. Er werde gleich nachkommen. Ich bekomme wieder Angst. Große Angst. Meine kleinen Hände wollen die seinen nicht loslassen. In dem Moment fahren mehrere Jeeps in den Hof. Die Kastanienfrau zieht mich weg. Wir laufen den schmalen, steinigen Weg hinunter zur Bucht, wo ein Boot unruhig auf den Wellen tanzt.
In diesem Moment ertönt ein Knall, so laut, als würde ein Luftballon in meinem Kopf zerplatzen. Ich reiße mich los, laufe, stolpere den Weg zurück. Ich drehe mich um. Die Halle gegenüber unserem Haus, in dem sich das Labor meiner Eltern befindet, steht in Flammen. Ich reiße mich los, laufe, stolpere den Weg zurück. Ich weiß, dass sie dort drin sind, und will unbedingt zu ihnen. Zu meiner Mami und meinem Papi, die mich lieb haben, ohne die ich nicht sein will. Eine Wand aus Feuer und beißender Rauch halten mich zurück. Doch ich habe keine Wahl. Ich halte die Luft an, schließe die Augen und renne los. Die Flammen greifen nach mir, der Qualm bohrt sich in meine Brust. Plötzlich sehe ich schemenhaft, wie ein Mann mit Bart auf mich zukommt. Er schreit gegen das Prasseln der Flammen meinen Namen, »Sina«, packt mich und nimmt mich auf den Arm. Im selben Moment taucht ein anderer Mann auf und schlägt ihn nieder. Ich falle auf den Boden. Alles wird schwarz.
Ich wache erst wieder durch ein leises Brummen auf. Als ich die Augen öffne, erkenne ich, dass ich in einem Flugzeug sitze. Einem großen Flugzeug. Ich bin schon öfter in kleineren Fliegern auf die Nachbarinseln von La Palma geflogen, nach Gran Canaria und Teneriffa.
Neben mir sitzt ein Mann mit einem Schnauzbart, in einem kurzärmeligen Hemd mit großen bunten Blumen darauf. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Er hat mehrere Papiere auf dem kleinen Tischchen vor sich ausgebreitet, die er konzentriert liest. Erst nach einer Weile merkt er, dass ich aufgewacht bin. Er fragt mich nicht besonders freundlich, wie es mir geht und ob ich etwas trinken möchte. Ich schüttle den Kopf. Dabei merke ich erst, wie weh mir alles tut und dass ich einen Verband um den Kopf habe und einen um den Arm. Der Mann erklärt mir, dass ich mich verbrannt habe, aber bald wieder gesund sein würde.
Ich drehe mich suchend nach meinen Eltern um, kann sie aber nirgendwo entdecken. Als ich den Mann frage, wo sie sind, sagt er, wir befänden uns auf dem Weg nach Panama zu meinem Großvater, der mir alles erklären wird. Panama sei ein sehr schönes Land, und es würde mir dort sicher gut gefallen.
Ich will nicht nach Panama. Ich muss weinen und möchte zu meiner Mami. Doch sie ist nicht da. Eine hübsche Frau in blauer Uniform beugt sich zu mir und wischt mit einem weichen Tuch meine Tränen weg. Ich schlage es ihr aus der Hand und schreie jetzt laut nach meiner Mami und meinem Papi. Die anderen Leute in dem Flugzeug drehen sich nach mir um. Jemand hält mir ein Stück Schokolade hin. Ich nehme es und schmeiße es auf den Boden. Ich will aufstehen, doch ein Gurt fesselt mich an den Sitz. Ich schreie immer lauter. Der fremde Mann hält mir den Mund zu und redet ärgerlich auf mich ein. Ich strample und wehre mich, doch es hilft nichts. Jetzt unterhalten sich die Frau in Blau und der Mann in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ich nutze es aus, dass sie von mir abgelenkt sind, und versuche den Gurt zu öffnen, was mir schließlich gelingt. Ich renne durch den Mittelgang des Flugzeugs nach hinten. Eine Frau hält mich schließlich fest und zieht mich auf ihren Schoß. Sie riecht wie meine Mutter. Dasselbe Parfüm. Ich klammere mich an sie und drücke mein Gesicht in ihre Halskuhle, wo der Duft am stärksten ist, und bleibe bis zum Ende des Fluges auf ihrem Schoß sitzen.
1. KAPITEL
Es klopfte. »Entra.«
Felipe steckte den Kopf durch den Türspalt und grinste bis über beide Ohren.
Sina blickte von ihrem Laptop hoch. Sie saß an ihrem Schreibtisch und bearbeitete drei Fallstudien für den morgigen Unterricht. Ein Muss für alle Studenten der ersten Jahrgangsstufe an der Harvard Business School, der amerikanischen Eliteuniversität der oberen Zehntausend.
»Störe ich?«
»No. Listo! Perfektes Timing. Ich bin soeben mit dem letzten Fall fertig geworden. Die Fischkonservenfabrik in Honduras.«
»Wie wäre es dann mit einem kleinen Spaziergang, mi amor? Es schneit gerade nicht, und es tut dir bestimmt gut, wenn du dir ein wenig die Füße vertrittst.«
Sie nickte, speicherte die Datei und klappte ihren Laptop zu. »Und du? Hast du auch brav deine Hausaufgaben erledigt?«
Felipe stöhnte. »Ich weiß nicht, warum sie uns jeden Tag gleich mit drei Fällen quälen.«
»Damit wir später nicht mehr lange überlegen müssen, wie wir Millionen scheffeln und andere, die nicht so viele Tricks auf Lager haben, besser über den Tisch ziehen können«, erwiderte sie lachend und zog sich ihre Strickjacke an, die über der Stuhllehne hing.
Felipe trug einen Daunenanorak und hatte einen dicken Schal um den Hals gewickelt, als wäre er zum Nordpol unterwegs. Sein kurz geschnittenes schwarzes Haar war unter einer Mütze aus Fleece versteckt. Es war für die beiden Panameños der erste Winter in den USA, und dementsprechend froren sie.
»Ich finde das gar nicht lustig. Hoffentlich erwischt es mich morgen nicht. Zu dem Softdrink-Hersteller, der eine Abfüllfabrik in Ägypten aufmachen will, habe ich jedenfalls keine abschließende Meinung.«
»Wieso? Wo ist das Problem? Die Entscheidung liegt doch auf der Hand. Investitions- und Lohnkosten sind zwar niedrig, aber der Tourismus ist wie in einigen anderen islamischen Ländern stark eingebrochen. Viele der großen Bettenburgen haben zugemacht, etliche Restaurants sind pleite, und der Umsatz mit den einheimischen Supermärkten reicht nicht.« Sie überlegte einen Augenblick, strich sich eine vorwitzige Strähne ihres schulterlangen dunkelbraunen Haars hinters Ohr und sah ihren Freund belustigt an.
»Die amerikanische Außenpolitik hat mit dem Arabischen Frühling dafür gesorgt, Nordafrika völlig zu destabilisieren. Es wird ziemlich lange dauern, bis die Region wieder so weit ist, dass es sich für Coca-Cola und Co. lohnt, dort zu investieren. Aber jetzt lass uns gehen, sonst halte ich dir noch einen Vortrag, den du sowieso morgen im Unterricht zu hören bekommst.«
Felipe sah sie bewundernd an. »Für dich ist das alles ein Kinderspiel, was? Apropos Kinder … heute ist ein besonderer Tag, und ich habe etwas für dich.«
»Was für ein Tag?« Sina blickte zu dem Kalender, der über ihrem Schreibtisch hing. »Dritter Dezember?« Sie überlegte einen Moment, dann grinste sie. »Du hast es nicht vergessen.«
»Natürlich nicht, cariño. Heute vor zwanzig Jahren haben wir uns kennengelernt. Du warst vier und ich fünf. Und du hast fürchterlich geheult, weil euer Hund deinen geliebten Stoffesel zerfetzt hat. Juanito.«
»Das weißt du noch?« Sina knuffte ihn in die Seite.
Felipe zog einen kleinen grauen Plüschesel mit langen Ohren und einer roten Schleife um den Hals hinter seinem Rücken hervor und überreichte ihn Sina. »Hier, für dich. Solange ich lebe, werde ich alles dafür tun, dass du nie mehr traurig bist oder weinen musst.«
Sina starrte auf den Esel. Doch statt Felipe für das lieb gemeinte Geschenk mit einer Umarmung zu belohnen, versteifte sich ihr Körper. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn, und sie verspürte einen stechenden Schmerz im Magen. Alles um sie herum schien plötzlich in ein grelles, beängstigendes Licht getaucht. Sie glaubte, laute, explosionsartige Geräusche zu hören, und es kam ihr vor, als schlage ihr eine heiße Feuerwand entgegen. Sie bekam plötzlich keine Luft mehr und hatte das Gefühl, zu ersticken.
»Déjame, por favor!«, flüsterte sie mit rauer Stimme. »Lass mich!«
»Was ist los, mi amor?«, fragte Felipe besorgt.
»Bitte!«
»Soll ich einen Arzt holen?«
»Nein! Lass mich einfach nur allein.«
»Sina!«
»Déjame! Bitte! Geh!«
Felipe warf ihr einen verzweifelten Blick zu und verließ dann wie ein geprügelter Hund ihr Zimmer.
Sina stürzte ins Bad und übergab sich zweimal. Doch der stechende Schmerz im Magen blieb, ebenso wie die Hitze auf ihrem Gesicht. Das Licht um sie herum hatte sich wieder normalisiert. Auch wenn sie wusste, dass sie ein hochempfindlicher Mensch war und ihr Magen schon bei der kleinsten Aufregung Probleme machte, hatte sie noch nie einen derart heftigen Anfall erlebt, der ihren ganzen Körper in Mitleidenschaft zog. Sie kauerte sich mit angezogenen Knien auf ihr Bett und versuchte, das Zittern zu unterdrücken, was ihr jedoch nicht gelang. Ihr war noch immer schwindlig. Der säuerliche Geruch, der durch die halb geöffnete Badezimmertür hereinströmte, raubte ihr zusätzlich den Atem. Sie schleppte sich zum Fenster und öffnete es. Die kalte Schneeluft kam ihr vor wie eine Ohrfeige, die sie zurück in die Wirklichkeit holte. Sie atmete tief durch.
Nach und nach fühlte sie sich besser, wenn auch völlig erschöpft. Dem Stoffesel, den Felipe auf ihrem Schreibtisch zurückgelassen hatte, schenkte sie keinen Blick. Sie legte sich auf ihr Bett und versank in eine Art Halbschlaf, der alles, was soeben passiert war, überdeckte.
Als Felipe eine Stunde später nach ihr sah und das Fenster schloss, eine Decke über sie breitete und sich auf den Rand ihres Bettes setzte, ohne sie zu berühren, nahm sie das wie aus weiter Ferne wahr.
»Geht es dir besser?«, flüsterte er.
Sina schwieg. Sie hatte keine Antwort, nicht darauf, wie sie sich fühlte, und noch weniger darauf, was eben mit ihr geschehen war.
Sie schlief durch bis zum nächsten Morgen. Wie immer wachte sie auch ohne Wecker gegen fünf Uhr auf. Der eklige Geschmack in ihrem Mund brachte die Erinnerung an den gestrigen Nachmittag zurück. Sina knipste die Nachttischlampe an, starrte einen Moment leicht orientierungslos auf die schwarzen Samtvorhänge, die sie gegen die hässlichen gestreiften Dinger ihres Vorgängers ausgewechselt hatte, und stand dann auf.
Jeder Student hier auf dem Campus bewohnte ein eigenes Zimmer. Sina hätte sich nicht vorstellen können, eines zu teilen, geschweige denn das Bad. Sie war weder ein Gruppenmensch noch ein Teamplayer, sondern am liebsten für sich allein. Da störte niemand ihre Gedanken, da musste sie keine Dinge tun, die ihr unsinnig erschienen, und vor allem keinen Small Talk führen.
Leicht fröstelnd schlüpfte sie in den weichen hellblauen Frotteebademantel, den ihr ihre Großmutter zur Immatrikulation in Harvard geschenkt hatte. In ihrem Zuhause in Panama City hatte sie sich nicht vorstellen können, jemals ein so warmes Kleidungsstück anzuziehen, doch im winterlichen Boston war es Gold wert. Sie ging zu ihrem Schreibtisch und zog die Vorhänge auf. Draußen dämmerte es bereits. Ihr Blick blieb an den Eisblumen hängen, die sich an der Fensterscheibe gebildet hatten, etwas, das in ihrer Heimat ein paar Grad nördlich des Äquators nie vorkam.
Sie zog ihre Joggingklamotten und Sportschuhe an, stülpte sich die Kapuze über den Kopf und lief die Treppe im Aufgang C hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Innerlich bereitete sie sich schon mal auf den Kälteschock vor, der sie gleich treffen würde, wenn sie die Tür nach draußen öffnete. Es nutzte jedoch nicht viel – ihre Muskeln verkrampften sich schlagartig. Sie lief einen Moment an Ort und Stelle und schüttelte die Arme aus. Ihr Atem stieg dampfend in die kalte Luft. Sina war schlank, aber kein sportlicher Typ. Sie wusste jedoch, dass sie als Kopfmensch einen Ausgleich brauchte. Seit ein paar Jahren hatte sie sich so an ihre morgendlichen Runden gewöhnt, dass sie ihr fehlten, wenn sich mal keine Gelegenheit dazu bot.
Sie lief seitlich an Mellon Hall vorbei, einem zweistöckigen, in edlem Hellgrau gestrichenen Bau, der mehr dem Seitenflügel einer teuren Villa ähnelte als einem Studentenwohnheim. Der Aufprall ihrer Füße auf dem mit Reif bedeckten Weg, der sich durch weiß überzuckerte Rasenflächen schlängelte, setzte sich in vibrierenden Schwingungen durch Muskeln und Knochen bis in ihren Magen fort, den empfindlichsten Teil ihres Körpers. Das Blut pochte in ihren Schläfen, und sie begann trotz der Kälte zu schwitzen. An den roten Backsteinwänden der anderen Wohnhäuser vorbei, bog sie auf der Westseite des Campus in den Harvard Way ein, der zur Baker Library führte, die mit ihrem Glockenturm und den mächtigen Eingangssäulen wie eine Mischung aus Kathedrale und griechischem Tempel aussah. Weiter ging es am Bloomberg Center vorbei und dann rechts Richtung Morgan Hall, wo sich die meisten Vorlesungsräume befanden. Alle Bauten hier trugen die Namen mächtiger Ökonomen, die zum Aufstieg des US-Kapitalismus beigetragen hatten. Schließlich steuerte sie auf Shad Hall zu, wo das Fitnesscenter untergebracht war, das wie beinahe alles hier den Vergleich mit einem Fünf-Sterne-Wellnesshotel nicht zu scheuen brauchte.
Das Licht brannte bereits, und sie hörte, wie sich jemand am Rudergerät abmühte. Es war Amy, eine junge Texanerin, die über drei Ecken mit der Bush-Familie verwandt war und meist genauso früh wie Sina ihren Körper auf Vordermann brachte. Sie trug ein buntes, eng anliegendes Trainingsoutfit, das ihre perfekte Figur gut zur Geltung brachte. Jeder, der hier in Harvard etwas auf sich hielt, war in einem der Ruderclubs und musste hart dafür trainieren. Sina war es gelungen, den Posten des Steuermannes zu ergattern. Das hieß, sie saß vorn im Boot und gab den Rhythmus an, um die Mannschaft im Gleichtakt zu halten und die größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Das Anführen lag ihr, und fast immer erreichte ihr Boot die besten Stoppzeiten.
»Hi, Sin«, grüßte Amy. Sie hatte die typisch amerikanische Angewohnheit, jeden Namen in eine Kurzform zu pressen. So wurde aus Felipe »Phil«, was überhaupt nicht zu ihm passte, und aus Sina »Sin«, die Sünde, worüber sie nur lächeln konnte.
»Na, bist du gestern mit allem fertig geworden? Ich habe noch bis Mitternacht an dem Fischkonservenfall gesessen. Oh Mann, ich hoffe nur, mein Schicksal führt mich nie nach Honduras. Ich denke, es ist hauptsächlich die schwarze Bevölkerung, die da Probleme macht. Sowohl als Arbeitskräfte wie auch als Konsumenten«, sagte Amy, während sie sich am Rudergerät abmühte, sodass die Sätze keuchend und nahezu aggressiv rüberkamen. »Habt ihr in Panama auch so viele Schwarze?«
Sina sah sie leicht befremdet an.
»Klar. Die spanischen Konquistadoren haben schon Anfang des sechzehnten Jahrhunderts Arbeitskräfte aus Afrika geholt, um ihre Plantagen zu bewirtschaften.«
»Hm«, erwiderte Amy nur, stand auf und rieb sich den Nacken mit einem Handtuch trocken. »Ich geh dann mal duschen. See you!«
Sina nickte ihr höflich zu. Sie wusste schon, warum es ihr nicht leichtfiel, Freundschaften zu schließen. Doch es waren nicht nur die Amerikaner; es schien, als hätten sich alle, die hier studierten, ein Wort auf die Stirn geschrieben, und das hieß »Profit«. Dieses Wort war auf dem Campus allgegenwärtig, und das nicht nur in den Seminarräumen. Auch draußen. Die Bienen schienen es zu summen, die Vögel von den Bäumen zu pfeifen, und selbst der Wind säuselte es, wenn er zwischen den Wohngebäuden der Studenten hindurchfegte.
Sina wusste, dass die Harvard Business School etwas ganz Besonderes war. Dass jeder es als ein außerordentliches Privileg ansah, hier studieren zu dürfen. Und sie wusste auch, dass sich an diesem Ort die Sicht der Einzelnen auf die Welt veränderte. Selbst sie, die es durch ihr familiäres Umfeld gewohnt war, beinahe alles in Zahlen zu bewerten, merkte, wie sich ihre Denkweise, seit sie hier war, noch mehr in Richtung Profitstreben verändert hatte. Sie konnte keinen Laden, kein Restaurant, kein Kino, kein Theater mehr betreten, ohne nicht sofort darüber nachzudenken, was man verändern könnte, um mehr Gewinn zu erzielen. Einerseits war es ein erhebendes Gefühl, weil man sich den jeweiligen Besitzern oder Geschäftsführern meilenweit überlegen fühlte, andererseits konnte man das, was schön und ursprünglich war, nicht mehr unbedarft genießen. Falls sie je so etwas wie Unschuld besessen hatte, war sie ihr hier genommen worden, und zwar auf eine Weise, dass sie es nicht einmal bemerkt hatte. Bis jetzt.
Nach einer halben Stunde harten Muskeltrainings verließ sie den Fitnessbereich, holte sich in der Kantine, die um diese Zeit noch erfreulich leer war, einen Kaffee im Pappbecher und lief wieder auf ihr Zimmer, um zu duschen und sich umzuziehen. Merkwürdigerweise gingen ihr nicht wie sonst alle Fakten der drei Fälle, die den heutigen Unterrichtsvormittag bestimmen sollten, im Kopf herum. Als sie ihre Unterlagen zusammenpackte und ihr Blick auf den Stoffesel fiel, der noch immer auf dem Schreibtisch lag, zog sich ihr Magen schon wieder zusammen, und sie floh geradezu hinaus auf den Gang.
Felipe, der in einem anderen Wohngebäude untergebracht war, wartete pünktlich wie immer um Viertel vor neun unten am Eingang von Mellon Hall auf sie, damit sie gemeinsam zu Aldrich Hall hinübergehen konnten, wo sich ihr Seminarraum befand.
»Cómo estás?«, fragte er mit besorgter Stimme und hauchte ihr zur Begrüßung rechts und links einen Kuss auf die Wange.
»Gracias. Es geht mir schon viel besser. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Keine Ahnung, was gestern mit mir los war. Vielleicht habe ich etwas Falsches gegessen. Du weißt ja, wie empfindlich mein Magen ist.«
»Aber so habe ich dich noch nie erlebt, corazón. Es war, als hättest du etwas gesehen, das dir schreckliche Angst eingejagt hat.«
»Wieso soll mir ein Stoffesel Angst einjagen?«, log sie.
»Sicher?«
»Sí. Seguro! Und nochmals vielen Dank für dein Geschenk.«
»Na ja. So wirklich gut angekommen ist es ja nicht.«
»Vergiss es einfach.« Sina wollte, dass er endlich damit aufhörte. Es war vorbei und kam hoffentlich nie wieder vor.
»Du solltest trotzdem mal rüber ins Medical Care Center gehen und dich durchchecken lassen.«
Sie warf ihm einen Blick zu, der alles bedeuten konnte und mit dem er sich nicht zufriedengab.
»Bitte!«
»Ich mache es. Dir zuliebe.« Und das meinte sie auch so. Ihre Verbindung zu Felipe war heute so eng wie nie zuvor. Deshalb hatten sie auch beschlossen, die zwei Jahre bis zum MBA ge meinsam mit ihm zu absolvieren. Damit kamen sie dem Wunsch ihrer beider Familien nach, die darauf spekulierten, dass sie und Felipe in naher Zukunft heiraten würden, um schon mal auf privater Ebene die geplante Fusion zweier großer Geschäftsimperien einzuleiten. Sie hatten auf dem Campus ganz bewusst verlauten lassen, dass sie verlobt waren, um sich damit beide dem inoffiziellen Heiratsmarkt in Harvard zu entziehen.
Als sie Aldrich Hall erreichten, hatte es zu schneien begonnen. Wie Sina seit ihrem ersten Unterrichtstag wusste, war das imposante Gebäude von dem legendären Businessman und Öl-Tycoon John D. Rockefeller gespendet worden, der es nach seinem Schwiegervater Nelson W. Aldrich benannt hatte, dem Parteivorsitzenden der Republikanischen Partei, Vorsitzenden der Nationalen Währungskommission und des Finanzausschusses.
Wahrscheinlich würden sie und Felipe hier auch irgendwann einen Anbau sponsern. Fast alles, von den Tennisplätzen bis zum Teelöffel, beruhte auf Spenden von ehemaligen Studenten oder sehr wohlhabenden, mit der Regierung paktierenden Familien. Harvard galt inzwischen nicht nur als die beste, sondern auch als die reichste Universität der Welt. Wer hier seinen Abschluss machte, betrat einen klar vorgezeichneten Weg an die Spitze. Er oder sie war perfekt ausgebildet, um im oberen Management auf internationaler Ebene den Ton anzugeben, und zwar ohne Kompromisse.
Vor dem Gebäude standen bereits mehrere Grüppchen von Studenten, die lebhafte Diskussionen zu den drei Fällen führten, welche heute anstanden. Doch Sina verspürte merkwürdigerweise nicht die geringste Lust, sich daran zu beteiligen. Die üblichen Wortfetzen wie »Effizienz«, »Overhead«, »Standortbedingungen« oder »Kundenvertrauen aufbauen« drangen an ihr Ohr, lösten aber nichts in ihr aus. Gar nichts. Es war, als ob sie das alles plötzlich nichts anginge.
Sie betrat so entspannt wie noch nie den Seminarraum und wählte ihren Platz ziemlich weit oben in der Mitte aus. Tische und Stühle waren wie in einem Amphitheater im Halbkreis treppenförmig angeordnet. Jeder hatte dadurch einen freien Blick auf den Professor, der unten in der Mitte vor der großen Schiefertafel stand, und ebenso auf jeden der neunzig Mitstudenten. Keiner musste auf irgendwelche Rücken schauen, was für die Art der Unterrichtsform der Harvard Business School extrem wichtig war. Hier wurde von den Dozenten nicht einfach Wissen mit dem Maschinengewehr abgefeuert, sondern jeder musste es sich anhand von realen Fällen, Diskussionen, Analysen und Entscheidungen selbst erarbeiten. Dafür wurden meist zwei Gruppen gebildet, die wie in den oberen Managementetagen großer Unternehmen das Für und Wider einer anstehenden Entscheidung erörterten. Alle mussten für jeden der zu diskutierenden Fälle bis ins letzte Detail vorbereitet sein. Es reichte nicht aus, die Bilanz zu kennen, sondern es war notwendig, sich ausführlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung, Politik, Bestechlichkeit, Arbeitsethik und den sozialen Strukturen des jeweiligen Landes auseinandergesetzt zu haben.
Sina holte ihr Namensschild aus der Tasche und stellte es vor sich auf den Tisch. Die Unterlagen für die heute anstehenden Fallstudien legte sie daneben – den Fischkonservenfall zuoberst. Sie hatte sich fein säuberlich Notizen an den Rand geschrieben, an deren Inhalt sie sich allerdings im Moment nicht erinnern konnte. Das beunruhigte sie nun doch. Felipe, der neben ihr saß, schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte.
»Alles in Ordnung?«
Sina nickte. Wie sollte sie ihm auch begreiflich machen, dass sie große Mühe hatte, sich zu konzentrieren? Glücklicherweise zog jetzt Professor Bloomfield, ein kleiner, stämmiger Mann in einem dunkelblauen Anzug mit weinroter Krawatte, die Aufmerksamkeit auf sich. Ohne dass er etwas sagen musste, nahmen die Studenten ihre Plätze ein. Er sprach ein paar einführende Worte, machte zur Auflockerung seine typischen jüdischen Witze und schaltete dann den Beamer an, um seine erste Präsentati on auf die große Leinwand neben der Tafel zu projizieren. In einer kurzen Einführung zum Hondurasfall fand er die passenden Worte, um die wirtschaftliche Situation Mittel- und Südamerikas nicht zu sehr zu kompromittieren – immerhin befanden sich neben Sina und Felipe noch zwei Studenten aus Brasilien, einer aus Argentinien sowie eine junge Frau aus Venezuela im Raum.
Sina musste sich extrem anstrengen, um Professor Bloomfield zu folgen. Es kam ihr beinahe so vor, als spräche er eine fremde Sprache, jedenfalls nicht Englisch, womit sie noch nie Probleme gehabt hatte. Wortfetzen wie »soziale und ökologische Komponenten«, »keine Diversifizierung«, »Überfischung«, »erhöhtes Steueraufkommen«, »Wertsteigerung«, »Preisdumping« und »Großhändler« rauschten nur so an ihr vorbei. Erst als sie ihren Namen hörte, tauchte sie wie eine Ertrinkende aus dem Brei aus Worten auf.
»Sina, was denken Sie? Sollte die Bank den Kredit für die Fischkonservenfabrik gewähren oder nicht?«
Ihr Blick ging durch Bloomfield hindurch, der sie über seine schmale Lesebrille hinweg ansah. Sie verstand überhaupt nicht, was er von ihr wollte. Panisch versuchte sie, aus ihren Notizen irgendeine schlüssige Argumentation zu basteln, aber auch das wollte ihr einfach nicht gelingen. Nicht nur, dass sie keine Antwort wusste, sie hatte auch keine Frage parat, die eine Diskussion in Gang bringen und so von ihr ablenken könnte. Neunzig Augenpaare ruhten auf ihr. Hatte plötzlich eine Art Lampenfiebervirus bei ihr angedockt, oder was war los?
»Sina, das ist doch Ihr Metier. Da müssten Sie sich doch ganz zu Hause fühlen.«
Doch Sina fühlte sich nicht zu Hause, sondern fremd und hilflos wie noch nie. Natürlich hatte Bloomfield recht. Fragen zu Kredit- und Investmentmöglichkeiten waren ihr seit ihrer Kindheit vertrauter als Märchen oder Puppen.
»Sind Sie vielleicht nicht vorbereitet?«
Der Satz fuhr auf sie hernieder wie ein Peitschenhieb. Nicht vorbereitet zu sein war etwas, das sich keiner hier leisten konnte. Ein absolutes No-Go, ein Zeichen völliger Ignoranz, Undankbarkeit und Missachtung. Der stechende Schmerz in ihrem Magen kehrte zurück, das Schwindelgefühl, das Zittern. Was war nur mit ihr los? Wieder drang die Stimme von Bloomfield an ihr Ohr.
»Sina, stimmt etwas nicht mit Ihnen?«
Er hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit ihr stimmte etwas ganz und gar nicht! Sie war nicht mehr sie selbst. Nicht mehr der brillante Kopf, der immer ein schlüssiges Argument für oder gegen eine Entscheidung hatte. Eines, dem in den seltensten Fällen etwas entgegenzusetzen war. Doch heute wollte ihr einfach nichts einfallen. Gar nichts. In ihrem Kopf gähnte dort, wo sie normalerweise ihre brillanten Antworten hervorholte, ein schwarzes Loch. Alles war gelöscht, ihre Festplatte war getilgt.
»Ich bitte um Entschuldigung«, stammelte sie leise. Was für eine Blamage, wo sie doch sonst immer die Erste war, deren Hand nach oben schnellte, selbst bei den kniffligsten Fragen.
»Kein Problem, Sina, das kann jedem mal passieren«, hörte sie Bloomfields Stimme mit leicht sarkastischem Unterton.
Ja, jedem, aber nicht ihr, Sina Saratoga, Enkeltochter von Enrique Mateo Saratoga, zukünftige Erbin des größten Bankenimperiums Lateinamerikas. Krampfhaft versuchte sie die aufsteigenden Tränen zu bezwingen und Haltung zu bewahren. Doch es war ihr unmöglich, sich dieser Schmach weiter auszusetzen. Sie zwängte sich an ihren Sitznachbarn vorbei und lief dann durch die Mitte nach vorn. Dabei fühlte sie sich wie ein geschlagener Gladiator, der die Arena verlassen musste. Aus dem Augenwinkel nahm sie noch wahr, wie Felipe aufstand, um ihr zu folgen, sich dann jedoch auf ein Handzeichen des Professors hin wieder setzte. Sie war froh darüber und lief, so schnell sie konnte, durch die hohen, majestätischen Gänge auf die Toilette. Ihr Magen und ihr Darm revoltierten um die Wette. Dieses Phänomen kannte sie nur zu gut. Es passierte immer dann, wenn sie emotional überfordert war, wenn zu viel auf einmal auf sie einprasselte. Aber dass ihr Kopf plötzlich wie leer gefegt war, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte, was sie auf die Frage von Bloomfield hätte antworten können, machte ihr nicht nur Angst, sondern versetzte sie in helle Panik.
Nachdem sie sich entleert hatte, wusch sie sich die Hände und starrte in den Spiegel auf ihr bleiches, von lockigem dunklem Haar umrahmtes Gesicht. Sie wischte sich Stirn und Nacken mit einem Papierhandtuch ab und stellte sich für einen Moment eine Zukunft vor, in der dieser Blackout andauerte und den vorzeitigen Abbruch ihrer Karriere herbeiführte. Von ihr würde nichts bleiben als eine Fußnote in irgendeiner Saratoga-Biografie, so winzig klein gedruckt, dass man eine Lupe brauchte, um sie zu entziffern. In Panama galt sie als aufgehender Stern am Bankerhimmel, doch wie es aussah, war sie nichts als eine Sternschnuppe, die gerade in Höchstgeschwindigkeit im All verglühte. All ihre Hoffnungen, durch ihre Position in dieser Welt etwas mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, schienen in diesem Augenblick zu sterben.
Da sie unmöglich in den Hörsaal zurückkehren konnte, aber auch nicht auf ihr Zimmer wollte, flüchtete Sina durch tanzende Schneeflocken in die Kapelle des Campus, den einzigen Ort, wo sie ungestört über ihre fatale Situation nachdenken konnte. Sie setzte sich auf eine Bank in dem lichtdurchfluteten kreisförmigen Raum und genoss die Stille, die lediglich vom Plätschern eines kleinen Wasserfalls unterbrochen wurde, der sich an der Außenwand in einen Kanal ergoss, der die Kapelle wie ein kleiner Burggraben umschloss.
Sie hatte gerade einen Einbruch ihrer Persönlichkeit erlebt, der sie zutiefst verstörte. Ihre bisherigen Mechanismen griffen plötzlich nicht länger. Sie konnte nur hoffen, dass dies ein einmaliger Anfall war, aber was, wenn nicht? In dem Fall würde sich ihr Leben drastisch verändern. Vielleicht war das ja ein Zeichen? Vielleicht war es ihr gar nicht bestimmt, das Bankenimperium ihres Großvaters zu übernehmen? Womöglich hatte irgendeine höhere Macht etwas ganz anderes mit ihr vor. Sie blickte zu dem Holzkreuz, das über dem angedeuteten Steinaltar schwebte. Auch wenn sie aus einem katholischen Land stammte, in dem die Kirche über große Macht verfügte, war sie nicht besonders gläubig. Die Kirche an sich schien ihr mehr etwas für die Armen, die Hoffnungslosen zu sein – die Schicht, der sie angehörte, verließ sich lieber auf den Verstand. Aber der war ihr nun offensichtlich abhandengekommen.
Eine weibliche Stimme unterbrach ihre Gedanken. »Hierher hast du dich also zurückgezogen!«
Sina drehte sich um und blickte in das Gesicht von Dr. Nichols, die sie aus ihrem Nebenfach »Psychologische Führungsmethoden und Strategien« kannte. Die noch relativ junge Frau mit dem aschblonden Pagenkopf und der schwarz geränderten Brille lächelte sie vertrauensvoll an.
»Ich habe gehört, was im Seminar von Professor Bloomfield vorgefallen ist, und wollte fragen, ob du vielleicht mit mir reden möchtest.«
Sina gab keine Antwort.
»Du brauchst dich deswegen nicht zu schämen, so etwas kann jedem mal passieren.«
»Das hat Bloomfield auch gesagt, aber …«
»Du bist einfach überarbeitet, Sina, und das ist nur zu verständlich. Du hast mit sechzehn das College als Beste deines Jahrgangs abgeschlossen, dann ein Wirtschaftsstudium mit Summa-cum-laude-Abschluss hingelegt, ein Jahr in der Bank deines Großvaters gearbeitet, wo du ein geniales High-Speed-Investmentprogramm entwickelt hast, und bist jetzt mit vierundzwanzig die jüngste Studentin der HBS. Und auch noch die beste. Das haut irgendwann das stärkste Pferd um.« Sie lächelte Sina vertrauensvoll an. »Vielleicht solltest du ein paar Nebenfächer ablegen oder sogar bis zum Semesterende eine Pause einlegen. Die anfallenden Klausuren kannst du im nächsten Jahr nachschreiben.«
Überarbeitet oder besser: Burn-out. Sina war sich ganz sicher, dass das bei ihr nicht der Fall war. So etwas kam nicht von einem Tag auf den anderen … ausgelöst durch einen Stoffesel. Sie musste innerlich lächeln. Wenn sie Dr. Nichols von dem Esel erzählte, würde man sie wahrscheinlich auf direktem Weg von Harvard in die Klapsmühle überführen.
»Was meinst du? Es sind doch nur ein paar Wochen bis Weihnachten, die hast du im neuen Jahr sicher schnell wieder aufgeholt. Vielleicht sprichst du auch mal mit deinem Arzt.«
»Ich werde darüber nachdenken. Vielen Dank.«
»Tu das! Und jetzt kommst du mit in die Mensa. Ich bin sicher, du hast heute noch nichts Vernünftiges gegessen.«
Sina schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall wollte sie sich den mitleidigen Blicken der anderen stellen. Bestimmt hatte ihr Aussetzer bereits wie ein Lauffeuer die Runde gemacht. Und sicherlich hatte sie damit einigen Neidern – die gab es hier zur Genüge – endlich mal Genugtuung verschafft.
»Ich würde gerne noch einen Moment hierbleiben«, antwortete sie.
»Wie du meinst. Aber du musst mir versprechen, etwas zu essen, Sina.«
»Versprochen. Und danke!«
»Gerne. Ich bin immer für dich da.«
Sina wandte sich ab und blickte wieder zu dem Holzkreuz. Was würde wohl ihr Großvater sagen, wenn sie mitten im Semester nach Hause käme? Wie sollte sie ihm, der so hohe Erwartungen an sie hatte, erklären, dass in ihrem Hirn nur noch Zuckerwatte war? Sie war doch seine Garantie für die Zukunft. Ihr hatte er es zu verdanken, dass in seinen Banken heute junge Leute saßen, die sich mit der Technologie ihrer Zeit auskannten und ihm äußerst lukrative Geschäfte ermöglichten, die in einem Wimpernschlag abgewickelt wurden. Ihr traute er als Einziger eine neue Art von Führungsstrategie zu. Nein, sie wollte erst einmal abwarten. Vielleicht war ja morgen schon wieder alles gut, und sie musste die Pferde in Panama gar nicht erst scheu machen.
2. KAPITEL
Einige Tage später verließen Sina und Felipe den Campus in nördlicher Richtung über die Anderson Memorial Bridge – Tage, in denen Sinas Gedächtnis sie immer öfter im Stich gelassen hatte. Sie passierten eine Baustelle, von der ein ohrenbetäubender Krach ausging. Sina, die ohnehin lärmempfindlich war, hielt sich die Ohren zu und verzog das Gesicht.
Unten auf dem Charles River trainierten die Rudermannschaften verschiedener Teams. Allerdings wurden die Kommandorufe der Steuermänner und -frauen, die sonst nach oben schallten, von den Presslufthämmern vollständig übertönt. Als Sina dann auch noch von einem Skateboardfahrer überholt wurde, der ihre Zehen nur knapp verfehlte, war sie so fertig, dass sie nur noch umkehren wollte. Felipe nahm jedoch ihre Hand und zog sie weiter. Er wusste um ihre hohe Sensibilität, die es ihr oft so schwer machte, Situationen zu ertragen, die andere mit links wegsteckten.
Sina verwünschte sich, den Termin bei Dr. Finkelstein nicht auf einen anderen Tag verschoben zu haben, und zwar einen, an dem die Taxifahrer nicht streikten. Aber Felipe hatte ihr davon abgeraten und sie überredet, die zwei Stationen bis Davidsquare mit der U-Bahn zu fahren. Es grenzte sowieso an ein Wunder, dass sie so schnell einen Termin bekommen hatte. Die Psychologin war schließlich weltberühmt und hatte sogar Patienten aus Europa, die extra über den Großen Teich kamen.
Die Empfehlung stammte von Eduardo, ihrem Privatlehrer und Freund ihrer Großmutter, der ebenfalls hier in den Staaten studiert hatte. Nach einer ausführlichen ärztlichen Untersuchung und einem Besuch beim Neurologen hatte sich Sina noch immer keinen Reim auf ihren Zustand machen können und schließlich Eduardo eingeweiht, ihn allerdings darum gebeten, ihren Großeltern vorerst nichts zu erzählen.
Am Harvard Square, wo sich die Metrostation befand, ging es auch nicht ruhiger zu. Straßenmusiker, Verkehr und Lautsprecherstimmen der Fremdenführer, die versuchten, ihre Schäfchen zusammenzuhalten, bildeten eine Kakofonie, die für Sina kaum auszuhalten war. Viele Studenten verdienten sich ein Zubrot, indem sie Touristen über den traditionellen Harvard-Campus führten und Anekdoten von Berühmtheiten wie Bill Clinton, Bill Gates oder George W. Bush, die alle hier studiert hatten, zum Besten gaben. Die etwas abgelegene Business School auf der anderen Seite des Flusses blieb glücklicherweise von diesen Menschenmassen verschont.
Felipe zog Sina die Treppen hinunter zur U-Bahn. Der Waggon war proppenvoll, sodass sie beide kaum Platz fanden. Die verschiedenen Ausdünstungen nahmen Sina fast den Atem. Es war so feucht und stickig, dass ihr unter dem Mantel kleine Bäche von Schweiß den Rücken hinunterliefen. Von Cambridge nach Summerhill waren es nur zwei Stationen. Trotzdem wäre sie am liebsten schon an der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Doch sie wollte sich und auch Felipe beweisen, dass sie, wie jeder andere Mensch in Boston, in der Lage war, mit der Metro zu fahren.
»Next stop: Davidsquare«, schallte es nach gefühlten zwei Stunden aus dem Lautsprecher. Die Türen hatten sich noch nicht ganz geöffnet, da drängte Sina bereits nach draußen, hastete die Rolltreppen hinauf und keuchte wie ein ausgepumpter Langstreckenläufer, als sie endlich wieder an der frischen Luft war.
»Du siehst nicht gut aus«, sagte Felipe, der kaum hinterherkam.
»Nein, alles in Ordnung«, versicherte Sina, obwohl sich ihr Darm wie auch ihr Magen schon wieder mit solcher Heftigkeit meldeten, dass sie schnellstens in einem der vielen Restaurants verschwinden musste.
Als sie von der Toilette zurückkam, hatte Felipe einen Tisch gefunden und ihr einen frisch gepressten Orangensaft bestellt.
»Wir haben noch etwas Zeit, trink erst mal einen Schluck.«
Sie lächelte ihn dankbar an und kippte dann den Orangensaft hinunter, als wäre er ein Zaubertrank, der ihr alles wiedergeben könnte, was sie verloren hatte.
Verloren? Was hatte sie eigentlich verloren? Ihre sogenannte Genialität? Aber vielleicht lebte es sich ja ohne viel besser, viel freier. Dieser Gedanke war ihr in den letzten Tagen öfter gekommen.
Sie stellte das leere Glas ab und sah Felipe nachdenklich an. »Was denkst du, werde ich wieder gesund? Werden wir unsere Träume von einem besseren Lateinamerika ohne Korruption, Drogen und Terror überhaupt wahr machen können? Vielleicht soll mir ja diese merkwürdige Krankheit sagen, dass das alles nur eine große Illusion ist und wir nichts als winzige, unbedeutende Zacken im großen Weltzahnrad sind. Vielleicht wird weder diese elitäre Schule noch alles Geld, das wir je verdienen können, ausreichen, um unsere Ziele zu erreichen.«
Felipe schüttelte den Kopf und nahm Sinas Hand.
»Du wirst sehen, wir schaffen das, und zwar wir beide gemeinsam. Eines Tages werde ich Präsident von Kolumbien sein. Ich werde dafür sorgen, dass sich kein Kolumbianer mehr schämen muss, wenn er seinen Pass vorzeigt. Die Kriminalität, der Drogenhandel, die Feindschaft, die Gier, der Hass, die Gewalt – das muss und wird aufhören! Ich möchte aufrecht in mein Land zurückgehen, auch wenn mein Vater dort viel Schaden angerichtet hat. Ich möchte, dass die Menschen in meiner Heimat nicht länger von Furcht beherrscht werden und sich nicht mehr nur durch ihr Verhältnis zur Gewalt definieren.«
Sina sah ihn lächelnd an. Sie liebte es, wenn er so sprach und sich gegen seinen Vater stellte, der einst einer der größten Drogenbarone Kolumbiens gewesen war, bis er sich in Panama niederließ und dort mit seinen Millionen ein Immobilienimperium zusammenkaufte. Mit der nicht unerheblichen Hilfe ihres Großvaters.
»Was wir hier in Harvard lernen, ist gut. Und Business ist wichtig, aber es darf nicht zulasten der kleinen Leute gehen. Man muss abgeben, muss seinen Gewinn teilen, alle müssen etwas davon haben. An einen Politiker erinnert man sich nicht deshalb, weil er Straßen und Krankenhäuser gebaut hat, sondern weil er in einer Gesellschaft ein anderes Bewusstsein hervorgebracht hat, so wie Martin Luther King oder Kennedy oder Gandhi. Man kann Menschen aus dem Weg räumen, aber keine Ideen! Wenn sie gut sind, überleben sie.« Er holte tief Luft und fuhr dann fort: »Wir sind nicht auf diesem Planeten, um uns gegenseitig Schaden zuzufügen – es gibt edlere Gründe, um zu leben.«
Sina drückte seine Hand. »Das solltest du dir für deine Antrittsrede merken.«
»Bei der du neben mir stehen wirst, als meine Frau. Ich werde immer bei dir bleiben, egal, ob du deine Fähigkeiten wiedererlangst oder nicht.«
Die Praxis von Dr. Finkelstein befand sich einige Straßen weiter in einer ruhigen Wohngegend mit den typischen weiß gestrichenen Neuengland-Holzhäusern. Auf dem Schild am Zaun, der den gepflegten Vorgarten von der Straße abtrennte, stand schlicht »Dr. Sarah Finkelstein, Psychotherapeutin, Sprechstunden nach Vereinbarung«.
Klar, dass sich hier in Boston, dem sogenannten Think Tank der Vereinigten Staaten mit MIT, Harvard, Berklee und der Boston University, viele Juden angesiedelt hatten. Das puritanische Neuengland, das sehr verbunden mit dem Alten Testament war, hatte sich von Anfang an offen gegenüber jüdischen Emigranten gezeigt. Von einer israelischen Mitstudentin wusste Sina, dass man bereits im siebzehnten Jahrhundert in Harvard Hebräisch studieren konnte.
Dr. Finkelstein empfing sie persönlich. Sie war um die fünfzig, mit grauem Kurzhaarschnitt und eleganter Kleidung. Ihre hohe Stirn und die wachen Augen ließen Sina schnell erkennen, dass sich hinter der eher unscheinbaren Fassade ein wacher Geist verbarg.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, begrüßte sie die beiden und sagte dann an Sina gewandt: »Eduardo hat mir schon einiges über Sie erzählt, aber keine Angst, ich werde mir auf alle Fälle selbst ein Bild machen.« Sie zeigte ihnen die Garderobe und bat Felipe, in dem stilvoll eingerichteten Vorraum zu warten.
»Sie können sich gerne bedienen«, sagte sie lächelnd und deutete auf ein gut sortiertes Bücherregal, das zum Stöbern einlud, und die Kaffeemaschine auf einem Tisch daneben.
Felipe bedankte sich und warf Sina einen aufmunternden Blick zu, bevor diese mit der Ärztin hinter der schallgedämmten Tür verschwand.
Das Sprechzimmer von Dr. Finkelstein zeugte von demselben guten Geschmack wie ihre Kleidung. Modernes und antikes Mobiliar harmonierten perfekt miteinander. Eine gemütliche Chaiselongue stand in einer Ecke, in der anderen ein alter Holztisch mit grober Maserung und vier Stühlen. Sina entschied sich für einen Platz am Tisch.
An der Wand hing eine gerahmte Mola, ein Bild aus verschiedenfarbigen zusammengenähten Stoffen, das eine Art Labyrinth darstellte und Sina an ihre Heimat erinnerte.
»Ein Geschenk von Eduardo«, erklärte die Therapeutin, die Sinas erstauntem Blick gefolgt war. »Als ich ihn vor Jahren in Panama besuchte, habe ich mich sofort in diese bunten Textilbil der der Kuna-Indios verliebt. Oben in meiner Privatwohnung hängen noch mehr davon.«
Damit war das Eis gebrochen. Dr. Finkelstein war Sina sofort sympathisch. Die Kunas waren ein außergewöhnliches Volk mit einer uralten Tradition. Sie lebten vollkommen autark nach eigenen Gesetzen in einem riesigen Territorium innerhalb Panamas, über das nur sie bestimmen konnten. Wer ihre Kunst liebte, musste ein sensibler Mensch sein, dem sie vertrauen konnte, dachte sich Sina. Auch wenn die Molas heutzutage hauptsächlich für Touristen hergestellt wurden, so waren sie doch ein Ausdruck der engen Verbundenheit der Kunas zu ihrem Land und ihrer Kultur. Sina wusste nicht, warum, aber das genügte ihr als Grund, sich dieser Frau zu öffnen. Sie setzte sich auf einen der Stühle und sah die Ärztin an.
»Was soll ich Ihnen erzählen, Dr. Finkelstein?«
»Sarah, mein Name ist Sarah. Ich denke, es ist einfacher, wenn wir uns duzen. Erzähl mir einfach, wie du dich gerade fühlst.«
Sina dachte einen Moment nach, bevor sie antwortete. »Beschämt und auch schuldig.« Es war eine Wohltat, endlich die Wahrheit sagen zu dürfen. Weder gegenüber Felipe noch Eduardo oder Dr. Nichols hatte sie ihre wahren Gefühle preisgeben wollen. Hier aber schossen die Worte nur so aus ihr heraus. »Auch ein wenig wie eine Versagerin und wie eine komplette Außenseiterin.«
»Bist du denn eine?«
»Ich bin nie in meinem Leben Fahrrad gefahren, nicht auf Bäume geklettert, nicht einmal in eine normale Schule gegangen. Ich habe Großeltern, die mich seit jeher verwöhnen, verhätscheln, anbeten, bewundern. Ich glaube kaum, dass man unter solchen Bedingungen normal bleiben kann – da muss man doch seltsam werden. Es ist ein Wunder, dass ich noch kein Magengeschwür habe und mir nicht vor jeder Prüfung an der Uni die Seele aus dem Leib gekotzt habe. Dass mir das Hirn nicht ständig wie eine Bohrmaschine dröhnt. Ich habe bisher nur zwei Mal mit einem Mann geschlafen, was jedoch nicht mit Lust oder Leidenschaft verbunden war, sondern immer mehr wie eine Aufgabe war, die es zu erledigen galt. So als müsste ich es hinter mich bringen, weil es ja irgendwie dazugehört zum Leben einer jungen Frau. Also bin ich jetzt ein Freak oder nicht?« Sina wunderte sich über sich selbst. Auf diese Weise hatte sie sich noch nirgends präsentiert.
Dr. Finkelstein sah sie weiterhin freundlich und nicht besonders überrascht an.
»War es der junge Mann, der draußen auf dich wartet?«
»Du meinst, ob ich mit ihm schlafe, ob er es geschafft hat, das Eis in meinen Adern zum Schmelzen zu bringen? Warum sagen wir eigentlich ›schlafen‹, wo doch schlafen das Letzte ist, was wir im Sinn haben, wenn wir mit jemandem ins Bett steigen? Insofern hast du recht. Felipe und ich schlafen miteinander. Öfter. Zusammen in einem Bett … sonst passiert allerdings gar nichts.«
Sarah sah sie abwartend an, und so sprach Sina einfach weiter.
»Wir fühlen uns manchmal einsam zwischen den ganzen Yankees, Russen und Chinesen … uns fehlt die Familie, und da kommt er zu mir ins Zimmer, und dann kuscheln wir uns in dem schmalen Bett aneinander. Das hat für uns beide etwas Tröstliches. Es vermittelt Geborgenheit. Aber Sex? Nein. Uns verbinden andere Dinge.«
»Was zum Beispiel?«
»Wie wir aufgewachsen sind, in was für einem Umfeld, mit welchen Ansprüchen.«
»Im Grunde sagst du mir, dass in deiner Kindheit etwas gefehlt hat, Sina. Wenn alle sich nur für deine Intelligenz, deine ungewöhnlichen analytischen Fähigkeiten interessiert haben, sind möglicherweise tiefe kindliche Bedürfnisse auf der Strecke geblieben.«
Sina sah sie aufmerksam an. »Aber das kann doch nicht der Grund dafür sein, dass Teile meines Gehirns plötzlich vollständig lahmgelegt sind. Meine Großeltern waren immer sehr gut zu mir. Mein Großvater traut mir eine Menge zu. Als sich zeigte, dass ich das Potenzial und die Begabung habe, in seine Fußstapfen zu treten, tat er alles, um mich zu fördern und mir das Leben so angenehm wie nur möglich zu machen.«
»Und trotzdem hat dir etwas Essenzielles gefehlt.« Sarah machte eine kleine Pause. »Kannst du dich eigentlich an deine Eltern erinnern – an irgendetwas?«
Sinas Blick versteinerte. »Ich war vier, als sie starben.«
»Nun, mit vier ist das Bewusstsein schon entwickelt. Da muss es doch irgendetwas in deiner Erinnerung geben?«
Sina schüttelte heftig den Kopf.
»Vielleicht ein Geruch, eine Berührung, Worte?«
Das Kopfschütteln wurde heftiger.
»Kann es sein, dass du dich nicht erinnern willst … weil es so wehtut?«
»Meine Eltern sind tot, und das schon seit über zwanzig Jahren. Sie sind bei der Explosion ihres medizinischen Labors auf der kanarischen Insel La Palma ums Leben gekommen«, leierte sie herunter, wie sie es schon viele Male getan hatte.
»Das haben dir deine Großeltern erzählt.«
»Ja, und es gibt auch alte Zeitungsausschnitte.«
»Warst du denn bei diesem Unfall dabei?«
»Nein.«
»Wo warst du?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Wenn ich meine Großeltern nach dieser Zeit frage, erzählen sie mir so gut wie nichts. Da gibt es überhaupt viele Heimlichkeiten. Schweigen und Heimlichkeiten. Manchmal komme ich in den Salon, und sofort wird es still. Ich weiß dann, dass sie von meinen Eltern gesprochen haben, oder zumindest von meinem Vater. Meine Mutter hat für sie sowieso nie existiert. Mein Großvater macht sie für den Tod meines Vaters verantwortlich. Ohne sie wäre er nie bei Forster’s Health ausgestiegen und auf die kleine Insel gegangen.«
»Forster’s Health, der große amerikanische Pharmakonzern?«, hakte Sarah nach.
Sina nickte. »Mein Vater war in erster Ehe mit der Tochter von Gerald Forster verheiratet und hat sie dann für meine Mutter verlassen. Das fand mein Großvater, der eng mit Gerald Forster befreundet ist, nicht gerade toll. Aber soviel ich weiß, machen die beiden immer noch Geschäfte miteinander.«
»Hast du denn ein Foto von deiner Mutter?«
»Ja, aber nur ein ganz schlechtes aus der Zeitung. Richtige Fotos gibt es keine. Meine Mutter war Waise. Sie hat ihre Eltern ganz früh bei einem Autounfall verloren und ist dann bei ihrer Großmutter in Spanien aufgewachsen. Aber die ist natürlich längst tot.«
»Kannst du dich denn an ihr Aussehen erinnern?«
»Sie soll rotblonde Haare gehabt haben. Großvater hat sie sogar mal als Hexe bezeichnet. Ich habe meine Eltern komplett vergessen«, sagte Sina. »Nicht nur ihren Tod, sondern dass sie überhaupt existiert haben. Es ist so, als hätte sie jemand aus meinem Gedächtnis ausradiert.«
»Nicht ausradiert – du hast sie verdrängt.«
»Verdrängt, wieso verdrängt? Ich will mich doch an meine Eltern erinnern. Aber ich kann es nicht.«
»Verdrängung ist ein unbewusster Vorgang«, erklärte Sarah mit sachlicher Stimme. »Sie tritt bei psychischen und physischen Ereignissen auf, die so überwältigend sind, dass wir sie nicht verarbeiten können. Zum Beispiel, wenn wir als Kinder etwas erleben, das große Angst in uns auslöst oder das wir nicht verstehen können – wie den Tod. Das kindliche Bewusstsein verfügt noch nicht über die Werkzeuge, sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen. Deshalb fassen wir den Entschluss, die schmerzliche Erfahrung aus unserem Gedächtnis zu streichen. Wir tun das allerdings nicht bewusst. In ausgeprägten Fällen wird die Erinnerung so früh ›ausgeschaltet‹, dass sie später der bewussten Wahrnehmung überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Man merkt nicht einmal, dass da etwas fehlt. Manchmal betrifft es eine ganze Lebensphase. Wir sprechen dann von psychogener Amnesie.«
»Psychogene Amnesie«, wiederholte Sina nachdenklich. »Das kann ich noch nachvollziehen – aber wieso sind jetzt plötzlich große Teile meines angelernten Wissens weg?«
»Ganz einfach: Wenn plötzlich Dinge, Situationen oder auch Gerüche auftauchen, die Ähnlichkeiten zu der unterdrückten Vergangenheit haben, führt das zu neuen Verdrängungen, Verwirrung und zu enormen Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen. Irgendetwas hat dich an das Verdrängte erinnert und eine weitere Amnesie ausgelöst. Sozusagen um dem, was du verdrängt hast, Platz zu machen.«
Sina sah sie nachdenklich an. »Der Esel! Felipe hat mir einen Stoffesel geschenkt. Darauf habe ich ziemlich heftig reagiert und von da an nichts mehr auf die Reihe bekommen.«
»Woran hat dich der Esel erinnert, Sina?«
Sie starrte die Therapeutin an und spürte plötzlich Angst in sich aufsteigen. Sie zwang sich, tief durchzuatmen.
»Ich hatte mal so einen als Kind.«
»Ein Geschenk von deiner Mutter oder deinem Vater?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wer hat dir diesen Esel geschenkt, Sina? Denk nach!«
»Ich hatte ihn schon, bevor ich nach Panama kam«, antwortete Sina zögernd.
»Das heißt, du hast ihn aus La Palma mitgebracht?«
»Ich glaube schon.«
Sina spürte ihren Magen wieder revoltieren und Panik in sich aufsteigen. Andererseits wurde ihr bewusst, dass der Schlüssel zu ihrer Heilung offensichtlich in der Zeit vor dem Tod ihrer Eltern verborgen lag. Aber im Moment sah sie nur ein schwarzes Loch, aus dem Leid strömte, unsagbares Leid. Und das machte ihr große Angst. Doch sie war kein Feigling und zwang sich, dieser Furcht ins Gesicht zu blicken.
»Heißt das, der Esel versperrt mir den Zugang zu immer mehr Erinnerungen, solange ich mich nicht an die Zeit vor dem Tod meiner Eltern entsinnen kann?«
Sarah lächelte, und Sina gönnte ihr den Triumph. Ihr war durchaus klar, dass es einen Therapeuten auszeichnete, wenn der Patient selbst die Lösung für sein Problem fand, denn nur dann war die Möglichkeit gegeben, dass er es auch löste.
»Und was soll ich jetzt tun?«
»Du musst gar nichts tun. Es wird dir passieren. Das Fenster in deine Vergangenheit hat sich bereits geöffnet. So wie der Stoffesel wieder aufgetaucht ist, werden weitere vertraute Dinge aufs Neue in dein Leben treten. Irgendwann wird sich daraus ein Bild ergeben, und du wirst dich an vieles aus deiner Kindheit erinnern können. Du musst nur offen dafür bleiben und deiner Intuition folgen.«
»Das wird nicht einfach sein«, sagte Sina nachdenklich. »Denn da sperrt sich etwas in mir. Und bis diese Barriere überwunden ist, wirst du durch zahllose Sitzungen mit mir immer reicher.« Sie grinste Sarah an. »Vielleicht werde ich sogar deine Patientin auf Lebenszeit. Allerdings müsstest du dafür nach Panama City ziehen. Vielleicht zu deinem Freund Eduardo … Wie wäre das?«
»Ich denke, einige Stunden müssten reichen«, erwiderte die Therapeutin amüsiert. »Außerdem lebe ich ganz gerne hier.«
»Und wann bekomme ich mein Gedächtnis zurück?«
»Das kann ich dir nicht sagen. So etwas ist ein Prozess, aber auf alle Fälle ist es einen Versuch wert.«
Sina kannte genug Menschen, die mindestens einmal wöchentlich ihren Therapeuten aufsuchten und eigentlich keinen Schritt weiterkamen. Nein, das war nichts für sie. So nett sie Sarah Finkelstein auch fand – sie würde das ohne weitere Hilfe schaffen. Sie hatte nur einen Anstoß gebraucht, jemanden, der ihr eine Richtung vorgab. Den weiteren Weg musste sie allein finden und gehen.
Während dieser Gedanke in Sina immer mehr Gestalt annahm, fiel ihr Blick erneut auf das bunte Textilbild, das in feinen Linien eine Spirale zeigte, von der sie sich geradezu magisch angezogen fühlte.
»Morgen Abend findet die Eröffnung einer kleinen Ausstellung über die Kunst der Kuna-Indios statt. Im Peabody Museum auf dem Harvard-Campus«, sagte Sarah, die Sina nicht aus den Augen gelassen hatte. »Eine Studiengruppe von Ethnologen und Anthropologen hat dort eine Menge Wissenswertes über die Kunas zusammengetragen. Die Kuratorin ist eine gute Freundin von mir. Vielleicht erfährst du ja etwas über die Ureinwohner deiner Heimat, wovon du noch nichts wusstest. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du kommst.«
Sina sah sie erstaunt an. In Panama würde keiner je auf die Idee kommen, dergleichen auf die Beine zu stellen. Dort gehörten die Kunas wie auch andere indigene Gruppen zur untersten Bevölkerungsschicht. Und ihre Kunst war wie der Panamahut bloß etwas für die Souvenirläden und Touristenmärkte.
3. KAPITEL
Das Büro ihres Großvaters in der Saratogabank, voll mit Umzugskartons. Sie sind alle da: Sinas Großeltern, Eduardo, Felipe sowie zwei gesichtslose Gestalten, in denen sie ihre Eltern erkennt. Neben ihnen steht ein Mann mit wildem blondem Bart, himmelblauen Augen und einer Narbe auf der Stirn. Und dann ist da noch Sarah. Sie öffnet eine der Schachteln und holt ein vierjähriges Mädchen heraus. Sie bietet es jedem Einzelnen an, aber alle lehnen es ab, weil es etwas Böses getan hat.
Plötzlich wird es dunkel, und vor den Fenstern steigt das Wasser immer höher. Die Wände bekommen Risse, Wasser dringt ein, immer mehr, bis der Druck so groß ist, dass als Erstes die Fenster bersten, dann die Wände einstürzen und schließlich alles überschwemmt wird. Das Kind schreit wie am Spieß und wird mit einer Welle aus dem Büro gespült. Es greift nach der gesichtslosen Frau, doch vergebens. Für eine Weile sind die anderen noch in der Nähe des Kindes, doch dann geht einer nach dem anderen unter. Das kleine Mädchen schwimmt ganz allein mitten auf dem Ozean. Es wird von schäumenden Wellen überrollt, doch es schafft es, immer wieder an die Wasseroberfläche zu kommen, um Luft zu schnappen. Plötzlich hält ein Boot neben dem Kind, ein junger Kuna bückt sich über die Reling und zieht es hoch. Aber das Mädchen will zurück ins Meer. Es reißt sich mit aller Kraft los und springt ins Wasser. Das Boot dreht ab, und neben dem Mädchen schwimmt nur noch der Stoffesel. Eine große Hoffnungslosigkeit überfällt es wie nie zuvor im Leben. Hoffnungslosigkeit und schreckliche Angst, weil alle es verlassen haben und es allein schuld daran war …
Sina wachte schweißgebadet auf. Ihr Herz schlug unregelmäßig, und Tränen liefen ihre Wangen hinab. Sie fühlte sich so einsam wie noch nie.
»Felipe, cariño. Kannst du kurz herkommen?«, schluchzte sie in ihr Handy, nachdem sie seine Nummer gewählt hatte.
»Ich bin gleich da«, antwortete ihr treuer Freund.
Sina konnte sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal so geweint hatte, vor allem nicht wegen eines Traums, in dem ein kleines Mädchen nicht gerettet werden will, weil es sich schuldig fühlt, schuldig für den Tod seiner Familie.
»Ich glaube, ich bin schuld daran, dass meine Eltern umgekommen sind. Me siento tan culpable«, sagte sie mit leiser Stimme, als Felipe ihr Zimmer betrat.
Er sah sie liebevoll an, setzte sich auf die Bettkante und nahm ihre Hand.
»Das ist doch Unsinn. Du warst zu diesem Zeitpunkt erst vier Jahre alt.«
»Ich weiß nicht, was damals wirklich passiert ist. Sarah Finkelstein sagt, ich habe es verdrängt, sodass meine frühe Kindheit nur ein weißer Fleck auf der Landkarte meines Lebens ist. Irgendwann verliere ich wahrscheinlich völlig den Verstand.«
Felipe legte sich zu ihr ins Bett und nahm sie fest in den Arm. Mit der rechten Hand streichelte er ihr über den Kopf, mit der linken über den Rücken. Zwischen ihnen waren nur der dünne Stoff ihres Nachthemdes und der seines T-Shirts.
»Lass dich einfach fallen, mi amor«, flüsterte er.
Trotz seiner Worte, die unter anderen Umständen vielleicht ein Trost gewesen wären, wusste sie genau, was nun eigentlich hätte kommen müssen. Dass sie feucht wurde, sich mit kreisenden Hüftbewegungen an ihn drängte, den Kopf hob und mit ihren Lippen seinen Mund suchte. Oder aber ihre Hände abwärts zu seinem angeschwollenen Penis gleiten ließ. Sie müsste ihm signalisieren, dass sie bereit war, die Stille der Nacht mit Lustschreien zu durchbrechen. Dieser einzigartigen Lust, die ein Orgasmus auslöste, wenn beide gleichzeitig kamen.
Aber das geschah nicht. Sina fühlte sich wie eine leere Hülle, und nicht einmal das. Bis zu dem Tag des Fischkonservenfalls hatte sie wenigstens denken können und dadurch existiert. Jetzt war sie ein Nichts.
Die Gewerkschaft der Taxifahrer hatte sich offensichtlich mit den Behörden geeinigt, denn es fuhren wieder Taxis in Boston. Sina ließ sich direkt am Haupteingang des Peabody Museums absetzen, einem mächtigen quadratischen Backsteingebäude an der Divinity Avenue. Felipe hatte am folgenden Tag ein wichtiges Tennismatch, und so hatte sie ihn gar nicht erst gefragt, ob er sie begleiten würde. Wie hätte sie ihm auch erklären sollen, dass diese einfachen Bilder, die aus bunten Stoffen zusammengenäht wurden und die sie beide seit ihrer Kindheit kannten, sie plötzlich so in den Bann zogen. Er hielt sie sowieso schon für vollkommen abgedreht, da war sie sich sicher. Aber sie würde ab jetzt allem nachgehen, was in ihr irgendetwas zum Klingen brachte, so wie Dr. Finkelstein ihr geraten hatte. Vielleicht war das tatsächlich der Weg aus der Dunkelheit und plötzlichen Leere ihres Gehirns. Selbst wenn er ihr noch sehr nebulös vorkam. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, durch welche Landschaften er führte, wie lang er war und was sie am Ende erwarten würde.
Sina war spät dran, und bis sie den richtigen Raum im dritten Stock gefunden hatte, war der Einführungsvortrag schon in vollem Gange. An den Wänden hingen Molas in verschiedenen Größen, Farben und Qualitäten. Eine Dame in Sarahs Alter, wahrscheinlich besagte Freundin, sprach von einem erhöhten Podest aus, während die Gäste mit einem Weinglas in der Hand um sie herumstanden und andächtig lauschten.
»Die Molas der Kunas sind inzwischen weltweit in Museen und privaten Sammlungen textiler Kunst zu finden und besitzen hohen Sammlerwert. Wir freuen uns ganz besonders, Ihnen hier eine kleine Auswahl präsentieren zu dürfen.«
Direkt hinter der Kuratorin war in einer Glasvitrine eine Mola ausgestellt, die wesentlich größer war als die anderen.
»Diese hier gilt als die älteste und ist ein einzigartiges Kunstwerk. Das Motiv birgt ein gewisses Geheimnis. Bei genauerem Hinsehen ist ein Baum zu erkennen, der jedoch weder in Panama noch im Rest Lateinamerikas beheimatet ist. Wie er in die Kosmologie und Sagenwelt der Kunas Einzug hielt, bleibt ein Rätsel.«
Der Baum hatte eine mächtige Krone, die von knorrigen Ästen geformt wurde, beinahe so wie die Speichen eines aufgespannten Schirms. An ihren Enden hingen lange, schwertförmige Blätter in einem dunkelgrünen Schopf nach unten. Darunter standen ein Mann und eine Frau, die sich an den Händen hielten.
Die Kraft, die von diesem Bild ausging, berührte Sina auf eine Weise, die sie sich nicht erklären konnte. Es war jedoch nichts Erschreckendes und rief auch kein Schuldgefühl in ihr hervor wie der Stoffesel. Im Gegenteil, der Baum hatte auf sie eine heitere, beruhigende Wirkung. Sie spürte beinahe so etwas wie Geborgenheit. Sehr seltsam. Hatte die Therapeutin sie deshalb hierher eingeladen? Aber wo war der Zusammenhang?
Sie versuchte, Sarah irgendwo in der Menschenmenge zu erspähen, während die Stimme der Kuratorin weiter an ihr Ohr drang.
»Tiere, Pflanzen, aber auch Gegenstände aus dem täglichen Leben der Kunas werden als Muster verwendet, ebenso wie geometrische Motive und Symbole aus ihrer magischen Welt. Ihren Ursprung aber haben die Molas in der Körperbemalung. Erst durch die Besiedlung durch die Spanier kamen die Kunas in Kontakt mit Stoffen und begannen die traditionellen Muster in Textilien umzusetzen. Ihre Herstellung wird als ›umgekehrte Applikation‹ bezeichnet. Die Motive werden mit der Schere aus zwei oder mehreren übereinanderliegenden, miteinander kontrastierenden Stoffschichten ausgeschnitten und dann gesäumt. Molas sind auch ein Teil der Tracht der Kunas und werden von den Frauen auf Vorder- und Rückseite ihrer Blusen getragen. Zusammen mit den blau-gelben Wickelröcken, den roten Kopftüchern und den charakteristischen dünnen Perlenketten, die kunstvoll um Hand- und Fußgelenke gewickelt werden, stellen sie die traditionelle Kleidung der Frauen dar.« Sie deutete auf einige groß aufgezogene Fotos, die Kunafrauen zeigten. Dann fuhr sie mit ihrem Vortrag fort.
»Molas haben eine derart wichtige Bedeutung für die kulturelle Identität der Kunas eingenommen, dass sie mitverantwortlich sind für den unabhängigen Status von Kuna Yala, ihrem Stammesgebiet.«
Was sie nun erzählte, war Sina durchaus bekannt, allerdings hatte es in ihrem bisherigen Leben keine Rolle gespielt.
»Bei dem Versuch der panamaischen Regierung, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts den Frauen das Tragen ihrer Tracht zu verbieten, kam es zu großen Widerständen, die in weiterer Folge die Kunarevolution von 1925 auslösten. Ergebnis des blutigen Kampfes war das Eingeständnis der Regierung, den Kunas ein autonomes Gebiet an der Karibikküste mit 365 vorgelagerten Inseln, eine eigene Verwaltung und Rechtsprechung zuzusichern.«