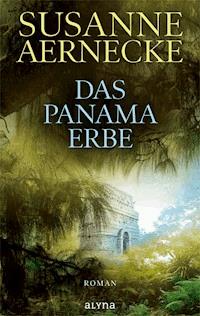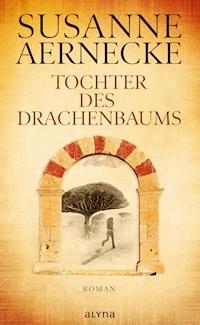
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Mystik, Abenteuer - ein Kampf um Liebe und Macht, der zwei Frauen über Jahrhunderte verbindet. In Vergangenheit und Gegemwart emtfaltet der Roman das Schicksal zweier Frauen, die zu Hüterinnen eines geheimnisvollen Heilmittels der kanarischen Ureinwohner bestimmt sind. Beide werden von den Mächtigen ihrer Zeit verfolgt und müssen ihr Geheimnis gegen den Mann schützen, der die Liebe ihres Lebens ist. Eine atemberaubende Mischung aus historischem Roman, Thriller und romantischer Liebesgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
aLYna ist ein Imprint der Europa Verlag GmbH & Co. KGherausgegeben von Michael Görden
1. eBook-Ausgabe 2015
© 2015 Alyna Verlag in der
Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, ZürichFoto: Drachenbaum auf Umschlagklappe © Frank Drozdowski
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
eBook-ISBN: 978-3-95890-001-1
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
La Palma me abrio sus puertas asia su universo benahoritay las brumas como cortinas de las mas delicada y fina seda me mostraron la belleza de su cielo entre dragos y estrellas los ojos azules de un mar profundo y mi amor por la vida en las entrañas de la caldera
La Palma öffnete mir ihre Tore
sie gewährte mir einen Blick in die Welt der Benahoaritas
gehüllt in neblige Schleier
gleich Gespinsten aus zartester und feinster Seide
Sie offenbarte mir die Schönheit
ihres Himmels unter Drachenbäumen und Sternen
die azurblauen Augen des unergründlichen Meeres
und meine Liebe für das Leben am Grund des Vulkans
Luis Morera
Liebe ist die Brücke, die Zeit und Raum überwindetund uns mit allem verbindet,was war, was ist und was sein wird.
Unbekannter Autor
1. KAPITEL
Romy war solo unterwegs. Free solo. Ohne Haken, ohne Seil und ohne Thea, ihre Kletterpartnerin.
Alles in ihr brannte darauf, endlich loszuklettern, einzutauchen in jene Welt, in der die von Menschen aufgestellten Regeln keine Bedeutung mehr hatten, in der es um höhere Gesetzmäßigkeiten ging. Um das Gesetz der Schwerkraft, die Diktatur von Wind und Wetter, um die Herausforderung, seine Fähigkeiten und Erfahrungen im richtigen Moment abzurufen: dann, wenn das Leben nur noch an den eigenen Fingerspitzen hing. Vielleicht gelang es ihr auf diese Weise, wenigstens für eine Weile nicht an Theas Krankheit zu denken. Aus lauter Sorge um die Freundin hatte sie eine weitere schlaflose Nacht verbracht und war kurz entschlossen um drei Uhr morgens aufgebrochen.
Sie hatte sich für den unteren Teil einer vertrauten Trainings-route entschieden, die trotz des Wintereinbruchs schnee- und eisfrei war. Das hieß: ungefähr zehn Meter an einer fast senkrechten Wand hochklettern, über einen Rist nach rechts queren und auf der abfallenden Rampe zurück zum Boden gelangen. Für jemanden wie sie, mit gut zehn Jahren Klettererfahrung, ein kalkulierbares Risiko. Auch ohne Sicherung. Sie kannte jeden Tritt und jeden Griff.
Nach ein paar Dehnungsübungen, um ihre Muskeln aufzuwärmen, setzte sie sich auf einen dicken Stein, der aus der frischen Schneedecke ragte, und wechselte die Schuhe. Dieser Stein könnte ihr den Schädel spalten, falls sie stürzte, schoss es ihr durch den Kopf, doch den Gedanken verscheuchte sie umgehend.
Sie verstaute ihren Rucksack in einer kleinen Höhle und rieb ihre Hände mit Magnesiumcarbonat ein. Ein eisiger Wind biss sich durch ihre bunte peruanische Wollmütze mit den Ohrenklappen. Erwartungsvoll streckte Romy ihr Gesicht der Sonne entgegen, die sich wie ein glühender Feuerball in diesem Moment über die zerklüfteten Gipfel des Karwendelgebirges schob. Das Rosa der Morgendämmerung war einem frischen Blau gewichen, gegen das sich nun leuchtend weiß die teils verschneiten Kalksteinfelsen abhoben. Sie sog das farbenprächtige Bild in sich auf und war froh über ihren Entschluss, hierhergefahren zu sein. Es war Montagmorgen, und sie würde die Wand wahrscheinlich ganz für sich haben. Und genau das brauchte sie auch.
Die ersten zwei Kalksteinschuppen waren nicht größer als Streichholzbriefchen. Sie spreizte ihre Finger wie Greifhaken und belastete die Vorsprünge, während sie den Oberkörper anspannte. Dann stellte sie die Schuhspitze auf eine leichte Wölbung im Fels, zog an und drückte sich nach oben. Als Nächstes griff sie mit der anderen Hand über sich und legte die Finger in eine taubengroße Delle in der Wand, presste die Fingerspitzen in die Einbuchtung und stieg höher. Diesen Ablauf wiederholte sie Tritt für Tritt, Griff für Griff. Dennoch war keine Bewegung wie die andere.
Als sie ungefähr acht Meter über dem Waldboden war, kreischte ein Schwarm Bergdohlen über ihr und holte sie aus ihrem Flow. Der eisige Wind zerrte an ihrer Jacke. Romy spürte plötzlich ihren Herzschlag und warf einen Blick nach unten.
Ein schon lange nicht mehr erlebtes Gefühl überschwemmte ihren Körper wie eine Welle. Und eine schon lange nicht mehr gehörte innere Stimme flüsterte ihr zu: Jetzt passiert etwas! Ihr wurde heiß und kalt zugleich. Ihr Kopf begann zu dröhnen. Eine unsichtbare Schlinge zog sich immer fester um ihren Hals. Ihr Atem ging nur noch stoßweise, und jeder einzelne Muskel ihres Körpers verkrampfte sich. Auch wenn ihre Hände fest um zwei sichere Griffe lagen, stand sie in exponiertem Gelände, und der Wind fauchte ihr in die Ohren. Sie liebte diesen Spitzentanz über dem Abgrund. Er war ihre ganz persönliche Droge. Ihre Medizin gegen die Panikattacken, die sie in ihrer Jugend gequält hatten. Der perfekte Ausgleich zu ihrem Leben als Ärztin, die im nie endenden Laborbetrieb stets funktionieren musste.
Doch plötzlich änderte sich etwas, und die längst verschwunden geglaubte Panik kehrte zurück, so sehr sie sich auch dagegen wehrte. Gedanken hämmerten wie ein Schlagbohrer rhythmisch auf sie ein: Jetzt fällst du runter! Jetzt erwischt es dich! Jetzt hast du das Rädchen überdreht!
Ihre Finger wurden steif, sie konnte sich kaum mehr halten. Gleich würde sie loslassen müssen. Alles loslassen. Sie schloss die Augen, drückte ihr Gesicht gegen den kalten Fels und zwang sich, gleichmäßig zu atmen. Eigentlich liebte sie es, das raue Gestein an ihrer Wange zu spüren. Doch jetzt trieb diese Berührung sie noch tiefer in die Panik. Warum nur hatte sie sich auf dieses Wagnis eingelassen? War sie etwa lebensmüde? War in ihr etwas, das nicht mehr weitermachen wollte? Lag es daran, dass Thea seit Wochen im Krankenhaus lag und vielleicht an Krebs sterben würde? Dass sie sich ein Leben ohne ihre Freundin nicht vorstellen konnte? Die Angst ballte sich in ihrem Magen zusammen wie ein klebriger Teerklumpen. Romy zitterte am ganzen Körper, war nicht mehr in der Lage, Arme und Beine zu kontrollieren. Wie der dunkle Schlund eines Raubtiers wartete unter ihr die Tiefe auf ihr Opfer, um es zu verschlingen. Sie presste den Bauch gegen den Fels, um Halt zu finden, und versuchte, ja keine ruckartige Bewegung zu provozieren, die sie aus ihrem labilen Gleichgewicht hätte bringen können. Doch ihre Finger rutschten über den rauen Fels, und ihre Füße verloren den Halt.
Sie hörte ihren eigenen gellenden Schrei an den Felswänden widerhallen und ruderte verzweifelt mit den Armen, während sie in die Tiefe stürzte. Ihr letzter Gedanke war: Nicht auf den dicken Stein fallen!
2. KAPITEL
Nebelschwaden zogen wie weiße Schleier über den gigantischen Vulkankrater, der von Höhlen durchzogen war. Ihre Eingänge sahen aus wie offene Münder von Toten, die man vergessen hatte zu schließen. In der größten Höhle waren die Anführer aller zwölf Stämme der kleinen Insel Benahoare zusammengekommen.
Iriomé, für die es der siebzehnte Winter war, ließ den Blick über die bärtige Schar schweifen, die sich auf den Seegrasmatten niedergelassen hatte. Die Männer hatten sich fein gemacht für diesen Anlass und die langen Haare zu Zöpfen geflochten. Die Bärte, sonst wild und zerzaust, hingen wohlgeordnet bis auf die braun gebrannte Brust herab. Manche trugen sandfarbene, mit bunten Samenkapseln bestickte Ledergewänder, andere hatten zusammengenähte Ziegenfelle um ihre Lenden gebunden.
Es war der kürzeste Tag des Jahres, jener Tag, an dem Tichiname, die Oberste Medizinfrau, die Grenzen der Zeit überschreiten würde, um zu erfahren, was die Götter ihrem Volk vorherbestimmt hatten. Sie saß reglos mit geschlossenen Augen inmitten der Höhle vor einem mächtigen Feuer. Ihr von Wind und Wetter zerfurchtes Gesicht, umrahmt von krausem weißem Haar, war mit blauen Spiralen bemalt, dem Zeichen der Unendlichkeit und der ewigen Wiederkehr des Seins. Um ihren faltigen Hals trug sie eine Schnur mit getrockneten Eidechsen, und in der Hand hielt sie einen grob geschnitzten Stab, an dessen Spitze ein Ziegenschädel mit zwei spitzen Hörnern steckte.
Die Stammesführer hofften von ihr zu erfahren, was das nächste Jahr ihnen bringen würde. Ob sich ihre Ziegenherden vermehrten, ob die Frauen genug Wurzeln, Früchte und essbare Blätter finden würden, um Vorräte für entbehrungsreiche Zeiten anzulegen. Ob genug Kinder geboren würden. Und ob der Guayote, der Höllenhund, der im tiefsten Inneren des feuerspeienden Vulkans saß, friedlich bleiben und keinen von ihnen begehren würde.
Ohne Ankündigung ließ die Weise Frau einen schrillen Pfiff los, der an den steinernen Wänden der Höhle verhallte.
Iriomé atmete tief durch. Es war so weit! Zum ersten Mal durfte sie dabei sein, wenn Tichiname den heiligen Trank Amakuna zu sich nahm. Sie hatte das Gebräu auf Anweisung der Medizinfrau so lange gekocht, bis der Schatten des Zeitstabes von einem Stein bis zum nächsten gewandert war. Und auch wenn sie noch nicht ganz verstand, was der Trank tatsächlich bewirken sollte, hoffte sie inständig, irgendwann einmal selbst damit eine Reise in jene geheimnisvollen Welten zu unternehmen, von denen Tichiname ihr immer wieder erzählt hatte. Doch bisher war sie nur die jüngste von sieben Schülerinnen, aus denen die Medizinfrau irgendwann ihre Nachfolgerin wählen würde.
Ein leises Summen erfüllte die Luft. Die sieben jungen Frauen standen Schulter an Schulter an den Wänden der Höhle und hoben die Arme. Ihre langen, aus gebleichten Pflanzenfasern gefertigten Umhänge breiteten sich aus wie die Flügel von Möwen. Ihre Lippen waren blau bemalt, und jede von ihnen trug um den Hals einen kleinen Lederbeutel mit getrockneten Kräutern.
Iriomé schloss die Augen, während das Summen anschwoll und schließlich zu einer Art Gesang wurde, in dem sie und die anderen sechs ein einziges Wort im immergleichen Rhythmus wiederholten:»Amakuna, Amakuna, Amakuna …«
Trotz der kaum mehr erträglichen Lautstärke nahm Iriomé den Klang der kleinen Tonglöckchen wahr, die an Tichinames ledernem Gewand hingen. Offenbar hatte die Medizinfrau sich erhoben. Das dreimalige Klopfen ihres schweren Holzstocks auf dem Felsboden der Höhle ließ den Gesang verstummen.
Iriomé öffnete die Augen, strich sich das lange rotblonde Haar aus dem Gesicht und trat nach vorn, um die ihr zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Stolz und aufrecht schritt sie zu der Felsnische, in der die Schale mit dem geheimnisvollen Gebräu stand. Ihr blieb dabei nicht verborgen, dass die dunklen Augen einer der Schülerinnen sie mit einem Blick verfolgten, der nichts Gutes verhieß. Sie wusste, dass der Neid Guayafanta fast zerfraß, denn sie glaubte, Anspruch auf Iriomés bevorzugte Stellung zu haben.
Zwei Talgfackeln beleuchten die Felswand, in die Dreiecke, Quadrate und konzentrische Kreise geritzt waren: Zeichen, durch die sich die Eingeweihten mit den Geistern verbinden konnten.
Iriomé nahm den Deckel von der Schale und verrührte mit einem Holzlöffel die öligen gelben Schlieren auf der Oberfläche. Dann nahm sie das Gefäß in beide Hände, kniete vor der Obersten Medizinfrau nieder und reichte es ihr. Gespannt beobachtete sie, wie ihre Lehrerin die Schale an die aufgesprungenen Lippen führte.
Iriomé glaubte den leicht fauligen, erdigen Geschmack des Saftes wahrzunehmen, als rinne er durch ihre eigene Kehle. Nach einigen Atemzügen schoben sich Tichinames Pupillen nach oben. Nur mehr das Weiß ihrer Augen war zu sehen. Sie schien angekommen in der anderen Welt.
Plötzlich ertönte ein dumpfer Knall.
Die Schale war zu Boden gefallen und in mehrere Teile zerbrochen. Iriomé zuckte zusammen und sah voller Schrecken, wie Tichinames Körper zu zittern begann, sich aufbäumte und wand, als wäre ein Dämon in ihn eingedrungen. Ihr Gesicht hatte sich zu einer hässlichen Fratze verformt. Schaum trat aus ihrem Mund. Sie keuchte, als kämpfte sie mit jemandem. Dann stürzte sie rücklings zu Boden.
Iriomé sprang auf, um sie aufzufangen. Doch der von Krämpfen geschüttelte Körper entglitt ihr und prallte auf eine Felskante. Aus der Wunde am Kopf sickerte Blut, das Tichinames weißes Haar rot färbte. Sie heulte auf und rollte sich über den Boden hinaus aus der Höhle. Dort drückte sie sich Hilfe suchend an den knorrigen Stamm eines gewaltigen Baumes, der mit seiner wuchtigen Krone wie ein Riese in das fahle Mondlicht aufragte.
Aus den erschrockenen Blicken der Anführer schloss Iriomé, dass dies nicht der normale Ablauf der Zeremonie sein konnte. Die Mädchen hatten sich entsetzt abgewandt, nur Guayafantas breites Gesicht mit den dunklen, undurchdringlichen Augen zeigte keine Regung.
Iriomé vermochte sich nicht vorzustellen, was die Medizinfrau in der anderen Welt gesehen hatte, das einen solchen Ausbruch hervorrufen konnte. Keiner wagte es, sich ihr zu nähern. Schließlich hielt Iriomé es nicht länger aus. Sie lief zu Tichiname, schmiegte sich an den noch immer stark zitternden Körper und versuchte, die Arme, die wie starke Taue um den Stamm geschlungen waren, zu lösen, doch ohne Erfolg. Erst nach einer ganzen Weile ließ die alte Frau los. Ihr Mund befand sich dicht an Iriomés Ohr, und so konnte sie hören, was ihre Lehrerin mit letzter Kraft flüsterte:
»Es werden Männer mit Schiffen kommen, Männer, für die nur Macht und Reichtum zählen. Diese Männer kennen keine Liebe. Sie werden alles, was uns heilig ist, vernichten. Doch eines darf niemals in ihre Hände gelangen: das heimliche Herz der Insel, das in der Höhle des höchsten Berges schlägt! Erst wenn die Menschen frei von Gier nach Macht und Reichtum sind, darf sein Geheimnis offenbart werden.« Ihre Stimme wurde schwächer. »Es ist deine Aufgabe, als meine Nachfolgerin Amakuna so lange zu bewahren, bis jene Zeit gekommen ist.« Erschöpft von der Anstrengung des Sprechens fiel ihr Kopf nach hinten, sodass Iriomé ihn stützen musste.
»Tichiname!«, schrie sie angsterfüllt.
»Schwöre es«, stieß die Sterbende mit letzter Kraft hervor.
Iriomé nahm deren faltige Hand und legte sie an ihr Herz.
»Ich schwöre.«
Ein tiefer Atemzug füllte den Brustkorb der alten Frau. Vacaguaré, hauchte sie in der Sprache ihres Volkes: »Ich möchte sterben.« Und dann noch einmal Vacaguaré!
»Nein«, flüsterte Iriomé verzweifelt. »Nein, geh nicht fort.« Tränen liefen ihr über die hohen Wangenknochen. Die blaue Farbe auf ihren Lippen war verschmiert, das Haar zerzaust. Sie presste sich mit dem Rücken an den Stamm des Baums, als könnte er neue Lebenskraft spenden, und blickte Hilfe suchend in die Gesichter der anderen, die einen Kreis um sie gebildet hatten. Doch der Atem der alten Medizinfrau wurde mit jedem Zug flacher, bis er ganz aus ihr wich und sie zu Boden glitt.
Iriomé brach schluchzend über ihr zusammen. Es war, als sei auch etwas in ihr gestorben.
3. KAPITEL
Zögernd öffnete Romy die Augen. Über ihr raues Gestein. Wasserrauschen. Sie brauchte lange Minuten, um sich zurechtzufinden. Wo war sie? Was war passiert?
Nur langsam stieg die Erinnerung in ihr auf. Die Panik. Der Sturz. Der dicke Stein. Das Rauschen musste der Regen sein, der draußen vor dem Höhleneingang niederprasselte. »Starke Regenfälle am späteren Nachmittag«, erinnerte sich Romy an die Wettervorhersage, die sie am Morgen auf der Fahrt von Augsburg im Auto gehört hatte. Um die Zeit hatte sie eigentlich längst zurück sein wollen.
Behutsam bewegte sie den Kopf und nahm ein dumpfes Gefühl wahr sowie einen faulen, erdigen Geschmack in ihrem Mund. Sie spuckte aus, doch der Geschmack hielt sich hartnäckig auf ihrer Zunge. Ihr Blick fiel auf den kleinen Rucksack mit den Winterstiefeln, den sie hier in der Höhle neben dem Klettereinstieg zurückgelassen hatte. Doch wie war sie hierhergekommen? Totaler Blackout. Romy suchte nach einer Erinnerung. Doch da war nichts. Nichts außer dem Sturz …
Vorsichtig versuchte sie, einzelne Gliedmaßen zu bewegen. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme und die Beine. Erstaunlicherweise konnte sie sogar aufstehen – ohne einen Schmerz zu verspüren. Offensichtlich lief die Produktion der körpereigenen Betäubungsmittel auf Hochtouren. War das die berühmte »goldene halbe Stunde«, ein Geschenk von Mutter Natur an alle Verletzten, das sie in die Lage versetzen sollte, lebensrettende Maßnahmen zu ertragen? Unmöglich. Draußen dämmerte es bereits. Ein Blick auf ihre Armbanduhr sagte Romy, dass sie seit mindestens sieben Stunden hier lag.
Sie hätte nicht einmal Medizin studieren müssen, um zu wissen, dass man nach einem Sturz aus acht Metern Höhe auf festgefrorenen Waldboden nicht einfach so davonkam. Sämtliche Gliedmaßen hätten gebrochen sein müssen, Bänder gerissen, Muskeln geprellt, von inneren Verletzungen ganz zu schweigen. Sie hätte querschnittgelähmt sein können, wenn nicht gar tot. Auf keinen Fall aber wäre sie in der Lage gewesen, sich in die Höhle zu schleppen. Und auf keinen Fall hätte sie einfach so aufstehen können. Doch sie stand tatsächlich auf ihren eigenen zwei Beinen, wenn auch leicht gebückt, um mit dem Kopf nicht an die Höhlendecke zu stoßen. Jemand musste sie geradezu aufgefangen haben! Aber wie? Und wer? Das war doch unmöglich. Und wieso hätte derjenige sie dann hier allein zurückgelassen? Das machte alles keinen Sinn. Dazu kam, dass ihr kein bisschen kalt war. Nach den vielen Stunden auf dem Boden der Höhle müsste sie eigentlich steif gefroren sein wie eine Tiefkühlpizza.
Hatte sie den Sturz vielleicht ebenso geträumt wie das, was sie in den vergangenen Stunden in jener merkwürdigen Steinzeitwelt erlebt hatte?
Doch Träume waren anders. Sowohl der Sturz als auch das, was sie durch die Augen dieses jungen Mädchens mit dem fremdartig klingenden Namen gesehen hatte, erschienen ihr ganz und gar real. Wenn sie sich auch beim besten Willen nicht vorstellen konnte, in welchem Teil der Welt oder zu welcher Zeit sich jenes gruselige Ritual abgespielt haben könnte, dessen Zeuge sie gewesen war. Die Sprache war ihr völlig fremd, obwohl sie jedes Wort verstanden hatte. Und auch die Menschen, vor allem die alte Medizinfrau, waren ihr irgendwie vertraut vorgekommen.
Sie musste unbedingt mit Thea darüber sprechen. Bestimmt hatte sie eine plausible Erklärung parat. Ihre beste Freundin hatte als Neurologin im selben Krankenhaus gearbeitet wie sie.
Bei dem Gedanken an Thea sah Romy wieder die Schale mit dem giftigen Gebräu vor sich. Hatte sie vielleicht aus einem verborgenen Schuldgefühl heraus das Mädchen erfunden, das der Weisen Frau den Todestrank gereicht hatte? Die Angst um ihre Freundin könnte möglicherweise eine Rolle spielen. Ihr wurde schließlich auch eine Art Todestrank verabreicht. Und sie selbst war es gewesen, die Thea letztlich zur Chemo überredet hatte. Aber wieso das steinzeitliche Ambiente, die merkwürdige Vegetation? Einen derart archaischen Baum, unter dem die Medizinfrau gestorben war, hatte sie noch nie zuvor gesehen.
Romy fühlte sich völlig unfähig, ihre Gedanken zu ordnen und zu erkennen, was Einbildung und was Realität war. Etwas, das ihr normalerweise überhaupt nicht schwerfiel. Sie galt sowohl in ihrem privaten als auch in ihrem beruflichen Umfeld als eine Frau, die mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Doch im Moment schien ihr Gehirn Spiele zu spielen, mit deren Regeln sie nicht vertraut war.
Was auch immer hier geschehen war, sie musste weg. Möglichst schnell, denn es würde bald dunkel werden.
Sie suchte in der Tasche ihres Windstoppers nach ihrem Handy. Es war in mehrere Teile zerbrochen. Das zeugte immerhin davon, dass sie tatsächlich gefallen sein musste. Doch wie sollte sie jetzt Hilfe holen?
Romy trat vor die Höhle. Der Regen hatte inzwischen etwas nachgelassen. Vorsichtig tat sie ein paar Schritte. Ihre Knie waren etwas weich, aber sie würde es schon bis zum Parkplatz schaffen. Vielleicht war es besser so. Was hätte sie ihren Freunden von der Bergwacht auch sagen sollen? Dass sie ohne Sicherung losgeklettert war, eine Panikattacke gehabt hatte und wie ein toter Käfer von der Wand gefallen war? Dass jemand sie aufgefangen und in einer Höhle abgelegt hatte, von wo aus sie zu einem kleinen Ausflug in die Steinzeit aufgebrochen war? Man würde sie wahrscheinlich auf der Stelle in die Geschlossene einweisen, und nicht mal Thea würde sie da so ohne Weiteres rauskriegen.
Seufzend holte sie ihre Winterstiefel aus dem Rucksack und schlüpfte hinein. Auch das bereitete ihr keine Mühe. Sie verstaute die Kletterschuhe im Rucksack, warf ihn über ihre Schulter und tastete sich vorsichtig an der Felswand entlang bis zu der Stelle, an der sie abgestürzt sein musste. Der Schnee dort war völlig aufgewühlt und durch den Regen zum Teil weggetaut. Trotzdem glaubte sie, neben ihren eigenen Spuren Abdrücke fremder Schuhe zu erkennen. Irgendjemand musste definitiv hier gewesen sein.
Romy kannte das beengende Gefühl und die knackenden Geräusche, während das CT ihren Körper optisch in einzelne Scheiben schnitt, nur zu gut. Sie war nicht zum ersten Mal in der »Röhre« und das war auch nicht ihr erster Kletterunfall.
Sie hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dieses Mädchen mit den geheimnisvollen Zeichen auf den Wangen und den blau angemalten Lippen ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Sie hatte »Amakuna« gegoogelt, alle möglichen Schreibweisen eingegeben, mit k, mit c, mit Doppel-m, mit h, und dennoch keine passenden Resultate erhalten. Das steinzeitliche Ritual lief unterdessen wie in einer Endlosschleife vor ihrem inneren Auge ab. Um zwei Uhr war sie so weit zu glauben, in einem früheren Leben diese Iriomé gewesen zu sein und selbst an der Zeremonie teilgenommen zu haben. Um drei Uhr hielt sie es gar für möglich, dass die Insulanerin oder jemand anderes aus jener Zeit sie gerettet hatte. Um vier beschloss sie, ins Krankenhaus zu fahren, um eine Computertomografie machen zu lassen. Vielleicht war ja doch mit ihrem Kopf etwas nicht in Ordnung.
Sie hatte Glück gehabt. Angie, ihre einzige Freundin im Augsburger Klinikum, schob gerade Frühschicht und war, wenn auch kopfschüttelnd, sofort bereit gewesen, sie ohne den üblichen Wust an Formularen in die Röhre zu schieben.
Ein längeres Summen signalisierte das Ende des Scans. Angie befreite sie lächelnd aus dem klaustrophobischen Apparat. »Ich spiele dir die Bilder direkt in den Auswertungsraum, dann kannst du sie dir ganz in Ruhe ansehen«, sagte sie auf ihre bedächtige Art.
»Gut, ich komme gleich«. Romy trat in die Umkleidekabine und warf einen kurzen Blick in den Spiegel auf ihr schmales, ungeschminktes Gesicht. Prüfend fuhr sie sich mit der Zunge über die Lippen, wo sie glaubte, noch immer diesen faulig-erdigen Geschmack wahrzunehmen. Rasch zog sie sich Jeans und Pullover an, band die langen rotblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und verließ die Kabine.
Im Auswertungsraum grinste ihr Angie breit entgegen. »Da hast du wieder mal Schwein gehabt. Ich hab auf den ersten Blick nichts erkennen können. Schädeldecke, Schultern, Wirbelsäule, Becken, so weit alles o.k.«
Eigentlich hatte Romy nichts anderes erwartet. Trotzdem war sie froh über Angies erste Einschätzung.
»Ich kapier nicht, warum du dich immer wieder so einem Risiko aussetzt«, sagte sie kopfschüttelnd, während Romy sich mit professionellem Blick die Bilder auf den verschiedenen Monitoren ansah, besonders den Kopf. So weit ihre Kenntnisse reichten, konnte auch sie nichts Auffälliges entdecken.
»Es gibt doch genug Sportarten, die nicht so gefährlich sind wie Klettern. Irgendwann geht wirklich mal was schief, und dann sitzt du im Rollstuhl – oder noch schlimmer.«
Aus Angies Worten war echte Besorgnis herauszuhören. Sie war eine gute Seele. Die meisten Kollegen waren so überarbeitet, dass nur ganz selten mal ein persönliches Wort fiel.
»Ich kann es dir nur so erklären«, antwortete Romy ernsthaft.
»Da oben in der Wand spüre ich mich einfach besser. Da fühle ich mich stark, da weiß ich, wer ich bin und was ich kann.«
Angie sah sie verwundert an. »Du bist stark. Ich kenne wenige Menschen, die so mutig sind wie du.«
»Das wirkt nur so auf andere«, wiegelte Romy mit einer Handbewegung ab.
»Immerhin hast du deinen Job aufs Spiel gesetzt, weil es dir wichtig war, mal die Wahrheit über die Arbeitsbedingungen in diesem Saftladen zu sagen.«
»Ich fühle mich aber trotzdem oft klein und hilflos«, erwiderte Romy. »Ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist so.«
Angie umarmte sie spontan. »Doch, ich verstehe das. Und ich glaube, dass es uns allen hin und wieder so geht.
»Schon möglich, aber mir tut es richtig weh.« Sie löste sich aus Angies Umarmung. »Trotzdem danke. Danke für alles.«
»Immer wieder gern. Du weißt ja, wo du mich findest.«
Inzwischen war es sechs Uhr morgens. Weckzeit im Krankenhaus. Da konnte sie schon bei Thea vorbeischauen. Vielleicht hatte die Freundin ein offenes Ohr für sie – und vielleicht sogar eine Erklärung für ihren Ausflug in die Steinzeit.
Im Gang der onkologischen Abteilung roch es nach Früchtetee, der in Thermoskannen auf den Essenswagen stand. Daneben stapelten sich die abgedeckten Plastikteller, wie eh und je mit drei Scheiben rosafarbener Wurst, einem Schüsselchen Marmelade, drei Scheiben grauem Brot und einem kleinen Päckchen Butter. Daran hatte sich im Lauf der Jahre nichts geändert. Wie üblich wurde bereits um diese unchristliche Zeit auf allen Stationen das Frühstück verteilt, etwas, das Romy noch nie verstehen konnte. Für sie gab es nichts Erholsameres, als morgens auszuschlafen. Doch das gönnte man hier weder den Patienten noch dem Personal. Wie so manches andere auch nicht. Angie hatte recht. Es war mutig gewesen, auf die Missstände aufmerksam zu machen und gewisse Änderungen vorzuschlagen, auch wenn es sich letztendlich als sinnlos herausgestellt hatte. Sie war der Macht der Krankenhausverwaltung nicht gewachsen gewesen, und am Ende war ihr nichts anderes übrig geblieben, als zu gehen. Seit dieser Niederlage arbeitete sie als Laborärztin bei Biotex, einem mittelgroßen Unternehmen für Medikamentenforschung. Dort war auch Avistan entwickelt worden, die Kampfansage gegen eine besonders aggressive Form von Brustkrebs. Derzeit lief die letzte von sieben klinischen Studien. Das hieß, das Medikament stand kurz vor der Zulassung. Deshalb hatte Romy Thea empfohlen, an der Studie teilzunehmen.
Noch bevor sie die Zimmertür öffnen konnte, kam ihr Anton Feistner entgegen, der die Studie leitete. Der Arzt sah in der Neonbeleuchtung so fahl aus, als würde er selbst gerade eine Chemo machen. Er war einen Kopf kleiner als Romy, trug einen Bürstenschnitt und nahm immer eine besonders aufrechte Haltung an, wenn er ihr gegenüberstand.
»Gut, dass ich dich treffe. Hast du schon gehört? Akutes Nierenversagen. Es ist heute Nacht passiert. Sie ist noch während der Dialyse gestorben«, sagte er mit der neutralen Stimme eines Arztes, der solche Sätze nicht zum ersten Mal aussprach.
Romy schnappte nach Luft. Ihr Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Boden drohte ihr unter den Füßen wegzukippen. Feistner konnte sie gerade noch festhalten. »Beruhige dich. Nein! Nein, nicht Thea. Ihre Bettnachbarin!«, sagte er schnell, als er bemerkte, was er angerichtet hatte.
Nur langsam gewann Romy die Fassung wieder. Am liebsten hätte sie ihm eine Ohrfeige verpasst.
»Sie war Hochdruckpatientin, und die Nieren waren schon vorher schwer angegriffen. Hat bestimmt nichts mit Avistan zu tun.«
Romy wischte sich die Träne weg, die über ihre Wange gerollt und in ihrem rechten Mundwinkel hängen geblieben war.
»Alles wieder o.k. mit dir?« Er wartete die Antwort gar nicht ab. »Thea glaubt jetzt natürlich, dass sie die Nächste ist. Versuche, sie irgendwie zu beruhigen!« Er sah sie verlegen an und machte auf dem Absatz kehrt. »Bis später, man sieht sich.«
Noch immer aufgewühlt, öffnete Romy die Tür zu Theas Zimmer. Es war leer. Das Fenster war gekippt und ließ kühle Luft herein. Wahrscheinlich ertrug Thea es nicht, auf die leere Stelle zu starren, wo bis vor Kurzem das Bett ihrer Leidensgenossin stand.
Romy fuhr mit dem Aufzug hinunter in die Cafeteria und entdeckte die Freundin versteckt hinter einem ausladenden Gummibaum an einem der blauen Plastiktische. Sie trug einen teuren Jogginganzug, der nicht verbergen konnte, wie schmal sie geworden war. Ihr Gesicht dagegen, von den Medikamenten leicht aufgedunsen, ließ sie älter wirken. Ihr einst volles kastanienbraunes Haar war dünn geworden.
»Das war’s dann wohl mit eurem Wundermittel«, sagte Thea leise und hob nur kurz den Kopf.
Romy zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. Sie wollte noch immer nicht wahrhaben, dass ihre beste Freundin, die zwar die Kleinere, aber immer die Stärkere von ihnen gewesen war, tatsächlich sterben könnte. Thea hatte es bisher geschafft, ihre Situation so gut wie möglich mit Humor zu meistern. Nur in ganz seltenen Momenten ließ sie sich ihre tiefe Verzweiflung anmerken. Jetzt schien so ein Moment zu sein, denn Thea stand eine Ernsthaftigkeit ins Gesicht geschrieben, wie Romy sie selten bei ihr erlebt hatte.
»Die haben da ein ganz mieses Ding am Laufen«, flüsterte sie und rückte näher an Romy heran. Sie sah sich aufmerksam um, ob irgendjemand in der Nähe war, der sie hören könnte. Aber außer einer alten Dame im geblümten Bademantel, die ihre Sauerstoffflasche auf einem Gestell neben sich stehen hatte, war noch niemand in der Cafeteria.
»Ich habe zufällig ein Telefonat mitgehört, das Feistner noch in der Nacht mit deinem Chef geführt hat«, fuhr sie mit unterdrückter Stimme fort. »Die wollen Avistan trotzdem auf den Markt bringen und die Studie sogar manipulieren, wenn es sein muss. Es steckt zu viel Geld in der Entwicklung. Wenn das Medikament nicht genehmigt wird, ist dein sauberes Labor am Arsch und wird endgültig von irgend so einem US-Konzern geschluckt.«
Romy atmete tief durch. »Bist du sicher? Vielleicht hast du was falsch verstanden?«
Thea schüttelte den Kopf. »Ganz bestimmt nicht. Ich habe noch genau seine Worte im Ohr.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Auf diese Weise als Versuchskaninchen zu sterben, ist nicht gerade das, was ich mir für mein Ende vorgestellt habe«, sagte sie.
Romy musste plötzlich wieder an Iriomé denken, die ihrer Lehrerin den Todestrank überreicht hatte. Sie fröstelte.
»Ich steige jedenfalls aus der Studie aus. Und ich bleibe hier in diesem Versuchskaninchenstall nicht einen Tag länger.«
Romy verstand ihre Freundin nur zu gut. Wie oft hatten sie über bestechliche Ärzte und über Medikamentenstudien diskutiert, die von der Pharmaindustrie finanziert wurden und dementsprechende Resultate aufwiesen. Und jetzt drohte Thea womöglich selbst zum Opfer dieses Systems zu werden. Das durfte nicht passieren.
»In Ordnung«, sagte sie kurz entschlossen. »Dann gehen wir jetzt hoch und packen deine Sachen zusammen. Du kommst erst mal zu mir.«
4. KAPITEL
Der morgendliche Regen war in Schnee übergegangen, als die beiden Freundinnen in Romys Golf den Weg zur Innenstadt einschlugen. Der Wagen war schon älter, aber immerhin war der CD-Player, aus dem nun »What a wonderful world« von Louis Armstrong tönte, noch voll in Ordnung. Romy wollte schon die Forward-Taste drücken, doch Thea hielt sie zurück. »Lass doch. Die Welt ist schön. Trotz allem.«
Romy blickte die Freundin an. Ohne ein Wort der Anklage hatte sie ihre Siebensachen zusammengepackt und Feistner klipp und klar gesagt, dass sie für die krummen Geschäfte der Pharmaindustrie nicht länger zur Verfügung stünde. Romy fragte sich, woher Thea nur diese Ruhe und diese Kraft nahm. Und das letztlich ohne Rückhalt. Ihr Partner war nach der Krebsdiagnose schnell verschwunden, und von ihrer Familie, die zu den reichsten Augsburgs gehörte, hatte sie sich schon vor Jahren losgesagt. Ihnen gehörte beinahe ein Viertel der Stadt, doch als Thea lieber Ärztin werden wollte, als ins Immobilienimperium einzusteigen, war es zum Eklat gekommen. Thea und sie hatten sich während des Studiums in München kennengelernt und sich gegenseitig die Familie ersetzt. Romys Eltern waren bei einem Autounfall gestorben, als sie noch ein Kind war, und so war sie bei ihrer Großmutter in Südspanien aufgewachsen. Ohne Thea hätte sie ihre ersten Jahre in Deutschland niemals überstanden. Die Freundin war ihr Ein und Alles.
In diesem Moment sah sie den Baum!
Sie trat mit aller Kraft auf die Bremse, sodass ihr Hintermann empört hupte.
»Was ist denn jetzt passiert?«, rief Thea und versuchte, den Sicherheitsgurt zu lockern, der sie fest in den Sitz presste.
Statt zu antworten, fuhr Romy in die nächste Toreinfahrt. Suchten sie jetzt schon wieder Halluzinationen heim? »Bin gleich wieder da«, sagte sie rasch, stieg aus und stapfte über den frisch zugeschneiten Bürgersteig ein paar Meter zurück, bis zum Schaufenster des Reisebüros, dessen Aushang sie so aus der Fassung gebracht hatte. Nein, es war keine Halluzination. Sie konnte sich trotz aller Aufregungen offensichtlich noch auf ihre fünf Sinne verlassen. Der Baum auf dem Poster im Fenster sah genauso aus wie der, unter dem die alte Medizinfrau gestorben war.
Ohne zu zögern, betrat sie den Laden. Eine Frau in ihrem Alter mit schlecht gefärbten roten Haaren saß hinter einem vollgepackten Schreibtisch und lächelte ihr geschäftsmäßig entgegen. »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«
»Dieser Baum, da draußen auf dem Poster …«
»… ist ein kanarischer Drachenbaum«, klärte die Rotgefärbte sie auf. »Wollen Sie eine Reise auf die Kanaren buchen?«
»Bitte?«
»Nun, woanders wachsen diese Bäume nicht. Die meisten finden Sie übrigens auf La Palma, der schönsten und grünsten Insel. Ein kleines Paradies.« Sie reichte Romy einen Prospekt, in dem in buntesten Farben die Naturschönheiten der Insel dargestellt waren: exotische Blumen, schwarze Strände, bizarre Vulkanlandschaften mit Kratern und Höhlen.
Eine der Aufnahmen stach Romy sofort ins Auge. Ihr wurde leicht schwindelig. Sie schloss kurz die Augen und versuchte, die Bilder aus ihrer Vision noch einmal auferstehen zu lassen. Kein Zweifel. Das Ritual musste genau dort in einer Höhle stattgefunden haben.
»Wo ist das?«, fragte sie aufgeregt und deutete auf den Prospekt.
»Das ist die Caldera de Taburiente, der große Vulkankrater im Zentrum der Insel. Ein Traumgebiet zum Wandern. Gerade um diese Jahreszeit. Immer noch angenehme Temperaturen. Nicht so heiß wie im Sommer. Haben Sie denn schon ein Datum, wann Sie fliegen wollen?«
Romy sah sie irritiert an. »Nein, nein gar nicht.«
»Ich könnte Ihnen eine hübsche Finca mit traumhaftem Meerblick und zwei Drachenbäumen auf dem Grundstück anbieten«, redete die Reisebürofrau unverdrossen weiter. »Wenn Sie sich schnell entscheiden, hätte ich sogar schon für morgen zwei günstige Flüge für Sie. Gerade gestern hat ein junges Pärchen abgesagt.«
Auch das noch, dachte Romy. Es kam ihr beinahe so vor, als wollte irgendeine fremde Macht, dass sie auf diese Insel flog.
»Und? Was meinen Sie?« Die Frau rief bereits das entsprechende Formular auf ihrem Computer auf.
»Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken«, erwiderte Romy etwas überrumpelt und trat einen Schritt zurück.
»Tun Sie das schnell. La Palma ist im Winter sehr beliebt. Ich könnte Ihnen die Flüge bis heute Mittag …«
Ein lautes Hupkonzert auf der Straße unterbrach das wohlwollende Angebot. Romy sah durch die Glastür nach draußen. Ein großer Laster wollte unmissverständlich in die Einfahrt, die ihr Wagen blockierte. Romy stürmte aus dem Reisebüro, lief zum Auto und sprang hinein. Ihr Versuch, an dem Laster vorbeizurangieren, löste ein noch massiveres Hupkonzert aus.
»Hast du uns eine Klettertour durch die Anden gebucht, oder was hast du da drin gemacht?«, fragte Thea, während Romy sich mühsam in den Verkehr einfädelte. Sie gab keine Antwort.
»Was ist denn nur los? Du siehst aus, als hätte man dich jetzt auch als Versuchskaninchen eingefangen.«
»Mir ist etwas Komisches passiert«, erwiderte sie. »Lass uns nach Hause fahren, dann erzähle ich dir alles.«
Der vierzigjährige Hüne mit den blauen Augen, der Narbe auf der Stirn und dem blonden Vollbart blickte nachdenklich aus dem Fenster im 25. Stock des Holiday Inn über die Dächer von Augsburg. Über dem muskulösen, braun gebrannten Körper trug er eine abgenutzte Militärjacke, von der er sich nicht mehr getrennt hatte, seit er als junger Mann mit dem Kampf gegen die Mächtigen begonnen hatte. Gegen die, die den Hals nicht vollkriegen konnten, die sich auf Kosten der Machtlosen immer mehr und immer von Neuem bereicherten.
Doch nun sah er endlich ein Licht am Ende des Tunnels, denn er würde ab jetzt nicht mehr auf sich allein gestellt sein. Die Weichen waren gestellt. Eine neue Zeitrechnung begann. Sie bekamen eine neue Chance. Er, der Krieger, und sie, die Heilerin. Und dann würde sich zeigen, ob der große Plan sich erfüllte. Ob die Zeit reif war. Ob die Liebe siegen würde oder ob die Menschen weiterhin von der Gier nach Macht und Reichtum getrieben würden.
Deutschland war ein gefährliches Pflaster für ihn, doch er hatte keine Wahl gehabt. Er hatte hierherkommen müssen, um alles, was nun geschehen würde, in Gang zu setzen. So war es seit vielen hundert Jahren vorherbestimmt. Seine Rolle in diesem großen Plan war, ihr Leben zu bewahren. Dafür zu sorgen, dass nichts dazwischenkam, was sie davon abhielt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Aber er durfte sie in keiner Weise direkt beeinflussen. Sie musste ihren eigenen Weg finden, ihre Entscheidungen aus freiem Willen treffen.
Er wandte sich vom Fenster ab, ging zum Telefon, das auf dem Nachttisch stand, und drückte die 0. »Rezeption?«, fragte er mit rauer Stimme. »Bitte buchen Sie mir einen Flug …«
Romy erzählte Thea alles, was sie am gestrigen Tag erlebt hatte, ohne ein Detail auszulassen. Die Freundinnen saßen an dem alten Eichentisch in der Küche von Romys gemütlicher Altbauwohnung und frühstückten das, was der spärlich gefüllte Kühlschrank hergab. Obst, Joghurt, Honig und einen alten Kanten Pfister Sonnenblumenbrot. Die beiden trugen dicke Pullover und Wollsocken, obwohl der alte Kachelofen sein Bestes gab. Dennoch war es kühl. Romy hatte unbedingt diese Wohnung im alten Welserkontor haben wollen und nahm die Nachteile klaglos in Kauf.
Als sie mit ihrer Geschichte am Ende angekommen war, blickte Thea sie nachdenklich an. Die Freundin hatte sie kein einziges Mal unterbrochen, doch Romy kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, dass sie sich längst eine Meinung zurechtgelegt hatte. Und so war es auch.
»Ich glaube, der Sturz war eine Halluzination«, sagte sie in dem typischen, freundlich-mitfühlenden Tonfall der Neurologin.
Romy schüttelte den Kopf. »Ich bin gefallen. Ganz bestimmt. Und jemand hat mich aufgefangen. Die Spuren im Schnee …«
»Du hast selbst gesagt, dass es angefangen hatte zu tauen.«
»Und die Geschichte mit dieser Iriomé?«, verteidigte sich Romy.
»Eine Art Tiefenhalluzination, ausgelöst durch die Adrenalinüberproduktion, die nach jedem Schock eintritt und die Synapsen im Gehirn verrückt spielen lässt.«
»Aber wenn ich doch gar nicht gefallen bin, woher dann der Schock?«
»Das muss mit deinen Panikattacken zusammenhängen, und die sind stressbedingt. Egal, ob alter oder neuer Stress.«
»Aber ich habe seit Jahren keine mehr gehabt. Und beruflich habe ich in meinem neuen Job viel weniger Stress als im Krankenhaus. Das Einzige, was mich fertigmacht, ist … dass du …« Sie verstummte.
Thea überging Romys Verlegenheit. »Wer, glaubst du denn, ist diese Steinzeitfrau, und was wollte sie dir sagen?« Sie sprach schon wieder mit dieser verständnisvollen Neurologinnenstimme.
Wäre Thea nicht ihre beste Freundin, hätte Romy das Gespräch jetzt abgebrochen. Sie erkannte sich ja selbst kaum wieder. Sonst argumentierte sie genau wie Thea immer über die Vernunftschiene. Doch irgendetwas hatte sich verändert. Sie hatte das drängende Gefühl, Iriomés Existenz verteidigen zu müssen.
»Ich könnte mir vorstellen, dass sie mich aus irgendeinem Grund gerufen hat.«
»Aus der Steinzeit?«, fragte Thea stirnrunzelnd.
»Vielleicht? Vielleicht war ich selbst einmal diese Iriomé, in einem früheren Leben. Thea, ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber es war alles so unglaublich real.«
»Das glaube ich dir ja, Schätzchen. Das ist typisch für Halluzinationen. Und Romy klingt ja fast wie Iriomé.«
»Du verarschst mich!«
»Nein, ich versuche nur herauszufinden, was mit dir los ist.«
Romy kam sich auf einmal vor, als wäre sie die Kranke und nicht Thea.
»Starke Empfindungen, Selbstreflexion und Gefühle sind seelische Zustände und ihre neurobiologischen Korrelate verbrauchen sehr viel Sauerstoff und Zucker. Ich denke, du bist aus irgendeinem Grund kollabiert, was einen Blackout verursacht hat und in der Folge diese Halluzinationen.«
Alles in Romy sträubte sich gegen diese Theorie. »Normalerweise würde ich dir ja recht geben. Aber … hast du denn nie, zumindest kurz, überlegt, dass unsere Seele wiedergeboren werden könnte?«
Thea grinste. »Ehrlich gesagt, nein. Wie ich dir eben schon erklärt habe, sind für mich sämtliche seelischen Funktionen mit Mechanismen und Zentren des Gehirns verbunden. Und wenn das tot ist … na ja … dann ist alles tot.«
»Aber was ist mit den alten Religionen? Reinkarnation ist für Buddhisten etwas ganz Normales. Und auch die Hindus sind davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.«
»Und die Erde ist eine Scheibe! Auch daran haben die Menschen viele Jahrhunderte lang geglaubt.«
»Halte mich für verrückt. Aber irgendwie habe ich durch dieses Erlebnis den Eindruck gewonnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Vielleicht ist es wirklich so, und unsere Seele macht sich immer von Neuem auf die Reise. Ich bin mir sogar sicher, dass es genau so ist.«
Thea sah sie nun wirklich besorgt an. »So kenne ich dich ja gar nicht!«
Die Freundin hatte vollkommen recht. War das wirklich sie? Ihre Stimme, die da sprach? Ihre Meinung?
»Na ja, in Anbetracht meines eigenen Zustands kann ich mir eigentlich nur wünschen, dass du recht hast«, sagte Thea plötzlich mit veränderter Stimme, nahm noch einen Schluck Tee und starrte anschließend eine Weile stumm in die Tasse, als würde sie dort eine Lösung finden.
»Sei ehrlich. Du hältst mich für ernsthaft gestört.«
»Nein, dafür kenne ich dich zu gut.«
»Aber was soll ich dann mit dieser Geschichte anfangen?«
In diesem Moment klingelte Romys Handy, sodass Thea ihrer Antwort erst einmal enthoben war. »Wo steckst du denn?«, tönte es aus dem Hörer. »Berger ist total von der Rolle wegen deiner Freundin und will dich sofort sprechen.«
»Ich bin gleich da«, sagte Romy so beherrscht wie möglich. »Versuche, ihn zu beruhigen.«
Sie drückte das Gespräch weg. »Kyra, die Sekretärin meines Chefs. Er will eine Erklärung für deinen Ausstieg aus der Studie.«
»Kann ich ihm gerne geben«, erwiderte Thea. »Soll ich ihn anrufen?«
»Lass mich zuerst mit ihm sprechen. Ich müsste eigentlich schon längst im Labor sein.«
»Dann fahr hin und mach ihm klar, dass er unter allen Umständen Avistan zurückziehen muss.«
»Ich verstehe dich. Trotzdem musst du dich schnellstmöglich mit einem Onkologen zusammenraufen und einen neuen Behandlungsplan aufstellen lassen«, redete Romy ihrer Freundin ins Gewissen.
»Keine Sorge. Heute Abend sehen wir weiter. Ich komme hier schon klar. Lass mich erst mal ein paar Stunden schlafen.«
5. KAPITEL
Mit klammen Fingern gab Romy ihren Code ein und hielt ihre Identifikationskarte an den Scanner. Summend öffnete sich die schwere Tür wie von Geisterhand und schloss sich genauso wieder hinter ihr.
Sie nahm die Treppe in den ersten Stock, öffnete wiederum mit ihrer Codekarte die Tür zu ihrem Labor und knipste die Deckenbeleuchtung an. Das Labor für medizinale Pflanzenforschung befand sich in einem Nebengebäude, und sie und ihre zwei Mitarbeiter hatten dieses Reich so ziemlich für sich. Die beiden waren gestern erst spät gegangen und würden heute später kommen. Ihr Büro, das sich ebenfalls nur mit ihrer Karte öffnen ließ, war durch eine Glaswand abgetrennt. Das Display des Telefons zeigte bereits fünf Anrufe vom Büro ihres Chefs. Trotzdem holte sie erst einmal ihren weißen Kittel aus dem Schrank, ging zurück ins Labor und checkte die Überwachungsmonitore des Synthetisierroboters. KL13 spaltete die DNA einer erst kürzlich im Amazonas entdeckten Wurzel in ihre einzelnen Bestandteile und überprüfte die Wirkungsmöglichkeiten sowie mögliche Übereinstimmungen mit bereits bekannten Zusammensetzungen. Es war ein mühsames Geschäft mit großem finanziellen Aufwand. Leider kam es viel zu selten vor, dass eine neue, wirksame pflanzliche Substanz entdeckt wurde, um bisher unheilbaren Krankheiten den Kampf anzusagen. Kein Wunder also, dass die Pharmaindustrie inzwischen hauptsächlich auf Gentechnologie und Chemie setzte und die Nebenwirkungen einfach unter den Teppich kehrte. Romy war überzeugt, dass die Natur selbst für alle Krankheiten ein Mittel parat hatte. Man musste es nur finden. Ihre neue Arbeit erfüllte sie jedenfalls weit mehr, als sie je gedacht hätte. Während ihrer Zeit an der Uni interessierte sie sich wenig für Forschung, aber jetzt kam es ihr fast so vor, als wären ihre Querelen mit dem Krankenhaus nötig gewesen, um ihre eigentliche Berufung zu finden.
Sie war gerade mal ein Viertel des Protokolls durchgegangen, als das Telefon läutete und Kyra sie zu Berger zitierte.
Sein Vorzimmerdrache, der einmal pro Woche die Haarfarbe wechselte und grundsätzlich Klamotten trug, die nicht zusammenpassten, blickte nur kurz auf, als Romy eintrat.
»Er ist ziemlich angefressen«, sagte Kyra und wandte sich dann wieder ihrem Bildschirm zu, auf dem sie in unglaublicher Geschwindigkeit Solitaire-Karten aufdeckte und einander zuordnete.
Berger sah übernächtigt aus, wie so oft in letzter Zeit. Wahrscheinlich hatte er auf der Bürocouch geschlafen. Er war unrasiert, und sein schütteres blondes Haar stieß in fettigen Strähnen auf den Kragen seines Hemds. Romy wandte den Blick ab. An der Wand hingen Fotos von historischen Militärfahrzeugen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Berger mit großer Leidenschaft sammelte und in seiner Freizeit restaurierte. Er liebte es, wie ein kleiner Junge durch Matsch, Geröll und Flüsse zu fahren. Kurz nach ihrer Einstellung hatte er Romy eingeladen mitzukommen, doch da sie eine extreme Abneigung gegen alles hegte, was nur im Entferntesten nach Krieg roch, hatte sie ihm einen Korb gegeben.
»Setz dich«, forderte er sie mit seiner leicht heiseren Stimme auf. »Es tut mir leid, was heute Nacht passiert ist. Aber ein solcher Einzelfall bedeutet nicht gleich das Aus von Avistan und rechtfertigt keine derart panische Reaktion. Ich weiß nicht, was in deine Freundin gefahren ist. Sie ist doch Ärztin.«
»Genau deshalb ist sie ausgestiegen«, antwortete Romy.
»Das ist ein Fehler, den sie noch bereuen wird. Du weißt genauso gut wie ich, dass sie keine Alternativen mehr hat.«
Romy musste ihm insgeheim recht geben. Thea hatte nach der Operation bereits alles versucht: zwei unterschiedliche Chemotherapien, Bestrahlung, dazu eine komplette Ernährungsumstellung, Mistel- und Immuntherapie … Doch der Tumor streute weiter, als wollte er sie verhöhnen, dass sie mit so schwachen Waffen gegen ihn antrat.
»Avistan wird sie schneller töten als der Krebs«, sagte sie leise.
»Das ist eine leere Behauptung. Die Patientin, die heute Nacht traurigerweise gestorben ist, wäre sowieso nicht mehr zu retten gewesen.«
»Dann hättet ihr sie gar nicht an der Studie teilnehmen lassen dürfen! Das macht doch keinen Sinn. Es würde die Ergebnisse von vornherein verfälschen, und daran kann ja wohl keinem gelegen sein.« Romy hatte sich eigentlich vorgenommen, Berger gegenüber sachlich zu bleiben. Doch wenn man ihr so scheinheilige Ausreden auftischte wie diese, fiel es ihr nicht leicht, sich im Griff zu behalten.
»Die Dinge laufen eben nicht immer so, wie wir uns das wünschen.«
»Genau deshalb musst du Avistan zurückziehen. Es ist ganz offensichtlich noch nicht ausgereift. Thea hat sich die Akte der Patientin angesehen, die gestorben ist. Sie war keinesfalls eine Hochdruck-Patientin«, sagte sie mit schneidender Stimme.
»Ich denke, diese Einschätzung fällt nicht wirklich in eure Kompetenz«, erwiderte Berger mit ebenso scharfem Unterton.
Bisher hatte Romy ihren Chef eigentlich geschätzt und als fairen und kompetenten Wissenschaftler erlebt.
»Ist es wegen Forster’s Health?«, fragte sie ihn. »Wie viele Millionen haben die eigentlich in die Entwicklung von Avistan gesteckt? Vier, fünf, sechs? Oder zehn?« Romy wusste, er hing am Tropf des amerikanischen Konzerns. Offenbar machten sie ihm Druck, und ihm blieb letztlich nichts anderes übrig, als Avistan bei der Bundesstelle für Medikamentenzulassung durchzudrücken. Dabei spielte eine tote Probandin nur eine untergeordnete Rolle. Feistner deckte ihn und bekam dafür bestimmt eine ordentliche Gehaltsaufbesserung. War er nicht letzte Woche mit einem niegelnagelneuen Jaguar vorgefahren?
»Wenn du irgendwann einmal mehr Verantwortung trägst als für dein monatliches Gehalt, rede ich gerne weiter mit dir. Jetzt kannst du eigentlich nur noch dafür sorgen, dass deine Freundin zur Vernunft kommt. Diese Unterhaltung ist damit beendet.«
Doch so schnell ließ Romy sich nicht abspeisen. »Und was machst du, wenn ich an die Presse gehe oder mich gleich an die Bundesstelle wende?«
»So dumm wirst du wohl kaum sein. Du hast schon einmal einen Job verloren, weil du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt hast. Und hier geht es um ein bisschen mehr als um bessere Pflege oder Arbeitszeiten für das Krankenhauspersonal. Ein solcher Konzern besitzt Macht, die weit bis in die Politik, die Presse und die öffentlichen Stellen reicht. Das ist ein Wespennest. Wer anfängt, darin herumzustochern, wird unweigerlich gestochen. Und jeder Stich ist tödlich.«
»Willst du mich einschüchtern?« Sie wusste natürlich, dass er recht hatte. Wenn Avistan hier in Deutschland nicht durchkam, würden die Amis es woanders probieren. In London, in New York, in Abu Dhabi … Irgendwo stand bei solchen Konzernen immer jemand auf deren »Gehaltsliste«, den sie gefügig machen konnten. Und dann heuerten sie ein paar Koryphäen an, die auf Kongressen und bei der Fachpresse Avistan über den grünen Klee lobten. Für eine ordentliche Summe auf einem Konto auf den Bahamas taten diese Kandidaten alles. Manchmal reichte sogar schon eine nette Urlaubsreise dorthin oder ein Kongress in einem Fünfsternehotel mit touristischem Rahmenprogramm für die Begleiterinnen.
Als könnte er ihre Gedanken lesen, wirkte Berger plötzlich nur noch wie ein Häufchen Elend. Er nahm einen Schluck aus seinem Kaffeebecher, der vor ihm auf dem Schreibtisch stand, und sah Romy desillusioniert an. »Letztendlich ist jeder käuflich, Romy. Auch du! Stell dir vor, jemand schlägt dir vor, in deinem Bereich ein neues Mittel gegen Krebs zu entwickeln. Würdest du nicht auch zugreifen, selbst wenn du einen Pakt mit dem Teufel schließen müsstest?«
Romy schwieg.
»Ich habe einmal genauso ambitioniert gedacht wie du. Tödliche oder chronische Krankheiten besiegen. Krebs, Aids, MS. Die Menschheit retten. Aber das hat man mir endgültig ausgetrieben. Zuerst lockt dich so ein Konzern mit großen Summen und Versprechungen, und dann ziehen sie die Schlinge um deinen Hals immer weiter zu, bis du keine Luft mehr bekommst. Diese Typen sind wie die Geier. Sie werden den Laden hier schlucken. So oder so.« Er stellte den Kaffeebecher zurück auf den Tisch. »In den nächsten Wochen wird Señor Nic Saratoga, der CEO von Forster’s Health, auf der Matte stehen und Ergebnisse sehen wollen. Und mit dem Mann ist nicht zu spaßen. Er kommt ursprünglich aus Kolumbien. Alte Kartellschule.« Berger lachte bitter, aber Romy war klar, wie ernst die Situation war und wie tief ihr Chef in der Bredouille saß.
»Mein gesamtes privates Geld steckt in dieser Firma. Ich habe sonst nichts, verstehst du! Was soll aus meiner Familie werden? Ich habe zwei Kinder, die irgendwann studieren wollen.«
So wütend sie eben noch auf Berger gewesen war, so sehr empfand sie plötzlich Mitgefühl für ihn. Sie kannte dieses schmerzhafte Gefühl, einer höheren Instanz ausgesetzt zu sein, gegen die man nichts ausrichten konnte.
In diesem Moment läutete ihr Handy. Romy sah auf dem Display, dass es Thea war. Reflexartig nahm sie den Anruf entgegen.
»Du wirst es nicht glauben!«, legte Thea los. »Ich habe im Internet recherchiert. Diese Steinzeitmenschen, wie du sie beschrieben hast, gab es tatsächlich auf La Palma, und zwar noch vor 500 Jahren. Als die Spanier die Insel eroberten, haben sie genau solche Menschen mit Fellen bekleidet und in Höhlen lebend vorgefunden. Das ist historisch nachgewiesen. Dazu würde auch passen, was deine Medizinfrau vorausgesehen hat!«
Romy schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch. Es werden Männer mit Schiffen kommen, Männer, für die nur Macht und Reichtum zählen.
»Mit den Männern hat sie die spanischen Konquistadoren gemeint«, sagte Thea aufgeregt.
»Das heißt, es war keine Halluzination?«, sagte sie und fing Bergers Blick auf. »Eine Sekunde«, signalisierte sie ihm.
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins:Wir müssen auf diese Insel.«
»Wir?«
»Ja, wir. Wenn es wirklich so was wie Wiedergeburt gibt, dann will ich das wissen.« Sie hielt einen Moment inne, nur ihr Atem war zu hören. »Würde mich irgendwie beruhigen. Sag dem guten Berger, dass du die nächsten drei Wochen Urlaub machst. Ich buche inzwischen unsere Flüge.«
Weg war sie. Romy musste grinsen. Das ist meine alte Thea!, dachte sie berührt, trotz allem so voller Tatendrang.
»War das Thea?«, fragte Berger. »Alles in Ordnung?«
Romy nickte.
»Und? Hat sie es sich noch mal überlegt?«
»Nein. Sie will morgen mit mir auf die Kanaren fliegen. Gibst du mir drei Wochen frei?«
»Das kommt etwas überraschend, oder?«
»Ja.« Sie sah ihn abwartend an. »Denkst du nicht, wir sind ihr das schuldig?«
Berger atmete tief durch. Sein Blick war schwer zu deuten. »Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Wenn ihr wieder zurück seid, hat sich hier alles ein wenig beruhigt, und Thea überlegt es sich vielleicht noch einmal … wenn es dann nicht zu spät ist.«
»Danke«, presste Romy hervor.
»Vergiss deinen Ärger und kümmere dich um deine Freundin.«
Romy verabschiedete sich und ging nachdenklich zurück in ihr Büro. Berger war kein schlechter Kerl. Er hatte sich nur korrumpieren lassen. Und nun hatte Forster’s Health ihn in der Hand. Sie würden Biotex schlucken und ihre Belange durchsetzen. Ihr Magen krampfte sich bei diesem Gedanken zusammen.
Der Mann mit den blauen Augen trug diesmal nicht seine Militärjacke, sondern eine blaue Windjacke, eine Hose von Jack Wolfskin, Bergschuhe und einen Rucksack. Er war rasiert und sah aus wie die meisten anderen Passagiere in der Warteschlange vor dem Check-in-Schalter des Flugs nach Santa Cruz de la Palma. Als sich sein Blick auf die beiden jungen Frauen richtete, die gerade am Counter eincheckten, bekam sein Gesichtsausdruck beinahe etwas Zärtliches.
Er zog sein Handy aus der Tasche und gab eine spanische Nummer ein.
»Hola, Ricardo … Ja. Es verläuft alles nach Plan. Die Maschine ist pünktlich.«
Plötzlich tippte ihm jemand auf die Schulter.
»Alexander Merten?«
Er drehte sich um und blickte in das ausdruckslose Gesicht eines Zivilbullen. Er kannte diese Typen nur zu gut und hätte unter hundert Gesichtern einen einzigen erkannt. So wusste er auch sofort, dass ihm keine Chance für eine Flucht blieb. Es standen mindestens fünf weitere Zivilpolizisten in unmittelbarer Nähe.
»Ricardo, es gibt ein Problem. Du musst dich um die beiden kümmern. Und lass sie auf keinen Fall in die Caldera«, konnte er gerade noch sagen, bevor ihm sein Telefon aus der Hand genommen wurde.
»Sie sind verhaftet. Ich muss Sie bitten, mit uns zu kommen.« Der Polizist zog seine Dienstmarke heraus.
Das Gesicht von Alexander Merten blieb unbeweglich.
Der Polizist wurde ein wenig nervös. »Bitte lassen Sie uns ohne großes Aufsehen den Flughafen verlassen. Wir wollen doch den Menschen hier nicht ihre Urlaubsvorfreude verderben. Darf ich fragen, was Sie auf La Palma wollten?«
Merten gab keine Antwort.
Die ersten Leute drehten sich nach ihnen um.
Er warf Romy und Thea noch einen besorgten Blick hinterher und fügte sich dann in sein Schicksal. Er hielt dem Polizisten seine Hände hin, damit er ihm Handschellen umlegen konnte. »Gehen wir. Sie haben Ihre Zeit auch nicht gestohlen.«
»Ich glaube, darauf können wir verzichten.« Der Polizist nahm dem Hünen den Rucksack ab und schob ihn in Richtung Ausgang. »Wissen Sie was? Im Grunde kann ich Sie sogar verstehen. Mir geht auch vieles gegen den Strich. Und manchmal könnte ich alles kurz und klein schlagen. Aber es gibt immer noch Gesetze.«
»Ich halte mich an meine eigenen Gesetze«, erwiderte Merten und hob das Kinn.
6. KAPITEL
Kurz vor der Landung riss die Wolkendecke auf. Romy beugte sich an Thea vorbei zum Fenster, und beide blickten gespannt nach unten. Die bis zu den felsigen Gipfeln bewachsene Vulkaninsel ragte geheimnisvoll aus dem Meer. Romy erschien sie wie ein grünes Urvieh. Sie lehnte sich wieder zurück. Würde sie dort tatsächlich etwas über diese Guanchen herausfinden? Guanche kam eigentlich von Guanchinet, womit nur die Ureinwohner von Teneriffa gemeint waren. In der Sprache der Berber bedeutete Guan »Mensch« und Chinet war ursprünglich der Name von Teneriffa. Die Ureinwohner von La Palma hießen Benahoares. Heute nannte man der Einfachheit halber alle Altkanarier Guanchen. Romy und Thea hatten die halbe Nacht im Internet gesurft, um mehr Informationen über die Kanaren und ihre Vergangenheit zu bekommen. Und das war nicht wenig. In der Antike wurden sie bereits von Homer als Inseln der Glückseligen beschrieben – ein irdisches Paradies, das irgendwo im Atlantik am westlichen Ende der damals bekannten Welt liegen musste, eine Art Elysium, wohin kein normal Sterblicher jemals gelangen konnte. Jene Inseln, so hieß es, waren nur für wenige Helden bestimmt, die von den Göttern auserwählt waren, um Unsterblichkeit zu erlangen. Und die erreichte man angeblich nur durch den Genuss von goldenen Früchten, die dort in Gärten wuchsen und von den Hesperiden, den Töchtern des Atlas, strengstens bewacht wurden. Alles nur Legenden, und trotzdem kam es Romy vor, als gäbe es irgendeinen Zusammenhang mit jenem Zaubertrank aus ihrer Vision. War Iriomé womöglich auch unsterblich und befand sich nur in einer anderen Dimension? Hatte sie vielleicht irgendeine Zeitschranke durchbrochen, um Romy Einblick in ihr Leben zu gewähren? Aber wenn es so etwas tatsächlich gab, dann blieb die Frage:Warum?
Die Anschnallzeichen blinkten, während die Maschine langsam tiefer ging. Der Flughafen von Santa Cruz de la Palma galt als einer der schwierigsten der Welt. Die Landebahn war extrem kurz, und die starken Fallwinde konnten selbst einen Airbus gegen die schroffen Felsen drücken. Romy merkte, wie ihre Hände feucht wurden und ihr Atem schneller ging. Thea legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Alles o.k.?«
Romy nickte und konzentrierte sich darauf, regelmäßig ein und aus zu atmen. Offensichtlich schlummerte die Panik noch immer in ihr, wie ein Vulkan, von dem man nie wusste, wann er ausbrechen würde.
Mit einem heftigen Ruck setzte die Maschine auf und bremste so stark ab, dass sie beide tief in ihre Sitze gepresst wurden. Die Passagiere klatschten laut. Romy fand das immer lächerlich, doch hier konnte sie es nur zu gut verstehen. Sie atmete tief durch, löste den Gurt und half Thea, ihren schweren Rucksack aus dem Gepäckfach herunterzuholen, der offenbar mit Unmengen von Büchern vollgestopft war. Normalerweise verschlang die Freundin pro Woche mindestens zwei. Sogar bei ihrem letzten gemeinsamen Trip in den Anden hatte Romy sie mit drei dicken Büchern in ihrem Rucksack erwischt.
Ein angenehm warmer Wind empfing sie, als sie vom Flugzeug die Gangway hinunter zum Flughafengebäude gingen. Auf dem Atlantik, direkt neben der Landebahn, tanzten kleine weiße Schaumkronen. Was für ein Unterschied zu Deutschland! Dort zeigte das Thermometer am Morgen minus drei Grad, und die Maschine musste sogar enteist werden.
Thea hatte den Großteil des Fluges verschlafen und fröstelte nun trotz der frühlingshaften Temperaturen. Sie zog sich ihren Wollschal fester um den Kopf, schien aber sonst ganz munter zu sein.
»Na, wie fühlt es sich an, den Boden deiner Ahnen zum ersten Mal zu betreten?«, neckte sie ihre Freundin.
Romy gab keine Antwort. Denn es kam ihr tatsächlich so vor, als würde sie diese Luft hier nicht zum ersten Mal atmen.
Das Flughafengebäude, ein zweckmäßig aus dunkelgrauem Sichtbeton gebauter Klotz, wirkte leider gar nicht wie das Tor zum Paradies. Die Moderne in ihren schlimmsten Auswüchsen hatte hier mit aller Gewalt zugeschlagen. Allerdings lief die Abfertigung wie am Schnürchen. Ihre Koffer erschienen fast als erste auf dem Gepäckband, und auch die Formalitäten für den Leihwagen ließen sich erfreulicherweise schnell erledigen, bis auf die zusätzliche Abholgebühr, die in dem Billigangebot aus dem Internet mal wieder nicht erwähnt worden war. Romy kam jedoch zugute, dass sie noch immer sehr gut Spanisch sprach.
Der kleine weiße Citroën, den sie erst nach längerem Suchen in dem riesigen Flughafenparkhaus ausfindig machen konnten, schien ganz neu. Zumindest roch er so, was hoffen ließ, dass die Bremsen gut funktionierten. Das sei auf der Insel überlebenswichtig, hatte die Reisebüroangestellte Romy noch mit auf den Weg gegeben, als sie die Tickets abholte.
Bereits nach den ersten Kilometern war klar, was damit gemeint war. Kaum hatten sie die Küstenstraße verlassen, um über einen hohen Bergkamm auf die Westseite der Insel zu gelangen, trafen sie auf eine Haarnadelkurve nach der anderen. Thea ließ das Seitenfenster herunter und legte sich vorsichtshalber die Kotztüte, die sie aus dem Flugzeug mitgenommen hatte, auf den Schoß. Romy bemühte sich, so langsam und so sanft wie möglich zu fahren. So blieb ihnen jedenfalls ausreichend Zeit, die beeindruckende Landschaft in sich aufzunehmen.
Gigantische Felswände links, tiefe Schluchten rechts und nach der nächsten Kurve umgekehrt. Über zweitausend Meter hohe, von Wolken umgebene Bergmassive fielen steil ab zu riesigen Bananenplantagen am Meer. Die meisten der abschüssigen Hänge waren mit unzähligen Mauern aus dicken Natursteinen in stufenförmige Terrassen unterteilt.
»Also, ich weiß nicht, ob die ursprünglichen Bewohner der glückseligen Inseln wirklich mit einem so sorgenfreien Leben verwöhnt waren. Da müssen etliche Generationen über Jahrhunderte mit unermüdlichem Fleiß Stein für Stein aufgeschichtet haben«, sinnierte Thea.
Romy musste ihr recht geben. Irgendwie hatte sie sich das Paradies auch ein bisschen anders vorgestellt. Nicht so steil und auch nicht so wild. Da sah man mal wieder, wie sehr sich Geschichten und Legenden doch von der Realität unterschieden. Trotzdem gefiel ihr die Landschaft, deren Vegetation sich ständig änderte. Während unten an der Küste hauptsächlich verschiedene Kakteenarten und Sukkulenten, dicke fleischblättrige Gewächse, wuchsen, stießen sie weiter oben auf zart rosa blühende Mandelbäume und meterhohe Christsterne. Dann fuhren sie wieder durch sonnendurchflutete, würzig duftende Kiefernwälder. Und natürlich wuchsen überall die kanarische Palmen, denen die Insel ja schließlich ihren Namen verdankte.
Vorgestern erst hatte sie von La Palma »geträumt«, und heute schon war sie hier. Egal, ob Wiedergeburt oder nicht: Es gab einen Grund dafür! Und den musste sie herausfinden.
»Sieh mal«, riss Thea sie aus ihren Gedanken und deutete auf ein Ortsschild mit dem Namen Tazacorte, das halb hinter einem Busch versteckt war. »Ich habe irgendwo gelesen, dass die Welser dort im Mittelalter einmal riesige Ländereien besaßen. Warte mal.«