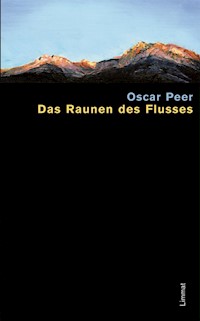
17,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erzähler kehrt im Herbst seines Lebens zurück zum verlassenen Haus am Inn, an die Orte seiner Kindheit im Unterengadin. Er findet Spuren und Erinnerungen an Menschen, an Landschaften und Gerüche. Das tägliche Leben taucht wieder vor ihm auf, die Schule, Streit und Versöhnungen, wichtige Menschen, der Vater, Eisenbahner und unersättlicher Leser, die Mutter, passionierte Briefeschreiberin, die Freunde, Lehrer, das harte Leben und die manchmal eigenwilligen Grossväter. Erinnerung und Imaginäres wechseln sich ab. Konzentriert um Orte, Themen und Personen, setzt sich die Jugendgeschichte Stück um Stück zusammen. Der Autor vermeidet die lineare Chronologie. In der Tradition einer eindrücklichen oralen Erzählkultur, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, erzeugt Oscar Peer eine einzigartige Stimmung vom Alltagsleben im Engadin der Dreissiger- und Vierzigerjahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Fotografie Yvonne Böhler
Oscar Peer (1928–2013), geboren und im Unterengadin aufgewachsen, gehört zu den bedeutendsten rätoromanischen Autoren der Gegenwart. Eigentlich mit einer Lehre als Maschinenschlosser angefangen, drängte ihn sein Weg nach deren Abbruch zum Lehrerberuf. Nach dem Lehrerseminar in Chur begann er ein Studium der Romanistik, das er mit einer Dissertation zum surselvischen Schriftsteller Gian Fontana 1958 abschloss. Auch danach widmete sich Oscar Peer dem Rumantsch. Mit dem «Dicziunari rumantsch, ladin-tudais-ch» ist ein Basiswerk für die romanische Sprache entstanden. Viele Jahre unterrichtete er an Mittelschulen, daneben entstand kontinuierlich sein literarisches Werk.
Oscar Peer
Das Raunen des Flusses
Limmat Verlag
Zürich
Carolina, ein Prolog
Den ersten Wohnort meines Lebens hatte ich schon seit langem nicht mehr gesehen, hatte auch keinen zwingenden Grund, ihn aufzusuchen nach so viel Jahren. Was tue ich in Carolina? Zu sehen gibt es ja nicht viel in dieser einsamen Gegend – kein Dorf, kein reizendes Engadin, keine Postkartenlandschaft, kein Sils-Maria. Hier haben weder Giacometti noch Segantini gemalt.
Carolina ist nichts als eine Station der Rhätischen Bahn, fünf Kilometer von Zernez entfernt, fünf von Cinuos-chel, eine Kreuzungsstation mitten im Wald: zwei auf braunem Schotter schimmernde Geleise, vier Serienhäuser für Bahnangestellte, die heute längst weggezogen sind. Ausser einem Alternativen wohnt niemand mehr da, die meisten Züge fahren vorbei ohne zu halten. Irgendwo ein ausgetrockneter Brunnen, am äussersten Ende des Areals ein Materialmagazin, gleich dahinter die Schlucht und der hohe Viadukt. Im Übrigen ringsum Wald, nichts als Wald.
Jemand hat gesagt, es sei nicht gut, an den Ort seiner Kindheit zurückzukehren. Vielleicht hatte er recht. Ein Wiedersehen, man weiss es, kann enttäuschen, weil unterdessen so vieles geändert hat, die Gegend aussen und die Gegend innen. Die Kindheit, die noch ein Versprechen war, liegt schon weit zurück, eine verdämmernde Traumwelt; und was nachher kam – ein Leben mehr oder weniger fragwürdig, eine Kette von Widersprüchen, Niederlagen und Versäumnissen, fragmentarisch wie alles. Hat man sich überhaupt gekannt? Weiss man, wer man gewesen ist und wer man hätte sein können?
Mit dem Auto kann man nicht bis Carolina hinauffahren, ich habe es unten parken müssen, bei der Landstrasse, wo eine Steinbrücke über den Inn führt. Die gedeckte Holzbrücke von einst ist verschwunden, doch der schmale Weg über dem Ufer ist noch da. Irgendwo geht es über Felsen senkrecht auf den Fluss hinunter. Kein Zaun. Hier nahmen mich die Grossen immer an der Hand. Der Abgrund beeindruckte mich so sehr, dass ich nachts von ihm träumte: ich fiel aus grosser Höhe in die Tiefe, unten rauschte der Fluss, ich fiel endlos, dachte aber dabei, alles sei vielleicht nur Traum und jemand werde mich schon auffangen. Einmal, während ich fiel, hörte ich meine Mutter rufen, worauf ich erwachte. Wenn sich später dieser Fall-Traum wiederholte, wartete ich halb unbewusst auf ihre Stimme.
Ich erreiche die Mündung des Val Tantermozza, steige über den Bach, beziehungsweise über eine Wüste von Steinen und Geröll. Ein Pfad führt den Wald hinauf; irgendwo der schwarze Teich, der zerfallene Kalkofen, Föhrenstämme, Erikablumen, Geruch von Harz und Moos. Oben das Pfeifen eines nahenden Zuges, man sieht ihn über den Viadukt kommen und wieder verschwinden. Dabei ein Gefühl des Déjà-vu, wie eine exakte Wiederholung aus der Kindheit, jedoch ohne Emotion. Empfindungen sind nicht abrufbar; das Magische, das erlebte man damals.
Hier endlich die Lichtung, eine planierte Terrasse am Fuss der Bahnböschung. Unser Haus und das der Nachbarn (reichere Leute, die hier ihre Sommerferien verbrachten), beide verlassen, Türen und Fensterläden geschlossen, weit und breit kein Mensch, keine Stimme, nichts als Vogelgezwitscher.
Ich setze mich auf die kleine Bank unter dem Vordach. Es herrscht schönes Wetter, ein Vormittag Mitte August. Der von einer Mauer eingefasste Vorplatz scheint kleiner geworden, in meiner Kindheit war er riesengross. Jetzt, da niemand hier wohnt, wächst überall Gras, kein getretener Platz mehr, kein Holz, kein Scheitstock, keine Axt. Jemand hat neulich gemäht, am Rande modert ein brauner Grashaufen. Vom unteren Boden, wo Mutter ihren Garten hatte, führen ein paar Steinstufen hier herauf. Ich stelle mir vor, wie ich da als Knirps nach oben kletterte – die Haustüre offen, man sieht in den Flur hinein, zuhinterst die Küche, Mamas Silhouette. Hie und da kam sie heraus, um zu schauen, ob ich noch da sei. Manchmal rief sie nach mir, und zwar nicht mit meinem Taufnamen, sondern mit einem spontan von ihr erfundenen «Kini», was der Kopfstimme besser entgegenkam – «Kiinii!», das hörte man auch von weitem und wurde daher zu meinem eigentlichen Ruf-Namen. Auch die andern nannten mich öfters so, bis ich annahm, dass ich tatsächlich so heisse.
Ich sehe Vater, wie er energisch den Pfad herunter schreitet. Er war Linienarbeiter und Streckenwärter, trug eine Dienstmütze mit Buchstaben dran, oft auch eine blaue, nachthemdähnliche Überziehbluse, die er, weil sie so gross war, hie und da unten aufrollte und am Gürtel befestigte. Er war mittelgross, hatte einen markanten Kopf, dunkles, dichtes und leicht krauses Haar, eine kräftige und gebogene Nase und den forschen Blick des Willensmenschen. Mutter war gleich gross wie er, wirkte aber als Frau grösser, auch korpulenter und stattlicher, was an ihrer Frauenkleidung liegen mochte, vielleicht auch an einer gewissen Vornehmheit ihrer Erscheinung. Auch sie war dunkelhaarig, eine schöne Frau mit blaugrauen Augen und einem offenen Gesicht.
Es war mir nicht gleich, wer von beiden mich auf dem Arm hielt. Bei Mama war mir wohl, ihre Arme waren dick und weich, man fühlte sich darin geborgen; bei Vater störte mich die Härte seiner Hände, oft auch die Bartstoppeln, der Schnauz, die Uhrkette an meinen nackten Füssen.
Morgens und abends hatte er seine Streckenkontrolle. Wenn er gegen Abend wegging, sah man ihn oben über den Viadukt schreiten. Er trug ein Futteral mit den Signalfahnen wie ein Gewehr an der Schulter, in der Hand die Karbidlampe. Mutter nahm mich auf den Arm, öffnete das Fenster und rief huhuu!, worauf er stehen blieb und winkte. Manchmal trug er auch dort seine nachthemdähnliche Überziehbluse, sie flatterte, dabei schien mir, als könnte er auf einmal vom Wind davongetragen werden.
Der Bahnhof auf dem höher gelegenen Trassee ist von hier kaum mehr sichtbar, weil unterdessen an der Böschung Bäume gewachsen sind, ein Dickicht jugendlicher Tannen und Lärchen. Früher sah man oben die beiden Häuser, wo die Kochs und die Müllers wohnten – die Kochs mit zehn, Müllers mit zwölf Kindern. Man sah Holzstapel, einen abgestellten Güter- oder Viehwagen, einen Gartenzaun, eine Wäscheleine mit flatternden Tüchern, Rauch aus einem Kamin.
Im Sommer, dank Farben und Geräuschen, war der Ort noch einigermassen belebt. Ich konnte mit meinen zwei oder drei Altersgenossen spielen, gelegentlich sah man auch Bahnarbeiter. Im Winter war alles verwandelt. Draussen lag Schnee, oft meterhoch, kein Weg mehr, kein Laut, die Tannen, weiss verhangen, schwiegen wie im Märchen. Morgens sah man oben die Schüler, die auf den Zug nach Zernez warteten, etwa fünfzehn Knaben und Mädchen, alle mit Schultasche, dickem Pullover und Wollmütze. Man sah Koch, den kleinen Stationsvorstand, wie er die Signalkelle hochhielt, den Lokführer am Fenster seiner Maschine, an den Leitungsdrähten ein violettes Blitzen. Und wenn der Zug vorbei war, wieder Schatten, Frost, Winterstille.
Mittags blieben die Schüler in Zernez. Die Kochs und meine zwei älteren Brüder assen bei Bekannten oder Verwandten; die Müllers, Kinder der grössten der drei Familien, nahmen ihre Mahlzeit am Bahnhof ein, und zwar im Güterschuppen. Ihre Mutter übergab dem Zugsschaffner einen Korb mit dem Essen, in Zernez nahm ihn der Stationsvorstand in Empfang und behielt ihn in seinem warmen Büro, bis sich mittags die Schar meldete. Der geheizte Warteraum kam als Esslokal leider nicht in Frage, und so blieb ihnen nur der kalte Schuppen.
Hier zuoberst am Hang das Materialmagazin, ein kleiner Holzbau mit rostigem Blechdach, in dem die Eltern damals den Fremden übernachten liessen. Eines Abends spät klopfte jemand ans Fenster, sie gingen hinaus, vor der Türe stand ein zerlumpter Mann, braunhäutig und kraushaarig, mit fremdländischem Gesicht. Er sagte etwas in einer Sprache, die sie nicht verstanden. Nach einigem Zögern liessen sie ihn hereinkommen, Mutter tischte etwas auf, wärmte einen Rest Kaffee. Er schien ausgehungert. Er hatte dicke Lippen, dunkelbraune, fiebrig schimmernde Augen. Vater zeigte ihm, wie man Butter aufs Brot streicht. Er nahm das Butterbrot und ass, sagte dann etwas, das vielleicht «danke» bedeutete. Natürlich keine Rede von Deutsch oder Romanisch, er schüttelte nur den Kopf. Vater versuchte es mit den Überresten seines Sekundarschulfranzösisch, worauf der Fremde immerhin lächelte, als hätte er so etwas auch schon gehört. Seine eigene Sprache klang merkwürdig rau, er versuchte etwas zu erklären, zeichnete dabei mit dem Finger auf den Tisch. Man verstand nur ein paar Namen – Casablanca, Tunis, Italy, Triest –, vielleicht Wegzeichen seiner Reise. Dann fügte er hinzu: «Deserteur – Francia.»
Sie beschlossen, ihn oben im Magazin schlafen zu lassen. Mama hatte zuerst an die Couch in der Stube gedacht, doch Vater wollte nicht – man konnte nie wissen. Da der Fremde nebst einem Halstuch nur Lumpen und zerschlissene Sandalen trug, holte man ihm Hosen und Schuhe von Vater. Die Hosen waren ein bisschen zu kurz, worüber er lachen musste. Er hatte blendende Zähne. Es waren Vaters ehemalige Militärhosen, auf die er verzichten konnte, doch die Schuhe wollte er unbedingt zurückhaben, sie waren noch relativ neu, Bergschuhe mit Gummisohlen; man gab sie dem Mann nur für heute, weil es draussen regnete. Die Eltern versuchten, es ihm mit Zeichen verständlich zu machen. Er nickte. Vater führte ihn die Böschung hinauf, wahrscheinlich hatte er die Karbidlampe dabei, die er jeweils in den Tunneln brauchte, dazu zwei Wolldecken. Im Magazin zeigte er ihm eine Ecke, wo man bequem schlafen konnte. Als er herunterkam, hatte Mutter einen alten Rucksack mit Proviant gefüllt, so dass er nochmals hinauf musste.
Später machte er sich Sorgen um seine Schuhe, bereute es, ihm nicht die ganz alten gegeben zu haben. Er sprach noch im Bett darüber, wäre vielleicht noch einmal hinaufgegangen, doch Mutter meinte, jetzt könne er ihn nicht mehr stören, der arme Teufel sei sicher todmüde.
Am nächsten Morgen früh, als Vater vor seiner Linienkontrolle die Magazintüre öffnete und hineinschaute, war der Fremde nicht mehr da. Vielleicht Angst vor der Polizei. Die beiden Wolldecken lagen sauber zusammengelegt auf einer Kiste, der Rucksack und die Schuhe waren weg.
Wie sich später herausstellte, war der Mann, als morgens der erste Zug talaufwärts fuhr, unter einen Waggon gekrochen und so, zwischen Achsen und Eisenstangen bis ins Oberengadin gelangt, dann irgendwo heruntergefallen und neben dem Geleise liegen geblieben. Man brachte ihn ins Spital von Samaden. Vater musste hin, um ihn zu identifizieren. Jemand führte ihn in ein Zimmer, wo der Verletzte in einem Bett lag, an Kopf und Armen verbunden. Er erkannte ihn sogleich – sein braunes Gesicht, das gekräuselte Haar, die Augen mit dem Wüstenglanz. Ein Arzt war anwesend, eine Krankenschwester, dazu zwei Polizisten. Als der Fremde etwas murmelte, fragte man Vater, was er gesagt habe. Er wusste es so wenig wie sie, wahrscheinlich sei es Arabisch. Wieso Arabisch? Weil er gestern etwas von Tunis und Casablanca gesagt habe, das sei doch dort unten.
Die Leute fragten sich, ob in der Gegend jemand zu finden wäre, der Arabisch konnte, vielleicht ein St. Moritzer Feriengast. Einer der Polizisten machte ununterbrochen Notizen. Vater blickte sich um. Der Rucksack war nirgends zu sehen, der lag vielleicht noch irgendwo auf der Bahnlinie; doch auf einer Stuhllehne sah er seine Militärhosen, unter dem Stuhl seine Bergschuhe mit den Gummisohlen. Er war nahe daran, den Leuten zu erklären, dass die eigentlich ihm gehörten und dass er sie mitnehmen möchte – schliesslich hatte er sie dem Mann nicht geschenkt; doch er konnte sich nicht entschliessen, wollte vielleicht nicht als mieser Kerl erscheinen, der einem Unglücklichen etwas wegnimmt, und so verabschiedete er sich und ging davon.
Sonst waren Besucher selten. Gelegentlich eine italienische Hausiererin, die sogar in Carolina Halt machte und die uns, wenn niemand zu Hause war, die frischen Eier aus dem Hühnerschlag klaute. Hie und da der Bahnmeister Riffel, Verantwortlicher für den Liniendienst, ein grosser, hagerer und grundehrlicher Mann, der nur vorbeikam, um mit meiner Mutter zu plaudern. Dass er deshalb kam, wusste ich damals noch nicht; ich sah nur, wie er in seiner Bähnleruniform am Tisch sass und Kaffee trank, während Mutter Wäsche bügelte.
Dann ab und zu der Jagdaufseher, um zu schauen, ob nicht gewildert wurde. Wild gab es in Hülle und Fülle, vor allem Rehe und Hirsche, die nachts in unsere Gärten sprangen, den Salat frassen und das je nachdem mit dem Leben zahlten. Jemand fällte verbotenerweise die schönsten Bäume, bis ihn der Förster Renold heimlich fotografierte, gerade während der Baum fiel; später kam er und hielt dem Frevler lächelnd das Foto unter die Nase, zeigte ihn aber nicht an. Man sagte, dass solche Spielereien zu ihm passten, weil er überhaupt gerne spielte – mit Foto- und Filmapparaten, mit Geld, mit den Leuten, vor allem auch mit Frauen. Er spielte auch glänzend Theater, das heisst in Zernez, wo er zu Hause war und wo ein reges Dorfleben herrschte. Carolina war leider kein Dorf, hier gab es nur den Wald, den Viadukt, am Himmel kreisende Raubvögel, meines Vaters Handharmonika, meine zwei oder drei Gespielen und die vorbeifahrenden Züge.
Wenn sie von Westen kamen, wo die Bahnlinie schnurgerade verlief, schienen sie fast stillzustehen, waren dann plötzlich da, hielten an oder fuhren vorbei. Auf der unteren Seite, jenseits der Schlucht, drangen sie aus einer Felsschneise und kamen über den Viadukt daher. Das Nahen der Züge vernahm man auch im Haus. Ich rannte ins Freie, sah oben die Wagen vorbeigleiten. Es kam vor, dass mir jemand zuwinkte. Ein Fräulein mit blonden Haaren und rotem Béret warf mir einmal eine Schokolade herunter. Tagelang wartete ich vergebens, dass die hübsche Person wieder erscheinen würde.
Geheimnisvoll, fast unheimlich, war der Lokführer, der vorne in der Maschine stand und steif wie ein Zinnsoldat geradeaus schaute. Manchmal, wie gesagt, hielt der Zug gar nicht, eilte dahin mit einem langgezogenen Pfeifen – es widerhallte durch die Gegend wie der Schrei eines geplagten Geistes. Ich stellte mir dann vor, dieser Geist wäre der Lokführer selber, ein zum Dahinrasen Verdammter, der nie zur Ruhe kam. Oder vielleicht ein Zauberer, Bewohner dieser dunkelroten Lokomotive. Mich beeindruckte vor allem die Vorderseite der Maschine, weil sie mit ihren zwei Fenstern oben, einer runden Lampe dazwischen und zwei auseinanderliegenden Lampen weiter unten genau einem menschlichen Gesicht ähnelte.
Einmal, als der Zug hielt und die Lokomotive gerade in meiner Nähe zum Stehen kam, liess der Mann (vermutlich immer derselbe) das Seitenfenster herunter und schaute heraus. Sein Gesicht kam mir ungewöhnlich vor, auch die Art, wie er in diesem schmalen Fenster eingeklemmt schien, den Kopf senkte und zu mir herabschaute, wobei ihm eine Haarsträhne in die Stirn fiel. Er hatte sehr dunkle Augen, und als er mich fragte, wie ich heisse, brachte ich kaum mein «Kini» aus der Kehle. Der Zauberer!, dachte ich, wahrscheinlich war er das ... Als der Zug langsam weiterfuhr, schaute er nach wie vor zu mir herab, schaute zurück statt nach vorn, lächelte und winkte leicht mit der Hand.
Ueli, Richard und Johanna waren mit mir die Kleinsten der drei Familien. Oft spielten wir auf der Fahrbahn, am liebsten beim Magazin, unmittelbar vor der Brücke. Wir legten rostige Nägel aufs Geleise, um zu schauen, wie sie platt gedrückt wurden. Wenn es vorne beim Bahnhof klingelte, wussten wir, dass bald ein Zug kam. Wir drückten das Ohr auf eine der beiden Schienen, vernahmen ein leises Klopfen, das sich langsam näherte, dann ein Brummen aus dem Erdinnern. Wir horchten mit wachsendem Kitzel, und wenn jenseits der Brücke plötzlich die Lokomotive sichtbar wurde, sprangen wir die Böschung hinab, pissten dabei fast in die Hosen. Ich sehe noch Johanna, wie sie mit nacktem Hintern im Gras kauert.
Brücken ... Ich staune über ihre Eleganz, vor allem über ihre Dauerhaftigkeit. Sie wurden anfangs des letzten Jahrhunderts gebaut, sind also hundert Jahre alt und halten noch immer. Es gibt eine in der Nähe von Cinuos-chel, direkt vor einem Tunnel, bei deren Bau zwölf Menschen ums Leben kamen – Fremdarbeiter, alles Italiener. Das Baugerüst, eine gewaltige Holzmasse, hatte sich plötzlich ein bisschen seitwärts geneigt; elf Männer standen darauf, jemand hatte einen Schrei ausgestossen. Ich stelle mir die schattige Schlucht vor, Felsen und Bäume, ganz oben vielleicht noch etwas Sonne, unten ein kleiner Bach. Man rät dem Bauführer, die Männer so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, doch der Mann, ebenfalls Italiener, behauptet stur, es fehle nur der letzte Stützbalken in der Mitte. Da niemand mehr den Mut hat, aufs Gerüst zu steigen, beauftragt er damit seinen vierzehnjährigen Sohn. Der zögert, doch als ihn der Alte anbrüllt, nimmt er den Balken auf die Schulter und schreitet auf einem Brett vorsichtig hinüber. Vermutlich herrscht Totenstille, nur unten das Geräusch des Baches, bis es irgendwo knarrt; dann beginnt sich alles langsam zu neigen und donnert mit Lärm und Getöse in die Tiefe. Nachher wieder Stille ... Am Eingang des Tunnels steht im Felsen eine Marmorplatte mit den Namen der Verunglückten. Auch der Name des Bauführers ist dabei, obwohl der nicht hinuntergestürzt war, sondern noch am selben Abend Selbstmord begangen hatte.
Ich schaue zum jenseitigen Talhang hinüber, wo es wenig Wald gibt, dafür Wiesen und Weiden. Auf der Landstrasse, die sich durchs Gelände dahinzieht, fahren Autos vorbei, geräuschlos wie in einem Stummfilm.
Eine Weile befinde ich mich auf dem Viadukt. Er ist sehr hoch, unten schlängelt sich der Bach durch Sand und Geröll, die Riesenschlucht mit einem vage-monotonen Geräusch füllend. Ohne dieses Eisengeländer könnte es einem leicht schwindeln. Es wurde uns Kindern eingeschärft, den Viadukt niemals zu betreten. Einmal war ich trotzdem mit Ueli Müller da oben, die Versuchung war zu gross. Wir sahen den Abgrund, die Brückenpfeiler; im Übrigen passierte nichts, es kam auch kein Zug. Wir begannen, Steine hinunterzuwerfen; zwischen den Geleisen gab es deren genug, Steine grösser als unsere Hände. Wir versuchten, den Bach zu treffen, was wegen der Höhe nicht leicht war. Dann schauten wir, welcher Stein zuerst unten ankam, der meine oder der seine, dabei neigten wir uns über die untere Geländerstange hinaus und blickten in die Tiefe. Von Schwindel keine Spur. Wir sahen nichts als das Spiel, bemerkten weder den Zug, der jenseits der Brücke daherkam, noch meine Mutter, die sich uns von hinten näherte. Ich weiss nur noch, wie wir plötzlich gepackt und davongetragen wurden, wie sie mit uns über die Brücke rannte, von Pfeifsignalen begleitet. Drüben schwenkte sie seitwärts ab, fiel mit uns ins Gras, blieb dort liegen und hielt uns fest, bis der Zug vorbei war.
An jenem Abend, als ich im Bett lag, versuchte sie, mir ein Dankgebet beizubringen. Ich konnte zwar meinen kleinen Vers, den ich allabendlich hersagte. Dieses Gebet war der Situation angepasst. Sie erklärte mir, der liebe Gott habe uns gerettet. Vielleicht stimmte es, wer weiss. Natürlich ist man nie sicher, man kann’s nicht beweisen, doch jedenfalls wurde man irgendwie beschützt, sonst wäre man nicht mehr da – vom lieben Gott oder vom Zufall oder von den Eltern, die unterdessen längst gestorben sind ... Unsere Versuche, in die Vergangenheit zurückzuschauen: Zum Beispiel abends die Petrollampe über dem Tisch, Nachtessen bei Dämmerlicht. Wenn es Vater nicht hell genug schien, zündete er seine Karbidlampe an. Die Flamme war gelblich und dicht, es verbreitete sich ein ätzender Geruch, den ich gern hatte. – Erst als wir schon einige Zeit in Carolina wohnten, wurde das elektrische Licht installiert. Freudenschrei, als der Monteur mit der Arbeit zu Ende war und jemand den Schalter herumdrehen durfte; das ganze Haus, die Zimmer schienen wie verwandelt. Doch eines Abends, als Vater nicht da war und wir mit Mutter allein am Tisch sassen, stand sie einmal auf, löschte das elektrische Licht und zündete die alte Petrollampe an. Auf unsere Frage, warum sie das mache, antwortete sie, wir müssten Strom sparen.
Oder der kleine Brunnen an der unteren Hausseite, der jeden Winter zufror, das gedämpfte Gurgeln, das Spiel des Wassers unter dem Eis.
Oder Val Verda, eine halbe Stunde von hier entfernt, eine Waldlichtung, wo wir im Sommer die Ziegen hüteten, etwa zwanzig Ziegen und fast ebenso viele Hirten und Hirtinnen. Genau genommen hüteten wir sie nicht, wir assen und spielten, während sich die Tiere unbeachtet entfernen, immer bergwärts, die Kühle suchend, kletterfreudig im Gebirge umherschweifend, wie die Ziege des Monsieur Seguin. Einmal fanden wir sie nicht mehr und kehrten abends ohne sie zurück, worauf der gutmütige Vater Müller die Tiere mit der Lampe suchen ging und sie um Mitternacht nach Hause brachte.
Liebenswürdigkeit der Müllers. Ihr Rheintaler Dialekt, wenn die Kinder mit den Eltern redeten, die nicht Romanisch konnten. Das überfüllte Haus, vierzehn Personen, die etwas muffige Luft. In der Küche der lange Esstisch, an dem jedoch kaum alle Platz hatten, doch sie waren es gewohnt, auf engem Raum miteinander auszukommen; oft mussten die Kleineren warten, bis die Grossen gegessen hatten und einige Plätze freigeworden waren. Die erwachsenen Söhne spielten miteinander Ländlermusik, oft auch vor dem Haus, sodass es abends vom Wald zurücktönte. Manchmal nahm dann Vater seine Harmonika und ging zu ihnen hinauf. Ihr Familiensinn. Paul zum Beispiel, der sich als Jüngling vornahm, die Schulden seiner Eltern zu bezahlen; es gab im Estrich einen ominösen Holzkoffer voll unbezahlter Bäcker- und Ladenrechnungen; von Zeit zu Zeit kamen Reklamationen. Er war eben der Schule entlasssen, ein Sechzehnjähriger, der jetzt aus eigener Initiative Waldakkorde übernahm, ein paar Leute anheuerte, unermüdlich schuftete, Geld zusammensparte und daranging, die Familienschulden abzutragen, eine nach der andern, bis sie nach Jahr und Tag alle getilgt waren.
Ich denke an die Raubvögel, die aus ihren Waldungen aufstiegen und über Carolina kreisten, auf unsere Hühner erpicht, vermutlich Sperber oder Habichte – schöne, braun und grau schimmernde Vögel, hie und da ihr heiserer Schrei. Solange sie Menschen sahen, blieben sie oben, doch oft waren die Hühner allein, dann schossen sie blitzschnell herunter und machten einem von ihnen den Garaus. Nachher fand man nur die Federn. Wenn Raubvögel in der Luft kreisten, holte Koch, der Stationsvorstand, eine grosse Pistole aus dem Haus, zielte in die Höhe und gab ein paar Schüsse ab. Ich weiss nicht, ob er je einmal getroffen hat. Jedenfalls verschwanden die Vögel, aber sie kamen immer wieder; vermutlich hatten sie sich an die Knallerei gewöhnt. Ein Habicht hatte sich an eine unserer Hennen herangemacht, mittags, während wir drinnen assen; grosse Aufregung im Haus, Vater schoss mit dem Jagdgewehr zum Fenster hinaus, traf aber leider das Huhn, während der Raubvogel mit schweren Flügelschlägen über die Baumwipfel davonflog.
Unsere beste Eierlegerin war spurlos verschwunden, wir fanden nicht einmal die Federn. Mutter trauerte ihr nach; doch eines Tages, während sie im Freien Wäsche aufhängte, erschien die Henne aus dem Wald und kam gluckend die Wiese herauf, gefolgt von einer Schar weisser Kücken.
Hie und da sah man einen Adler. Auch er kreiste geduldig über unseren Häusern, meistens abends nach Sonnenuntergang, wenn wir unten bereits im Schatten lagen und er oben noch im rötlichen Licht. Wir staunten, wie lange er kreisen konnte, ohne ein einziges Mal die Flügel zu bewegen.
Ich denke an Grass, den Fotografen aus Zernez, der uns hier vor dem Haus fotografiert hat. Das Foto besitzen wir noch immer. Mich, den Kleinsten, hat man auf ein Tischchen gesetzt, die Geschwister stehen daneben, geputzt, gekämmt, die beiden Brüder mit dem Sonntagspullover, die Schwester mit zwei festgedrehten Zöpfchen. Die Geschwister würde man auf dem Bild leicht erkennen, mich wahrscheinlich noch nicht – zweieinhalbjährig, ich käme jedenfalls kaum darauf, dass ich das selber bin, mit diesen Locken, einem weichen, noch traumbefangenen Kindergesicht. Unser Jüngster fehlt noch; der kam erst Jahre später zur Welt, hat unterdessen gelebt und ist bereits wieder gegangen, so wie auch die andern drei. Schade, dass die Eltern auf diesem Foto fehlen. Es wäre eine Gelegenheit gewesen, wenigstens einmal alle zusammen auf ein Bild zu bringen. Doch Vater wird in seinen Tunneln gewesen sein, Mama wird beiseite gestanden haben, um zu schauen, wie Grass seinen Apparat einstellte und fotografierte. An sich selbst dachten sie kaum.
1933 zogen wir von Carolina weg. Es war Ende April, es schneite ein bisschen, leichter Flockentanz wie oft im Frühjahr. Ich hatte zum Geburtstag neue Schuhe bekommen, deren Lederduft mich bezauberte. 1933 – ein berüchtigtes Jahr, nur wusste man in jenem Alter noch nichts von Politik und Weltgeschichte. Wir lebten unbehelligt von einem Tag zum andern, wir hatten genug zu essen, wir wurden nie vertrieben, wir mussten nie fliehen. Als wir den Ort verliessen, geschah das friedlich, und man hatte Zeit genug, alles sorgfältig einzupacken. Nachdem unser Hausrat weg war und wir hier die Türe zumachten, hörten wir deutlich, wie es innen widerhallte. Meine Schwester und ich waren mit der Mutter als letzte hier geblieben; ich weiss nicht, warum Mutter zögerte, nochmals öffnete und in den verdunkelten Flur hineinschaute.
Unterdessen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, andere Leute sind hier eingezogen und später wieder fortgegangen. Nun ist das Haus nicht mehr bewohnt, Türen und Läden geschlossen. Schade, dass man nicht durch ein Fenster in die Stube hineingucken kann, oder durch jenes andere in die Küche. Es wäre ein flüchtiger Blick in den rätselhaften Raum der Vergangenheit. Geschlossen auch der kleine Stall dort, wo wir unsere Ziegen unterbrachten. Eine von ihnen war gemsrot, eine andere (die «Toggenburgerin») war braun, eine hell und dunkel gefleckt. Hedi, die hörnerlose, war ganz weiss; sie mochte ich am liebsten, und es schien mir, sie rieche geradezu nach Milch.
Es gibt Erinnerungen, die mit einer gewissen Regelmässigkeit wiederkehren, andere scheinen für immer gelöscht. Doch es kommt vor, dass etwas plötzlich wieder auftaucht, wie die Tigerkatze mit den grünen Augen, die einen Sommer lang verschwunden blieb und dann unerwartet zurückkam, einen Tag vor Wintereinbruch.
Da oben die Bahnlinie, eben geht ein Zug vorbei, ohne zu halten. Man sieht die Strombügel der Lokomotive, die Dächer einiger Wagen, die Böschung dämpft das Geräusch. Sonst ist nichts zu hören als weit unten der Fluss, den man von hier nicht sieht. Die Lärchen sind noch hellgrün, einige Wipfel werfen ihre Schatten über den Vorplatz, am Himmel ein paar leichte Wolken.
Dass etwas einmal war und dass es jetzt nicht mehr ist, kommt uns oft merkwürdig vor. Wir achten nur nicht immer darauf, weil die Zeit geräuschlos vergeht, und weil das ihre uralte Gewohnheit ist, zu vergehen.
Mutters Eigenwille
Immer wieder die Frage: bis wohin reicht das Gedächtnis zurück, diese mysteriöse Fähigkeit, längst Vergangenes von innen her zu sehen. Manches hat sich schon in der Kindheit verankert, wenn auch nur schemenhaft. Oft bin ich nicht sicher, ob etwas Erinnerung ist oder blosse Imagination. Zum Beispiel wie ich im Bettchen liege, wie die Türe aufgeht und meine Mutter lautlos neben mir erscheint, wie sie mit mir redet – wobei ich, im vorsprachlichen Stadium, ihre Worte vermutlich nur als freundliches Gelalle wahrnehme.
Das war noch in Carolina, dessen Welteinsamkeit mich möglicherweise für immer geprägt hat. Kaum zu ermessen, wie sehr Umwelten an uns hängen bleiben. Schon die Mutter selber war eine Umwelt. Ich sehe noch, wie sie mich morgens vom Bett holt, mich auf den Arm nimmt, mit mir in die Stube geht und regelmässig vor den Spiegel tritt. Für sie wahrscheinlich ein heiterer Tagesbeginn, während ich selbst den Spiegel nicht mochte und mir das Gesicht verhüllte. Nachher stand sie mit mir am Fenster.
Ich war noch im Nachthemd, sie selber noch im Schlafrock und mit gelöstem Haar. Sie spazierte mit mir auf dem Arm in der Stube umher; wenn ich kalte Füsse hatte, setzte sie mich auf einen Stuhl, sie selber setzte sich nahe vor mir und nahm meine Füsse, um sie zu wärmen, zwischen ihre Beine. Ich hatte das nicht gern, etwas sträubte sich dagegen, so sehr ich sonst ihre Nähe suchte. Nachts zum Beispiel war ich glücklich, neben ihr zu schlafen und noch im Schlaf ihre Wärme zu spüren. Es bekümmerte mich, wenn ich morgens erwachte und statt ihrer meine Schwester oder einer meiner Brüder neben mir lag. Nächtliche Bettwechsel gab es immer wieder, umständehalber oder weil eines der Grösseren unerwartet auch zur Mutter ins Nest kroch und sie ihn dann nicht vertreiben wollte; nur war für drei zu wenig Platz vorhanden, weshalb sie, sobald der Zuzüger eingeschlafen war, das eigene Bett verliess und im freigewordenen weiterschlief.
Bevor Johann, unser Jüngster, zur Welt kam, genoss ich acht Jahre lang das Privileg des Nestkückens. Vielleicht der Grund einer starken Mutterbindung. Ich frage mich, ob mir aus dieser Bindung nicht sogar Eigenschaften erwachsen sind, die man sonst als erblich bezeichnet, während sie vielleicht durch lange leibliche und seelische Nähe einfach übertragen wurden – in meinem, beziehungsweise unserem Fall eine gewisse Schwerblütigkeit, Stimmungsschwankungen, Wechsel zwischen Geselligkeit und Einsamkeit, gelegentliche Gesellschaftsflucht, Festtagsallergien, Müdigkeit am Morgen und Aufleben bei Nacht. Vielleicht sogar gewisse nervlich bedingte Herzschwächen bei Bise oder Föhn.
Wenn sie hie und da auf Reisen ging, nahm sie mich mit, wobei ich mich schon als Kleiner daran gewöhnt hatte, dass wir fast immer den ersten Zug verpassten. Ich weiss nicht, ob sie nicht auf die Uhr schauen konnte oder ob sich in ihr irgendetwas gegen Uhren und Fahrpläne sträubte. Vielleicht wusste sie schon im voraus ganz genau, dass wir den ersten Zug verpassen würden. Sie hatte ihren eigenen Rhythmus, vor allem eine für sie offenbar lebensnotwendige Morgenlangsamkeit, war dann auch eigenwillig genug, sich von der Welt nichts aufzwingen zu lassen. Eine Hoteldirektorin in St. Gallen, bei der sie einst als erwachsenes Mädchen angestellt gewesen war, soll ihr einmal gesagt haben: «Du hast einen Kopf, und der gehört dir!»
Unsere Reisen fanden meistens an Sonntagen statt. Manchmal gingen wir nach Sent zu ihrer jüngeren Schwester Hermina. Falls wir ausnahmsweise den ersten Zug erwischt hatten, konnten wir in Scuol das Postauto besteigen, das auf uns wartete, durch die Ortschaft fahren und uns dann in sanften Kurven bergwärts tragen lassen. Hinter uns blieb eine Staubwolke zurück, die Strasse war von Bäumen gesäumt. Bei schönem Wetter war das Autodach geöffnet, dann huschten grüne Laubkronen über uns hinweg ... Doch wenn wir erst den zweiten Zug benützt hatten, gab es kein Postauto, dann stand uns ein langer Marsch bevor; zuerst das langgezogene Scuol mit Hotels, Läden und Schaufenstern, und wenn wir die Ortschaft endlich hinter uns hatten, erklärte sie: «Jetzt haben wir schon fast die Hälfte.» Ich widersprach nicht, obwohl ich wusste, dass es nicht stimmte. Kurz nach dem Dorfausgang gab es oberhalb der Strasse eine schwefelhaltige Mineralquelle. Wir gingen hinauf, man konnte eine Röhre nach unten drücken, worauf das Wasser kam. Ich fand es scheusslich, trank aber trotzdem, weil es gratis war und weil Mutter erklärte, das fördere den Appetit für das herrliche Mittagessen, das uns in Sent erwarte. Nachher ging es den Berg hinauf, Kurven hin und her, Naturstrasse, am Rande die staubige Böschung, graue Wermutsträucher, Disteln und Grillengezirp. Sie musste mich ein bisschen ziehen und immer wieder aufmuntern. Irgendwo sah man auf dem Berg endlich das Dorf, eine kompakte Häuserkulisse im blauen Himmel, aber noch unendlich fern. Man sah den schlanken Turm, vernahm etwas Glockengeläute. Irgendwo machten wir eine Pause, sie nahm ihr Taschentuch, benetzte es mit Speichel und putzte irgendeine Stelle an meinem Gesicht. Doch unsere Ankunft in Sent, das Haus der Verwandten, die Begrüssung und das herrliche Mittagessen, mit dem sie mir den Marsch schmackhaft gemacht hatte, das ist weg, vergessen, ausgelöscht, als wären wir nie in Sent angekommen. Es bleibt nur Mama, die Mühsal und der unendliche Weg.
Ich denke an jene Reisen mit ihr, an den Knirps, den sie an der Hand mitzog, frage mich, ob das schon die gleiche Person war wie diejenige, die sich jetzt zu erinnern versucht.
Sie nahm mich wie gesagt immer mit. Erstens war niemand zu Hause, um mich zu hüten, zweitens gab ihr meine Begleitung vielleicht eine gewisse Sicherheit. Sie war zwar eine starke Persönlichkeit, doch kann ich mir vorstellen, dass bei längeren Reisen eine leichte Weltbangigkeit mitging und dass sie dann froh war, sich an mir festhalten zu können. Chur zum Beispiel war schon sehr weit weg. Die Reise nach Chur war schon deshalb aufregend, weil es nach Bever, wo man umsteigen musste, durch einen langen Tunnel ging. Wenn man jenseits herauskam, schien die Welt irgendwie verändert. Zuerst noch Wald und Felsen, doch bald gelangte man in sanftere Täler hinab, die im Gegensatz zum noch winterlichen Engadin schon grün schimmerten. Man sah ganze Haine weiss blühender Obstbäume, die meine Mutter zu Freudenausrufen bewegten. Unter einer hallenden Metallbrücke strömten zwei Flüsse zusammen, um dann gemeinsam weiter zu ziehen. Merkwürdig schien mir, dass wir, nachdem es zuerst immer westwärts gegangen war, auf einmal wieder nach Osten fuhren, und ich fürchtete, wir könnten, trotz der veränderten Gegend, wie durch Zauberei plötzlich wieder zu Hause ankommen.
In Chur wohnten die Grosseltern väterlicherseits, zudem ein Onkel und eine Tante. Bei Grossmutter Berta kam einem ein bestimmter Hausgeruch entgegen, den ich jedesmal wieder erkannte – unten duftete es nach Waschküche, zwei Treppen weiter oben nach Gasherd. Wir betraten jeweils die Wohnung ohne zu läuten, weil nona schwerhörig war und das Läuten gar nicht gehört hätte. Hinter dem Glas der Küchentüre sah man ihren Schatten. Mutter klopfte, öffnete dann vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Wenn man sich mit ihr unterhielt, musste man sehr laut reden. Ich fand es merkwürdig, dass sie dann selber ebenfalls laut redete, als wären alle taub. Wenn man sass, bediente sie sich eines hornartigen Geräts, das sie sich ans Ohr hielt und in dessen muschelartige Öffnung man hineinreden musste.
Im Gegensatz zu allen andern Verwandten war sie blond und bleich, im übrigen auch die einzige Katholikin in der Familie. Zu Hause unterhielt man sich oft darüber, dass sie von Zeit zu Zeit Erscheinungen hatte, fragte sich, ob das mit ihrer Schwerhörigkeit zusammenhängen könnte. Ihr Mann, Grossvater Andri, glaubte nicht daran, weil sie nämlich schon früher Visionen gehabt hatte; er war überzeugt, die Sache habe etwas mit ihrem katholischen Glauben und ihrer Religiosität zu tun – sie denke zu viel ans Jenseits und an die Toten, und dann kämen sie eben. Hie und da, etwa bei Tisch, konnte es geschehen, dass sie plötzlich erschrak, das Besteck fallen liess, verwirrt ins Leere blickte und hastig flüsterte: «Schau da! Schau da! Habt ihr gesehn?» Das Ganze dauerte nur ein paar Sekunden, dann war der Spuk vorbei. Nachher schien sie noch blasser als sonst. Sie hatte jemanden gesehen, der zur Türe hereinkam, etwas im Küchenschrank suchte und dann durch die Mauer verschwand. Sie erkannte die Person nie genau, manchmal war diese wie durchsichtig, doch sie war überzeugt, es handle sich um ihre Tochter Chatrina, die mit dreiundzwanzig Jahren gestorben war. «Mein böses Gewissen», sagte sie. Sie dachte an damals, als Chatrina mit Lungentuberkulose darniederlag und sie selber ihre Tochter, aus Angst vor Ansteckung, durch jemand andern pflegen liess und nicht einmal in der Nacht ihres Todes bei ihr blieb – aus purer Feigheit. Dafür hatte sie jetzt ihre Heimsuchungen, die sie, wie sie behauptete, manchmal schon eine Weile vorher kommen spürte. Wenn sie dann plötzlich aufhorchte und zur Türe starrte, fragte Grossvater ganz ruhig, die Suppe löffelnd: «Kommt sie wieder?»
Grossvater Andri war ein grosser, starker Mann, damals in Chur als Bauarbeiter tätig. Bei ihm sah ich übrigens zum ersten Mal im Leben ein Grammofon. Er führte mich in die Stube, holte ein Köfferchen herbei, öffnete es, nahm eine schwarz schimmernde Platte mit feinen Rillen aus einer Papierhülle und legte sie auf den beweglichen Teller des Apparates, drehte an einer Kurbel, bewegte einen mit einer dünnen Nadel versehenen Metallarm, senkte ihn vorsichtig auf die Platte herab. Eine Weile vernahm man ein kratzendes Geräusch, dann plötzlich Ländlermusik – jene Musik, die ich von zu Hause kannte, wenn Vater mit den Müllers spielte – doch hier tönte sie aus diesem kleinen Kasten, was für mich an Zauberei grenzte. Grossvater schaute mir ernst nickend ins Gesicht, wie jemand, der tatsächlich zaubern kann. «Siehst du?», sagte er. «Hörst du die Klarinette und die Bassgeige? Und die Handorgel, das ist dein Vater! Die sind jetzt alle da drin!» Ich staunte, konnte mir nicht erklären, wie die Männer in diesem Köfferchen Platz hatten und noch so gutgelaunt aufspielten. Nach einer Weile jedoch, während sich die Platte drehte und es drauflos ländlerte, akzeptierte ich das Unglaubliche als etwas Naturgegebenes. Zuletzt schien alles möglich. Als die Musik zu Ende war und es wieder kratzte, legte Grossvater die Platte auf die andere Seite, dann kam ein neues Stück, und diesmal glaubte ich, meinen Vater noch viel deutlicher herauszuhören.
Am nächsten Tag hätte ich die Musik gern nochmals gehört, doch mittags schien Grossvater schlechtgelaunt, und abends warteten wir vergebens mit dem Nachtessen auf ihn. Grossmutter Berta schien besorgt. Da er nicht kam, assen wir allein. Als später eine meiner Cousinen (sie war ein Jahr älter als ich) auftauchte, schickte man sie zu einem nahe gelegenen Wirtshaus, um nachzuschauen, ob der «Neni» dort sei. Sie eilte davon, kam bald wieder wie ein Sturmwind zur Türe herein und meldete ausser Atem, er sei tatsächlich dort, man höre ihn bis auf die Strasse heraus. Nona Berta forderte sie auf, so rasch wie möglich ihre Mutter zu holen, die Cousine rannte wieder davon, etwas später erschienen sie beide. Es wurde diskutiert, was zu tun sei. Meine Mutter, tapfer wie sie war, anerbot sich, in jene Beiz zu gehen und den Grossvater nach Hause zu bringen, doch wurde ihr davon dringend abgeraten. Am besten, meinte die Tante, wir würden so rasch wie möglich unsere Sachen zusammenpacken, mit ihr kommen und bei ihr übernachten. Das geschah denn auch, wir verabschiedeten uns von der Grossmutter, wechselten das Quartier, wanderten mit unserem Gepäck durch heiter beleuchtete Strassen, kamen auch an jener berüchtigten Kneipe vorbei, aus der es tatsächlich laut tönte. Bald erreichten wir das Haus an der Paradiesgasse, in welchem die Tante wohnte. Es gab noch etwas Obst und Schokolade, dann steckte man mich ins Bett, und zwar zu meiner Cousine, die sich über die Ereignisse des Abends geradezu riesig freute und vor Vergnügen mit den Beinen strampelte.
Als ich älter war, erfuhr ich übrigens, dass meine Mutter damals, während ich schlief, doch noch jenes Wirtshaus aufgesucht und Grossvater herausgeholt hatte. Sie brachte ihn nach Hause und blieb dort, bis er den von ihr verordneten schwarzen Kaffee getrunken hatte und dann zu Bett ging.
Unsere längste Reise führte uns ins Ausland, das heisst ins Liechtensteinische. Ich wusste nicht, was «Ausland» bedeutete, merkte nur, dass die Fahrt länger dauerte als sonst. Verwandte hatten wir dort keine, doch in Liechtenstein waren die Zahnärzte billiger als bei uns. Mutter musste ihre Zähne behandeln lassen, und da sie als Frau eines Bähnlers eine Gratisfahrkarte besass, konnte sie durch die lange Reise etliche Franken einsparen.
Den ersten Zug hatten wir diesmal nicht verpasst. Ich vermute, dass wir gegen Mittag in Vaduz ankamen. In einer Konditorei kauften wir etwas Patisserie, dann wanderten wir aufs Feld hinaus, setzten uns neben einem Zaun ins Gras und assen zu Mittag. Vielleicht war es Frühling, ich glaube mich an Löwenzahn zu erinnern, an weidende Schafe, auf einem Felsen ein imposantes Schloss, vom Dorf herüber Glockengeläute.
Nach der Mahlzeit benetzte Mutter ihr Taschentuch und putzte mir den Mund. Sie lehnte mit dem Rücken am Zaun, ich lag neben ihr, mit dem Kopf auf ihrem Schoss. Morgens waren wir früh aufgestanden, jetzt nickten wir bald ein und schliefen eine ganze Weile. Doch plötzlich fuhr sie zusammen und sprang auf. Wir mussten uns beeilen, rannten über das Feld in Richtung Dorf, sie zog mich mit sich fort, einmal fiel ich hin, darauf trug sie mich ein Stück weit. Wir betraten ein Haus, das sich gerade neben der Konditorei befand. Während sie sich dann stundenlang vom Zahnarzt behandeln liess, schlief ich in einem Zimmer mit rosafarbenen Tapeten. Ich erinnere mich nicht mehr, wie man mich dort zu Bett brachte, sondern nur an mein Erwachen: ein Fräulein in weissem Kittel kam lächelnd auf mich zu, sagte etwas auf Deutsch, nahm mich auf den Arm und verliess mit mir das Zimmer. Unten wartete Mama.
In St. Moritz wohnte ihre Schwester Ottilia. St. Moritz grenzte ans Märchenhafte: unten der schimmernde See, oben die schlossähnlichen Gebäude mit Türmen und Terrassen. Es gab rötliche Plätze, wo Männer und Fräuleins miteinander Ball spielten; es gab duftende Bäckereien, zauberhafte Schaufenster, Warenfülle – ein Schlaraffenland, man hätte sich durch Berge von Pralinen, Kuchen und Bananen hindurchfressen mögen. Auf den Strassen Fahrzeuge mit oder ohne Dach, Pferdekutschen, Kummetgeklingel. Die Leute grüssten nicht. Mutter sagte: «Hier reden sie nicht mehr romanisch, hier wimmelt es von Fremden, und die sind anders als wir.» Sie hatten glättere Gesichter, waren anders gekleidet, sie bewegten sich mit einer gewissen Trägheit; manche trugen Sonnenbrillen, irgendeine buntscheckige Mütze. Man sah Frauen mit blutroten Lippen, und mir schien, dass sie ihre Münder bewusst nach vorn hielten, damit man sie besser sehe. Es gab sogar alte Frauen mit solchen Lippen, wobei das Rot merkwürdig von ihren bleichen Gesichtern abstach.
In einer Parkanlage nahe der Strasse sass ein Fräulein auf einer Bank, neben ihr ein älterer Herr, der sie um die Schulter hielt und ihre Haare streichelte. Das Fräulein war mir aufgefallen, weil sie nicht nur die Lippen, sondern das ganze Gesicht gefärbt hatte – die Wangen rötlich, die Augenlider wie mit Grafit bemalt und zudem dunkel umrandet, Brauen und Wimpern schwarz –, so dass ich zuerst glaubte, sie trage eine Maske. Sie schien traurig zu sein, weshalb ihr der ältere Herr das Haar streicheln mochte. Vielleicht starrte ich sie an, denn plötzlich zeigte sie mit dem Finger auf mich und begann zu lachen. Mutter zog mich mit sich fort, einige Schüler lärmten an uns vorbei, einer von ihnen warf seine Schultasche weit von sich auf die Strasse, ein Auto hupte. Irgendwo hörte man Musik, dann gerade über den Dächern das Gesurre eines Flugzeugs.
Der Ort hatte etwas Verwirrendes. Auf dem Dorfplatz, mitten im Mittagsverkehr, blieb Mutter auf einmal stehen: ein gewisser Onkel, den ich nicht kannte, war hier Polizist und hatte offensichtlich etwas mit diesem Verkehr zu tun. Sie sagte: «Siehst du dort drüben – das ist Onkel Gisep!» Der Mann stand, in grüner Uniform und mit weissen Handschuhen, auf einem Podest, gestikulierte mit Armen und Händen, schien den Automobilisten Befehle zu erteilen. Die Autos kamen von verschiedenen Seiten, einzelne blieben stehen, andere fuhren los und überquerten den Platz; er winkte, spedierte sie nach links oder rechts ... Wie ging das zu? Entweder wählten die Fahrer genau die Richtung, die er ihnen angab, das heisst sie gehorchten ihm, oder es verhielt sich so, dass er genau wusste, wohin sie fahren mussten.
Die Wohnung der Tante kannte ich, auch den Blick zum Stubenfenster hinaus – Dächer und Kamine, irgendwo eine grosse Kuppel, in der Nähe ein Kirchturm, der ganz schief stand, weit unten der See, einige Segelschiffchen. Doch was mir in diesem Haus am besten gefiel, war die Toilette, ein längliches Lokal, an dessen Türe ein farbiger Karton hing; man sah darauf einen sommersprossigen Spitzbuben mit einer Zahnlücke, der mir kameradschaftlich zugrinste.
Bevor wir uns verabschiedeten, musste ich der Tante zuliebe immer ein bestimmtes Lied singen, das ihr, wie sie sagte, so gut gefiel. Manchmal, vor allem wenn noch andere Leute da waren, sträubte ich mich dagegen. Dann liess man mich im Nebenzimmer singen, während die Türe einen Spalt offen blieb.
Abends, auf dem Weg zum Bahnhof, fragte ich mich, ob wir nochmals das Fräulein mit dem Maskengesicht treffen würden. Es reizte mich, sie noch einmal zu sehen. Doch als wir an jener Stelle vorbeikamen, war das Bänkchen verlassen.
Einmal war Mutter ohne mich verreist. Vater war auch nicht da, wir Kinder allein zu Hause. Es dunkelte schon, als Betta von der Terrasse hereinrief, wir sollten schnell herauskommen. Mutter hatte dort ihre Blumen, unter anderem einen Kaktus, der soeben zu blühen begann. Aus der dornigen Schale entliess er eine herrliche weisse Blüte, auf die Mutter jahrelang gewartet hatte. Nun war sie da. Wenn man genau hinschaute, glaubte man, sie langsam wachsen zu sehen – eine füllige Dolde, zuerst noch aufgerichtet, dann durch das eigene Gewicht sich neigend.
Wir staunten über dieses Weiss, das wie Schnee im Dunkel schimmerte. «Wie schade, dass Mama nicht zu Hause ist», meinte Betta. «Sollte man nicht zum Nachbarn gehen und nach Zürich anrufen, damit sie es wenigstens weiss?» – «Das hat keinen Sinn», sagte Adrian. «Wenn sie es weiss, kann sie die ganze Nacht nicht schlafen.» Hierauf Thom: «Aber morgen kommt sie nach Hause, dann sieht sie’s.» – «Ja, dann sieht sie’s», sagte Adrian, «aber morgen ist sie wahrscheinlich schon verblüht – was so schön ist, dauert nicht lange.»
Leider stimmte es. Als Mama am nächsten Tag heimkam, war die Blüte schon halb verwelkt, ihr Zauber dahin, das Weiss gelblich verfärbt. Mutter war sichtlich enttäuscht. Sie schaute, kehrte in die Küche zurück, ging später nochmals hinaus: «Vielleicht hättet ihr den Kaktus in den Flur tun sollen, wo es kühl und schattig ist. Die Sonne hat ihm nicht gut getan.» Betta tröstete sie: «Aber der wird sicher wieder einmal blühen.» – «Ja, ja, aber das dauert wieder Jahre, und wer weiss, ob wir dann noch da sind.»
Ich war sechsjährig (wir wohnten damals schon in Zernez), als ich zu stehlen begann. Ich stahl Geld, sonst nichts, nur Geld, und zwar aus Mamas Haushaltbörse. Diese befand sich in einer kleinen Schublade des Küchenbüffets. Ich nahm immer nur Kleingeld, weil ich vermutete, das falle weniger auf. Angefangen hatte ich mit einem Zehnrappenstück, für das ich im Laden bei Regi, knapp zwei Minuten von uns entfernt, einige Zuckerplätzchen oder einen Schokoladestengel bekam. Später nahm ich dann mehr, zwei Zehnräppler, einen Zwanziger, dann einen Fünfziger, je nach Börseninhalt. Die Fünfziger waren kleiner als die Zwanziger, versteckten sich manchmal auch in den Falten des Beutels und schienen mir schon deshalb geeigneter zu sein. Als ich einmal in der Börse einen einzigen Zehner vorfand, liess ich ihn drin und kam mir dabei sehr klug vor. Am günstigsten war es, wenn Mutter gerade vom Laden kam und dort mit einem grösseren Geldschein bezahlt hatte. Ich sass dann in der Küche und schaute zu, wie sie Brot, Spaghetti, Kaffee, Konservenbüchsen auspackte, wobei der Geldbeutel eine Weile wie ein Kätzchen vor mir auf dem Tisch liegen blieb.
Ich erinnere mich, wie leicht mir das Stehlen fiel und wie der Reiz zunahm. Es war der intensivste Reiz, den ich je erlebt hatte. Das geklaute Geld steckte ich jeweils in die Tasche, schlenderte vor mich hin pfeifend die Treppe hinunter und aus dem Haus, ging dann entweder zu Regi oder in die Bäckerei Füm, kaufte Schokolade, Makrönchen oder Mohrenköpfe, was ich dann in irgend einem verborgenen Winkel verspeiste.
Süssigkeiten waren das eine, der Diebstahl das andere, denn während ich stahl, dachte ich noch kaum an den Bäckerladen, da war das Klauen noch Selbstzweck. Mit leichtem Kitzel betrat ich die Küche, dann die Stube, ich rief: «Hallo, ist jemand da?» Wenn sich niemand meldete, näherte ich mich dem Büffet, öffnete die kleine Schublade, griff nach dem Geldbeutel, spürte die Berührung mit dem weichen Leder. Jetzt nahm ich gelegentlich auch Einfrankenstücke. Für einen Franken bekam man allerhand, oft reichte es sogar für eine der grossen Schokoladen und einige Makrönchen. Von bösem Gewissen war nicht die Rede, vielleicht war ich mir nicht einmal bewusst, etwas Böses zu begehen. Im Gegenteil, in einem Anflug von Generosität war ich dazu übergegangen, das Gekaufte jeweils mit ein paar Kameraden zu teilen. Ich merkte, dass sie mich schätzten. Wir vereinbarten einen stillen Ort, wo sie auf mich warteten, bis ich mit meinem Papiersack auftauchte. Es wurde nie gefragt, woher ich das Geld hätte, um die Sachen zu kaufen. Vielleicht ahnten sie es, sagten aber kein Wort.
Einmal hätte es mir schlecht ergehen können. Ich war mit zwei Kirschen aus Zuckerguss heimgekommen. Auch die bekam man bei Füm; sie waren gross, rot glasiert, hingen voll und appetitlich an einem zweigähnlichen Goldfaden, wie zwei richtige Kirschen, die mir schon ihrer Farbe und Grösse wegen gefielen. Ich hielt sie in der Hosentasche versteckt, ging auf die Terrasse hinaus, um sie dort in aller Stille zu geniessen. Ich zerriss den Goldzweig, steckte eine der beiden Früchte wieder in die Tasche, die andere in den Mund. Die Türe stand offen, doch niemand störte mich; ich begann zu lutschen, genoss die leckere Kugel in meinem Mund, zumal sie kompakt schien und nicht so bald zergehen würde. Doch eine Weile später, als sie kleiner geworden schien und ich sie schlucken wollte, blieb sie mir im Halse stecken; ich hatte mich verrechnet, brachte sie weder hinunter noch in den Mund zurück, konnte auf einmal nicht mehr atmen, schreien ging auch nicht; ich erstickte, stiess vermutlich nur stöhnende Laute hervor, schüttelte die Arme und stampfte mit den Füssen ... Ein Schutzengel kam mir zu Hilfe, genau im richtigen Moment wie alle Schutzengel, nämlich Frau Giamara, die Gattin unseres Hausvermieters, die zufällig einige Ferientage hier verbrachte. Sie erschien an der Terrassentüre, sah meinen grotesken Tanz, eilte heraus. Am Vorabend (das wurde mir erst später erzählt) hatten meine Eltern, die Frau Giamara sonst sehr schätzten, über sie gesprochen und sich dabei über ihre langen Fingernägel gewundert. Doch gerade diese kamen mir jetzt zugute: die Frau hielt mich mit dem linken Arm fest, steckte mir den Kleinfinger der Rechten in den Rachen, grübelte darin mit ihrem langen Fingernagel, bis es ihr gelang, die stecken gebliebene Kugel herauszuholen. Dabei rief sie laut nach meiner Mutter, und als diese herbei rannte, war ich bereits gerettet und konnte einen Schrei ausstossen. Später sagte man mir, ich sei schon ganz blau gewesen.
Merkwürdig übrigens, wie Frau Giamara die Zuckerkirsche in der flachen Hand hielt und fragte: «Was soll ich damit tun?» – «Wegwerfen!», sagte meine Mutter. Später, als ich allein war, warf ich auch die andere weg.
Leider kam mir diesmal der liebe Gott, den ich sonst in kritischen Situationen herbeirief, nicht in den Sinn, sonst hätte ich den Vorfall als Fingerzeig von oben deuten können. Stattdessen klaute ich weiter.
Mit der Zeit begann Mutter, die Dieberei zu bemerken, schien aber im Zweifel, welches ihrer Kinder dahinter steckte. Vielleicht dass sie mich, als ihren Jüngsten, vorerst ausschloss. Eines Abends bei Tisch sagte sie enttäuscht: «Heute ist mir schon wieder Geld gestohlen worden; ich frage mich, welches meiner Kinder ein Dieb ist.» – Betretenes Schweigen, man blickte sich um. Dann Betta, halb zornig weinend: «Also mich müsst ihr nicht anglotzen, ich habe noch nie gestohlen.» Hierauf Thom, die Ruhe in Person: «Ich auch nicht.» Adrian, damals schon Sekundarschüler, erklärte trocken: «Wenn jemand stiehlt, hat er das im Blut, dann ist ihm nicht zu helfen.» Vater fragte ihn: «Woher weisst du das? – Hast du es genommen? Zum Beispiel für Zigaretten?» Adrian war empört: «Für wen hältst du mich? Übrigens habe ich noch nie geraucht, wenn du es wissen willst!» Vater meinte: «Also wenn es niemand von euch war, dann ist es wahrscheinlich die Katze gewesen.»
Ich selber tat, als hätte ich kaum zugehört. Eine Weile herrschte Schweigen, doch als ich das Gesicht vom Teller hob, sah ich, dass alle Blicke auf mich gerichtet waren. Vor allem Vater musterte mich mit einer unheimlichen Miene. Ich weiss nicht, ob es mir gelang, Unschuld vorzutäuschen, jedenfalls passierte diesmal noch nichts.
Ich war entschlossen, nicht mehr zu stehlen. Nie wieder. Doch einige Tage später, da mich niemand zur Rede gestellt hatte und die Sache schon vergessen schien, tat ich es wieder. Es war Nachmittag, Mutter hatte erklärt, sie müsse zu einer Nachbarin. Ich hörte, wie sie die Treppe hinunterstieg, die Haustüre öffnete und wieder zumachte. Etwas später, als ich in der Küche die kleine Büffetschublade öffnete, vernahm ich ein Geräusch: sie beobachtete mich, ich sah ihr Gesicht im Türspalt.





























