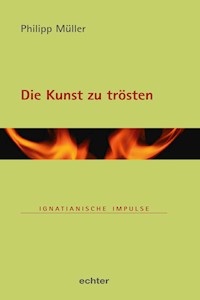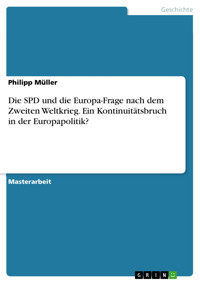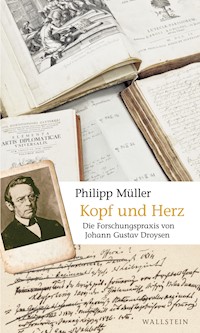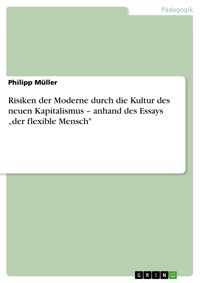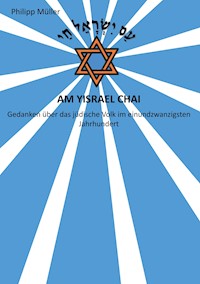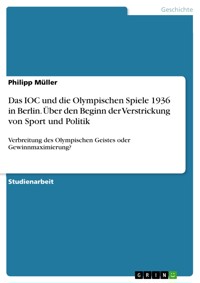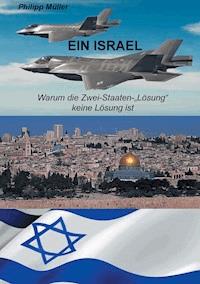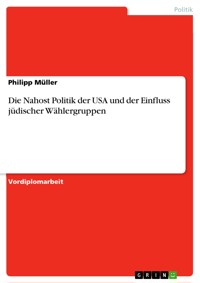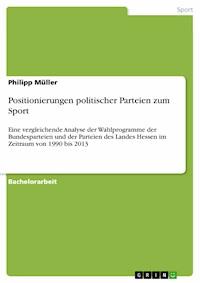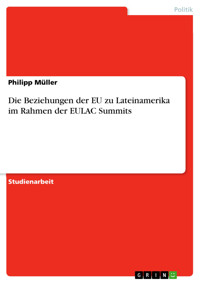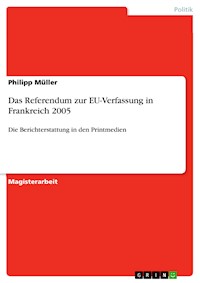
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1, Justus-Liebig-Universität Gießen (Institut für Politikwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Am 29. Mai 2005 stürzte das französische „Non“ zur Verfassung für Europa die EU in eine tiefe Krise, der europaweite Ratifikationsprozess wurde ausgesetzt. Die Ablehnung durch ein Gründungsmitglied der EU kam für viele Beobachter überraschend, Umfragen1 vor und nach dem Referendum zeigten eine generell pro-europäische Haltung der Franzosen. Einmal mehr hatten sich die bekannten Risiken des Referendums als Instrumentarium der direkten Demokratie gezeigt(Ricard-Nihoul 2005: 13). Die Gründe des Scheiterns der Verfassung in Frankreich sind Inhalt mehrerer Untersuchungen2, die die paradoxe Situation einer generell positiven Haltung zur EU und der gleichzeitigen Ablehnung des Vertragstextes zu erklären versuchen. Im Mittelpunkt stehen die Motive der Wähler. Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Analyse der Rolle von zwei Printmedien einen Beitrag zu diesen Untersuchungen zu leisten. Politikwissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Bedeutung der Massenmedien in Referenden auseinandersetzen, kommen zu dem Schluss, dass generell in Referendumskampagnen der Bedarf an Informationen größer ist als in Wahlkampagnen. Dies führt dazu, dass „during a referendum, the media have far more power to impose their own narratives and interpretations of the substantive issue” (Jenkins/Mendelsohn 2001: 220). Diese Besonderheit in Referendumskampagnen verstärkt die generelle Entwicklung der Massenmedien hin zur primären politischen Informationsquelle der Bürger (Strohmeier 2004: 83).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 3
I. Abkürzungsverzeichnis
CFDT
CGT CF
CSA EU Eurostat EUV FN IPSOS LO Minitel MNR OFM OJD PCF PQN PS
SNJ Socpresse TCE TF1 UDF UMP
Page 1
1. Einleitung
Am 29. Mai 2005 stürzte das französische „Non“ zur Verfassung für
Europa die EU in eine tiefe Krise, der europaweite Ratifikationsprozess wurde ausgesetzt. Die Ablehnung durch ein Gründungsmitglied
der EU kam für viele Beobachter überraschend, Umfragen1vor und nach dem Referendum zeigten eine generell pro-europäische Haltung der Franzosen. Einmal mehr hatten sich die bekannten Risiken des Referendums als Instrumentarium der direkten Demokratie gezeigt (Ricard-Nihoul 2005: 13). Die Gründe des Scheiterns der Verfassung
in Frankreich sind Inhalt mehrerer Untersuchungen2, die die paradoxe Situation einer generell positiven Haltung zur EU und der gleichzeitigen Ablehnung des Vertragstextes zu erklären versuchen. Im Mittelpunkt stehen die Motive der Wähler. Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Analyse der Rolle von zwei Printmedien einen Beitrag zu diesen Untersuchungen zu leisten. Politikwissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Bedeutung der
Massenmedien in Referenden auseinandersetzen3, kommen zu dem Schluss, dass generell in Referendumskampagnen der Bedarf an In-formationen größer ist als in Wahlkampagnen. Dies führt dazu, dass „during a referendum, the media have far more power to impose their own narratives and interpretations of the substantive issue” (Jenkins/Mendelsohn 2001: 220). Diese Besonderheit in Referendumskampagnen verstärkt die generelle Entwicklung der Massenmedien hin zur primären politischen Informationsquelle der Bürger (Strohmeier 2004: 83). Folgt man der Theorie von Jenkins/Mendelsohn, so muss in der Berichterstattung der Massenmedien im Vorfeld eines Referendums ein wichtiger Faktor in Bezug auf seinen Ausgang gesehen wer-
156Prozent der Franzosen sehen die EU-Mitgliedschaft positiv, 18 Prozent negativ und 28 Prozent weder gut noch schlecht. Quelle: Eurobarometer (2004) 62 Herbst 2004.http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb62_fr_exec.pdf(10.07.2009) Nach dem Referendum sehen 46 Prozent der Franzosen die EU-Mitgliedschaft positiv, 15 Prozent negativ und 36 Prozent weder gut noch schlecht. Quelle: Eurobarometer (2005b) 64 Herbst 2005.http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb64/eb64_exec_fr.pdf(10.07.2009)
2Vgl. Beaudin 2005; Clergerie 2005; Gerstlé 2006; Herbillon 2005; Kimmel 2007; Laurent/Sauger 2005; Lienemann 2005; Mergier 2005; Ricard-Nihoul 2005; Ricard-Nihoul/Larhant 2005
3Vgl. LeDuc 2002; Jenkins/Mendelsohn 2001; Marcinkowski 2007; Svenson 2007: Tonsgaard 1992; Vreese/Semetko 2004
Page 2
den. Dieser Ansatz, der für die jeweilige Situation anhand der vorlie-genden Bedingungen zu untersuchen ist4, gewinnt im Fall des französischen Referendums von 2005 insbesondere deshalb an Brisanz, da es im Rahmen der Kampagne massive Kritik an der Berichterstattung der Massenmedien gegeben hat. „Le NON censuré dans les médias, ça suffit!“ Unter diesem Namen veröffentlichten führende Journalisten
öffentlicher und privater TV-Sender am 17. Mai 2005 eine Petition5zur Berichterstattung ihrer Arbeitgeber über die Kampagne. Darin beklagen sie die an Propaganda grenzende Parteinahme für die Befür-worter der Verfassung und die ungleichmäßig verteilte Sendezeit zugunsten des „Oui“-Lagers.
Die Erfassung und Auswertung der Berichterstattung zum Referendum im französischen Fernsehen liegt, zumindest was die Sender TF1 und France2 betrifft, mit der Untersuchung von Gerstlé (2006) bereits vor. Aus diesem Grund hat die vorliegende Untersuchung die Berichterstattung in den Printmedien zum Gegenstand.
Als empirische Methode wird die Medieninhaltsanalyse verwendet, die Stichprobe bilden die Qualitätszeitungen „Le Monde“ und „Le Figaro“. Zur Beschreibung der Berichterstattung mit Hilfe der Medieninhaltsanalyse werden die relevanten Artikel nach formalen, inhaltlichen und wertenden Aspekten kategorisiert. Die Frage, ob eine objektive Berichterstattung vorlag, steht dabei im Mittelpunkt. Das heißt, es werden Tendenzen in der Berichterstattung gesucht, die die oben genannte Kritik der TV-Journalisten bestätigen oder widerlegen. Die Untersuchung orientiert sich an den folgenden drei Leitfragen:
1) In welchemAusmaßwurde über den Verfassungsvertrag berichtet?
4Im Kapitel 2.3 „Meinungsbildung und Wählerverhalten in Referenden“ wird erklärt, welche Faktoren in Referenden eine größere oder kleinere Bedeutung haben und wie diese sich gegenseitig bedingen. Dabei wird, mit dem Ziel der Einordnung der Rolle der Massenmedien in Referendumskampagnen, der erwähnte theoretische Ansatz geschildert. In Kapitel 2.5 „Einordnung der Faktoren der Referendumskampagne auf das Wählerverhalten“ wird dann die Theorie auf den besonderen Fall der Abstimmung über die Verfassung für Europa von 2005 angewendet, um so darstellen zu können, welche Faktoren eine größere und welche eine kleinere Rolle gespielt haben.
5http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=330(08.07.2009)
Page 3
2) Welches sind dieHauptthemender Berichterstattung über den Verfassungsvertrag beziehungsweise über das Referendum?
3) Wird die Verfassungbewertet?Und wenn ja - positiv oder negativ?
Mithilfe dieser Fragen soll die Berichterstattung zusammengefasst und auf einzelne Aussagen reduziert werden, die weitergehende Schlüsse ermöglichen.
Um auf den zu Beginn dieser Einleitung angesprochenen besonderen Einfluss der Massenmedien in Referendumskampagnen zurückzukommen, muss an dieser Stelle eine mögliche Wirkung der Berichterstattung auf das Abstimmungsverhalten erwähnt werden. Untersuchungen, die sich zum Ziel setzen die Art und Weise einer Berichterstattung in Wahlkämpfen oder Referendumskampagnen zu beschreiben, beinhalten als übergeordnete Fragestellung eben das Ausmaß dieses Einflusses. So dient die Inhaltsanalyse der Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz (Früh 2004: 25). Das heißt, von den Merkmalen des Untersuchungsgegenstandes, in diesem Fall der Art und Weise der Berichterstattung in den Zeitungen, soll auf Merkmale der sozialen Wirklichkeit, in diesem Fall auf das Abstimmungsverhalten, geschlossen werden.
Demnach ergibt sich für die vorliegende Arbeit eine zweiteilige Arbeitshypothese.
Hypothese:
Tendenzen in der Berichterstattung schaffen ein Ungleichgewicht in der Abbildung der beiden Lager und ihrer Argumentationen. Dieses Ungleichgewicht entfaltet eine Wirkung auf das Abstimmungsverhalten.
Anhand der drei Leitfragen soll mit der Medieninhaltsanalyse der erste Teil der Hypothese überprüft werden, der erwähnte Inferenzschluss
Page 4
schließlich dient der Überprüfung des zweiten Teils und führt zu einer Aussage über die Wirkung der Berichterstattung. Auf diese Art und Weise soll die vorliegende Arbeit einen bescheidenen Beitrag zur Erforschung der Motive der Ablehnung der Verfassung für Europa im französischen Referendum 2005 leisten.
Kapitel 2 „Das Referendum“ stellt die verschiedenen Formen von Referenden dar und präsentiert die Diskussion in der Forschung über Vor- und Nachteile direktdemokratischer Elemente in repräsentativen Demokratien. Welche Faktoren in einem Referendum Einfluss auf das Abstimmungsverhalten nehmen wird ebenfalls erklärt. Nach dieser theoretischen Darstellung wird auf den speziellen Fall, das Referendum in Frankreich 2005 eingegangen und ein Bezug zu den genannten Aspekten von Referenden im Allgemeinen hergestellt. Abschließend wird, mit dem Ziel einer Einordnung der Rolle der Massenmedien im französischen Referendum ein Überblick über die für das Abstimmungsverhalten in Frankreich 2005 wichtigen Faktoren gegeben. Kapitel 3 „Massenmedien und Medienwirkungsforschung“ gibt zunächst eine Definition von Massenmedien und stellt die unterschiedlichen Wirkungsweisen der einzelnen Medientypen ebenso dar, wie die Theorie der Medienwirkungsforschung. Zur besseren Einordnung der Stichprobe der Untersuchung in dieser Arbeit werden die französische Medienlandschaft insgesamt sowie die Rolle der Printmedien darin, dargestellt. Die Erläuterung der Bedeutung der Zeitungen „Le Monde“ und „Le Figaro“ steht dabei im Mittelpunkt. Nach der Darstellung der Bedeutung der Massenmedien im französischen Referendum und der Einordnung der Stichprobe folgt mit Kapitel 4 die Untersuchung: Die Darstellung der Medieninhaltsanalyse als empirische Methode, der Aufbau der Untersuchung und das Codebuch, sollen den Verlauf der Medieninhaltsanalyse der Berichterstattung der Zeitungen „Le Monde“ und „Le Figaro“ offen legen. Mit der anschließenden Präsentation der Untersuchungsergebnisse soll gezeigt werden ob sich der erste Teil der Arbeitshypothese bestätigt. Die folgende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse beinhaltet den erwähn-
Page 6
2. Das Referendum
Im Folgenden soll das Referendum als Instrument direkter Demokratie vorgestellt werden. Dabei geht es zum einen darum, die verschiedenen Formen von Referenden darzustellen und zum anderen die Diskussion in der Forschung über die Vor- und Nachteile direktdemokratischer Elemente in einer repräsentativen Demokratie aufzuzeigen. Mit dieser theoretischen Einordnung des Referendums soll gezeigt werden, dass bestimmte Elemente die im Fall des französischen Referendums eine Rolle gespielt haben, in der Theorie der direkten Demokratie erklärt sind und im Vorfeld der Bestimmung der plebiszitären Ratifikation bekannt waren.
Welche Faktoren in welchen Zusammenhängen welche Rolle in einer Referendums-Kampagne spielen und welchen Einfluss diese auf die Entscheidung der Wähler, sowie auf die Fluktuation vor der Abstimmung haben, ist Inhalt von Abschnitt 2.3 „Meinungsbildung und Abstimmungsverhalten in Referenden“. Dabei steht die Einordnung der Rolle der Massenmedien in Referendumskampagnen im Mittelpunkt. Schließlich wird der Verlauf des Referendums in Frankreich dargestellt und die bekannten Motive der Ablehnung erklärt. In Anwendung der Theorien aus Abschnitt 2.3 „Meinungsbildung und Abstimmungsverhalten in Referenden“, wird gezeigt welche Faktoren im speziellen Fall des französischen Referendums Einfluss auf die Abstimmungsentscheidung hatten
2.1 Arten von Referenden
Weltweit sehen ungefähr 70 Prozent aller Länderverfassungen die Abhaltung von Referenden vor (vgl. Qvortrup 2002). Dabei handelt es sich um verschiedene Formen von Referenden, von obligatorischen bis zu fakultativen. Simon Hug hat eine Klassifizierung dieser Referenden
Page 7
vorgenommen und deren unterschiedliche Bedeutung dargestellt6(vgl. Hug 2003). In einem Dreistufenmodell unterscheidet er zwischen 1) den Arten der verfassungsmäßigen Grundlage, 2) den Ursprüngen der Forderung nach einem Referendum und 3) der Herkunft des Themas des Referendums. In der ersten Stufe wird zwischen verpflichtendem und fakultativem Referendum unterschieden, entsprechend der Vorgabe der Verfassung. In der zweiten Stufe werden die fakultativen Referenden weiter unterteilt: Es wird untersucht wer der Initiator des Referendums ist. Handelt es sich um die Regierung so gilt dies als ein passives Referendum. Wird eine Abstimmung auf Initiative einer anderen (Oppositions-) Gruppierung abgehalten, klassifiziert Hug dieses als aktiv. Regierung ist in diesem Falle jede Ansammlung von Akteuren, die in der Lage ist ein Gesetz zu verabschieden, folglich auch eine Mehrheit im Parlament. Opposition definiert Hug als jede Gruppierung innerhalb oder außerhalb des Parlaments, die in der Lage ist ein Referendum zu initiieren.
Schließlich wird auf der dritten Stufe zwischen Vorschlägen der Opposition und der Regierung unterschieden, die der Bevölkerung in dem Referendum vorgelegt werden.
Hug bildet aus diesen drei Stufen ein System von vier Arten von Referenden:
1) Obligatorische Referenden, die in vielen Verfassungen vorgesehen sind für Verfassungsänderungen oder Veränderungen des Territoriums.
2) Fakultative aktive Referenden über Vorschläge der Regierung. 3) Fakultative, aktive Referenden über Vorschläge der Opposition.
4) Fakultative, passive Referenden, in denen die Regierung den
Bürgern Vorschläge zur Abstimmung vorlegt7.
6Hug unterscheidet in seiner Bezeichnung nicht zwischen Volksentscheid beziehungsweise Plebiszit und Referendum, sondern zwischen aktivem und passivem Referendum. Auch Rux verwendet den Begriff Referendum sowohl für die aktive wie für passive Form der direkten Demokratie (Rux 2008)
7Diese vierte Stufe liegt im Fall des französischen Referendums zum Verfassungsvertrag der EU von 2005 vor. Mehr dazu im Abschnitt 2.4 „Das Referendum in Frankreich 2005“
Page 8
Rux weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in den meisten ausländischen Verfassungen nur Referenden vorgesehen sind, die nicht durch die Bürger initiiert werden können (vgl. Rux 2008). Ob ein Referendum obligatorischen oder fakultativen Charakter hat, hat nach Luthardt keinen Einfluss auf dessen Wirkung (vgl. Luthardt 1994). Demnach fühlt sich die Regierung auch bei beratenden Referenden der Entscheidung des Volkes verpflichtet, selbst wenn rechtlich keine Verbindlichkeit besteht. Hierbei spielen mögliche politische Konsequenzen einer Ignorierung der Entscheidung der Bürger eine zentrale Rolle.
2.2 Das Referendum und die repräsentative Demokratie
In modernen Demokratien, in denen Referenden als Möglichkeit der Mitbestimmung der Bevölkerung möglich sind, bestehen diese als Ergänzung zu einem System der repräsentativen Demokratie. In welchem Ausmaß dabei Entscheidungen per Referendum und per parlamentarischem Entschluss getroffen werden, ist unterschiedlich. Es gibt eine breite Übereinstimmung darüber, dass direkte Demokratie keine Alternative zu repräsentativer Demokratie sein kann, (vgl. Heußner 2009; Qvortrup 2002; Rux 2008) vielmehr wird direkte Demokratie lediglich als deren Ergänzung gesehen. Das Motiv der Refe-rendums-Befürworter ist in den meisten Fällen eine „ (…) Verbesserung des Systems, als konservative Überprüfung der Legislative“ (Qvortrup 2002: 8). Dass das von den Befürwortern der direkten Demokratie kritisierte Politikmonopol von Staat und Partei zu Politikverdrossenheit führe (vgl. Heußner 2009), wird als weiteres Argument für die stärkere Beteiligung der Bürger angeführt. Mehr direkte Demokratie und mehr politische Partizipation werden als Lösungsinstrumente zur Behebung eines Demokratiedefizits gefordert (vgl. Luthardt 1994).
Argumente wie die Diktatur der Mehrheit und die Anfälligkeit für Demagogie als Defekte von Referenden werden von den Gegnern di-