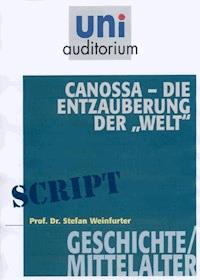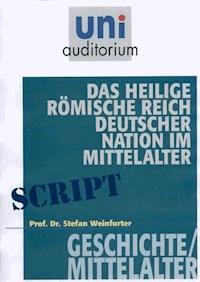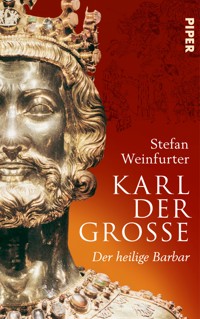12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entstehung und Ausprägung des Reichs im Mittelalter bilden das Thema dieses eindrucksvollen Buches. Es erzählt von den Ursprüngen des Fränkischen Reichs und seiner Blüte unter den Karolingern, von der Entfaltung des römischen Kaisertums unter den Ottonen, von der Neugestaltung von Kaisertum, Königsherrschaft und Reich in der Salier-Zeit, vom Heiligen Reich in der Ära der Staufer und von den Anfängen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Weinfurter
DAS REICH IM MITTELALTER
Kleine deutsche Geschichtevon 500 bis 1500
C.H.Beck
Zum Buch
Stefan Weinfurter schreitet in dem vorliegenden Buch noch einmal jenen Weg ab, den die Geschichte von den Franken zu den Deutschen genommen hat, und vermittelt in einer dichten, lebendigen und facettenreichen Erzählung das Grundwissen über die Entstehungszeit des Heiligen Römischen Reiches im Mittelalter. Rund eintausend Jahre sollten vergehen, ehe sich aus frühen fränkischen Reichsbildungen das Volk formte, das schließlich unter dem Namen der Deutschen seinen Platz in der Historie fand. Diese Zeitspanne umfasst die gesamte Epoche des Mittelalters und ist in politischer, kultureller und religiöser Hinsicht von zahllosen Einflüssen und Wechselfällen geprägt. So verliefen die darin eingewobenen Entwicklungen bei genauerem Hinsehen sehr viel windungsreicher und viel weniger zielorientiert, als es vielleicht im Rückblick zunächst scheinen mag: Wie wäre unsere Geschichte verlaufen, wenn der Franke Chlodwig sich nicht hätte taufen lassen und daraufhin auch sein Volk den christlichen Glauben angenommen hätte? Was wäre geschehen, wenn König Karl, bevor er zum Kaiser gekrönt und der Große wurde, auf einem seiner zahllosen Kriegszüge gefallen oder wenn König Otto I. den Ungarn auf dem Lechfeld unterlegen wäre? Welche Konsequenzen hätte es gehabt, wenn Gregor VII. im Investiturstreit Kaiser Heinrich IV. niedergerungen und die weltliche Herrschaft dauerhaft unter das Joch des Papsttums gezwungen hätte? Welche Entwicklung hätte das Reich genommen, wenn 1348 nicht die große Pest ausgebrochen und dadurch europaweit bis zu einem Drittel der Bevölkerung hinweggerafft worden wäre? So wird bei der Lektüre dieses Buches auch stets jener machtvolle historische Prozess deutlich, dessen ganz verschiedenartige Faktoren die Ausformung des Reiches und die Frühzeit der deutschen Geschichte bestimmten.
Über den Autor
Stefan Weinfurter - Seniorprofessor für Mittelalterliche Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und dort Direktor der Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe - ist Ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Von ihm liegen im Verlag C.H.Beck vor: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (2003, hrsg. zusammen mit Bernd Schneidmüller); Canossa. Die Entzauberung der Welt (32007).
INHALT
EINLEITUNG
1. DAS REICH DER FRANKEN
Die fränkische Reichsgründung
Menschen im Reich der Franken
Kaiser Karl und seine Erben
2. DIE ENTFALTUNG DES RÖMISCHEN KAISERTUMS
Die Sachsenkönige und die Liebe zu Italien
Lebensordnungen in ottonischer Zeit
Das römische Kaisertum um die Jahrtausendwende
3. NEUFORMIERUNGEN VON KAISERTUM, KÖNIGTUM UND REICH
Auf dem Wege nach «Canossa»
Neue Moral und Wahlkönigtum
Ein «deutsches Reich» um 1100?
4. DAS HEILIGE REICH
Friedrich Barbarossa und das Scheitern seiner Konzeption
Die Anfänge einer «neuen Welt» um 1200
Heinrich VI. und Friedrich II.: Das Kaisertum löst sich vom Reich
5. DIE DEUTSCHE NATION
Der lange Weg zur Goldenen Bulle von 1356
Lebenswelten und «deutsche Länder» im späten Mittelalter
Reformen in Kirche und Reich des 15. Jahrhunderts
SCHLUSSGEDANKEN: «DEUTSCHE» WERTE ZUM AUSKLANG DES MITTELALTERS
ANHANG
Die fränkischen und deutschen Herrscher des Mittelalters
Karten und Stammtafeln
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Register
Bildnachweis
EINLEITUNG
Vor über zwei Jahrhunderten, 1806, ging das Heilige Römische Reich deutscher Nation zu Ende. Der habsburgische Kaiser Franz II. legte die Kaiserkrone dieses Reichs nieder, und damit löste sich ein politisches Gebilde von ganz eigener und besonderer Art auf – ein Reich, das fast 1000 Jahre Bestand gehabt hatte. Sein Ende hatte viele Gründe: Der Nationalstaat war im Begriff, sich durchzusetzen, die Aufklärung trieb die Säkularisation der geistlichen Fürstentümer voran, vor allem aber wirkte die Neugestaltung Europas, die Napoleon vorgenommen hatte. Der Rheinländer Joseph Görres sah das Alte Reich schon 1797 mit der Eroberung der Stadt Mainz durch die Franzosen ins Herz getroffen. Mainz war bis dahin der altehrwürdige Sitz des ersten und vornehmsten der geistlichen Kurfürsten gewesen – war er doch zugleich der Erzkanzler des Reichs. So schrieb Joseph Görres am 7. Januar 1798 seine «Rede auf den Untergang des Heiligen Römischen Reiches» und schloss sie mit den Versen:
«Von der Sense des Todes gemäht, atemlos und bleich,
Liegt hier das heilige römische Reich.
Wandrer, schleiche dich leise vorbey, du mögest es wecken,
(…).
Ach! Wären die Franzosen nicht gewesen,
Es würde nicht unter diesem Steine verwesen.
Requiescat in Pace.»
Aber so rasch verschwindet eine über 1000 Jahre gewachsene politische und gesellschaftliche Ordnung nun doch nicht. Vieles, was das Heilige Römische Reich ausgemacht hat, ist in seinen Auswirkungen bis heute spürbar. Am deutlichsten zeigt sich dies am föderativen Prinzip unserer modernen Staatsordnung. Aber auch in der Gestalt unserer Städte, Dörfer, Klöster, Kirchen, Burgen und Schlösser blieben wesentliche Inhalte dessen, was das Heilige Römische Reich kennzeichnete, erhalten. Die deutsche Sprache hat sich über die Jahrhunderte hin geformt. Die Wurzeln für all dies und letztlich die Prägung unserer gesamten gesellschaftlichen und kulturellen Anfänge erfolgte maßgeblich im Mittelalter, auch wenn wir heute allzu leicht geneigt sind, dies zu übersehen. Aber – auch das gilt es zu beachten – das Mittelalter war lange Zeit nicht «deutsch» im modernen Sinne. Von einem «deutschen Reich» kann man im Mittelalter nur bedingt sprechen, und einen «deutschen Kaiser» gab es erst im 19. Jahrhundert, als der preußische «Weißbart» Wilhelm I. die Kaiserkrone annahm und dabei an den «Rotbart» Friedrich I. Barbarossa anknüpfte. «Deutsch» und die «Deutschen» haben im Mittelalter einen langen Weg über viele Etappen benötigt, um sich so zu formieren, wie wir heute die Begriffe mit Inhalt füllen. Dieser Weg führte mitten durch Europa, und die damit verbundene Entwicklung war immer mit der Geschichte Europas verquickt. Daher müsste man, um den «deutschen Weg» in seinem ganzen Facettenreichtum hervortreten zu lassen, «Europa» viel mehr zu Wort kommen lassen, als es in diesem Buch möglich ist. In dem Bewusstsein, nur eine Auswahl an – freilich bedeutenden – Weg- und Wendemarken zu bieten und nur Entwicklungslinien ziehen zu können, sind die Aspekte, die Schwerpunkte und die historischen Epochen und Zäsuren für dieses Buch und sein Thema gewählt worden.
1. DAS REICH DER FRANKEN
Die fränkische Reichsgründung
Am Anfang war das Reich – könnte man denken. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Eine, von der Ausdehnung her gesehen, feste Größe eines Reichs gab es nie. Und außerdem: Von welchem Reich sprechen wir eigentlich? Am Anfang stand jedenfalls nicht ein deutsches Reich, sondern ein Reich der Franken, ein regnum Francorum. Es waren kleine fränkische Gruppen, die sich am Niederrhein und am Mittelrhein niedergelassen hatten und im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus in den Raum zwischen Aachen und Paris, also in das späte Römische Reich, einsickerten. Wie dieser Prozess vor sich ging, weiß man nicht so genau. Es war die Zeit des Zerfalls des weströmischen Reichs.
Dennoch war es keineswegs so, als hätten die Franken diese Teile des Römischen Reichs erobert. Vielmehr erwiesen sie sich zunächst als loyale Krieger und Heerführer und wurden gar als besonders fähige Soldaten in die römischen Legionen eingegliedert. Sie bewährten sich so gut, dass sie zunehmend das Kommando übernahmen. Durchaus mit Stolz wurde auf einem fränkischen Grabstein vermerkt: «Als Landsmann bin ich ein Franke, als römischer Soldat stehe ich unter Waffen» (Francus ego civis, miles Romanus in armis). Ein wichtiges Element des Integrationsprozesses bildeten demnach militärische Leistungen. Am Anfang des Reichs, so könnte man sagen, standen Kriegertum und militärische Bewährung.
Solche Dienste wurden belohnt. Allmählich rückten fränkische Siedler aus ihren bisherigen Gebieten in Toxandrien, dem Raum zwischen der Rhein- und der Scheldemündung, in die romanisierten Gebiete im Westen vor – in etwa der Raum, den wir heute mit Belgien, dem nördlichen Frankreich und dem Niederrhein umschreiben würden. Es scheint, dass sich bald eine der fränkischen Sippen besonders hervortat, nämlich die der Salier, die unter der Führung eines Chlodio stand. Möglicherweise bestand das Kennzeichen von Chlodios Familienclan, der später unter dem Namen Merowinger gefasst wurde, schon in den Anfängen in langer Haartracht. Jedenfalls werden die Könige aus dieser Familie bereits in der Chronik des Fredegar (III, 9) im 7. Jahrhundert als «langhaarig» (crinitus) bezeichnet.
Die Franken waren nicht sehr zahlreich. Man schätzt, dass es vielleicht zehntausend oder zwanzigtausend kampffähige Männer waren, doch das ist reine Spekulation. Es waren jedenfalls so wenige, dass sie in den gallorömischen Regionen noch nicht einmal in der Lage waren, die Sprache der Bevölkerung zu beeinflussen. Aber sie übernahmen die politische Führung, wobei sich die Familie der Merowinger gegen Ende des 5. Jahrhunderts an die Spitze setzte. Einer aus der Sippe Chlodios, Childerich, der das fränkische Kleinreich von Tournai anführte, soll zunächst von den Franken verjagt worden sein, weil «er anfing, ihre Töchter zu missbrauchen» (Gregor von Tours, Historia Francorum II, 12). Er unterstellte sich jedenfalls als «Reichsgermane» dem Oberbefehl des gallischen Heerführers Aegidius und errang glänzende Erfolge. Damit verhalf er seinem Herrn um Soissons in Nordgallien zu einer mächtigen Position. Als Aegidius’ Sohn, Syagrius, 464 die Herrschaft in Nordgallien übernahm, stand auch Childerich wieder an seiner Seite. Seine fränkisch-barbarische Armee war eine zentrale Stütze der im rapiden Niedergang begriffenen römischen Macht.
Mit einem Schatz aus Waffen, Juwelen und Münzen, die aus byzantinischen, hunnischen, germanischen und gallorömischen Werkstätten stammten, wurde Childerich nach seinem Tod 482 beigesetzt. Sein Grab, das 1653 in der Nähe von Tournai aufgefunden wurde, barg einen goldenen Siegelring mit dem Namen und dem Brustbild des Merowingers: Childirici regis. Er hatte sich also bereits selbst als rex, als König, bezeichnet. Der Dienst für Rom hatte ihn an die Spitze der Gesellschaft gebracht, und seine Welt war durchdrungen von römischer Lebensart.
Mit Chlodwig, seinem Sohn und Nachfolger, kam die Wende – mit ihm, so kann man sagen, begann die Geschichte des fränkischen Reichs. Unterstützt von anderen fränkischen Kleinkönigen schlug er Syagrius 486/487 vernichtend in der Schlacht von Soissons – eine europäische Weichenstellung. Ein romanisierter Barbarenkönig hatte den letzten weströmisch-gallischen Herrscher beseitigt. Ohne Schwierigkeiten trat er an dessen Stelle, übernahm den Oberbefehl über die römisch-fränkische Armee, ließ die römische Provinzverwaltung bestehen und bemächtigte sich der römischen Fiskalländer, deren Steueraufkommen ihm zugute kam. Das Land um Soissons wurde zur Keimzelle des fränkischen Reichs. Die darauf folgenden Siege über andere Stämme festigten Chlodwigs Stellung: 496/497 schlug er bei Zülpich die Alemannen, die damals ihre Gebiete im Elsaß, am nördlichen Mittelrhein und in den rechtsrheinischen Gebieten an Main und Neckar verloren. Als sie sich 506 wieder erhoben, wurde der Aufstand blutig niedergeschlagen. Fortan waren die Alemannen in das Frankenreich einbezogen. 491/492 unterwarf Chlodwig die niederrheinischen Thüringer und zwischen 509 und 511 die rheinischen Franken um Köln. Um 500 setzte er sich gegen die Burgunder durch, die allerdings erst 534 vollständig ins Frankenreich eingegliedert werden konnten. Auch der Zugang zum Mittelmeer durch die Eroberung der Provence gelang erst unter Chlodwigs Nachfolgern (536/537).
Doch die militärische Überlegenheit und die Übernahme der römisch-gallischen Herrschaftsverwaltung allein hätten kaum ausgereicht, um den Beginn einer neuen, weitwirkenden westeuropäischen Reichsgründung in Gang zu bringen. Geradezu entscheidend war es, dass sich Chlodwig dem römisch-christlichen Glauben anschloss. Schon bald erkannte er, der vorher wahrscheinlich dem römischen Polytheismus – und damit dem traditionellen Reichsglauben an Götter wie Jupiter, Saturn, Mars und Merkur – angehangen hatte, dass er sich auf den christlichen Gott als Sieghelfer verlassen könne. Vielleicht aber war es auch seine burgundische Ehefrau Chrodechild, die seinen Sinneswandel herbeiführte. Sie glaubte an den Christengott – und zwar gemäß dem römischen Bekenntnis – und habe «nicht aufgehört, ihm Predigten zu halten», um ihn von den Vorteilen des Wechsels zum Christengott zu überzeugen: Jupiter sei ein schmutziger Eheschänder, und Mars und Merkur hätten auch nicht viel zu bieten. Der Christengott aber habe Himmel und Erde geschaffen, lasse die Sonne leuchten und die Sterne glänzen, habe das Wasser mit Fischen, das Land mit allerlei Getier und die Luft mit Vögeln erfüllt und das Menschengeschlecht erschaffen (Gregor von Tours II, 30). In einer militärischen Notlage, als die Alemannen das Frankenheer zu besiegen drohten, habe dann Chlodwig am Ende tatsächlich die Hilfe von Jesus Christus angerufen, nachdem die römischen Götter keine Reaktion gezeigt hätten. Jedenfalls ließ sich Chlodwig an einem Weihnachtstag um 500 – die genaue Jahreszahl ist umstritten: 496, 498, 500 oder gar 508 – von Bischof Remigius in Reims taufen. Zuvor hatte er sein «Volk» befragt, also seine wichtigsten Gefolgsleute, die ihm zurieten. Die Konversion des Königs zog zwangsläufig auch diejenige seiner Gefolgschaft nach sich: «Mehr als dreitausend aus seinem Heer», so Gregor von Tours in seiner Frankengeschichte (II, 31), seien ihrem Herrn bei dem Übertritt gefolgt.
Diese Taufe, so könnte man etwas zugespitzt formulieren, war zugleich die Geburtsstunde des mittelalterlichen Europa. Die Christianisierung der Franken beseitigte die bislang in Gestalt unterschiedlicher Kulte bestehenden Hürden und ermöglichte die enge Zusammenarbeit und schließlich die Verschmelzung mit den Gallorömern – den Bauern, Handwerkern und dem Adel Galliens. Dieser Prozess, der die Gesellschaft in allen Schichten erfasste und durchdrang, ist ein Signum des 6. Jahrhunderts.
Andere germanische Völker hatten zwar auch das Christentum angenommen, aber nicht in der römischen Variante. Sie entschieden sich für den arianischen Glauben. Das war die Lehre des Presbyters Arius aus Alexandria (gest. 336), der behauptete, Jesus Christus sei nicht «gottgleich» (homoousios), sondern nur «gottähnlich» (homoiousios). Nur Gott Vater sei der einzig wahre Gott, und sein Sohn, der unter ihm stehe, sei ein kleinerer und untergeordneter Gott. Der Heilige Geist schließlich sei ein Geschöpf des Sohnes und besitze als dessen Diener (minister) eine noch geringere Gotteswürde. Diese vor allem im Osten des Römischen Reichs herrschende Auslegung wurde durch die Bibelübersetzung des westgotischen Bischofs Wulfila (311–383) seinem Volk vermittelt und dann von fast allen germanischen Völkern übernommen. Offenbar entsprach sie deren Vorstellungen einer hausherrschaftlichen Ordnung mit klarer Rangfolge. Aber im Römischen Reich hatte sich durch den Beschluss des Konzils von Nikaia in Kleinasien im Jahre 325 und endgültig dann durch das Konzil von Konstantinopel im Jahre 381 die Lehre von der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater durchgesetzt. Sie galt seither in der römischen Kirche als Kriterium der Rechtgläubigkeit.
Angesichts dieser Spaltung wird erst vollends deutlich, von welcher Tragweite der Übertritt Chlodwigs und seiner Franken zur römischen Richtung des Christentums gewesen sein musste. Nur die Franken konnten demnach in diesen innigen, synergetischen Kultur- und Ordnungstransfer mit den Römern und der von ihnen bevorzugten Ausprägung des Christentums eintreten – eines Christentums, dessen kulturelle und politische Wirkungsmacht für die Spätantike hochbedeutend war. Nun konnte ein «Volk der Franken» (populus Francorum) entstehen, das sich aus Galliern, Kelten, Römern, Goten, Burgundern – und auch aus Franken zusammensetzte.
Dass auch Chlodwig selbst es für unerträglich gehalten habe, «dass diese Arianer einen Teil Galliens besitzen» (Gregor von Tours, II, 37), klingt nicht unwahrscheinlich, zumal dies eine zusätzliche Motivation dafür bot, 507 das westgotische Reich von Toulouse auszulöschen. Um sich der Gottgefälligkeit seines Plans zu versichern, hatte er zuvor den heiligen Martin an dessen Grab in Tours befragen lassen, ob die Gelegenheit für einen Kriegszug günstig sei. Als seine Boten die Kirche betraten, hörten sie, wie der Vorsänger gerade den Psalm 18, 40 f. anstimmte: «Herr, Du hast mich zum Kampf mit Kraft umgürtet, Du hast alle in die Knie gezwungen, die sich gegen mich erhoben. Meine Feinde hast Du zur Flucht gezwungen, und alle, die mich hassen, konnte ich vernichten.» Das klang vielversprechend. Diese Worte nahmen die Boten quasi als Orakelspruch mit in das Zelt ihres Königs. Daraufhin gab dieser sogleich den Befehl, loszumarschieren und die Westgoten bei Poitiers anzugreifen. Nach weiteren Kämpfen und seinem endgültigen Sieg kehrte er im Triumphzug nach Tours zurück, wo er in der Kirche des heiligen Martin den Purpurrock anlegte und sein Haupt mit dem Diadem schmückte – Zeichen imperialer Würde in römischer Tradition. Von da an sei er «gewissermaßen Konsul oder Augustus genannt worden» (ab ea die tamquam consul aut augustus est vocitatus, Gregor von Tours II, 38). Von Tours aus, so der Chronist weiter, sei Chlodwig nach Paris gezogen und habe dort den Sitz seiner Herrschaft eingerichtet (ibique cathedram regni constituit).
Seit seinen großen militärischen Erfolgen verehrte Chlodwig den heiligen Martin vor allen anderen Heiligen des Christentums. Überall, wo die Franken siegreich ihre Lanze in den Boden stießen, übernahm der heilige Martin als Patron die Regie in den wichtigsten Kirchen. Die Bischofskirche von Mainz, auf der der heilige Martin heute noch auf dem Dachfirst reitet, ist ein Beispiel dafür. Chlodwig und seine Nachfolger ließen den halben Mantel, der dem heiligen Martin geblieben war, nachdem er die andere Hälfte der Legende zufolge einem Bettler geschenkt hatte, sogar am Königshof mitführen. Mantel heißt lateinisch cappa, und deshalb nannte man die geistlichen Bewacher dieser cappa die Kapläne.
Noch aber konnte sich Chlodwig seines neuen Reichs nicht sicher sein, noch lebten zu viele männliche Mitglieder seiner Sippe, die sich ebenfalls die Königswürde zugelegt hatten. Einen nach dem anderen tötete er mit List und Entschlossenheit, nicht selten eigenhändig, damit «außer seinen eigenen Nachkommen keiner von seinen Verwandten mehr übrig bliebe» (Fredegar III, 27). Die gesamte Familie von König Sigibert, der über die am Rhein bei Köln siedelnden Franken regierte, wurde ermordet. Am Ende habe Chlodwig darüber geklagt, dass er nun keine Verwandten mehr habe, die ihm im Notfall Hilfe bieten könnten. «Aber», so der Chronist, «er sprach dies nicht aus Schmerz um den Tod derselben, sondern aus List, ob sich vielleicht doch noch einer fände, den er töten könnte.» (Gregor von Tours II, 42).
Christlicher Glaube, römische Organisation sowie kriegerische Brutalität und Skrupellosigkeit bildeten nicht nur keinen Widerspruch zueinander, sondern vielmehr die Grundlagen des fränkischen Reichs. Zielstrebig wurde von nun an die kirchliche Liturgie zur Stabilisierung des merowingischen Königtums eingesetzt. So lautete eine der Segensformeln für einen jeden merowingischen König: «Blicke, allmächtiger Gott, wohlgefällig auf Deinen glorreichen Knecht [hier folgte der Name des jeweiligen Königs]. Wie Du Abraham, Isaac und Jakob gesegnet hast, so schenke ihm die Segnungen Deiner Gnade und erachte ihn als würdig, dass sich die ganze Fülle Deiner Macht über ihn ergießt und ihn durchdringt. Gib ihm vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde, Überfluss an Getreide und Wein und Öl und Reichtum an allen Früchten.» Magische Vorstellungen von der königlichen Heilskraft verbanden sich mit christlichen Traditionen.
In wenigen Jahren war aus dem spätrömischen Erbe ein großes und verhältnismäßig festes Reich erwachsen. Das römische Straßennetz, die Städte und Handelsverbindungen blieben erhalten, man lebte weithin überwiegend nach römischem Recht und pflegte lateinische Bildung und Sprache. Am Hof des Königs hielten sich romanische Offiziere auf, und gallorömische Sekretäre (scriniarii) und Kanzler (referendarii) aus der spätrömischen Verwaltung standen nach wie vor zur Verfügung. Vor allem wirkte die straffe römische Militärorganisation in die fränkische Zeit hinein. Im Hinblick auf die militärische Disziplin kann man geradezu von einem romanisierten Heerwesen der Franken sprechen. In größeren Städten wurden Garnisonen eingerichtet, die von einem «Grafen» (comes) befehligt wurden. Seine Aufgaben waren militärischer und rechtlicher Natur. Er hob in seinem Bereich die Truppen aus und setzte, wenn er dazu in der Lage war, das königliche Recht durch. Dazu benötigte er in der Regel die Mitarbeit des Bischofs der Stadt.
Enorme Tragweite erlangte die Entscheidung, mit der Chlodwig, der 511 starb, seine Nachfolge regelte. Er teilte das Reich unter seinen vier Söhnen auf. Niemand kann bis heute sagen, warum er dies so entschieden hat. Man verweist darauf, dass es auch bei anderen Völkern zeitweise mehrere Könige gleichzeitig gab. Aber das war keineswegs die Regel, und es gab sogar Völker, die gar keinen König hatten, wie die Sachsen. Eine andere Erklärung bringt die magische Kraft der merowingischen Abstammung ins Spiel, und zwar im Hinblick auf die Herkunft des mythischen Ahnherrn von einem halbgottähnlichen «Meerungeheuer mit Stierkopf» (bistea Neptuni Quinotauri similis, Fredegar III, 9). Die Gattin Chlodios soll von diesem Monster geschwängert worden sein und Meroveus geboren haben, eine Art Stammvater der «Merowinger». Diese Vorstellung von göttlicher Abkunft ging auf alle männlichen Mitglieder über, die deshalb alle denselben Anspruch auf das Erbe im Königtum erhoben. Eine andere Folge davon war, dass sich die Merowinger schon bald von der übrigen politischen Elite so weit abgrenzten, dass sie im Grunde nur noch untereinander heirateten und anderen Adelsfamilien die Nähe zum Königshaus verwehrten. Diese genetische Abschottung, die den Erneuerungsprozess der Dynastie beeinträchtigte, führte zum Niedergang des Königshauses. Ein dritter Vorschlag zur Erklärung der Reichsteilung unter die Söhne knüpft an die römische Tradition an: Im Römischen Reich hatte es längst mehrere Herrscher nebeneinander gegeben. Außerdem, so ist zu erkennen, wurde das Reich Chlodwigs nach den Prinzipien römischer Grenzziehung geteilt. Jeder Bruder erhielt seinen eigenen Hof und seine römischen Berater in seiner jeweiligen Hauptstadt (Reims, Soissons, Paris, Orléans). Bei der Zuteilung der Teilreiche wurde die Ordnung der römischen Stadtprovinzen (civitates) zugrunde gelegt, also die gewachsenen gallorömischen Strukturen; entscheidend waren die Steuereinnahmen jeder Region. Jeder der Söhne erhielt außerdem Anteil am fränkischen Kerngebiet (Francia) zwischen Rhein und Loire und am Gebiet des neu eroberten Aquitaniens.
Blieb auch die Idee von der Einheit des Gesamtreichs weiterhin bestehen, so war durch dieses Teilungsprinzip quasi zugleich mit der Errichtung des Frankenreichs auch der Keim zu seiner Auflösung gelegt. Das System der Erbteilung blieb fortan erhalten. Das Reich wurde wie ein Hausbesitz der Königsfamilie betrachtet. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil darin zum Ausdruck kommt, dass sich in der fränkischen Königsherrschaft von Beginn an keine Vorstellungen von einem abstrakten Reichsbegriff ausgebildet haben. Was die Konzepte von «Staatlichkeit» betrifft, so war die römische Tradition eines überzeitlichen Staatswesens offenbar rasch versiegt. Im Gegenteil: Das «Reich der Franken» stellte sich ganz als ein Verband von Personen dar, der auf den König zugeordnet war. Dieser wiederum verstand sich als eine Art Hausvorsteher, als senior, freilich mit der Vorgabe, dass diese Funktion, aus mythischen Wurzeln erwachsen, immer nur mit der Familie der Merowinger verbunden sein könne. Über diese mythologische Verklammerung war das Reich auch in seinen Teilen letztlich in der Familie der Merowinger vereinigt. Daher blieb die Vorstellung lange bestehen, dass es nur ein einziges regnum Francorum gebe, dessen Idee sich wie eine Klammer über alle Teilreiche legte und diese zusammenhielt.
In diesem Sinne bemühten sich die Nachfolger Chlodwigs auch gemeinsam nach Kräften, das Reich der Franken auf Kosten der Nachbarn auszudehnen. Im Inneren gab es allerdings unablässig Auseinandersetzungen und Versuche, sich gegenseitig umzubringen. Das Ergebnis war eine verwirrende und gewalterfüllte politische Geschichte in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten. In der Forschung hat man daher bereits erwogen, ob die Merowinger nicht auch in dieser Hinsicht viel von den Römern gelernt haben könnten …
Einen besonders unrühmlichen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung mit der grausamen Hinrichtung der Königin Brunhilde (Brunichilde) im Jahr 613. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich nach einem längeren Prozess die Teilreiche Austrien (Ostreich), Neustrien (Westreich) und Burgund als Größen herausgebildet, die auch künftig eine Rolle spielen sollten. Brunhilde, die Tochter des westgotischen Königs Athanagild, stammte aus dem alten Westgotenreich um Toulouse. Sie war die Gemahlin König Sigiberts I. von Austrien (gest. 575), der im Namen seiner Frau Ansprüche auf Gebiete der anderen Teilreiche erhob. Außerdem strebten die beiden danach, den Adel von Austrien einer straffen Verwaltung nach römischem Muster zu unterwerfen. Letztlich wurde von ihnen das Ziel eines fränkischen Einheitsreichs verfolgt.
Die Folge waren langjährige erbitterte Kämpfe im gesamten fränkischen Reich. Lange Zeit vermochte Brunhilde, eine starke Stellung zu behaupten – ihre Gestalt ging nicht von ungefähr in das Nibelungenlied ein. Die mächtigen burgundischen und austrischen Adligen suchten Hilfe bei König Chlothar II. von Neustrien (gest. 629) und lieferten ihm die Königin aus. Drei Tage lang wurde sie gefoltert, dann auf einem Kamel im ganzen Heer herumgeführt und schließlich mit den Haaren, einem Fuß und einem Arm an den Schwanz eines wilden Pferdes gebunden. Durch dessen Hufe und den rasenden Lauf sei die Königin schließlich in Stücke gerissen worden (Fredegar IV, 42). Dieses schreckliche Schauspiel bildete das Ende eines Vernichtungskampfes im Merowingerhaus, bei dem zehn Könige ihr Leben ließen.
Der Sieg Chlothars II., mit dem eine fünfzehnjährige Ruhephase im Reich einsetzte, war letztlich ein Sieg des austrischen Adels. Hier formierten sich die Kräfte, die ein neues Selbstbewusstsein entwickelten und ihre Macht schrittweise ausbauten. Zwei Männer ragten unter ihnen hervor, Bischof Arnulf von Metz (gest. um 640) und Pippin der Ältere (gest. 639), die Stammväter der Karolinger. Die Sammelbezeichnung «Karolinger» entwickelte sich erst später, weil der Name durch Karl Martell, Karl den Großen, Karl den Kahlen und andere Könige dieses Hauses eine besondere Bedeutung im Sinne von «großmächtiger Herrscher» oder gar Kaiser erlangte. Vom Stammvater in männlicher Linie her gesehen, müsste man eigentlich von «Arnulfingern» sprechen.
Der Sohn des Metzer Bischofs Arnulf war Ansegisel (gest. nach 657), der die Tochter Pippins namens Begga (gest. um 693) heiratete. Aus dieser Verbindung wiederum ging Pippin der Mittlere hervor (gest. 714), der den Aufstieg der Karolinger vorantrieb. Als sich seit 638/639 für 40 Jahre keiner der Merowingerkönige mehr durchsetzen konnte, gelang es ihm, die Besitzungen der Arnulfinger und Pippiniden im Zentrum Austriens zwischen Maas, Mosel und Rhein in seiner Hand zu vereinen. Um 675 erscheint er als «Herzog» (dux) in Austrien, und 687 errang er in der Schlacht bei Tertry an der Somme einen großartigen Sieg gegen seine sämtlichen Widersacher. Damit stand die Dynastie der Arnulfinger-Pippiniden an der Spitze des Reichs, denn Pippin der Mittlere übernahm das Amt des Hausmeiers (maior domus) für das gesamte Frankenreich. In dieser Stellung kontrollierte er den Königshof und führte den Befehl über das Heer.
Das Jahr 687 darf als Schlüsseldatum für die Geschichte des Frankenreichs gelten. Von nun an verlagerte sich das Zentrum der fränkischen Macht von Paris und dem Seine-Gebiet in das Land zwischen Maas und Mosel. Nicht mehr die merowingischen Könige, sondern der «karolingische» Hausmeier vereinte das Gesamtreich in seiner Hand. Auf dem Thron saßen zwar noch Merowinger, aber sie waren herabgesunken zu Kreaturen Pippins des Mittleren, der sich «Fürst der Franken» (princeps Francorum) nannte.
Nach dem Tod Pippins im Jahre 714 kam es nochmals zu einer kurzen Krise, als sein Sohn Karl sich der Angriffe des Adels von Neustrien zu erwehren hatte. Aber er konnte diese schwierige Lage rasch überwinden. «Wie die Sonne nach kurzer Finsternis ihre hellen Strahlen dem ganzen Erdkreis sendet, so leuchtete Karl, der würdigste Erbe Pippins, den ermatteten und schier ob des Heils verzweifelten Völkern als großmächtiger Beschützer», so beschrieben später die Fränkischen Reichsannalen diese Situation. So, als wäre Pippin von den Toten wieder auferstanden, sei der Sohn gegen die Feinde losgestürmt. Die Neustrier wurden 719 bei Soissons endgültig besiegt, und den Nachstellungen im eigenen Haus begegnete er damit, dass er seine Stiefmutter Plektrud in die Verbannung schickte.
Mit Karl beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des fränkischen Reichs. Von Kindheit an, so berichten die Quellen, sei er für den Krieg und das Militärwesen geschult worden. Später kam für ihn der Beiname Martell auf, der «Schmiedehammer», denn, so erklärt der Chronist Hugo von Flavigny, er habe alle benachbarten Reiche wie mit einem Hammer zermalmt. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Karl Martell eilte von Sieg zu Sieg, unterwarf 736 Aquitanien und 733 die Provence, fiel 720, 722, 724 und 738 in Sachsen ein, 725 und 728 in Bayern und plünderte von 718 bis 722 Friesland. Auch der Herzog der Alemannen, Theudebald, bekam den «Hammer» zu spüren und musste 732 die Flucht ergreifen. Aber noch heller als alle diese Heldentaten erstrahlte der Ruhm, den Karl Martell mit seinem Sieg über die Araber 732 bei Tours und Poitiers errang: 711 waren muslimische Berber unter ihrem Befehlshaber Tāriq ibn Ziyād über die Meerenge zwischen Afrika und Europa übergesetzt. Der Berg, an dem sie am 27. April landeten, wurde nach ihrem Anführer «Gibraltar» genannt, «Berg des Tarik» (Gabal Tāriq). In einem unaufhaltsamen Siegeszug überzogen sie die iberische Halbinsel, überquerten die Pyrenäen und fielen in das Frankenreich ein. Herzog Eudo von Aquitanien (gest. 735) konnte sie 721 erstmals aufhalten, und Karl Martell scheint sie in einer ganzen Reihe von Kämpfen bezwungen zu haben. Jedenfalls entstanden bald Lieder, die ihn als Sieger feierten und seinen Mythos begründeten. Die Muslime zogen sich auf die iberische Halbinsel zurück, wo sich mit der Zeit der Widerstand der Reconquista, das heißt, der christlichen Rückeroberung Spaniens, formierte.
Mit Karl Martell war die Übergangsphase von der spätantiken Welt zum mittelalterlichen Europa verbunden. Die innere Ordnung des Reichs wurde neu stabilisiert, das Heerwesen reformiert, eine neue Gefolgschaft aufgebaut, die Mission und der Ausbau der Kirche vorangetrieben. Die Bedeutung der Städte ging zurück, während die der adligen Herrenhöfe und ihrer Grundherrschaften auf dem Land zunahm. Es scheint, als habe Karl Martell auch damit begonnen, im Bereich seiner riesigen Besitzungen durch gezielte Maßnahmen die Erträge ganz erheblich zu steigern. Einem Salhof (Herrenhof) wurden planmäßig umliegende Bauernsiedlungen (häufig mit den Namen Osthofen, Westhofen und ähnlichen) zugeordnet und eine Art Flurbereinigung durchgeführt. Sein Enkel, Karl der Große, sollte dieses «Villikationssystem», dem ein Gutsverwalter (villicus) vorstand, dann weiter ausbauen und für das gesamte Reich verbindlich machen.
Erfolge ziehen Gefolgschaften an. Seine Krieger vermochte Karl Martell reich zu belohnen. Neben den eroberten Ländern zwang er auch die Klöster dazu, Teile ihrer Besitzungen an seine Krieger auszugeben. «Landleihe auf Befehl des Königs» (precaria verbo regis) nannte man dieses Vorgehen. Wieder, so könnte man sagen, ging die Erneuerung des Reichs wie einst in seiner Anfangszeit vom Militärwesen aus. Aber Karl Martell förderte auch die Mission, die vor allem von den Iren und den Angelsachsen betrieben wurde. Er unterstützte Pirmin (gest. 753), der unter anderen das Inselkloster Reichenau gründete und in Pirmasens begraben wurde, das seinen Namen dem Heiligen verdankt. Der Angelsachse Willibrord (gest. 739) wirkte als Bischof in Utrecht und bei den Friesen und errichtete das Kloster Echternach bei Luxemburg. Der berühmteste unter ihnen war Winfrid Bonifatius (gest. 754), ein Angelsachse aus Wessex. Sein Ziel war es, die Kirche im Reich der Franken der straffen römischen Ordnung und Organisation anzupassen. Bistümer sollten feste Grenzen haben und die Liturgie nach römischem Muster durchgeführt werden. Immer wieder stieß der unermüdliche Verkünder der römischen Normen auf Widerstand, ganz besonders im Klerus von Köln und Salzburg. Der Salzburger Bischof Virgil (gest. 784) war aus Irland gekommen, wo die Bildung in höchster Blüte stand, und so hatte dieser für den angelsächsischen und in seinen Augen ungebildeten Eiferer nur Spott übrig. Die Wirkung, die von Bonifatius ausging, der bei der Mission der Friesen nahe Dokkum den Märtyrertod erlitt, war dennoch groß. Sie bestand vor allem darin, dass die fränkische Kirche nun noch enger an Rom herangeführt wurde und sich auf diese Weise ein fester Kontakt zwischen dem Bischof von Rom und dem Hausmeier des Frankenreichs anbahnte. Die politische Elite der Franken begann ihren Blick nach Süden zu richten, während die fränkische Kirche einer Disziplinierung unterworfen wurde.
Als Karl Martell 741 starb, befand sich das Reich der Franken längst wieder im Aufwind. Nach anfänglicher Teilung des Reichs unter den Söhnen gelang Pippin dem Jüngeren 747 dessen Vereinigung in einer Hand, nachdem sein Bruder Karlmann – möglicherweise gezwungenermaßen – mit Frau und Kindern in ein Kloster eintrat. Diese Macht gedachte Pippin nicht mehr zu teilen. Zwar gab es mit Childerich III. seit 743 noch einen merowingischen Schattenkönig, aber um die Mitte des Jahrhunderts war für Pippin der Moment gekommen, selbst nach der Krone zu greifen. Nun zahlte es sich aus, dass die karolingischen Hausmeier eine starke adlige Gefolgschaft um sich geschart hatten und dass durch Bonifatius die Verbindung mit Rom vorbereitet worden war. Im Frühjahr 750 reiste eine fränkische Gesandtschaft zu Papst Zacharias (741–752), um ihm jene berühmte Anfrage zu unterbreiten, ob es gut sei oder nicht, wenn diejenigen im Frankenreich Könige seien, die keine Macht hätten (Fränkische Reichsannalen zum Jahr 750). «Papst Zacharias», so erfahren wir weiter, «gab Pippin den Bescheid, es sei besser, denjenigen als König zu bezeichnen, der die Macht habe, als den, der ohne königliche Macht blieb.» Und dann folgt ein bedeutungsvoller Satz: «Damit die Ordnung nicht zugrundegerichtet werde, ließ er kraft seiner päpstlichen Autorität Pippin zum König machen» (ut non conturbaretur ordo, per auctoritatem apostolicam iussit Pippinum regem fieri). Mit dem Wort ordo war die göttliche Weltordnung gemeint, in der alles und jeder seinen Platz zum Wohl des Ganzen auszufüllen hatte. Wenn einer aber nur den Namen trägt und nur als König bezeichnet wird, ohne diese Funktion auch faktisch auszuüben, dann war er dieser Idee zufolge ungeeignet und musste ersetzt werden. Diese Vorstellungen gehen auf den Kirchenvater Augustinus (354–430) zurück, der die göttliche Ordnung als das Zusammenwirken der vielfältigen, auch divergierenden Kräfte in einer wunderbar geordneten, gottgewollten Harmonie beschrieb und mit Hilfe der Kirche auf Erden verwirklicht sehen wollte. Die «Verwirrung» (conturbatio) dieser Ordnung galt als das Böse schlechthin, gelenkt von den teuflischen Mächten. So wurde mit diesem päpstlichen Bescheid an Pippin in verschlüsselter Weise zum Ausdruck gebracht, dass auch die Unfähigkeit der Merowingerkönige vom Bösen und Verfolger der Kirche selbst verursacht worden sei. Der Karolinger Pippin wurde dagegen in die Rolle des im Sinne der Kirche guten und gottgewollten Königs gerückt.
Damit war das Ende des alten Königshauses gekommen. Childerich III., der «falsche König» (qui false rex vocabatur), wurde geschoren und mitsamt seinem unmündigen Sohn zu lebenslanger Haft ins Kloster Saint-Bertin geschickt. Die fränkischen Gefolgsmänner stimmten dem Wechsel im Königtum verständlicherweise zu, und 751, wohl am Weihnachtstag, nahm, wie die Quellen andeuten, Bonifatius selbst die Salbung vor.
Die Forschung ist sich uneins darüber, ob mit der kirchlichen Salbung ein neues Element in die fränkische Königserhebung Einzug hielt oder ob man einen alten Brauch der Merowinger weiterführte. Alle Umstände weisen aber doch wohl recht eindeutig darauf hin, dass die Königssalbung Pippins ihm vor allem eine neue Legitimation verschaffte, mit der das Königtum der Merowinger gerade nicht einfach fortgesetzt werden sollte. Die Deutung wird bestätigt durch den Bund gegenseitiger Liebe, der drei Jahre später, 754, zwischen dem Papst Stephan II. (752–757) und Pippin in Quierzy geschlossen wurde. Dort kam es auch zu der berühmten Pippinischen Schenkung, mit der Pippin dem Papst weitreichende Gebietszusagen in Italien machte. Schließlich wiederholte der Papst in der Kirche von Saint-Denis den Salbungsakt. Die Königssalbung, das Zeichen des göttlichen Auftrags, lässt sich somit als hauptsächliches Merkmal der neuen Königslegitimation erkennen. Doch muss man hinzufügen, dass auch Pippins Sohn Karl und dessen jüngerer Bruder Karlmann die Salbung erhielten und Pippins Gemahlin Bertrada den päpstlichen Segen empfing. Damit ging die neue Herrschaftslegitimation auf die gesamte Familie über, mithin auf das karolingische Königshaus, das an die Stelle des merowingischen trat. Diese Beobachtung ist wichtig, weil sich damit erklären lässt, dass auch die Karolinger das Reich als eine Art groß dimensionierter Hausherrschaft verstehen konnten. In diese Richtung weist ebenso der Befehl des Papstes an die Franken, sie dürften niemals einen König aus einem anderen Geschlecht erheben.
Zusätzlich verlieh der Papst dem neuen König den Ehrentitel eines Patricius der Römer. Der Patricius war bis dahin der Stellvertreter des in Konstantinopel (Byzanz) residierenden römischen Kaisers, der in Rom die weltliche Herrschaft innehatte. Eigentlich hatte der Papst darüber gar kein Verfügungsrecht, aber mit der Übertragung dieses Amtes legte sich auch der Papst eine neue Autorität zu – nämlich in der Lage zu sein, wie ein Kaiser in hohe weltliche Machtpositionen einzuweisen. Pippin war nunmehr mit dem Auftrag ausgestattet, anstelle des Kaisers von Byzanz den Schutz über Rom und St. Peter auszuüben. Dass es von hier bis zur Übernahme der Kaiserwürde durch einen fränkischen Herrscher kein großer Schritt mehr war, deutet sich an. Bezeichnend ist im übrigen, dass Pippin das Amt des Hausmeiers (maior domus), das ihm den Aufstieg erst ermöglicht hatte, nicht wieder besetzte. Auf diesem Wege sollte ihm kein Konkurrent mehr entstehen.
Das Reich der Franken war solchermaßen ein zweites Mal begründet worden. Dieses Mal erscheint es nicht mehr als Ableger des Römischen Reichs, sondern vereinigte in einer neuen Synthese die dominierenden politischen und kirchlichen Kräfte im westlichen Europa. Die Verbindung mit dem Papsttum verschaffte dem karolingischen Königtum nicht nur eine neue Legitimation, sondern auch neue Handlungsspielräume, die den Charakter des Reichs weitgehend beeinflussen sollten.
Menschen im Reich der Franken
Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Diese biblische Erkenntnis (Genesis 2,18) hatte in den verschiedenen Zeiten einen unterschiedlichen Stellenwert. Das Individuum, der «Single», ist in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht in manchen Großstädten wie München oder Berlin schon der Normalfall. Vor eintausend und mehr Jahren jedoch wäre er nicht überlebensfähig gewesen. Von überall her drohte Gefahr. Bedroht etwa von den Unbilden der Witterung – von Stürmen, Eis und Kälte, Hitze und Dürre –, waren die Menschen in höchstem Maße von der Natur abhängig. Ungewöhnliche Naturereignisse mussten daher die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn sie schienen Veränderungen zu signalisieren, auf die man achten musste. Neben der christlichen Religion mit ihrer Deutungshoheit für den Weltenlauf blieb daher weiterhin auch die traditionelle heidnisch-mythische Interpretation der Naturereignisse lebendig. Erscheinungen von Kometen riefen höchste Erregung in der Bevölkerung hervor. So berichtet der sogenannte Astronomus in seiner Lebensgeschichte Kaiser Ludwigs des Frommen zum Jahre 837 folgendes (Kapitel 58): Am Osterfest dieses Jahres sei ein Komet im Sternbild der Jungfrau aufgetaucht. Er habe in 25 Tagen die Zeichen des Löwen, des Krebses und der Zwillinge durcheilt und habe endlich am Kopf des Stieres seinen feurigen Leib mit dem langen Schweif niedergelegt. Der Kaiser selbst habe erkannt, dass dies als Zeichen für «die Veränderung des Reichs und den Tod des Fürsten» zu deuten sei: Mutationem enim regni mortemque principis hoc monstrari portento dicitur. Daraufhin habe er sich ganz den Lobgesängen und Gebeten zu Gott hingegeben.
Noch schlimmer war es, wenn Heuschreckenschwärme einfielen, wie im Jahre 873, «Würmer mit vier Flügeln und sechs Füßen, … einem breiten Maul, einem langen Magen und zwei steinharten Zähnen», die alles, was sie auf den Äckern fanden, in Windeseile verzehrten (Annalen von Fulda). So war die Furcht ein ständiger Begleiter der Menschen, stets sah man sich bedroht. Doch all dies wurde übertroffen von der Angst vor dem Jüngsten Gericht. Nur bei Gott und den Heiligen konnte man Schutz und Rettung erflehen und finden. So stifteten die Reichen Kirchen und Klöster und ließen aus Rom die Gebeine von Heiligen und Märtyrern herbeischaffen. Der Reliquienhandel blühte auf, und Betrüger machten ihre Geschäfte, indem sie einbalsamierte Mäuse und ähnliches als heilige Gegenstände feilboten.
Nicht zuletzt war das Überleben damit verknüpft, wie man sich in den unausgesetzt wütenden Kriegen behauptete. Das unfreie Volk war zwar häufig Ziel von Plünderung und Mord, aber unter günstigen Umständen konnte es sich in die Wälder flüchten und retten. Der adlige Krieger hingegen konnte dem Kampf nicht ausweichen, und damit erklärt es sich, dass gerade im Adel die Lebenserwartung besonders niedrig war. Im Durchschnitt konnte man mit einer Lebensdauer von 30 Jahren rechnen. In solch bösen Zeiten musste man sich zusammenschließen. Nur als Teil einer Gruppe konnten die Menschen bestehen, eingebunden in eng geknüpfte Beziehungen von Verwandten und Freunden, von Kriegergefolgschaften, religiösen Gemeinschaften, grundherrschaftlichen Verbänden oder Gilden.
Die wichtigste Gruppe war mit der Sippe vorgegeben. Sippen basierten auf Verwandtschaft, aber das Rangsystem einer Sippe war keineswegs festgelegt. Es richtete sich nach dem Ansehen und der Durchsetzungskraft einzelner Mitglieder. Um deren «Haus» gruppierten sich dann die näheren und entfernteren Verwandten. Diese Konzentration auf einen Sippenverband mit ihren Zentren in «Häusern» führte dazu, dass Sippen- oder Stammeszugehörigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Ehefrau beziehungsweise des Ehemanns wurde, um den Fortbestand solcher Personengemeinschaften zu erhalten und zu festigen. Daher heiratete man selten über Stammesgrenzen hinweg. Für die Sachsen bestätigt dies der Annalist Rudolf von Fulda im frühen 9. Jahrhundert: Diese hätten sorgfältig darauf geachtet, sich nicht mit anderen Völkern zu verbinden. «Deshalb», so stellte er fest, «haben sie auch fast alle dieselbe Gestalt und Leibesgröße und dieselbe Haarfarbe».
Die Wahl des Ehepartners war von größter Bedeutung, weil davon der weitere Bestand ganzer Personengemeinschaften abhängen konnte. Eine Heirat war deshalb nicht in das Belieben eines einzelnen gestellt, sondern musste von den Sippen sorgfältig vorbereitet werden, um nicht durch eine falsche Partnerwahl vielleicht Unglück über viele Menschen zu bringen. In gründlich ausgehandelten Verträgen schlossen die beteiligten Sippen einen Ehevertrag im Rahmen der Verlobung (desponsatio). Diese bildete bereits den rechtserheblichen Akt einer Ehebindung, auch wenn die Ehepartner noch Kinder waren. Dazu gehörte auch die Festlegung der Brautausstattung, die von der Familie der Braut aufzubringen war und in das neue «Haus» überging. Der Bräutigam seinerseits hatte die Brautgabe, das sogenannte Wittum (dos) – Ländereien, Vieh und Hörige – einzubringen, um damit seiner künftigen Frau eine Sicherheit zu verschaffen, falls sie Witwe werden sollte. Waren diese Voraussetzungen geklärt, wurde die Braut dem Bräutigam in ritueller Weise in einem Festakt übergeben (traditio) und, wenn sie noch minderjährig war, nicht selten im Haus der Eltern des künftigen Ehemannes erzogen. Die Kirche war an allen diesen Vorgängen zunächst gar nicht beteiligt. Noch blieb die Hochzeit ein rein weltlicher Akt. Der Vollzug der Ehe folgte, wenn die Braut zumindest 12 Jahre alt war und die Geschlechtsreife erreicht hatte. Inwieweit dieser Vollzug bereits in fränkischer Zeit als symbolischer Akt im Beisein von Sippenmitgliedern erfolgte, ist nicht geklärt. Den ersten Nachweis eines öffentlichen «Beilagers» haben wir erst aus der Zeit um 1200. Dabei handelt es sich ausgerechnet um die Heirat der heiligen Elisabeth von Thüringen.
Schon in fränkischer Zeit begann freilich die Kirche, sich in die Regeln und Rituale der Eheschließung einzumischen. So wurde auf der Grundlage der mosaischen Gesetze des Alten Testaments etwa die Verwandtenehe zurückgewiesen. Die «Nahehe» sollte nach kirchlicher Auffassung nicht mehr rechtsgültig sein. Auch sollte die Trennung einer Ehe im Prinzip nicht oder nur mit kirchlicher Billigung möglich sein. All das stieß auf entschlossenen Widerstand vor allem beim Adel, der seine Besitzungen zusammenhalten wollte. Aber die Kirche begann, die neue Eheordnung in hartnäckig geführten Eheprozessen durchzusetzen.
Dies zeitigte schwerwiegende Folgen. Eine davon war, dass im 9. Jahrhundert eines der fränkischen Teilreiche, nämlich das lotharingische Mittelreich, das die Klammer für das fränkische Gesamtreich bilden sollte, unterging. König Lothar II. (gest. 869) wollte sich von seiner Gemahlin Theutberga, die ihm keine Kinder gebar, trennen und seine Nebenfrau Waldrada heiraten, von der er einen Sohn hatte. Mit diesem Vorhaben scheiterte er allerdings an der Weigerung des Papstes, der Scheidung zuzustimmen. Daher galt sein Sohn als illegitim, sein Haus starb aus und sein Reich ging unter.
Eine weitere Forderung der Kirche bestand darin, dass eine Braut in die Heirat einwilligen müsse. Die Kirche war daher auf lange Sicht gesehen die Wegbereiterin der Liebesheirat. Auch das konnte von den Sippen dieser Epoche nicht akzeptiert werden, denn damit hätten Mädchen, nicht selten minderjährig, über das Schicksal ganzer Personenverbände entschieden.
Von nicht geringerer Bedeutung als die Sippenverbände war die Gruppenbildung durch Freundschaft (amicitia) und Treue (fides). Freundschaft und Gefolgschaft sind dabei kaum zu trennen, wie die jüngere Mittelalterforschung immer deutlicher herausgearbeitet hat. Lange Zeit war man der Meinung, dass Gefolgschaftsverbände in fränkischer Zeit vor allem durch die rechtliche Bindung der Lehnsbeziehung hergestellt worden seien. Das System der wechselseitigen Treue zwischen dem Herrn und seinem Gefolgsmann habe das Lehnswesen hervorgebracht, bei dem der Lehnsmann mit der Wohltat (beneficium) einer Landleihe ausgestattet worden sei und dafür fortan Dienst und Gehorsam zu leisten gehabt hätte. Insbesondere für die Zeit Karls des Großen hat man schon ganze Lehnssysteme, Vasallenheere oder gar eine die Verfassung strukturierende «Lehnspyramide» konstruiert. Davon rückt man heute immer mehr ab. Vielmehr richtet man den Blick auf «Freunde und Getreue», die den Kreis der Haus- und Kampfgenossen bildeten und durch Freundschaftsbeziehungen, die Vertragscharakter besaßen, miteinander verbunden waren. Dieses «System» basierte im Prinzip auf Gleichrangigkeit: Facti sunt amici – «Sie haben sich zu Freunden zusammengeschlossen». Auch Könige schlossen solche Freundschaftsbündnisse – so Karl der Große mit dem König von Galizien und Asturien, den Königen von Schottland und sogar dem Kaiser von Byzanz.
Zur Freundschaft trat der Eid hinzu. Die «Eidgenossenschaft» oder «Schwurfreundschaft» bildete eine besonders dauerhafte Vereinigung. Eine der frühen, berühmten Schwureinungen wurde durch die Straßburger Eide von 842 geschaffen. Damals war das fränkische Reich in den ersten blutigen Bürgerkrieg geraten. Drei Brüder, Lothar I. (gest. 855), Ludwig der Deutsche (gest. 876) und Karl der Kahle (gest. 877), waren nach dem Tod ihres Vaters, Ludwigs des Frommen (gest. 840), wegen des Erbes übereinander hergefallen. Der Konflikt gipfelte in der Schlacht von Fontenoy am 25. Juni 841. Es war der Tag der mörderischsten und wohl auch erbärmlichsten Schlacht, die die Franken gegeneinander austrugen. Ein Augenzeuge, Angilbert, beschreibt, wie «der Bruder dem Bruder den Tod gab, der Onkel dem Neffen, der Sohn dem Vater». Als die Schlacht zu Ende war, befahlen die Bischöfe ein mehrtägiges Fasten und Beten wegen der Sünde, dass so viel christliches Blut vergossen worden war. Um eine neue Handlungsgrundlage zu schaffen, bemühten sich Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle, wechselseitige Liebe zu zelebrieren. Man tauschte Geschenke aus und ließ die Getreuen in Gastmählern Eintracht feiern. Um das immer noch vorherrschende Misstrauen auszuräumen, wurde schließlich am 14. Februar 842 in Straßburg zwischen den Brüdern im Beisein ihrer Gefolgsleute ein feierliches Bündnis geschlossen. Es fand seinen Höhepunkt in den Straßburger Eiden, die von den Brüdern öffentlich in romanischer (lingua Romana) und in «deutscher» Sprache (lingua Teudisca) geschworen wurden: «Aus Liebe zu Gott und zur Erlösung des christlichen Volkes und um unser beider Wohl will ich von diesem Tag an in alle Zukunft, so mir Gott Wissen und Macht dazu gibt, diesen meinen Bruder sowohl in Hilfeleistung wie auch in anderer Hinsicht so halten, wie man von Rechts wegen seinen Bruder halten soll, unter der Voraussetzung, dass er mir dasselbe tut.» Auch die beiden Gefolgschaften vereinigten sich durch Eide in romanischer und in «deutscher» Sprache.
Diese Eide wurden von dem Chronisten Nithard (Historiarum Libri Quattuor) aufgeschrieben und sind uns dadurch erhalten geblieben. Sie gehören zu den ältesten Zeugnissen der althochdeutschen und der altfranzösischen Sprache – und sie bezeugen, dass nunmehr Herrschaftsbereiche der karolingischen Könige auch als Sprachbereiche erscheinen. Die Zugehörigkeit zu einem Reich wurde nun erstmals durch die gemeinsame Sprache zum Ausdruck gebracht. Dabei darf die lingua Teudisca aber noch nicht als «deutsche Sprache» verstanden werden, sondern als «Sprache des Volks» im Gegensatz zum Lateinischen. Immerhin wird mit dieser Umschreibung doch ein bestimmter, sich auch politisch definierender Teil des fränkischen Reichs erfasst. So könnte man sagen, dass sich hier eine Gemeinschaft konstituierte, die über ein Freundschaftsbündnis zu wachen hatte und deren Hauptsprache auf der einen Seite romanisch und auf der anderen Seite fränkisch war – immerhin eine erste wichtige Station auf dem weiten Weg, den die «Deutschen» zu sich selbst zurückzulegen hatten.
Alle diese Gruppen und Gemeinschaften, in denen die Menschen im Frankenreich sich organisierten, gaben ihren Mitgliedern Regeln und Wertenormen, gewissermaßen kollektive Erwartungen, vor. Ihnen hatte sich jeder zu unterwerfen. «Von Rechts wegen» hatte man sich in bestimmter Weise zu verhalten – ein Bruder gegenüber einem Bruder oder ein Gefolgsmann gegenüber seinem Herrn (senior) oder seinen Mitstreitern. Was das Recht war, war freilich nicht aufgeschrieben. Es wurde vielmehr «gelebt» und in öffentlichen Inszenierungen immer wieder gefunden und der Gemeinschaft vor Augen gestellt. Alle Handlungen und Entscheidungen liefen in Reden, Ritualen und Gebärden ab, wurden auf diese Weise öffentlich kontrolliert und, sollten sie gültig sein, bestätigt. In rituellen Handlungen suchten sich die Gruppen ihrer Gemeinschaft zu vergewissern.
Auch der gesamte Bereich der Konfliktregelung war vom Ritual bestimmt. In Konflikten, die nicht mit Gewalt ausgetragen werden sollten, einigten sich die Parteien auf Vermittler oder auf Schiedsrichter, deren Spruch sich die Beteiligten zu unterwerfen versprachen. Dieses Verfahren bot in den Augen der damaligen Menschen einen höheren Grad an Effizienz als ein Gerichtsverfahren. Über die Zusammensetzung des Schöffenkreises bei Gericht konnte ein Gerichtsherr das Verfahren beeinflussen, konnte sogar selbst gleichzeitig Vorsitzender und Partei sein. Eine Anklage bedeutete meist schon eine Verurteilung, und ein Gerichtsbeschluss, wurde er denn durchgeführt, ließ neue Konflikte entstehen. Ganz anders das Schlichtungsverfahren: Hier konnte man einen Weg finden, der allen Beteiligten half, ihr Gesicht zu wahren, der auch sogleich, hatte man sich einmal geeinigt, den Frieden herstellte. Das ganze System war also nicht auf Bestrafung ausgerichtet – dieses Prinzip der Strafgerichtsbarkeit, das zum modernen Rechtsdenken überleitete, setzte sich erst im hohen Mittelalter durch –, sondern auf die Herstellung des Friedens. Im Friedensmahl konnte die neue Einigkeit und Versöhnung dann wieder rituell demonstriert werden.
Das Mahl bot auch sonst ein Forum der öffentlichen Ordnung. Das festliche Mahl vereinte Freunde und Gefolgsleute, lockte Freunde an den Hof des Feiernden, stellte seine Herrschaft und Herrlichkeit zur Schau. Dieser führte seine mit Teppichen und Tüchern geschmückten Räume vor, tischte köstlichen Wein und leckere Speisen in kostbaren Gefäßen auf und zeigte damit seinen Rang. Entsprechende Anlässe gerieten gleichsam zu einer Bestandsaufnahme seiner Macht. Von besonderer Bedeutung waren dabei kirchliche Hochfeste, adlige Hochzeiten, Königskrönungen, Hoftage, Begräbnisfeierlichkeiten oder Friedensschlüsse. Auch die Jagd spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Trafen sich Könige, wurden kostbare Geschenke ausgetauscht und Prestige und Status in den Ritualen des Auftretens sichtbar gemacht. Herrschaftszeichen, Gaben, Kleider und Gebärden machten Leute. Kostbare Gewänder waren unabdingbar für den Herrn, weil sie sein Herrentum zeigten. Bei Frauen kam das Geschmeide hinzu, der Schmuck aus Gold, Silber und Edelsteinen. Bei Männern war es vor allem das Wehrgehänge mit dem Schwert.
All dies gehörte zur Verfassung der Gesellschaft und der politischen Ordnung des fränkischen Reichs. Die hohe Bedeutung dieser Ordnungsmechanismen und Instrumentarien zu begreifen, ist unverzichtbare Voraussetzung für das Verständnis von Handlungsweisen und Entscheidungen einzelner Personen und der Geschichte dieser Epoche im Ganzen. Unter diesem Blickwinkel wird auch deutlich, wie weit entfernt jene Gesellschaft – trotz ihrer Nähe zum Römischen Reich – von einer Vorstellung «staatlicher» Ordnung gewesen ist, die wir mit diesem Begriff verbinden.
Das kulturelle Leben wurde von den Klerikern und den Mönchen getragen. Sie waren vom 8. Jahrhundert an mehr und mehr die einzigen, die im Reich der Franken lesen und schreiben konnten. Vor allem die Klöster wurden zu Zentren kultureller Vermittlung, als die Mönche damit begannen, die antiken Autoren auf Pergament abzuschreiben und sie damit der Nachwelt zu erhalten. Nur in Klöstern und Domschulen wurden Sprach- und Denkhorizonte entwickelt, innerhalb derer wenigstens gewisse Grundlagen einer abstrakten Begrifflichkeit existierten. Ein überzeitliches, transpersonales Denken war schon von den sprachlichen Voraussetzungen her kaum entwickelt. Auch das gilt es heute zu beachten, wenn der Charakter der «Staatlichkeit» dieses Reichs beschrieben werden soll.
Im Bewusstsein der Zeitgenossen war die Vorstellung großer Organisationen ausschließlich über personale Beziehungen oder organologische Modelle denkbar: Die Kirche stellte dafür die Idee vom Leib Christi mit seinen Gliedern und Organen zur Verfügung. Dieses Konzept konnte man auch zur Deutung der «staatlichen» Ordnung einsetzen – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man das Reich als kirchliche Einrichtung verstand, gleichsam als «Gottesstaat». Daneben gab es das Modell von der gesellschaftlichen Gliederung in drei Stände: die Mönche, die Kleriker und die Laien. Diese Ordnung, die vor allem im 9. Jahrhundert die gesellschaftliche Deutung bestimmte, basierte auf der Bibel. Sie war auf dem jeweiligen Heilswert der drei Gruppen gegründet. Die Mönche folgten einer Lebensweise, die ihr eigenes Seelenheil garantierte. Die Kleriker waren schon einigermaßen tief in die säkularen Dinge verwoben, so dass sie den Mönchen im Heilswert ihrer Lebensweise unterlegen waren. Die Laien schließlich hatten die geringsten Aussichten, ihr Leben den Anforderungen christlicher Gebote in ausreichendem Maße anzupassen.
Demgegenüber waren Konzepte öffentlich-säkularer Ordnung in den Jahrhunderten des fränkischen Reichs so gut wie nicht vorhanden. Man dachte in den Kategorien von Sippe, «Haus» und Hausgenossen, Verwandtschaft und Gefolgschaft, Kampfgemeinschaft und Gebetsbruderschaft, Mächtigen und Armen. Bei den Mönchen herrschte wie in der weltlichen Ordnung das Modell der väterlichen Gewalt vor. Der abbas, der Abt, war schon von der Wortbedeutung her nichts anderes als der «Vater» seiner Mönchsgemeinschaft, der mit väterlicher Liebe und auch väterlicher Strenge seinen Konvent zu leiten hatte. Der Abt, so lesen wir in der Regel des heiligen Benedikt, solle daran denken, dass er seine Mönche wie Söhne behandle. Der eine brauche Güte, ein anderer bedürfe des Tadels, wieder ein anderer des guten Zuredens. Der Abt müsse sich daher auf die Eigenart eines jeden einzelnen einstellen und sich danach richten, so dass er nicht nur die ihm anvertraute Herde vor Schaden bewahre, sondern sich auch am guten Gedeihen aller erfreuen könne. Am Ende der Tage müsse er Rechenschaft über alle diese Seelen ablegen (Benediktregel, Kapitel 2).