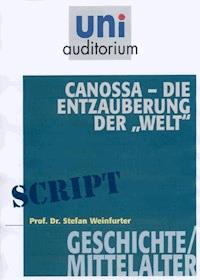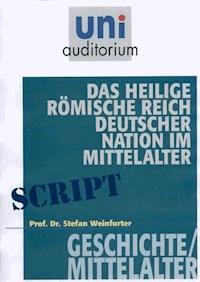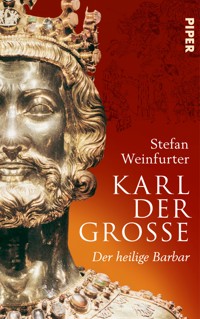
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele haben versucht, Karl den Großen für sich zu vereinnahmen. War der erste Kaiser des Abendlandes nun Deutscher, Franzose oder gar der Vater Europas? Und was weiß man jenseits aller Legenden tatsächlich von ihm? Nicht nur die Menschen seiner Zeit, sondern auch die Nachwelt ist bis heute von dem Frankenherrscher fasziniert: ein überaus erfolgreicher und brutaler Kriegsherr, der in einem jahrzehntelangen Kampf die heidnischen Sachsen missionierte, die germanischen Stämme vereinte und ein Großreich errichtete. Ein Bildungshungriger, der zwar selbst kaum schreiben konnte, aber doch die Verbreitung der Schrift förderte, die wir noch heute schreiben. Ein Herrscher, der sich in seiner Aachener Pfalz entspannt den Badefreuden hingab und der an seinem Hof die bedeutendsten Dichter und Denker Europas versammelte. Stefan Weinfurter, der bekannte Heidelberger Mittelalterforscher, zeigt die vielen Gesichter Karls des Großen und bringt uns einen der charismatischsten Herrscher des Mittelalters nahe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Brigitte
Juni 2015
ISBN 978-3-492-96384-8
© Piper Verlag GmbH, München 2013
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: dpa/akg-images (Büstenreliquiar Karls des Großen)
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Vorwort
»›Seine Gedanken‹, so sagt Cicero, ›schriftlich niederzulegen, ohne sie zu ordnen, schön zu formulieren und den Leser damit zu ergötzen, heißt Zeit und Schrift zu vergeuden.‹ Dieser Ausspruch des großen Redners hätte mich vom Schreiben abschrecken können, wäre ich nicht von dem Entschluss geleitet gewesen, mich lieber der Kritik auszusetzen und durch diese Arbeit den Ruf meines Talents in Gefahr zu bringen, als vor lauter Bedachtsamkeit die Erinnerung an einen so großen Mann unbeachtet zu lassen« (So heißt es bei Einhart in seiner Vorrede zur ›Vita Karoli Magni‹). Wie für den berühmten Biografen und Zeitgenossen Karls ist auch heute noch die Beschäftigung mit Karl dem Großen ein überaus reizvolles Unterfangen – trotz der Flut von Forschungen, vor allem aus der angelsächsischen Wissenschaft. Es sind die ungewöhnliche Bündelung der Kräfte und die enorme Effizienzsteigerung auf allen Gebieten der Gesellschaft, Politik und Kultur, die von dieser Epoche ausgehen und jeden, der sich damit beschäftigt, in ihren Bann ziehen.
Die Begeisterung für dieses Thema hat sich zu meinem Glück auch auf das Team meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter übertragen, sodass ich von ihrer Seite wertvolle Unterstützung erfuhr. Eigens bedanken möchte ich mich bei Frau Theresa Jäckh, Frau Nora Küppers und Herrn Florian König. Darüber hinaus haben die Fachgespräche mit dem Team meines Heidelberger Forschungsprojekts »Wissenstransfer von der Antike ins Mittelalter«, dem Herr Priv.-Doz. Dr. Tino Licht, Frau Dr. Julia Becker, Frau Dr. Natalie Maag und Frau Kirsten Tobler angehören, wichtige Anregungen geliefert. Am Heidelberger Marsilius-Kolleg, an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, an der Universität München und am Deutschen Historischen Institut Rom hatte ich Gelegenheit, Grundgedanken zu meiner These der »Vereindeutigung« vorzutragen und zu diskutieren. Mein Kollege Prof. Dr. Bernd Schneidmüller hat schließlich klaglos die Last einer inhaltlichen Überprüfung auf sich genommen. Alle seine kundigen Anregungen, für die ich ihm sehr dankbar bin, sind in die Darstellung eingeflossen.
Ein besonderer Dank geht auch an Frau Kristin Rotter vom Piper Verlag, nicht nur für die professionelle Betreuung, sondern auch für ihren Mut, an dem Vorhaben trotz manch unvorhersehbarer Umstände festgehalten zu haben. Frau Dr. Heike Wolter danke ich für die wertvolle Lektoratsarbeit. Meiner Familie zu danken ist schließlich das Mindeste angesichts der Tatsache, dass sie für mehrere Monate eigentlich nur noch »Karl« vor sich hatte. Dieser wird hiermit in die Öffentlichkeit entlassen.
Heidelberg, im Juli 2013
KAPITEL 1
Fern oder nah? Unser Verhältnis zur Epoche Karls des Großen
Karl der Große regierte das Frankenreich von 768 bis 814, fast ein halbes Jahrhundert – ungewöhnlich lang für einen Herrscher des Mittelalters. Eine solche Zeitspanne bot ihm die Gelegenheit, Zeichen zu setzen, Weichen zu stellen und seine Persönlichkeit in das politische Geschehen in hohem Maße einzubringen. Wie hat er diese Möglichkeiten genutzt? Und vor allem: War er ein guter oder ein böser Herrscher? Gerade die letzte Frage beschäftigt die Forschung seit vielen Jahren.
Es gab Zeiten, da hat man ihn dafür gelobt, dass er die Grundlagen für das Abendland gelegt und der christlichen Kirche zum Durchbruch verholfen habe. Er galt geradezu als der strahlende »Vater Europas« (pater Europae) – ein Zitat aus dem zeitgenössischen ›Paderborner Epos‹ (kurz vor 800) – oder als »Baumeister Europas«, um ein Zitat aus der Forschung des 20. Jahrhunderts anzufügen.1 Ihm – so lautete die überwiegende Meinung – sei die Basis des künftigen Europa zu verdanken. Jahrhundertelang sah man in ihm das Vorbild des mächtigen, gerechten, barmherzigen, siegreichen und untadeligen Herrschers. Darüber hinaus wurde er nicht nur zum Stammvater der französischen Könige, sondern als ›heiliger Karl‹ auch die Symbolfigur für das römisch-deutsche Kaisertum. Dieses Bild des glanzvollen Kaisers entwickelte eine starke Ausstrahlungskraft, die bis in unsere Zeit hinein wirkt. Also ein guter Kaiser?
Doch weist die Forschung auch schon lange auf die dunklen Seiten dieses Herrschers hin. War er nicht auch ein »brutaler«, ja »kaltblütiger und berechnender« oder »verschlagener« Barbar, wie einige der jüngeren Urteile lauten? Ließ er nicht seine Gegner mitsamt Frauen und Kindern töten? Hatte er nicht Tausende von Sachsen, Awaren und Langobarden auf dem Gewissen und das bayerische Fürstenhaus Tassilos III. ausgelöscht? Führte er nicht, wie eine spätere Legende ausmalte, ein liederliches und ausschweifendes Leben, sodass bei seinem Tod die Teufelsschar schon bereitgestanden habe, um seine Seele in die ewige Finsternis zu führen? Beugte er nicht den Adel, der sich gegen seine Gewaltaktionen erhob, gnadenlos nieder? Also ein böser Kaiser?
Die Frage ist auch heute nicht gelöst. Es scheint aber doch so zu sein, dass Karls Glanz etwas im Schwinden begriffen ist. Der große Karl wird kleiner. Das hängt damit zusammen, dass auch ›Europa‹ zunehmend seine Attraktivität verloren hat, oder besser: dass die Vorstellung von Europa als einem kulturellen und zivilisatorischen Vorsprungs-Kontinent mittlerweile nicht mehr gilt. ›Eurozentrismus‹ zählt heute – ebenso wie die Kategorie der Nation – zu den gröbsten Verirrungen der Geschichtswissenschaft (und anderer Wissenschaften). Auch die Idee von einem ›Christlichen Abendland‹ hat längst ihre Kraft verloren angesichts moderner Sehnsüchte nach einer transkulturellen Gesellschaft, in der sich auch die Religionen in einem ständigen Bewegungsfluss gegenseitig befruchten mögen.
Die Bewertung, ob ein Kaiser des Mittelalters gut oder böse war, hängt entscheidend von unserem eigenen Wertekanon und unseren Vorstellungen von guten oder schlechten Ordnungsmodellen in Politik und Gesellschaft ab. Können wir bei einer Darstellung Karls des Großen dieser Gebundenheit, in der wir uns befinden, und den daraus entstehenden Vorurteilen entkommen? Dafür ist es zuallererst erforderlich, die Normen und Kriterien für das Handeln des Herrschers aus den Bedingungen seiner eigenen Zeit heraus zu erschließen. Wir müssen versuchen, nicht nur das Handeln zu beschreiben, sondern auch die dahinterstehenden Konzeptionen von politischer und gesellschaftlicher Ordnung zu entschlüsseln.
Bei Karl dem Großen befinden wir uns in dieser Hinsicht in einer guten Lage, denn gerade zur Frage der ideellen, konzeptionellen und moralischen Grundlagen seines Handelns gibt es eine Vielzahl an Quellen. Freilich stammen sie in der Hauptsache nicht von ihm persönlich, sondern von den Menschen in seiner Umgebung, insbesondere den Gelehrten an seinem Hof. Insofern wird man stets Vorsicht walten lassen müssen und die Aufmerksamkeit darauf zu richten haben, inwieweit sich hier nur ein ideales Herrscherbild niedergeschlagen hat. Die Autoren der Quellen brachten ja ihre eigenen Wünsche und Interessen ein oder waren zumindest in kollektive Vorstellungszirkel eingebunden. Aber das sollte uns nicht zu voreiliger Geringschätzung dieser Quellen führen, denn die Bilder Karls, die sie bieten, sind immerhin Ausdruck des ›Zeitgeistes‹.
War die gesellschaftliche Ordnung vor 1200 Jahren etwas gänzlich Andersartiges als die heutige und müssen wir uns deshalb auf die Erkenntnis dieser Andersartigkeit (›Alterität‹) beschränken? Das gilt wohl nur zum Teil.2 Nicht weniges, was die Menschen heute bewegt, gab es immer. Die Sehnsucht nach Frieden und Friedensräumen ist wahrlich nicht neu. Und selbst die Veränderung an sich verbindet uns mit dem Mittelalter, denn: »Nichts Beständigeres gibt es als den Wandel«, so stellte der Chronist Otto von Freising im zwölften Jahrhundert fest. Wir sollten uns jedenfalls darum bemühen, mit den alten Zeiten und ihren Menschen ›fair‹ umzugehen. Aus einem späteren Wissensvorsprung heraus ist es immer einfach, sich von ihnen abzugrenzen oder sich gar über sie zu erheben und sie als ›unterentwickelte‹« Kulturen des Mittelalters zu belächeln. Aber damit sollten wir vorsichtig sein. Dasselbe könnte uns in künftigen Zeiten ebenso widerfahren. Vor allem: Unsere eigene Kultur, unser Wissen und unsere gesellschaftliche und politische Ordnung sind nicht aus dem Nichts entstanden. Alles, was unser kulturelles Profil ausmacht, mitsamt den Einschnitten, Wandlungen und Veränderungen steht auf den Fundamenten von Jahrhunderten.
So gesehen, sollten wir die ›Andersartigkeit‹ früherer, mittelalterlicher Zeiten nicht zu sehr betonen, etwa in dem Sinn, dass wir damit gar nichts mehr zu tun hätten. Dies trifft sogar in ganz besonderer Weise auf die Zeit um 800 zu. Dass hier in der Tat die Grundlagen für die weitere Entwicklung Europas gelegt wurden, wird von niemandem bestritten. Diese Zeit war in verschiedener Hinsicht eine Schlüsselepoche europäischer Geschichte. Das liegt vor allem daran, dass nach dem Zusammenbruch des weströmischen Reiches erstmals wieder große Teile Europas unter einer Herrschaft vereint wurden. Dieser Vorgang veränderte zwangsläufig die Anforderungen, die an einen Herrscher gestellt wurden. Wie konnte man einen Raum, der vom Ebro in Spanien bis an den Ärmelkanal, von der dänischen Grenze bis nach Rom, vom Atlantik bis an die Elbe reichte, ordnen, befrieden, gestalten? Ein Herrscher, so hat einmal der frühere Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, Karl Ferdinand Werner, formuliert, musste darüber informiert sein, was in dem Land, das er regierte, geschah. Er musste die Macht haben, seine Anweisungen bekannt zu machen und umzusetzen. Er musste in der Lage sein, Ungehorsam und Missbrauch zu bestrafen, und schließlich über die Ressourcen verfügen, um seine Aktionen finanzieren und Belohnungen verteilen zu können.3
Vor diesen Aufgaben und Anforderungen stand Karl der Große, dessen Reich eine Vielzahl von Völkern und Kulturen Europas umfasste und einen für damalige Verhältnisse gewaltig großen Raum umschloss. Wie ging er damit um? In welchem Maße konnte er die Veränderungen steuern? Welche Modelle der Verwaltung und der Organisation entwickelte er und was entstand daraus? Und nicht zuletzt: Können wir bei diesen Vorgängen Maßnahmen, Einrichtungen und Ordnungsentwürfe erkennen, die in der Geschichte weitergewirkt haben?
Von fundamentaler Bedeutung war gewiss die Verchristlichung des ›Staatswesens‹ um 800. Karl und seine Berater verfolgten das Ziel, die Grundlagen und die gesamte Legitimation der ›staatlichen‹ Ordnung aus den christlichen Normen und Vorgaben heraus zu entwickeln und zu gestalten. Die theoretische Vorlage dafür lieferte das Werk von Augustinus ›Über den Gottesstaat‹ (›De civitate Dei‹). In diesem Buch, in dem zum ersten Mal in der europäischen Geschichte das Ineinanderwirken von Christentum und Staatlichkeit in einem großen theoretischen Wurf entwickelt wurde, fand Karl das gesamte Programm für den Umbau seines Reiches zu einem ›Gottesstaat‹. Es ist wahrlich kein Zufall, dass Einhart (gest. 840), der intime Kenner und Biograf des karolingischen Kaisers, eigens betonte, Karl habe die größte Freude an diesem Buch von Augustinus gehabt.4 Hier konnte er geradezu die Anleitung für sein Handeln finden, wie wir noch sehen werden. Auf dieser Grundlage schuf Karl einen ganz neuen Typus der staatlichen Ordnung, den ›christlichen Gottesstaat‹ – und er bereitete damit zugleich den Mythos vor, der ihn später zum heiligen Kaiser werden ließ.
Noch nachhaltiger waren die geistigen und wissenschaftlichen Impulse, die sich in seiner Zeit voll ausformten. Vieles, was wir heute als selbstverständlich hinnehmen, hat seinen Ausgang in der Zeit um 800. Ein sinnfälliges Beispiel ist unsere heutige Schrift. Sie entwickelte sich – auf der Grundlage spätantiker Schriftformen – in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts und wird ›Karolingische Minuskel‹ genannt. Unsere Schrift, vor allem die viel gebrauchte Computerschrift Times New Roman, ist also keineswegs eine ›lateinische‹ Schrift. Als solche wurde sie erst von den Humanisten bezeichnet, die sich nicht vorstellen konnten, dass eine so schöne und hocheffiziente Schrift aus dem barbarischen Mittelalter stammen könnte.
Dieser Hinweis sollte uns neugierig machen: Was war das für eine Zeit, in der eine Schrift entstand, die so perfekt gestaltet war, dass wir sie heute noch verwenden? Welches Verständnis von Wissen, von Texten, ja von Wissenschaft stand hinter einem solchen Vorgang? Wir werden sehen, dass die neue Schrift nur ein Segment einer großen Wissens- und Bildungsoffensive darstellte, die mit einem gewaltigen Aufwand verbunden war und den kulturellen Nährboden für Jahrhunderte schuf.
Aber auch mit dieser Feststellung erreichen wir noch keineswegs den Kern der Vorgänge. Die eigentliche Kraft der Neuorientierung entsprang einer faszinierenden Idee: der Idee der Eindeutigkeit. Es ging um die ›Vereindeutigung‹ in möglichst vielen Lebensbereichen, es ging um die Deutungshoheit im religiösen und moralischen Verhalten, um die Eindeutigkeit der Sprache, der Argumentation und der zeitlichen Ordnung, es ging um die Eindeutigkeit in der politischen, militärischen und kirchlichen Organisation.
Eindeutigkeit wurde zur Voraussetzung für richtiges und gerechtes Handeln und damit auch für die Wahrheit an sich. Schon Alkuin, der herausragende Gelehrte am Hof Karls des Großen, nannte die Erkenntnis der Wahrheit das vornehmste Ziel aller Studien und Wissenschaften. Letztlich war die Wahrheit Gott selbst. In einem Brief an Abt Rado von Saint-Vaast bei Arras (790–808) legte er diesem ans Herz: »Halte die Brüder dazu an, dass sie die heiligen Schriften sehr sorgfältig lesen! Sie sollen nicht auf den Klang der Zunge vertrauen, sondern auf das Verständnis der Wahrheit, damit sie denen, die der Wahrheit widersprechen, Widerstand leisten können!«5 Die Kirche benötige gegen die vielen falschen Gelehrten (multi pseudodoctores) viele Verteidiger, die durch die Lehre der Wahrheit die Burg Gottes tapfer zu verteidigen wissen.6 Ganz ähnlich hat dreihundert Jahre später der Theologe und Gelehrte Anselm von Canterbury (gest. 1109) in seinem Buch ›Über die Wahrheit‹ (›De veritate‹) argumentiert: Eindeutigkeit (norma) sei die Grundlage für Gerechtigkeit und damit für die Wahrheit.7
Diese tief greifenden Prozesse, die auf eine ›Wahrheitsordnung‹ und eine ›Wahrheitsgesellschaft‹ abzielten, wurden in der Zeit selbst stark empfunden und reflektiert. Die Gedanken, Argumente, Konzeptionen und Anordnungen wurden schriftlich festgehalten. Die Epoche Karls des Großen brachte daher eine Flut von Texten hervor. Schriftlichkeit ist ein typisches Zeichen für Zeiten, in denen es um die »Durchsetzung von Erneuerung« geht.8 Natürlich kann man den Wissensaustausch um 800 nicht im Entferntesten mit unserer Kommunikationsfülle vergleichen, aber man sollte die Möglichkeiten und Leistungen der karolingischen Welt auf diesem Gebiet nicht unterschätzen. Dem ›Schreibrausch‹ vor 1200 Jahren ist es immerhin zu verdanken, dass die klassischen Autoren und frühchristlichen Väterschriften erhalten blieben, weil sie damals in vielen Tausenden von Exemplaren auf haltbares Pergament übertragen wurden. Ein Beispiel von ungewöhnlicher Nachhaltigkeit, würde man heute sagen. Auch diese Texte dienten dem Studium der Wahrheit und dem Streben nach Eindeutigkeit.
Die Eindeutigkeit der Wahrheit wurde zum alles bestimmenden Programm. So begann um 800 der Prozess, der im Lauf des Mittelalters die Methoden zur Erforschung der Wahrheit immer mehr verfeinerte und der im Prinzip bis weit in das 20. Jahrhundert hinein noch den Anspruch der Wissenschaft bestimmte. Man sollte in diesem Zusammenhang daran denken, dass die europäischen Universitäten, die Keimzellen der Wissenschaften und der Wahrheitssuche, im zwölften Jahrhundert entstanden sind. Wissenschaft und Wahrheitssuche sind eine Leistung des europäischen Mittelalters.
Um hier gleich einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Eindeutigkeit gibt es in der Lebenspraxis der Menschen nie und kann es auch nicht geben. Aber es gibt Epochen und Kulturen, in denen um Eindeutigkeit gerungen wurde. Dazu gehörte das Zeitalter Karls des Großen in ganz besonderem Ausmaß.
Es gibt andere frühe Kulturen, in denen gerade das Gegenteil angestrebt wurde, nämlich die Vieldeutigkeit von Aussagen, von Schrift und Begriffen. Ein Beispiel dafür ist die altorientalisch-assyrische Welt. Der Heidelberger Assyriologe Markus Hilgert hat gezeigt, dass die mesopotamischen Keilschriftzeichen dafür eingesetzt wurden, möglichst breite Wissens- und Bedeutungsfelder abzudecken.9 Jedes Zeichen konnte in verschiedener Weise, in verschiedener Zuordnung und auch mit der Möglichkeit eines Bedeutungswandels benutzt werden. Diese Schrift stellte ganze ›Cluster‹ von Wissensgeflechten zur Verfügung. Für den Sinn, den sie transportierte, war gerade die Mehrdeutigkeit kennzeichnend. Mit ihr konnte Wissen nicht nur gespeichert, sondern auch in ganz unterschiedlichen Kontexten abgerufen und verwendet werden. Eine der frühen und bedeutendsten Hochkulturen der Menschheit hat sich demnach also gerade nicht für die Eindeutigkeit der Sprache und der Schrift entschieden, sondern für Multidimensionalität, Variabilität, Instabilität und Offenheit von vielfältig verflochtenen, aber nicht linearen Wissensinhalten und Wissensobjekten.
Es kommt also darauf an, ob eine Gesellschaft Eindeutigkeit anstrebt oder nicht. Heute scheinen wir uns eher den Vorstellungen der altorientalischen Kulturen zu nähern. Unter uns hat längst die Überzeugung um sich gegriffen, dass es ebenso viele Wahrheiten gibt wie Kulturen und deren Traditionen in der Welt, denen man sich öffnen möchte. Ein Pochen auf Eindeutigkeit wäre dabei störend. Ganz im Gegenteil, man will »der Vereindeutigung entkommen«.10 Auf wissenschaftlichen Kongressen wird es derzeit gewöhnlich als »ausgesprochen horizonterweiternd« empfunden, wenn sich am Ende möglichst viele Mehrdeutigkeiten einstellen und eindeutige Antworten vermieden werden.11 In den Geisteswissenschaften spricht man schon von einer »Ontologie-Angst«12. Ob die Forderung nach »Genauigkeit«, die neuerdings in die Diskussion eingebracht wurde, einen Ausweg bietet, wird sich erweisen.13
Auch den Anspruch, Wahrheit innerhalb eines Wissenschaftssystems zu erlangen oder wenigstens zu fordern, hat man weitgehend aufgegeben – trotz gelegentlicher Ankündigung einer »Rückkehr der Wahrheit«.14 Wahrheit, so lautet die längst dominierende Überzeugung unserer ›postmodernen‹ Zeit, sei – ebenso wie Eindeutigkeit – nicht nur niemals erreichbar, sondern auch gar nicht erstrebenswert. Nur wenn wir heute den »essentialistischen Wahrheitsbegriff« aufgeben, so lautet die Position der jungen Forschung, können wir die Voraussetzung dafür schaffen, »dass verschiedene, kulturell spezifische Formen epistemischer Praxis als prinzipiell gleichwertige Alternativen gelten können«.15
An die Stelle der Eindeutigkeit ist die Offenheit für die Vielfalt wissenschaftlicher Methoden getreten, für die Vielfalt kultureller Bewegungen, Begegnungen, Transfers und Wechselwirkungen. Sie ist das neue Ideal, sei es in der Gesellschaft, in der Politik oder in der Wissenschaft. Das heutige Signalwort dafür lautet »Unbestimmtheit«.16 Diese Vorgänge und die Rolle der ›Unbestimmtheit‹ in unserer Wissenschaft und im gesamten ethischen Verhalten werden in der modernen Geschichtsforschung, in der Philosophie und in den Gesellschafts- und Lebenswissenschaften intensiv diskutiert, gewiss zu Recht, denn dieser Wandel greift an die Substanz unseres gesamten überkommenen Denk- und Wissenschaftssystems. Auch der Blick der Forschung auf das Mittelalter konzentriert sich längst auf ›Ambiguität‹, also auf die Vielfalt der Ordnungen und Wertestrukturen. Sie ist hier ohne Frage reichlich anzutreffen und hat die Lebenswirklichkeit des Mittelalters im Ganzen gesehen geprägt.
Diese Veränderungen unserer modernen Zeit oder gar ein Werturteil darüber sollen aber nicht Gegenstand dieses Buches sein. Hier soll vielmehr gezeigt werden, dass es Phasen in der europäischen Geschichte gab, in denen ein gegenteiliges Konzept angestrebt wurde, ein Konzept, das auch das Handeln des Herrschers und der politischen und intellektuellen Elite in höchstem Maße bestimmte: das Bemühen um Eindeutigkeit. Genau dies ist das besondere Kennzeichen der Epoche Karls des Großen. Sehr treffend ist diese Grundhaltung eingefangen worden von Einhart, dem Gelehrten am Hof Karls, der uns noch mehrfach begegnen wird. Er bezeichnete das Bemühen Karls als »Beseitigung jeder Unbestimmtheit« (omni ambiguitate remota).17
Es ist gar nicht anders denkbar, als dass der Herrscher einer solchen gesellschaftlichen Konzeption selbst von dieser Idee geleitet war, dass er folglich selbst die vielfältigen Impulse, Anregungen, theoretischen Reflexionen und sonstigen Anstöße aufnahm, bündelte und ihnen auch von seiner Seite weitere Impulse gab. Karl der Große erscheint aus dieser Perspektive nicht nur als ein barbarischer oder christlich-heiliger Kaiser, sondern auch als ein Herrscher, der höchsten Anspruch auf Deutungshoheit entwickelte, um Eindeutigkeit zu schaffen. Die weiteren Überlegungen und Darstellungen sollen zeigen, welche Konsequenzen dieses Streben nach ›Vereindeutigung‹ für die Menschen, die Organisationen und die Strukturen seines Reiches hatte, welche Instrumentarien, Methoden und Kommunikationsformen – wie die Schrift – dafür eingesetzt wurden oder daraus entstanden sind und was dies alles für das politische Handeln und schließlich die Formung einer bestimmten Gesellschaftsordnung bedeutete.
KAPITEL 2
Die Vita Karls des Großen und andere Quellen
Welche Nachrichten gibt es, die uns über Karl den Großen und seine Zeit berichten? Über welches ›Arbeitsmaterial‹ verfügen wir? Im Mittelpunkt steht eine ganz einzigartige Quelle, nämlich seine Lebensbeschreibung, die ›Vita Karoli Magni‹. Geschrieben hat sie der Gelehrte Einhart. Dieser gilt bis heute als »der berühmteste Biograph des 9. Jahrhunderts«.1 Um 770 wurde er – vielleicht in Seligenstadt am Main – geboren. Er entstammte einer ostfränkischen Adelsfamilie aus dem »Maingau« (Moingeuui), einem Gebiet, das sich von Hanau über Aschaffenburg und Dieburg bis in den Odenwald erstreckte. Wegen seiner Abstammung nannte sich Einhart einen »Barbaren« (homo barbarus), weil er als »Nichtromane« in der »römischen Sprache« (Romana locutio) wenig geübt sei. Aber ganz so schlecht, so fügte er hinzu, sei sein Latein auch wieder nicht gewesen.2 Dennoch: So wie in der Antike galt demnach im Gelehrtenkreis dieser Zeit derjenige, der nicht Romane war, als Barbar – und das trifft auch auf den Franken Karl den Großen zu.
Die Ostfranken, die rechts des Rheins lebten, zählte Einhart zu den Germanen.3 Das ist ein nicht unwichtiger Hinweis, denn in der jüngeren Forschung glaubte man lange Zeit, das Wort ›Germanen‹ als Bezeichnung für die Völker im fränkischen Reich ganz vermeiden zu müssen. Das Bewusstsein einer solchen Gruppenzugehörigkeit habe es gar nicht gegeben, vielmehr handle es sich um eine Fremdbezeichnung durch die Römer. Der Begriff Germanen galt außerdem durch den Missbrauch im Nationalsozialismus als belastet. Erst vor wenigen Jahren hat der Wiener Historiker und Frühmittelalterforscher Herwig Wolfram eine Ehrenrettung für die Sammelbezeichnung »Germanen« formuliert: Es gebe eben keinen ordentlichen Ersatz dafür.4 In der Zeit um 800 hatte man damit offensichtlich keine Probleme.
Seine Ausbildung erhielt Einhart seit dem Ende der 770er-Jahre im Kloster Fulda, wo er an christlichen Texten der Kirchenväter, aber auch antiken Autoren, Grammatikern und Rhetorikern geschult wurde (unter anderen Origenes, Gregor der Große, Augustinus). Auch Griechischkenntnisse hat er sich dort erworben. Fulda besaß damals zwar noch keine große Bibliothek, aber immerhin die ›Handbibliothek‹ des großen angelsächsischen Missionars Bonifatius (gest. 754), der sich in dem vom ihm gegründeten Kloster Fulda hatte begraben lassen. Einharts in der Klosterschule erworbene Fertigkeiten im Schreiben waren so gut, dass man ihm schon 780 oder kurz danach die Ausfertigung von Urkunden anvertraute. Auch die Schenkung seiner Eltern, Einhart und Engelfrida, an das Kloster Fulda, hat er selbst geschrieben.5
Aber Einhart trat nicht als Mönch in das Kloster ein. Er wurde auch nicht Kleriker, sondern blieb zeitlebens Laie und war mit Imma (gest. 836) aus einer hochgestellten Familie verheiratet. Einen niederen kirchlichen Weihegrad kann man bei ihm nicht ausschließen, aber auch das würde an der Tatsache, dass er ein Leben als Laie führte, im Grunde nichts ändern. Das ist eine bemerkenswerte Beobachtung, denn Quellentexte und Nachrichten, die von Laien stammen, sind für diese Zeit eher selten. Sein Laienstatus hinderte ihn im Übrigen nicht daran, als »Laienabt« die Leitung von sieben Klöstern in den verschiedensten Teilen des karolingischen Reiches zu übernehmen. Am Ende gründete er in Seligenstadt noch ein eigenes Kloster, in dem er nach seinem Tod am 14. März 840 bestattet wurde.
Noch vor 796 schickte der Abt von Fulda, Baugulf (779–802), den jungen Adligen, der durch »Auffassungsgabe und Intelligenz herausragte«6, an den Hof Karls des Großen. Dort befreundete sich dieser mit Alkuin von York (gest. 804), dem wohl größten Gelehrten seiner Zeit, der wegen seiner Gelehrsamkeit in den Hofkreisen den Namen Flaccus nach dem römischen Dichter Horaz führte. Bei ihm lernte er gleichsam die letzten Feinheiten der Wissenschaften und der Weisheit – und in diesem Sinne kann man durchaus davon sprechen, dass Alkuin sein Lehrer war. Einhart verehrte ihn zeitlebens. In seiner ›Vita Karoli Magni‹ hob er ihn als einen in jeder Hinsicht überaus gelehrten »Meister« hervor.7
Am Hof Karls erwarb sich Einhart rasch hohes Ansehen. Man bewunderte seine Schaffenskraft. Sein Gelehrtenkollege Theodulf von Orléans (gest. 821) nannte ihn emsig »wie eine Ameise«.8 Vor allem war er vielseitig. Alkuin erkannte seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der Mathematik und empfahl ihn Karl dem Großen als Lehrer für mathematische und astronomische Themen. Doch ebenso großartig waren seine Leistungen als Baumeister. Der Bau der »fünfhundert Schritte« langen, hölzernen Rheinbrücke bei Mainz stand unter seiner Aufsicht, »ein herrliches Werk«, wie Einhart selbst schwärmte.9 In zehn Jahren sei es mit unendlicher Mühe und wunderbarer Kunst so fest aus Holz gebaut worden, als würde es ewig halten. Dass die Brücke einige Jahre später abbrannte – und der Rhein dann über Jahrhunderte keine Brücke mehr hatte –, war freilich ein Desaster. Auch bei den Pfalzbauten in Ingelheim und Aachen wirkte er an vorderster Stelle mit. Am Hof übernahm er überdies die Leitung der Kunstwerkstätten. Alle diese Fertigkeiten haben ihm am Hof den Namen Beseleel (Bezalel) eingebracht, den Namen des Baumeisters im Alten Testament. Dieser war von Moses auserwählt worden, das »Heiligtum«, eine Wohnstätte für den Herrn aus zehn Zelttüchern und in kunstvollster Ausgestaltung, zu errichten (Exodus 35–38). Beseleel sei »durch Weisheit, Klugheit und Kenntnis für jegliche Arbeit« (Exodus 35,31) ausgezeichnet gewesen – und mit diesen ungewöhnlichen und reichen Anlagen war offenbar auch Einhart gesegnet. Sein zweiter ›Spitzname‹ war Nardulus, weil er klein, aber wirkungsvoll gewesen sei wie eine Narde.
Noch wichtiger ist in unserem Zusammenhang, dass Einhart in seiner Zeit in Aachen – wo in den 90er-Jahren des achten Jahrhunderts die Hauptresidenz des karolingischen Reiches entstand – ein enger Vertrauter Karls des Großen wurde. Ihn begleitete er, wann immer es möglich war, auf seinen Reisen, für ihn übernahm er diplomatische Missionen und ihm diente er als Ratgeber. Im Vorwort seiner ›Vita Karoli Magni‹ betonte Einhart selbst die Freundschaft, die ihn mit Karl und dessen Kindern verbunden habe. Niemand, so war er überzeugt, wäre deshalb in der Lage, wahrheitsgetreuer als er diese Vita zu schreiben und aufzuzeichnen, »was ich selbst miterlebt und persönlich mit der Gewissenhaftigkeit eines Augenzeugen erfahren habe«. Der Hof (aula) in Aachen, wo er sich bis 830 aufhielt, wurde zu seiner zweiten Heimat. Hier befand er sich im Zentrum der politischen Vorgänge und Entscheidungen und hier konnte er aus nächster Nähe das herrscherliche Programm seines großen Förderers aufnehmen und begleiten.
Diese Einordnung Einharts ist wichtig, denn sie bietet uns die Voraussetzung dafür, seine ›Vita Karoli Magni‹ in ihrem Aussagewert einzuschätzen. Das Werk ist zweifellos vom Geist der Aachener Reichselite und der dortigen ›Höflinge‹ durchdrungen. Es spiegelt die Auffassung und das Bild, das man im Gelehrtenkreis um Karl entwickelte, und es dürfte auch der Selbsteinschätzung Karls keineswegs widersprochen haben. Schon an scheinbaren Kleinigkeiten ist das zu erkennen. So ist es auffällig, dass Einhart in seinen Schriften niemals das Wort »Adliger« (nobilis) als Standesbezeichnung gebrauchte. Das entsprach ganz dem Programm Karls, für den alle, die nicht Unfreie (servi) waren, vor dem König gleich sein sollten.
Trotz dieser ungewöhnlich guten Informationen, über die Einhart verfügte, ist in der Forschung am Quellenwert der Vita Kritik geäußert worden. Sie sei angeblich erst spät entstanden, etwa um 830, als die Regierung von Karls Sohn und Nachfolger, Ludwig dem Frommen (814–840), in eine tiefe Krise stürzte. Diesem sollte daher mit der Lebensgeschichte seines Vaters ein Beispiel erfolgreicher Herrschaft vor Augen geführt werden, damit sich der Sohn ein Beispiel daran nehmen könne. Zuletzt hat man in der Forschung die Entstehungszeit etwas vordatiert in die Jahre 825–829, weil in den Synoden, den großen kirchlichen Versammlungen dieser Zeit, die eigene (unerfreuliche) Gegenwart mit der (glanzvollen) Herrschaft Karls des Großen verglichen worden sei und somit eine allgemeine Sehnsucht nach der »guten alten Zeit« spürbar werde.10
Diesen Überlegungen kann man entgegenhalten, dass die Vita selbst keine Hinweise auf eine solche Intention enthält. Nichts ist zu erkennen von Spannungen oder Gegensätzen, die den Hof und das Reich um 830 erschütterten. Die einzige Stelle, die darauf hinzudeuten scheint, findet sich im Prolog. Einhart, so heißt es da, wolle »das ruhmvolle Leben des hoch erhabenen und größten Königs seiner Epoche und seine herausragenden Taten, die von den Menschen der modernen Zeit (moderni temporis hominibus) kaum erreichbar sind, nicht in die Nacht des Vergessens absinken lassen«. Bedeutet der Ausdruck »moderne Zeit« (modernum tempus), dass seit dem Tod Karls ein größerer Zeitabschnitt vergangen sein muss? Nicht unbedingt. Der Begriff modernus bezeichnet im Mittelalter ganz einfach den »Zeitgenossen«.11 Im Satz davor wird von Einhart sogar betont, dass doch gerade das »gegenwärtige Zeitalter« (aevum praesens) es verdiene, in Schriften aufgenommen zu werden – und damit meinte er nichts anderes als die Zeit Karls des Großen.12
Das heißt, die ›Vita Karoli Magni‹ könnte schon früher, vielleicht schon um 817, entstanden sein. Eine solche Datierung würde sich gut in die Schilderung einfügen, die in der Vita über die letzten Tage Karls zu lesen ist. Sie liefert uns eine Reihe von präzisen Tages- und Stundenangaben und genaue Hinweise auf die Abläufe. Auch der Schlusssatz der Vita, Ludwig der Fromme habe das Testament Karls »so schnell er konnte nach seinem Tod mit der größten Gewissenhaftigkeit ausführen lassen«13, erweckt eher den Eindruck einer Nähe zu den Vorgängen.
Diese Überlegungen machen deutlich, wie hoch der Quellenwert der von Einhart verfassten Vita ist und wie unmittelbar sie uns – trotz des lobenden Grundtons – zu dem Denken und dem ganzen Ambiente am Hof Karls des Großen und auch zu diesem selbst hinführt. Aber, so lautet immer wieder ein Einwand: Einhart habe für seine Vita die Kaiserbiografien von Sueton als Vorlage benutzt. Er sei also nichts anderes als ein Plagiator, und seine Darstellung habe daher mit der Wirklichkeit wenig zu tun. In der Tat, Einhart hat Formulierungen klassischer Autoren verwendet – etwa gleich zu Beginn Cicero. Vor allem für die Komposition seiner Vita hat er das biografische Werk von Sueton (gest. nach 122) ›Über das Leben der Cäsaren‹ (›De vita Caesarum‹) herangezogen. Darin werden die römischen Kaiser von Caesar (100–44 v.Chr.) bis Domitian (51–96 n.Chr.) beschrieben. Sueton setzte für die einzelnen Kaiserbiografien ein bestimmtes Schema ein: Herkunft, Jugend, Erziehung, Kriege, Privatleben, Vorzeichen für den Tod sowie Tod und Testament. Auch Einhart gliederte seine Vita in ähnliche Abschnitte: Kriege, Beziehungen nach außen, Aussehen und Lebensweise, Reichsverwaltung, Tod und Testament. Überdies dürfte er die Biografie über den Heerführer Gaius Julius Agricola von Tacitus (58–120 n.Chr.) benutzt haben. Tacitus und Einhart betonen gleichermaßen in ihrer Vorrede, dass sie die Sitten und Taten der von ihnen beschriebenen Männer für die Nachwelt schriftlich festhalten wollten.
Aber welch ein Unterschied, wenn man den Inhalt, die Stilkunst und die konzise Fokussierung bei Einhart mit den ausufernden Geschichten bei Sueton vergleicht! An manchen Stellen wirkt die Darstellung des antiken Autors geradezu geschwätzig. Auch der Grundton ist bei Sueton völlig anders. Sein Werk ist durchzogen von einer stets abwertenden, mitunter sarkastischen Distanz. Die ›Vita Karoli Magni‹ kann man demgegenüber geradezu als einen Gegenentwurf von höchster Qualität bezeichnen. Es ist ein Werk von geschlossener und konzentrierter Gestaltung und, so gesehen, von diesen Vorlagen ganz unabhängig.
Weshalb hat Einhart aber dennoch Suetons Kaiserbiografien und andere Autoren so intensiv benutzt und durch Zitate in sein Werk einfließen lassen? Weil er – so die maßgebende Forschungsmeinung – damit den imperialen Rang Karls schon von der Anlage des Werkes her deutlich machen wollte.14 Niemand, so die Überzeugung Einharts, werde an die Einzigartigkeit Karls heranreichen. So entstand eine einzigartige »Kaiserbiografie« – und genau so könnte auch der ursprüngliche Titel des Werks gelautet haben: ›Vita Caroli imperatoris‹.15
Im Übrigen war die Benutzung von Texten anderer Autoren – auch ohne »Fußnoten« – im Mittelalter keineswegs ungewöhnlich. Damit wollte man Gelehrsamkeit nachweisen und zeigen, dass man sich in einer bestimmten Wissenstradition bewegte. Die Vorlagen schöpfte man gezielt aus, um das eigene Vorhaben in eine bestimmte literarische Gattung einzuordnen. Mit einem Plagiat im modernen Sinne hatte das nichts zu tun, ganz im Gegenteil: Nur Fleiß und Nachahmung (studium et imitatio) könnten zur Perfektion führen, so hatte schon Cicero bemerkt.16 Nach seinem eigenen Verständnis schuf Einhart – wie er in der Vorrede schrieb – trotz seiner Anleihen ein »neues Werk« (nova scriptio), für das er sich geeigneter Anregungen und Formeln früherer Autoren bediente. Die Art und Weise, wie er sie einsetzte, unterstreicht allerdings die Eigenständigkeit der ›Vita Karoli Magni‹ und hebt den authentischen Ton des Werkes hervor.
Zu den Eigenschaften Karls zählte Einhart die »Hochherzigkeit« beziehungsweise die »Seelengröße« (magnanimitas). Sie gehörte zu den vier Kardinaltugenden und galt schon in antiker Zeit als das Herrscherideal schlechthin. Cicero hat sich darüber in seinem Werk ›De officiis‹ geäußert: »Diejenigen, die von Natur aus die erforderlichen Eigenschaften für die politische Tätigkeit haben, müssen, wenn sie alles Zögern abgelegt haben, politische Ämter übernehmen und den Staat lenken; denn anders kann eine Bürgerschaft nicht geleitet und Großmut nicht bewiesen werden. Diejenigen aber, welche die politische Laufbahn einschlagen, müssen ebenso wie die Philosophen, vielleicht sogar noch mehr, die oft genannte Hochherzigkeit (animi magnitudo) und Verachtung äußerlicher Werte aufbringen sowie Seelenruhe und Gelassenheit, insofern sie nicht besorgt sein, sondern mit Würde und Charakterfestigkeit leben wollen.«17 Ohne »Hochherzigkeit« war gute Herrschaft demnach gar nicht möglich. Angesichts des engen, geradezu intimen Zusammenwirkens zwischen Karl und seinen Gelehrten, ganz besonders mit Alkuin und Einhart, muss man davon ausgehen, dass auch der große Karolinger von solchen Gedanken geleitet war. Der gesamte Hof stilisierte offenbar dieses Bild.
Zum anderen erscheint Karl der Große in Einharts ›Vita‹ als Mann der imperialen Größe und des konsequenten Handelns. Immer wieder wird betont, der Herrscher habe keine halben Sachen gemacht. Habe er etwas begonnen, dann sei dies auch durchgeführt worden, unter Umständen bis zum bitteren Ende: »Der König, der alle Fürsten seiner Zeit an Klugheit und Hochherzigkeit überragte, ließ sich durch nichts von dem, was zu unternehmen und auszuführen war, abhalten, weder durch Mühen noch durch Gefahren.«18 Erst der endgültige Abschluss einer Unternehmung – so könnte man diese Hinweise deuten – schaffte dauerhafte Klarheit, oder besser: Eindeutigkeit.
So erweist sich die ›Vita Karoli Magni‹ aus verschiedenen Perspektiven als ein einzigartiges, ungemein wertvolles, kunstvolles und eben auch selbstständiges Zeugnis für die Geschichte Karls des Großen, seiner Herrschaft und seines Reiches. Mit ihm kommen wir nahe an das Bild heran, das Karl der Große selbst von sich gehabt hat oder von dem er zumindest wollte, dass es in seiner Umgebung gepflegt wurde. Dass es aus diesem Grunde zwangsläufig auch einseitig ist und so manche ›dunklere Seite‹ bei Karl unter den Tisch fällt, liegt auf der Hand.
Richten wir den Blick auf weitere Quellen. Es gibt noch eine zweite Lebensbeschreibung Karls aus karolingischer Zeit. Dabei handelt es sich um die ›Taten Karls‹ (›Gesta Karoli‹), verfasst von dem Mönch und Lehrer Notker »dem Stammler« (lateinisch Balbulus) (gest. 912) aus dem Kloster St. Gallen. Notker wurde um 840 geboren, kannte Karl den Großen also nur noch aus Erzählungen. Im Dezember 883 wurde er von Kaiser Karl III. (gest. 888), einem Urenkel des Kaisers, aufgefordert, die erheiternden Anekdoten, die er über Karl den Großen zu erzählen wusste, aufzuschreiben. Im Jahr darauf ist das Werk, das nur fragmentarisch erhalten ist, entstanden. Es hat kaum historischen Wert, ist aber höchst unterhaltsam und voller witziger Geschichten. Vor allem wird Karl der Große in höchsten Tönen gerühmt: Er ist der Schrecken erregende Herr für alle Völker Europas, zugleich ist er weise und milde, unbesiegbar, einzigartig und »unvergleichlich« (incomparabilis). »Fast ganz Europa« (cuncta pene Europa) habe ihn verehrt.19 Der ›Mythos Karl‹ hatte sich also schon bald nach dem Tod des Kaisers im neunten Jahrhundert mächtig entfaltet. Jeder Mythos hat freilich seine Wurzeln im Gegenstand selbst, und das heißt nichts anderes, als dass eben auch Karl seinen eigenen Mythos vorbereitet hatte.
Ein demgegenüber grundlegendes und hoch informatives Quellenwerk für die Zeit Karls des Großen liegt uns mit den ›Fränkischen Reichsannalen‹ (›Annales regni Francorum‹) vor. Dabei handelt es sich um Jahresberichte, die offenkundig am Hof Karls des Großen selbst angefertigt wurden. Durch vielfältige und enge Beziehungen zu bedeutenden Reichsklöstern kam es auch dort zu unterschiedlichen Fassungen der Annalen mit Erweiterungen und Zusätzen. Die Gelehrten dieser Zeit versammelten sich nicht nur am Hof, sondern lebten auch in den Reichsklöstern. Das Kloster Lorsch an der Bergstraße, aus dem die älteste Handschrift der ›Reichsannalen‹ überliefert ist, spielte dabei eine besonders wichtige Rolle.
Wie die verschiedenen Fassungen der karolingischen Annalenwerke voneinander abhängen und wie die Zusammenhänge im Einzelnen aussehen, hat die Forschung bisher nicht zufriedenstellend aufdecken können.20 Sicher ist, dass die ›Reichsannalen‹ einen deutlich offiziösen Charakter aufweisen und dass bei den Nachrichten, die sie überliefern, sehr selektiv vorgegangen wurde: Der Glanz Karls und des Frankenreichs sollte möglichst ungetrübt erstrahlen. Negative Ereignisse wie Aufstände, Konflikte und Verschwörungen gegen Karl wurden einfach verschwiegen. Vor allem wurden die Wertungen der Abfassungszeit, also der 790er-Jahre, auf frühere Jahrzehnte übertragen. Insofern werden die ›Reichsannalen‹ gewöhnlich als ein problematisches Konstrukt bezeichnet.
Dennoch wird man die Frage stellen müssen, inwieweit von einer bewussten Fälschung historischer Ereignisse auszugehen ist. Mit einer solchen Unterstellung muss man vorsichtig sein. Es ging eher um die Darstellung der fränkischen Selbstwahrnehmung. Der Sinn der Annalen war es, einen autorisierten Rahmen kollektiver Erinnerung zu schaffen: So sind wir Franken und so ist unser Frankenreich! Und es war das erklärte Ziel, dem Leser das rechtmäßige und gerechte Handeln des Herrschers und seiner Franken vor Augen zu führen. Gerechtigkeit und »Rechtheit« (rectitudo) waren Kernelemente des fränkischen Selbstverständnisses. In diesem Sinne wurde jedes Handeln zum Guten verwandelt. Die Beschreibung des Vorgehens Karls des Großen gegen Herzog Tassilo III. von Bayern – auf das wir noch zu sprechen kommen – kann als Muster dafür gelten. Nur so konnten die Franken die »Guten« sein, und dies sollte durch die Geschichtsschreibung festgehalten werden.
Es scheint, als hätten die Verfasser der ›Reichsannalen‹ über große Vertrautheit mit der Rechts- und Urkundensprache verfügt, weshalb man sie in der Forschung zur Hofkapelle Karls des Großen rechnet. Diese Hofkapelle war nicht nur für die Abhaltung der Gottesdienste und sonstiger liturgischer Handlungen zuständig. Die »Kapelläne« (capellani) waren auch die Hüter der am Hof vereinten Heiligenreliquien, des ›Reliquienschatzes‹. Das wertvollste Stück darunter war der Mantel des heiligen Martin, den die Franken »zu ihrem Schutz und zur Überwältigung ihrer Feinde stets mit in den Krieg nahmen«.21 Dieser Mantel hieß lateinisch cappa, wovon sich die Bezeichnung Kapelle für den Aufbewahrungsort ableitet. Die Kapelläne hatten ihn stets »mit sich zu führen und zu bewachen«, wie es bei Walahfrid Strabo heißt.22 Sie waren aber auch für die Ausfertigung von Urkunden und Briefen und für diplomatische Aktionen zuständig. Dadurch flossen ihnen stets reiche Informationen über die politischen Vorgänge, Vorhaben und Vorstellungen des Herrschers und seiner Leute zu, die sie für ihre Amtsgeschäfte benötigten. Aus diesem Grund hat man in der Forschung auch schon die Vermutung geäußert, die ›Reichsannalen‹ könnten zunächst speziell für den ›Dienstgebrauch‹ verfasst worden sein. Doch bald wurden sie vielfach und in verschiedenen Variationen abgeschrieben, ergänzt und ausgeschmückt. In kurzer Zeit waren sie weitverbreitet und konnten so die öffentliche Meinung über den Herrscher, seine Herrschaftsführung und seinen Anspruch beeinflussen und steuern.
Man geht davon aus, dass es eine erste Fassung gab, die zwischen 787 und 793 entstanden ist und im Rückblick den Zeitraum von 741 an – dem Tod Karl Martells (714–741) – bis 793 darstellte. Der Verfasser und auch andere Autoren haben dann die folgenden Jahresberichte eingetragen. Eine bis 801 fortgeführte und überarbeitete Fassung wollte man früher Einhart als Verfasser zuweisen, doch diese Zuordnung hat man längst aufgegeben. Einen eigenen Abschnitt bilden die Berichte für die Jahre von 808 bis 829. Auffallend ist, dass der Stil der ›Reichsannalen‹ für die Jahre zwischen 794 und 807 eine höhere Qualität erreicht. Man hat vermutet, dass dies mit Hildebald, dem gebildeten Bischof von Köln (787–818) zusammenhängen könnte, der 791 das Amt des obersten Kapellan am Hof übernahm.
Weshalb wurde für diese so wichtige, geradezu amtliche Hofgeschichtsschreibung das Format der Jahresberichte gewählt? Diese Gattung, bei der die Ereignisse Jahr für Jahr einfach chronologisch aneinandergereiht werden, wirkt eher bescheiden, was die gestalterische Kraft betrifft. Diese etwas simple Anlage passt auf den ersten Blick so gar nicht zusammen mit der hohen Bildungskultur am Hof dieser Zeit, die uns noch beschäftigen wird. Am Niveau der Autoren dürfte es nicht gelegen haben.
Man weiß seit Langem, dass die Jahresberichte sich aus den Notizen entwickelt haben, die man in den Klöstern in die Kalender eintrug. Schon frühzeitig waren in England die sogenannten ›Ostertafeln‹ entstanden und von dort auf das Festland gekommen. Mit ihnen berechnete man die kirchlichen Festtage, vor allem das ständig variierende Osterfest, mehr oder weniger weit im Voraus. Am Rand der jeweiligen Ostereinträge war Platz für weitere, kurze Notizen, die sich dann ausgeweitet haben zu umfangreicheren Berichten – bis hin zu einer Geschichte des fränkischen Reiches. Das ist die gültige und sicherlich überzeugende Erklärung für die Entstehung der ›Reichsannalen‹.
Aber vielleicht muss man noch einen Schritt weitergehen. Wir werden noch sehen, dass die Mathematik für den Gelehrtenkreis und für Karl den Großen selbst von außerordentlicher Bedeutung war. Das Rechnen ordnete, erklärte und präzisierte die Abläufe der Zeit, der Kirchenfeste, der Bewegungen der Himmelskörper einschließlich der Mond- und Sonnenfinsternis, ja das System des gesamten Kosmos und damit der Heilsgeschichte. Computistik wurde Ende des achten Jahrhunderts zur vornehmsten Wissenschaft. Genau diesem Denken und diesem Ordnungsbestreben entsprach die mathematisch begründete Gliederung der historischen Ereignisse in Jahre. Damit war der Überblick gewährleistet. Die Vorgänge konnten präzise – oder besser: eindeutig – verortet werden.
Nur kurz sei noch auf weitere Bereiche hingewiesen, aus denen uns wichtige Quellen zur Verfügung stehen. Dies sind zum einen die Urkunden Karls des Großen selbst. Durch den Titel, den Karl in seinen Urkunden führte, aber auch durch die Begründung der Rechtsgeschäfte, die in den Urkunden dargestellt werden, können wir uns ein Bild von seinem Selbstverständnis machen. Zudem öffnet sich ein Weg, um Abläufe von Rechtshandlungen genauer zu bestimmen. Auch die Mitglieder der königlichen Kanzlei kann man, wenigstens teilweise, erkennen.
Zum zweiten sind die Beschlüsse (Dekrete) der zahlreichen Konzilien zu erwähnen, die in der Zeit Karls des Großen abgehalten wurden. Er selbst berief die Konzilien ein und führte zusammen mit dem Erzbischof von Metz oder von Mainz den Vorsitz. Die Themen, die dort behandelt wurden, bezogen sich nicht nur auf kirchliche Angelegenheiten, vielmehr wird stets deutlich, dass in dem von Karl angestrebten ›Gottesstaat‹ Kirchliches und Weltliches kaum zu unterscheiden waren.
In diesem Zusammenhang ist eine große Sammlung von Synodalbeschlüssen und Kommentaren hervorzuheben, die von 792 bis 794 entstanden ist. Es handelt sich um die ›Karolinischen Bücher‹ (›Libri Carolini‹), die von Karl in Auftrag gegeben wurden, um seine Position im sogenannten Bilderstreit deutlich zu machen und zu festigen.23 Der Gelehrte und Bischof Theodulf von Orléans war der Hauptautor, der die Texte in vier Büchern zusammenstellte und damit eine Gegenschrift gegen die byzantinische Bilderverehrung formulierte. Auf der Synode von Frankfurt am Main 794 sollte das Thema auf der Grundlage dieser Schrift behandelt und geklärt werden. Karl der Große hat sich dann aber doch für eine gewisse Zurückhaltung in dieser Frage entschieden, um einen Konflikt mit dem Papst, der die Bilderverehrung befürwortete, zu vermeiden. Dennoch vermittelt uns dieses Werk einen sehr authentischen Eindruck von der Werkstatt der Gelehrten am Hof und eben auch vom Mitwirken Karls des Großen selbst. Das Redaktionsexemplar ist uns nämlich erhalten (Biblioteca Apostolica Vaticana Cod. Vat. lat. 7207), und darin finden sich als Randnotizen die Stellungnahmen des Königs in Kurzschrift angegeben: »gut«, »ganz ausgezeichnet«, »klug« oder »richtig« (bene, optime, prudenter, recte) – eine einmalige Quelle!
Ebenfalls in den Bereich der kirchlichen Rechtstexte gehört die sogenannte ›Collectio Dionysio-Hadriana‹, eine Kirchenrechtssammlung, die Papst Hadrian I. im Jahre 774 in Rom Karl dem Großen überreichte. Sie enthält Briefe Papst Gregors des Großen (590–604), das Glaubenbekenntnis und die Beschlüsse der Ökumenischen Konzilien von Nizäa (325), Konstantinopel (381) und Chalcedon (451). In ihnen sind die Grundsätze der frühen Kirche enthalten. Man muss davon ausgehen, dass diese Sammlung trotz der kirchlichen Themen als eine Art Grundgesetz für die gesamte Ordnung im fränkischen Reich gedacht war. In ihnen wurden die Normen und Werte auch der Gesellschaft insgesamt definiert. Zur rascheren Orientierung war neben dieser »historisch« ausgerichteten Quellensammlung noch eine systematische Aufbereitung sinnvoll. Sie stand in der sogenannten ›Collectio Vetus Gallica‹ zur Verfügung – und beide Sammlungen erscheinen nicht selten in einem Werk zusammengefügt. Erwähnt werden muss schließlich noch die damals im Frankenreich ebenfalls an Einfluss gewinnende ›Irische Sammlung des Kirchenrechts‹ (›Collectio Canonum Hibernensis‹), die besonders strenge Regeln setzte.
Aus der Kommunikation zwischen Karl und seinen Bischöfen, Äbten und anderen Amtsträgern, vor allem mit den Päpsten, ist uns eine beträchtliche Anzahl an Briefen überliefert. Sie führen uns mitten hinein in das politische Geschehen und in die Gedankenwelt der Zeit. Dass wir heute noch den Briefwechsel mit den Päpsten vorliegen haben, ist einem einzigartigen Umstand zu verdanken: Karl der Große selbst ließ eine Sammlung mit neunundneunzig – fast ausschließlich päpstlichen – Briefen an die Karolinger von 739 bis 791 zusammenstellen. Grund war seine Sorge, dass die fast durchgängig auf brüchigem Papyrus geschriebenen Mitteilungen allzu rasch zerfallen könnten. Die Themen der Briefe sind vielfältig. Es geht um das päpstlich-karolingische Bündnis und um aktuelle theologische und kirchenpolitische Fragen. Nur noch in einer einzigen Handschrift ist uns diese so überaus wertvolle Quelle überliefert (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 499).
Nicht weniger wichtig für die Beurteilung von Karls Herrschaft waren seine Erlasse, die sogenannten ›Kapitularien‹ – so benannt nach ihrer Einteilung in Kapitel. Mit ihnen machte er Befehle, Anweisungen und Entscheidungen im gesamten Reich oder in Teilen seines Reiches bekannt. Es ist in der Forschung umstritten, ob diese herrscherlichen Anordnungen angesichts der gesellschaftlichen, kulturellen und rechtlichen Vielfalt im Reich überhaupt große Wirkung erzielen konnten. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Karl der Große mit seinen Rechtserlassen ein Instrument auszuformen suchte, das auf vielen Gebieten der staatlichen, kirchlichen und privaten Ordnung klare Regeln, Normen und Vorgaben schaffen sollte. Die Kapitularien waren eines seiner stärksten Mittel in seinem Bemühen, Eindeutigkeit in seinem Reich zu schaffen.
Ebenfalls dem Rechtsbereich gehören die ›Volksrechte‹ (›Leges‹) an. Unter ihnen ragen die beiden Rechtsbücher der Franken für die Salier (im Gebiet Belgiens und im Raum Arras, Cambrai und Tournai) und die Ripuarier (um Köln und am Rhein) heraus. Aber auch die Rechte der Alemannen und der Bayern sind aufschlussreich, auch wenn sie in der Hauptsache schon in der Zeit vor Karl dem Großen entstanden waren. Auf diesem Gebiet war Karl allerdings bei seinen Versuchen, die Rechtslage zu vereinheitlichen, kein besonderer Erfolg beschieden.
Schließlich seien – neben den Heiligenviten – noch Quellenbereiche genannt, welche die Epoche Karls des Großen in besonderer Weise kennzeichnen: Es sind zum einen die vielen Gedichte der Gelehrten, die meist für den Vortrag am Hof geschrieben wurden. Sie eignen sich bestens dazu, uns das Milieu des höfischen Lebens zu vermitteln. Zum anderen sind die wissenschaftlichen und theologischen Erörterungen zu nennen, die Lehrbücher und Forschungsarbeiten der geistigen Elite im damaligen Europa. Wir blicken mit ihnen in die Zentren der Wissenschaft und in die Labore eines neuen Gesellschafts- und Wertesystems. Vieles, was wir hier antreffen, ist über die Theorie nicht hinausgekommen, aber anderes war in höchstem Maße wirksam. Die beeindruckenden neuen mathematischen Erkenntnisse etwa, die Wiederbelebung der »trivialen« Künste der Rhetorik, der Grammatik und der Dialektik, die Beherrschung also des Schreibens, Redens und Argumentierens, und die Beschäftigung mit der Antike auf ganz unterschiedlichen Feldern waren wegweisend für die Zukunft. Hier treffen wir unentwegt auf das Bemühen, Eindeutigkeit zu schaffen und Deutungshoheit zu entwickeln.
Die Quellennachrichten, die uns zur Verfügung stehen – so wird mit diesem Überblick deutlich –, strömen für die Zeit Karls des Großen ungewöhnlich reichlich. Mitunter bekommt man den Eindruck, als habe eine regelrechte ›Schreib-Euphorie‹ um sich gegriffen. Dass dies wiederum mit einer groß angelegten Bildungsoffensive und auch mit dem Bestreben nach Regulierung und Vereindeutigung in den verschiedensten Lebensbereichen und schließlich nach ›Deutungshoheit‹ grundsätzlich zusammenhängt, wird uns bei den weiteren Betrachtungen immer wieder auffallen.
KAPITEL 3
Heiliger Karl – Heiliges Reich
Karl der Große ist bis heute ein Mythos. Nicht die Vita von Einhart oder die vielen Quellen aus seiner Zeit prägten sein Bild in der kollektiven Erinnerung. Vielmehr wurde seine »Unvergleichlichkeit«, von der schon Notker »der Stammler« im ausgehenden neunten Jahrhundert sprach, Schritt um Schritt immer noch großartiger ausgestaltet. Schließlich mündete die Entwicklung sogar in die Heiligsprechung Karls des Großen.
Vieles deutet darauf hin, dass ein erster Schritt in Richtung Heiligkeit im Jahre 1000 erfolgte.1 Damals, zu Pfingsten des Jahres, ließ Kaiser Otto III. (983–1002) zum ersten Mal das Grab Karls des Großen in Aachen öffnen, ein höchst bemerkenswerter Vorgang. Der Ort der Grabesstätte sei gar nicht so leicht zu finden gewesen, versicherte Thietmar von Merseburg, ein Zeitgenosse der Ereignisse. Der italienische Pfalzgraf Otto von Lomello, ein enger Vertrauter Ottos III., soll dabei gewesen sein. Jedenfalls wird das in der Chronik von Novalese von ca. 1030 behauptet. Sein Bericht ist in der Chronik festgehalten:
»Wir traten also bei Karl ein. Er lag nicht, wie das bei Körpern anderer Verstorbener üblich ist, sondern saß auf einem Thron, als würde er noch leben. Mit einer goldenen Krone war er gekrönt, das Szepter aber hielt er in Händen, die mit Handschuhen überzogen waren, bei denen bereits die Fingernägel, die sich hindurchgebohrt hatten, herausstanden. Über ihm befand sich eine Decke, fest gebaut aus Kalk und Marmorstein. Durch sie schlugen wir zuerst ein Loch, um zu ihm zu gelangen. Als wir dann zu ihm gekommen waren, empfanden wir einen intensiven Wohlgeruch. Sogleich verehrten wir ihn mit gebeugten Knien. Dann bekleidete ihn Kaiser Otto mit weißen Gewändern, schnitt ihm die Nägel und stellte alles, was um ihn herum fehlte, wieder her. Von seinen Gliedern war noch nichts durch Verwesung vernichtet, außer dass von seiner Nasenspitze etwas fehlte. Dies ließ der Kaiser aus Gold ersetzen. Aus seinem Mund zog er einen Zahn, dann ließ er die Decke wieder herstellen und ging weg.«2 So also soll die Grabesöffnung fast zwei Jahrhunderte nach Karls Tod abgelaufen sein.
Ist diese Geschichte wahr? Die Schilderung besticht in der Tat durch die Details. Manches wird durch den Mönch Adémar von Chabannes aus Aquitanien, der ebenfalls um 1030 schrieb und für phantasiereiche Schilderungen bekannt ist, bestätigt3: Karls Körper sei in einer gewölbten Gruft (arcuata spelunca) in der Aachener Marienkirche gefunden worden. Er sei noch ganz unverwest gewesen und habe auf einem goldenen Thron gesessen. Auf seinen Knien habe ein goldenes Evangelienbuch gelegen. Die goldene Krone auf seinem Haupt sei mit einem Kreuz geschmückt gewesen. Außerdem habe Karl ein Szepter und ein Schwert aus purem Gold (ex auro purissimo) gehalten. Das goldene Szepter Karls taucht auch in Erzählungen anderer Quellen auf. Schon Notker »der Stammler« aus St. Gallen erwähnte es im späteren neunten Jahrhundert in seinen ›Gesta Karoli‹. Der Thron wiederum, auf dem sich das Skelett Karls befunden haben soll, wird auch in der Chronik Thietmars von Merseburg erwähnt: »Die Gebeine Kaiser Karls…wurden auf dem königlichen Thron aufgefunden«4, heißt es da. Wahre Geschichte oder Phantasie? Adémar von Chabannes will auch wissen, dass der goldene Thronsitz aus dem Grab Karls von Otto III. an den polnischen Herzog Bolesław Chrobry nach Gnesen geschickt worden sei, der ihm dafür eine Armreliquie des heiligen Adalbert für Aachen überlassen habe.
Alles erfunden? Heute ist man in der Forschung der Meinung, Karl sei nach seinem Tod 814 in den berühmten Proserpina-Sarkophag – den wir noch näher betrachten werden – gelegt worden. Ist das Bild von dem auf dem goldenen Thron sitzenden Leichnam Karls lediglich Ausdruck dessen, dass man sich diesen Kaiser nur so vorstellen konnte? Man muss diese Frage so stehen lassen. Über Spekulationen kommen wir nicht hinaus.
Diese Berichte jedenfalls, darauf hat der Münchener Historiker Knut Görich aufmerksam gemacht, weisen auf wichtige Begleiterscheinungen für eine geplante Heiligsprechung hin: Die Unversehrtheit des Leichnams, vor allem der Wohlgeruch, aber auch die geheim (clam) ablaufende Aktion, wie sie der Chronist Thietmar betonte. An der Öffnung des Grabes auf Veranlassung Ottos III. ist jedenfalls nicht zu zweifeln. Aber was war damit bezweckt? Wollte er damit den Kaiser Augustus nachahmen, der das Grab Alexanders des Großen hatte öffnen lassen? Belege gibt es auch dafür nicht. Fest steht, dass sich Otto III., ebenso wie sein Großvater Otto der Große (936–973), als Kaiser ostentativ in die Tradition Karls des Großen gestellt hat, ja mehr noch: Er wollte wie Karl eine enge Verbindung mit dem Papst im Sinne einer gemeinsamen, gottgewollten Ordnung in einem Universalreich herstellen. Hinzu kam noch die hoch gesteigerte Endzeitstimmung um die erste Jahrtausendwende.5 Sie verlangte vom Herrscher ein besonderes Bemühen um die Fürsprache heiliger und höherer Mächte. Karl, der kraftvolle Verbreiter der christlichen Wahrheit, wurde ganz ohne Zweifel bereits zu diesen höheren Mächten gerechnet. Er war damit nicht mehr weit davon entfernt, in den Kreis der Heiligen aufzusteigen.
Aber es war auch wieder nicht so einfach, jemanden in die Sphäre der Heiligkeit zu erheben. Vor allem mussten Wunder geschehen sein und Wunderberichte vorliegen. Adémar von Chabannes erwähnt Wunder am Grab (multis signis et miraculis clarescere cepit), aber diese Bemerkungen sind ganz allgemein und daher unbrauchbar. Näheres ist nicht bekannt. Außerdem war die Erhebung der Gebeine, die für die Heiligenverehrung in damaliger Zeit die Hauptaktion darstellte, eine Angelegenheit des zuständigen Bischofs – im Falle von Aachen wäre das der Bischof von Lüttich gewesen, denn die Aachener Pfalz lag in seinem Bistum. Der Papst war dafür noch nicht notwendigerweise erforderlich, auch wenn seine Zustimmung eine Heiligsprechung fördern konnte, wie das zum ersten Mal im Falle des Bischofs Ulrich von Augsburg wenige Jahre zuvor, 993, der Fall gewesen war. Alle weiteren denkbaren Schritte aber wurden durch den frühzeitigen Tod Ottos III. eineinhalb Jahre später (Januar 1002) jäh beendet. Dennoch, der Stein war ins Rollen gebracht worden.
Es vergingen freilich weitere eineinhalb Jahrhunderte, bis es endlich so weit war. Unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) wurde das Werk vollendet. Am 29. Dezember 1165, dem Fest des biblischen Königs David, des Stammvaters Christi, wurde Karl der Große schließlich heiliggesprochen. Wir besitzen dazu eine erstrangige Quelle, nämlich eine Urkunde Barbarossas vom 8. Januar 1166. Darin schildert er ausführlich, wie der Akt abgelaufen ist6: »Veranlasst durch die ruhmreichen Taten und Verdienste des allerheiligsten Kaisers Karl und infolge der nachdrücklichen Bitten unseres lieben Freundes, des Königs Heinrich von England, und mit Zustimmung und Autorität des Papstes Paschalis sowie auf Rat aller unserer Fürsten, der weltlichen wie der geistlichen, haben wir für die Auffindung, Erhebung und Heiligsprechung einen feierlichen Hoftag zu Weihnachten in Aachen veranstaltet. Dort haben wir dessen [Karls] heiligsten Leichnam, der aus Furcht vor äußeren und inneren Feinden sorgfältig verborgen war, aber durch göttliche Offenbarung wieder gefunden wurde, zum Lob und Ruhm des Namens Christi, zur Festigung des Römischen Imperiums, zum Heil unserer geliebten Gemahlin, der Kaiserin Beatrix, und unserer Söhne Friedrich und Heinrich, in Anwesenheit zahlreicher Fürsten und einer großen Menge von Geistlichen und Laien unter Hymnen und frommen Gesängen mit Furcht und Ehrerbietung am 29. Dezember erhoben und erhöht.« »Wir haben erhoben«: elevavimus et exaltavimus! Hat der Kaiser mit eigenen Händen die Gebeine des großen Karl aus seiner Gruft erhoben – oder wahrscheinlicher: aus dem Proserpina-Sarkophag – und in ein neues Reliquiar gelegt? Es scheint so gewesen zu sein. Den entscheidenden Akt für die Erhebung Karls in den Himmel der Heiligen vollzog Kaiser Rotbart in eigener Person! Ein wahrlich sensationeller Vorgang – auch wenn Papst Paschalis III. (1164–1168), der sich damals nur mithilfe des Kaisers auf dem Stuhl Petri halten konnte, seine Zustimmung gegeben hatte. Immerhin konnte sich Barbarossa auf ein Beispiel berufen: Nur kurz zuvor, 1163, hatte schon König Heinrich II. von England in Westminster Abbey die Gebeine König Edwards des Bekenners erhoben, der freilich bereits zwei Jahre zuvor vom Papst heiliggesprochen worden war.7
Was waren Barbarossas Motive für diese aufsehenerregende Aktion? Dafür muss man den Blick auf das politische Umfeld richten. Barbarossa stand in diesen Jahren in einem heftigen Kampf gegen den anderen Papst, den es damals gab, Alexander III. (1159–1181). Dabei ging es um eine Frage von grundlegender Bedeutung, nämlich darum, wie sich die beiden Gewalten Kaisertum und Papsttum zueinander verhalten. Wer stand über dem anderen? Barbarossa war zunächst auf Gleichrangigkeit aus. In seiner Wahlanzeige von 1152 an den damaligen Papst Eugen III. (1145–1153) schlug er vor, sie beide seien doch wie die zwei Schwerter, die – gemäß der Bibel – Jesus gezeigt wurden und von denen dieser sagte: »Das ist genug« (satis est) (Lukas 22,38). Daraus entstand die Lehre, dass es auf Erden zwei Gewalten gebe, die geistliche und die weltliche bzw. die päpstliche und die kaiserliche (Zweigewaltenlehre), dass beide unmittelbar von Christus kämen und daher keine der anderen untergeordnet sei.8
Aber das Papsttum war seit dem Investiturstreit, der insbesondere mit dem großen Reformpapst Gregor VII. (1073–1085) verbunden ist, auf dem Weg, den Vorrang in Kirche und Welt für sich zu beanspruchen.9 Auch der Kaiser habe dem ›Stellvertreter Christi‹, als der sich nun der Papst betrachtete, zu gehorchen – wie ein Sohn dem Vater oder sogar, wie um 1160 diskutiert wurde, wie ein Lehnsmann dem Lehnsherrn.10 Als es 1159 zu einer schismatischen Wahl kam, aus der zwei Päpste hervorgingen – eben Alexander III. und auf der anderen Seite Viktor IV. (1159–1164) –, wollte Barbarossa als oberste Autorität für die christliche und kirchliche Einheit auftreten und das Schisma beenden. Ganz so hatten es die römischen Kaiser in der Spätantike gemacht – und an diesen wollte er sich orientieren.
Doch Alexander III. dachte nicht im Entferntesten daran, die päpstliche Gehorsamsforderung aufzugeben oder sich gar dem Urteil einer vom Kaiser dominierten Synode in Pavia (1160) zu unterwerfen. Schon seit Längerem pflegte er eine enge und vertraute Verbindung zum König von Frankreich, der sich Schritt um Schritt – in Konfrontation zum Kaiser – zum ›eigentlichen‹ Beschützer des Papstes aufschwang. In diesem Zusammenhang waren in Saint-Denis Texte entstanden, die Karl den Großen als Stammvater der französischen Monarchie und Vorbild für die Beschützerrolle des Königs von Frankreich beschrieben. Mit Frankreich lag aber wiederum der König von England im Streit, und so ist es verständlich, dass auch König Heinrich II. von England (1154–1189) dem Erhebungsakt am 29. Dezember 1165 zugestimmt hatte.
Damit deutet sich an, gegen wen die Heiligsprechung Karls des Großen gerichtet war: gegen den König von Frankreich und gegen Alexander III., also gegen denjenigen der beiden Päpste, der die Heiligkeit der Kirche (sancta ecclesia) und des heiligen Stuhls (sancta sedes apostolica) über die Autorität des Kaisertums erhob. Mit dem heiligen Karl aber gab es seit 1165 auch einen heiligen Kaiser – und damit war auf diesem Gebiet Gleichrangigkeit erreicht. Die eine Heiligkeit wurde gegen die andere gestellt, ein bemerkenswerter Vorgang!
Diese Politik Barbarossas hatte eigentlich schon 1157 begonnen. Damals wurde in seiner Kanzlei zum ersten Mal der Ausdruck »heiliges Reich« (sacrum imperium) in einer offiziellen Verlautbarung verwendet. Das »heilige Reich« war, so ist zu erkennen, aus einer Kampfsituation gegen das Papsttum heraus entstanden. Der »heiligen Kirche« wurde ein von ihr unabhängiges Gegenstück, das »heilige Reich«, gegenübergestellt. Unsere heutige landläufige Meinung, das »heilige Reich« des Mittelalters sei ein Produkt der Kirche, trifft also nur bedingt zu.11 Eher wird man sagen können, dass Friedrich I. Barbarossa den Kampf um die Gleichrangigkeit von Kaiser und Papst mit den Mitteln der Kirche führte.
Damit wird deutlich erkennbar, in welche Zusammenhänge Karl der Große damals geraten war. Ein »heiliges Reich« benötigte eine heilige Symbolfigur. Zu diesem Zweck waren kurz zuvor auch schon die heiligen drei Könige eingesetzt worden. 1162 hatte Barbarossa gegen die ungehorsamen lombardischen Städte gekämpft und dabei Mailand erobert. Bei dieser Gelegenheit fand man dort die Gebeine der heiligen drei Könige – eine Sensation, denn nicht einmal die Mailänder wussten bis dahin, dass die drei Weisen aus dem Morgenland in ihrer Stadt lagen. Wer auch immer sie ›gefunden‹ hat: Diese Könige besaßen einen großen Vorteil gegenüber dem Papst und der Kirche, denn sie waren bereits von Anfang an heilig. Sie hatten zu einer Zeit gelebt, in der es das Papsttum noch gar nicht gegeben hatte. Die höchste weltliche Gewalt konnte sich auf diese Weise in eine eigene Tradition stellen. Ihre Heiligkeit war sogar älter als die der Kirche.
1164 ließ Erzbischof Rainald von Dassel in Absprache mit Barbarossa die kostbaren heiligen Gebeine nach Köln bringen. Dort wurden sie sogleich zum Mittelpunkt einer großen und überaus wirkungsvollen Verehrung in der Stadt und im ganzen Reich. Der um 1200 entstandene goldene, reich mit Edelsteinen geschmückte Schrein, der heute noch im Kölner Dom zu sehen ist, zählt zu den prächtigsten Goldschmiedearbeiten des Mittelalters. Die drei Könige waren seither nicht mehr wegzudenken aus dem symbolischen Repertoire des Reiches.
Aber sie reichten noch nicht aus. Ein Jahr später, 1165, kam Karl, der große Kaiser des Abendlandes, hinzu und trat in eine enge Verbindung mit ihnen. Anders als diese, die irgendwoher aus dem Morgenland kamen, symbolisierte Karl ganz konkret die weltlich-kaiserliche Autorität im Abendland. Mit ihm hatte das »heilige Reich« als eine eigenständige politische Größe einen konkreten ›Spitzenahn‹ erhalten. Mit dem Gesamtensemble von Karl und den drei heiligen Königen wurde die Legitimation des Imperiums auf eine neue Grundlage gestellt.
Dieser Aufstieg Karls in die Sphäre der Heiligkeit war durch eine ganze Reihe neuer ›Karlsbilder‹ vorbereitet worden. Schon vor 1165 waren Texte entstanden, mit denen der ›neue Karl‹ erfunden und konstruiert wurde – allerdings nicht im Reich, sondern in Frankreich. Den Beginn machte die sogenannte ›Beschreibung des Nagels und der Dornenkrone des Herrn‹ (›Descriptio clavi et corone domini‹). Sie wurde von Mönchen des Klosters Saint-Denis verfasst, wahrscheinlich 1053/1054.12 Um die etwas im Sinken begriffene Bedeutung des Klosters wieder zum Glänzen zu bringen, erdichtete man die Geschichte von einer Byzanzreise Karls des Großen. Dieser habe von dort ein Stück der Dornenkrone Christi mit acht Dornen sowie einen Nagel und einen Splitter vom Kreuz Christi sowie das Schweißtuch mitgebracht. Auf diese Weise wurde Karl der Große in unmittelbare Beziehung zum Heiligen Land und zu Jerusalem gesetzt.
Diese unsagbar wertvollen Heiligtümer, so die ›Descriptio‹ weiter, seien zuerst nach Aachen in die dortige Pfalzkapelle gekommen. Doch später habe sie Karl der Kahle (840/843–877), einer der Enkel Karls des Großen, dem Kloster Saint-Denis geschenkt. Der eigentliche Hüter des Erbes Karls des Großen, so wurde damit zum Ausdruck gebracht, sei gar nicht Aachen, sondern Saint-Denis. Der große Kaiser des Frankenreichs sollte fortan zum Gründungsvater des damals entstehenden Frankreichs werden. Und an den damaligen französischen König, Heinrich I. (1031–1060), erging damit die Aufforderung, dass er die Anknüpfung an Karl den Großen nur über Saint-Denis erreichen könne.