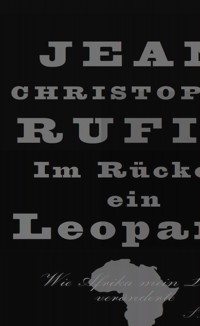2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine herzerwärmende Geschichte über die Freundschaft zwischen einem jungen Mann und seinem Hund
Sommer 1919: In einer kleinen französischen Stadt sitzt der Kriegsheld Jacques Morlac in Untersuchungshaft. Er wurde eingesperrt, weil er den ihm verliehenen Tapferkeitsorden seinem Hund ans Halsband heftete, statt die Ehrung anzunehmen. Warum hat er das getan? Und warum will er nun seinen treuen Gefährten, der sich vor dem Kerker die Seele aus dem Leib bellt, nicht zu sich lassen? Auch der Mutter seines kleinen Sohnes, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwartete, verweigert er das Wiedersehen. Keine leichte Aufgabe für den jungen Richter Lantier de Grez, Morlacs dunkles Geheimnis aufzudecken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jean-Christophe Rufin
Das rote Halsband
Roman
Aus dem Französischen von Nathalie Lemmens
Mit Illustrationen von Carla Nagel
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Le collier rouge« bei Éditions Gallimard, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2014 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Covermotiv: © MirasWonderland / GettyImages; johny007pan / GettyImages; Yolande de Kort / Trevillion Images; Mark Owen / Trevillion Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15082-2 V002 www.cbertelsmann.de
1
In der drückenden Hitze, die um ein Uhr mittags auf der Stadt lastete, war das Gebell des Hundes nicht auszuhalten. Seit zwei Tagen war er da, auf der Place Michelet, und seit zwei Tagen bellte er. Es war ein großer brauner Hund mit kurzem Fell, ohne Halsband, eines seiner Ohren zerfetzt. Er kläffte ungefähr alle drei Sekunden einmal, in einer tiefen Tonlage, die einen wahnsinnig machte.
Von der Schwelle der ehemaligen Kaserne aus, die während des Krieges in ein Gefängnis für Deserteure und Spione umgewandelt worden war, hatte Dujeux mit kleinen Steinen nach ihm geworfen. Aber es half nichts. Wenn der Hund die Kiesel herannahen spürte, wich er für einen Moment zurück, verstummte kurz und bellte danach umso lauter. Es gab nur einen Gefangenen im Gebäude, und er machte nicht den Eindruck, als wollte er fliehen. Doch unglücklicherweise war Dujeux der einzige Wärter, und sein Pflichtgefühl verbot es ihm, seinen Posten zu verlassen. Er hatte keine Möglichkeit, das Tier zu verjagen oder ihm wirklich Angst zu machen.
Bei dieser Gluthitze wagte sich niemand vor die Tür. Das Bellen hallte zwischen den Mauern der menschenleeren Straßen wider. Irgendwann kam Dujeux der Gedanke, seine Pistole zu benutzen. Aber mittlerweile herrschte Frieden; er fragte sich, ob er einfach so schießen dürfe, mitten in der Stadt, und sei es nur auf einen Hund. Vor allem aber hätte der Gefangene das als Vorwand nutzen können, um die Bevölkerung noch ein wenig mehr gegen die Behörden aufzustacheln.
Dass Dujeux den Kerl nicht ausstehen konnte, war noch milde ausgedrückt. Auch auf die Gendarmen, die ihn festgenommen hatten, hatte er einen unangenehmen Eindruck gemacht. Der Mann hatte sich nicht gewehrt, als sie ihn ins Militärgefängnis gebracht hatten. Er hatte sie mit einem übertrieben sanften Lächeln angesehen, das ihnen nicht gefallen hatte. Man spürte, dass er sich seiner Sache sicher war, als hätte er sich aus freien Stücken entschlossen, sie zu begleiten, als hinge es nur von ihm ab, eine Revolution im Land losbrechen zu lassen …
Und vielleicht stimmte das ja sogar. Dujeux hätte es nicht beschwören wollen. Was wusste er, der Bretone aus Concarneau, denn schon von dieser Unterpräfektur im Bas-Berry? Wohl fühlte er sich dort jedenfalls nicht. Das Jahr über war das Wetter feucht, und während der wenigen Wochen, in denen die Sonne den ganzen Tag schien, war es zu heiß. Im Winter und in den regnerischen Jahreszeiten stieg ein ungesunder, nach verrottetem Gras riechender Dunst vom Boden auf. Im Sommer hing trockener Staub über den Wegen, und in der kleinen Stadt, die von nichts als offenem Land umgeben war, stank es – niemand wusste, wieso – auch noch nach Schwefel.
Dujeux hatte die Tür wieder geschlossen und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Von dem Gebell bekam er Migräne. Aufgrund von Personalmangel wurde er nie abgelöst. Er schlief in seinem Büro, auf einem Strohsack, den er tagsüber in einem Metallschrank verstaute. In den beiden vergangenen Nächten hatte er wegen des Hundes kein Auge zugetan. Das war doch nichts mehr in seinem Alter. Er war der festen Überzeugung, dass ein Mann von solchen Prüfungen verschont bleiben sollte, wenn er einmal die fünfzig überschritten hatte. Seine einzige Hoffnung war, dass der Offizier, der wegen der Untersuchung herkommen sollte, schnellstens eintraf.
Perrine, die Kellnerin aus der Bar des Marronniers, kam morgens und abends über den Platz und brachte ihm Wein. Er musste ja schließlich durchhalten. Das Mädchen reichte ihm die Flaschen durchs Fenster, und er gab ihr wortlos das Geld. Sie schien keine Angst vor dem Hund zu haben, am ersten Abend war sie sogar stehen geblieben, um ihn zu streicheln. Die Einwohner der Stadt hatten sich für eine Seite entschieden. Und es war nicht die von Dujeux.
Er hatte Perrines Flaschen unter seinen Schreibtisch gestellt und bediente sich heimlich daran. Er wollte vermeiden, beim Trinken erwischt zu werden, falls der Offizier unerwartet hereinkommen sollte. Nach den schlaflosen Nächten war er so erschöpft, dass er nicht sicher war, ob er ihn hören würde, wenn er ankam.
Und er musste tatsächlich für ein Weilchen eingenickt sein, denn als er die Augen wieder öffnete, sah er ihn vor sich. An der Tür zum Büro stand ein hochgewachsener Mann in eng anliegendem königsblauem, für die Jahreszeit zu dickem und trotzdem bis zum Kragen zugeknöpftem Uniformrock und musterte Dujeux unnachsichtig. Der Gefängniswärter richtete sich auf und schloss mit fahrigen Fingern ein paar Knöpfe an seiner Jacke. Dann stand er auf und nahm Habtachtstellung ein. Ihm war bewusst, dass seine Augen geschwollen waren und er nach Wein roch.
»Können Sie diesen Köter nicht zum Schweigen bringen?«
Das waren die ersten Worte des Offiziers. Ohne Dujeux zu beachten, sah er zum Fenster hinaus. Dieser stand immer noch in Habtachtstellung, ihm wurde übel, und er wagte nicht, den Mund zu öffnen.
»Dabei wirkt er eigentlich nicht aggressiv«, fuhr der Militärrichter fort. »Als der Fahrer mich abgesetzt hat, hat er sich nicht vom Fleck gerührt.«
Also hatte ein Wagen vor dem Gefängnis gehalten, und Dujeux hatte nichts gehört. Er hatte eindeutig länger geschlafen als gedacht.
Der Offizier drehte sich zu ihm um. »Rühren«, sagte er matt. Offensichtlich legte er keinen großen Wert auf Disziplin. Er bewegte sich ungezwungen und schien die militärische Inszenierung eher für lästige Folklore zu halten. Er griff nach einem Sprossenstuhl, drehte ihn um und setzte sich rittlings darauf, den Oberkörper über die Rückenlehne vorgebeugt. Dujeux entspannte sich. Er hätte gern einen Schluck getrunken, und vielleicht wäre sein Gegenüber bei dieser Hitze froh gewesen, ihm dabei Gesellschaft zu leisten. Aber er verscheuchte den Gedanken und begnügte sich damit, etwas Speichel zu schlucken, um seine Kehle zu benetzen.
»Ist er da drin?«, fragte der Richter und wies mit dem Kinn auf die Metalltür, die zu den Zellen führte.
»Ja, mon commandant.«
»Wie viele haben Sie im Moment?«
»Nur den einen, mon commandant. Seit Kriegsende ist es hier leer geworden …«
Und das war mal wieder typisch für Dujeux, diesen Pechvogel. Bei einem einzigen Gast hätte er eigentlich ein geruhsames Leben führen sollen. Aber da musste der Bursche ausgerechnet einen Hund haben, der ununterbrochen vor dem Gefängnis herumkläffte.
Der Offizier schwitzte. Behände öffnete er die etwa zwanzig Knöpfe an seinem Rock. Dujeux sagte sich, dass er sie bestimmt erst kurz vor dem Hereinkommen zugeknöpft hatte, um ihn zu beeindrucken. Der Mann war um die dreißig, und nach diesem Krieg war es nichts Ungewöhnliches, derart junge Männer mit Tressen geschmückt zu sehen. Sein vorschriftsmäßiger Schnurrbart wollte einfach nicht dicht wachsen, weshalb es aussah, als hätte er zwei Augenbrauen unter der Nase. Seine Augen waren stahlblau, aber sanft, bestimmt war er kurzsichtig. Aus einer Tasche an seiner Weste schaute eine Hornbrille hervor. War er zu eitel, um sie aufzusetzen? Oder wollte er seinem Blick absichtlich jene Unbestimmtheit verleihen, die die Verdächtigen, die er verhörte, gewiss verunsichern musste? Er zog ein kariertes Taschentuch hervor und trocknete sich die Stirn.
»Ihr Name, Feldwebel?«
»Dujeux, Raymond.«
»Waren Sie im Krieg?«
Der Wärter richtete sich auf. Die Gelegenheit war günstig. Er konnte ein paar Punkte sammeln, seinen Aufzug vergessen machen und zeigen, dass er diese Funktion als Gefängnisaufseher nur ungern ausübte.
»Aber sicher, mon commandant. Ich war bei den Jägern. Man sieht es nicht; ich habe mir den Bart abrasiert …« Als sein Gegenüber nicht lächelte, fuhr er fort: »Zweimal verwundet. Das erste Mal die Schulter, an der Marne, und das zweite Mal am Bauch beim Anstieg auf den Mort-Homme. Und darum bin ich seitdem …«
Mit einem Wink bedeutete ihm der Offizier, dass er verstand und Dujeux nicht weiter auszuführen brauchte.
»Haben Sie seine Akte?«
Dujeux stürzte zu einem Rollsekretär, öffnete ihn und reichte dem Offizier eine Aktenmappe. Der kartonierte Umschlag täuschte. In Wirklichkeit enthielt sie nur zwei Dokumente: das Protokoll der Gendarmen und den Militärpass des Gefangenen. Der Richter überflog sie rasch. Sie enthielten nichts, was er nicht bereits wusste. Er stand auf, und Dujeux wollte schon hastig nach dem Schlüsselbund greifen. Aber statt sich den Zellen zuzuwenden, trat der Offizier wieder ans Fenster.
»Sie sollten es öffnen, bei Ihnen bekommt man ja keine Luft.«
»Das ist wegen des Hundes, mon commandant …«
Draußen in der prallen Sonne bellte das Tier ununterbrochen. Wenn es Atem holte, hing ihm die Zunge aus dem Maul, und man sah, dass es hechelte.
»Was, glauben Sie, ist das für eine Rasse? Sieht aus wie ein Weimaraner.«
»Mit Verlaub, ich würde sagen, es ist eher ein Mischling. Solche Hunde sieht man oft hier auf dem Land. Sie hüten die Herden. Aber sie gehen auch mit auf die Jagd.«
Der Offizier schien ihn nicht gehört zu haben.
»Oder vielleicht ein Pyrenäenschäferhund …«
Dujeux entschied, dass es besser war, sich da rauszuhalten. Noch so ein Aristokrat, so ein Treibjagdfanatiker, einer dieser Landjunker, die während des Krieges durch ihren Hochmut und ihre Unfähigkeit so viel Unheil angerichtet hatten …
»Gut«, schloss der Offizier ohne große Begeisterung. »Fangen wir an. Ich werde den Verdächtigen anhören.«
»Wollen Sie in seiner Zelle mit ihm sprechen, oder soll ich ihn für Sie herholen?«
Der Richter warf einen Blick in Richtung Fenster. Das Gebell des Hundes hielt unvermindert an. Wenigstens würde man im hinteren Teil des Gebäudes den Lärm nicht so deutlich hören.
»In seiner Zelle«, sagte er.
Dujeux nahm den großen Ring, an dem die Schlüssel aufgereiht waren. Als er die Tür öffnete, die zu den Zellen führte, drang ein Schwall kühlerer Luft in das Büro. Es roch beinahe wie in einem Keller, hätten nicht die unangenehmen Ausdünstungen von Körpern und Exkrementen in der Luft gehangen. Der Flur wurde durch ein Oberlicht am gegenüberliegenden Ende erhellt, durch das ein kaltes, milchiges Licht in das Dunkel sickerte. Es war ein ehemaliger Stubentrakt, und um daraus ein Gefängnis zu machen, hatte man große Riegel an den Türen angebracht. Diese standen ein Stück weit offen, und man sah in die leeren Zellen. Die letzte Tür, ganz hinten, war geschlossen, und Dujeux öffnete sie mit viel Getöse, wie ein Wanderer, der mit dem Fuß auf den Boden stampft, um die Schlangen zu vertreiben. Dann ließ er den Offizier eintreten.
Ein Mann lag auf einer der beiden Pritschen, das Gesicht zur Wand gedreht. Er rührte sich nicht.
»Aufstehen!«, rief Dujeux übereifrig.
Der Offizier bedeutete ihm, still zu sein und sie allein zu lassen. Er setzte sich auf das zweite Bett und wartete ein Weilchen. Er schien seine Kräfte zu sammeln, nicht wie ein Sportler vor dem Wettkampf, sondern eher wie jemand, der eine lästige Pflicht zu verrichten hat und nicht weiß, ob er über die nötige Energie dafür verfügt.
»Guten Tag, Monsieur Morlac«, sagte er leise, wobei er sich die Nasenwurzel massierte.
Der Mann rührte sich nicht. Seine Atmung jedoch verriet, dass er nicht schlief.
»Ich bin Major Lantier du Grez. Hugues Lantier du Grez. Wir werden uns ein wenig unterhalten, wenn es Ihnen recht ist.«
Dujeux hörte diesen Satz und schüttelte bekümmert den Kopf, während er in sein Büro zurückkehrte. Seit der Krieg zu Ende war, war nichts mehr so wie früher. Selbst die Militärjustiz wirkte zögerlich, geschwächt, wie dieser junge, allzu freundliche Richter. Lange her war die Zeit, als man die Leute noch ohne viel Federlesen erschießen ließ.
Der Gefängniswärter setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Ohne zu wissen, wieso, fühlte er sich entspannter. Etwas hatte sich verändert. Es war nicht die Hitze, die ihm, im Gegenteil, noch drückender erschien, nachdem er kurz in die Kühle der Zellen eingetaucht war. Es war auch nicht der Durst, der sich immer quälender bemerkbar machte und den er zu löschen beschloss, indem er vorsichtig eine Flasche unter seinem Schreibtisch hervorholte. Nein, was sich verändert hatte, war die Stille: Der Hund bellte nicht mehr.
Nach zwei höllischen Tagen war dies der erste ruhige Moment. Er stürzte ans Fenster, um nachzusehen, ob das Tier noch da war. Erst sah er es nicht. Doch als er den Kopf neigte, entdeckte er es im Schatten der Kirche, auf seinen Hinterpfoten sitzend, aufmerksam, aber stumm.
Seit der Richter die Zelle seines Herrn betreten hatte, hatte der Hund aufgehört, so gotterbärmlich zu bellen.
Der Militärrichter hatte die Akte geöffnet und auf seinen Schoß gelegt. Er hatte es sich auf dem Bettgestell bequem gemacht, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Man spürte, dass er sich für einen längeren Aufenthalt einrichtete und es nicht eilig hatte. Der Gefangene hatte sich nicht bewegt. Ausgestreckt auf seinem harten Lager, wandte er ihm immer noch den Rücken zu, aber es war unverkennbar, dass er nicht schlief.
»Jacques Pierre Marcel Morlac«, las der Offizier in ausdruckslosem Ton. »Geboren am 25. Juni 1891.«
Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, während er nachrechnete.
»Sie sind also achtundzwanzig Jahre alt. Achtundzwanzig Jahre und zwei Monate, denn wir haben jetzt August.« Er schien keine Antwort zu erwarten und fuhr fort: »Ihr offizieller Wohnsitz ist der Bauernhof Ihrer Eltern in Bigny, wo Sie auch geboren wurden. Das ist hier ganz in der Nähe, glaube ich. Eingezogen im November 15. November ’15? Sie müssen als Ernährer der Familie eingestuft worden sein, das hat Ihnen einen Aufschub verschafft.«
Der Richter hatte reichlich Erfahrung mit solchen Einführungen. Mit betrübter Miene leierte er die Personalien herunter. Die Unterschiede in den Daten und Orten, die ein Individuum definierten, waren von entscheidender Bedeutung: Ihnen verdankte ein jeder, dass er derjenige war, der er war. Und gleichzeitig waren diese Abweichungen so lächerlich, so minimal, dass sie besser als jede Matrikelnummer verdeutlichten, durch wie wenig sich die Menschen doch voneinander unterschieden. Abgesehen von diesen Eintragungen – ein Name, ein Geburtsdatum … – bilden sie eine kompakte, konturlose, anonyme Masse. Und jene Masse war es, die der Krieg durchgewalkt, vergeudet, verbraucht hatte. Niemand, der diesen Krieg erlebt hatte, konnte noch glauben, dass der Einzelne auch nur den geringsten Wert hatte. Und trotzdem verlangte die Justiz, für die Lantier inzwischen tätig war, dass ihr Individuen vorgeführt wurden, um ein Urteil zu fällen. Das war der Grund, warum er diese Informationen sammeln und sie in eine Akte stopfen musste, wo sie vertrocknen würden wie gepresste Blüten zwischen den Seiten eines dicken Buches.
»Man hat Sie zunächst der Intendantur in der Champagne zugeteilt. Das dürfte nicht allzu mühselig gewesen sein. Viehfutter auf Bauernhöfen requirieren, das können Sie. Und es ist nicht gefährlich.«
Der Offizier machte eine Pause, um zu sehen, ob der Beschuldigte darauf reagierte. Die Gestalt ihm gegenüber rührte sich immer noch nicht.
»Danach wurden Sie mit Ihrer Einheit zur Orientarmee abkommandiert. Ankunft in Saloniki im Juli ’16. Nun, da dürfte Ihnen die Hitze hier ja nicht allzu viel ausmachen! Da unten hatten Sie genügend Zeit, sich daran zu gewöhnen.«
Ein Lkw, der mühsam die Straße erklomm, fuhr mit heiserem Geräusch am Zellenfenster vorbei und entfernte sich wieder.
»Sie müssen mir unbedingt von diesem Feldzug auf dem Balkan erzählen. Ich habe das nie so recht verstanden. Wir wollten die Türken in den Dardanellen ärgern, und die haben uns zurück ins Meer getrieben, stimmt’s? Daraufhin haben wir uns nach Saloniki zurückgezogen und dort Katz und Maus mit den Griechen gespielt, die sich nicht dazu durchringen konnten, an unserer Seite in den Krieg einzutreten. Oder täusche ich mich? Wir an der Somme waren jedenfalls immer der Meinung, die Jungs bei der Orientarmee seien faule Säcke, die am Strand eine ruhige Kugel schieben …«
Lantier wusste, was er tat, als er überraschend in ein umgangssprachliches Register verfiel, vor allem aber diese unverhohlene Beleidigung äußerte. In seiner Miene spiegelte sich immer noch der gleiche Überdruss. Diese kleinen Knalleffekte gehörten zur Routine solcher Verhöre. Er wusste, welchen Nerv er bei dem Mann kitzeln musste, so wie ein Bauer die empfindlichen Stellen seines Viehs kennt. Der vor ihm liegende Gefangene bewegte einen Fuß. Das war ein gutes Zeichen.
»Wie auch immer, Sie haben sich ausgezeichnet. Bravo. August ’17 öffentliche Belobigung im Tagesbefehl, unterzeichnet von General Sarrail: ›Der Gefreite Morlac war entscheidend an einem Angriff gegen die bulgarischen und österreichischen Truppen beteiligt. Beim Sturm in erster Linie kämpfend, setzte er persönlich neun feindliche Infanteristen außer Gefecht, bevor er selbst an Kopf und Schulter verwundet wurde und bewusstlos auf dem Schlachtfeld zusammenbrach. Er hielt aus, bis es seinen Kameraden gelang, ihn nachts zurück hinter die französischen Linien zu holen. Diese heldenhafte Tat markierte den Beginn der siegreichen Gegenoffensive unserer Truppen in der Region der Cerna.‹ Wunderbar! Meinen aufrichtigen Glückwunsch!«
Diese Lektüre hatte ihre Wirkung offenkundig nicht verfehlt, denn der Gefangene versuchte nicht einmal mehr, so zu tun, als schliefe er. Zwar blieb er immer noch liegen, aber er wechselte die Stellung, möglicherweise mit der Absicht, die Worte des Offiziers zu übertönen.
»Sie müssen ja wirklich außergewöhnliche Tapferkeit bewiesen haben, dass Sie mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet wurden. Die Ehrenlegion! Für einen einfachen Gefreiten! Ich weiß nicht, wie das bei der Orientarmee war, aber in Frankreich habe ich, wenn ich mich recht erinnere, nur von zwei oder drei derartigen Fällen gehört. Darauf können Sie ganz besonders stolz sein. Sind Sie darauf ganz besonders stolz, Monsieur Morlac?«
Der Gefangene kramte unter seiner Decke herum. Es war abzusehen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis er sich zeigte.
»Kommen wir nun zu der Tat, wegen der Sie verhaftet wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann, dem aufgrund solcher Verdienste die Ehrenlegion verliehen wurde, sich in vollem Bewusstsein dessen schuldig machen würde, was man Ihnen zur Last legt. Ich nehme an, Sie waren betrunken, Monsieur Morlac. Der Krieg hat uns alle aus dem Gleichgewicht gebracht. Manchmal holen unsere Erinnerungen uns ein, und um ihnen zu entfliehen, trinken wir einen Schluck. Einen Schluck zu viel. Was dazu führt, dass man Dinge tut, die man im Nachhinein bereut. War es so? Falls ja, so entschuldigen Sie sich, äußern aufrichtiges Bedauern, und wir lassen es dabei bewenden.«
Auf der Pritsche gegenüber hatte sich der Mann endlich aufgerichtet. Er war schweißgebadet unter seiner Decke, seine Wangen waren gerötet, die Haare standen ihm zu Berge. Aber sein Blick war klar. Er setzte sich auf die Bettkante und ließ die nackten Beine baumeln. Er fuhr sich mit einer Hand über den Nacken, verzog das Gesicht und streckte sich. Dann schaute er den Richter an, der immer noch mit der Akte auf dem Schoß dasaß, und lächelte matt.
»Nein«, sagte der Mann. »Ich war nicht besoffen. Und ich bedaure nichts.«
2
Der Mann hatte recht leise gesprochen, und seine Stimme klang dumpf. Man konnte ihn unmöglich draußen gehört haben. Und doch hatte der Hund auf dem Platz sofort wieder angefangen zu bellen.
Unwillkürlich blickte der Richter zur Tür.
»Wenigstens einer, dem etwas an Ihnen liegt. Gibt es denn niemanden sonst, der Ihnen nahesteht, Gefreiter? Niemanden, der es vorziehen würde, wenn Sie diese unselige Geschichte hinter sich brächten und freikämen?«
»Ich sage es Ihnen noch einmal«, entgegnete Morlac. »Ich bin für meine Taten verantwortlich, und ich sehe keinen Grund, mich dafür zu entschuldigen.«
Auch er war offensichtlich vom Krieg gezeichnet. Etwas in seiner Stimme verriet, dass er es hoffnungslos ehrlich meinte. Als hätte die Gewissheit des nahen Todes, die er an der Front Tag für Tag verspürt hatte, alle harten Schalen der Lüge, alle gegerbten Häute, die das Leben, die Prüfungen und der Umgang mit anderen Menschen bei gewöhnlichen Leuten über die Wahrheit legen, in ihm dahinschmelzen lassen. Das hatten sie beide gemeinsam, diese Erschöpfung, die einem alle Kraft und jede Lust raubt, Dinge zu sagen oder zu denken, die nicht wahr sind. Und zugleich war es unmöglich geworden, Gedanken zu formulieren, die sich auf die Zukunft, auf das Glück, auf die Hoffnung richteten, da sie sogleich durch die widerwärtige Realität des Krieges zerstört wurden. Sodass nur noch traurige Sätze übrig blieben, ausgesprochen mit der grenzenlosen Nüchternheit der Verzweiflung.
»Läuft Ihnen dieser Hund schon lange nach?«
Morlac kratzte sich am Arm. Er trug ein ärmelloses Unterhemd, das seine Muskeln betonte. Dabei war er gar nicht besonders kräftig. Er war mittelgroß, hatte hellbraunes Haar, eine Stirnglatze und helle Augen. Man sah, dass er vom Land stammte, aber er hatte die erleuchtete Art und den intensiven Blick, die man sich bei Propheten oder Hirten vorstellt, die religiöse Erscheinungen gehabt hatten.
»Schon immer.«
»Was meinen Sie damit?«
Lantier begann, sein Verhörprotokoll zu schreiben. Er brauchte präzise Angaben für diese Aufgabe. Aber er widmete sich ihr ohne große Begeisterung.
»Er ist mitgekommen, als die Gendarmen mich für den Krieg abgeholt haben.«
»Erzählen Sie mir davon.«
»Wenn ich was zu rauchen kriege.«
Der Richter suchte in seiner Weste und holte ein zerknittertes Zigarettenpäckchen heraus. Morlac zündete eine davon mit dem Luntenfeuerzeug an, das ihm der Offizier gereicht hatte. Er stieß den Rauch durch die Nase aus wie ein wütender Stier.
»Das war gegen Ende des Herbstes. Sie wissen das, es steht in Ihren Unterlagen. Die Äcker waren noch nicht alle gepflügt. Mein Vater konnte schon lange nicht mehr hinter dem Pferd herlaufen. Und ich musste mich auch um die Felder der Nachbarn kümmern, weil ihr Sohn als einer der Ersten gegangen war. Die Gendarmen tauchten gegen Mittag auf. Ich sah, wie sie die Lindenallee hochkamen, und wusste gleich Bescheid. Ich hatte mit meinem Vater darüber gesprochen, was ich tun würde. Ich war dafür gewesen, mich zu verstecken. Aber er kannte sie und hatte gesagt, dass sie mich früher oder später doch erwischen würden. Also bin ich mit ihnen mitgegangen.«
»Waren Sie der Einzige, den sie abholen sollten?«
»Natürlich nicht. Sie hatten schon drei andere Rekruten bei sich. Ich kannte sie vom Sehen. Die Gendarmen ließen mich auf ihren Karren steigen, und dann haben wir noch drei weitere eingesammelt.«
»Und der Hund?«
»Der ist hinterhergelaufen.«
Hatte das Tier ihn gehört? Nachdem es ununterbrochen gebellt hatte, seit sein Herr aufgewacht war, schwieg es nun, als sie über es sprachen.
»Er war ja nicht der Einzige. All die anderen hatten auch einen Hund, der ihnen anfangs noch folgte. Die Büttel fanden das lustig. Ich glaube, sie ließen sie absichtlich hinter dem Karren herlaufen. Das wirkte fröhlich, es sah aus, als gingen wir auf die Jagd. Und darum kamen die, die wir abholten, auch mit, ohne Theater zu machen.«
Er lachte, während er davon erzählte, aber seine Augen blieben traurig, und der Offizier ihm gegenüber zeigte die gleiche aufgesetzte Fröhlichkeit.
»Hatten Sie diesen Hund schon lange?«
»Freunde hatten ihn mir gegeben.«
Der Richter notierte alles sorgfältig. Es war schon ein wenig komisch, zu sehen, wie er in vollem Ernst diese Hundegeschichten aufschrieb. Aber tatsächlich spielte das Tier eine wichtige Rolle in der Angelegenheit, die er hier zu untersuchen hatte.
»Welche Rasse?«
»Die Mutter war ein Briard, relativ reinrassig, glaube ich zumindest. Wer der Vater war, haben wir nie so genau rausgekriegt. Anscheinend hatte sie sich von allen Rüden der Gegend bespringen lassen.«
Es schwang nichts Anzügliches in diesen Worten mit, vielmehr Abscheu. Seltsam, wie der Krieg solche körperlichen Themen unerträglich gemacht hatte. Als entsprächen dieses Chaos des Anbeginns, diese Mysterien der Zeugung auf tragische Weise jener Orgie aus Blut und Tod, jener abscheulichen Mixtur, welche die Granaten in den Schützengräben hervorgebracht hatten.
»Wie auch immer«, unterbrach der Offizier seine Gedanken, »dieser Hund ist Ihnen also nachgelaufen. Und dann?«
»Dann ist er immer weitergelaufen. Anscheinend war er raffinierter als die anderen. Man hat uns in Nevers zusammengeführt, und von da aus ging es mit dem Zug nach Osten. Die meisten Hunde sind auf dem Bahnsteig zurückgeblieben, aber der da hat Anlauf genommen, und in dem Moment, als der Zug losfuhr, ist er auf die Plattform gesprungen.«
»Haben die Unteroffiziere ihn denn nicht verjagt?«