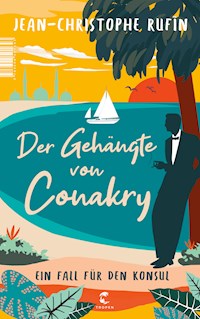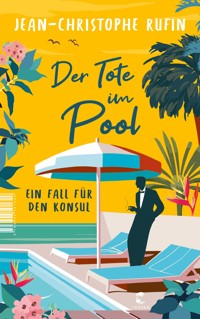
13,99 €
Mehr erfahren.
Je rätselhafter der Mordfall, desto wichtiger der Weißwein In Mosambik wird die Leiche eines Hotelbesitzers aus dem Pool gefischt, kurz darauf seine französische Exfrau verhaftet. Doch ist sie tatsächlich die Mörderin? Der tödlich gelangweilte Konsul Aurel Timescu hat da so seine Zweifel. Mit einem Glas Weißwein in der Hand beginnt er zu ermitteln. Und taucht ein in eine Welt aus Korruption, komplizierten Liebesbeziehungen und dubioser Diplomatie. Konsul Aurel Timescu wittert kriminelle Machenschaften: Kurz nach seiner Versetzung nach Maputo, Mosambik, wird ein unliebsamer Hotelbesitzer tot in seinem Pool aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei ist der Konsul sich sicher, dass die Exfrau des Toten unschuldig im Gefängnis sitzt. Doch wer hat den Hotelier stattdessen auf dem Gewissen? Kurzerhand stellt Aurel Timescu seine eigenen Ermittlungen an. Es dauert nicht lang, und er stößt auf die illegalen Machenschaften von Bauunternehmern und Wilderern auf der Jagd nach Elfenbein. Aber sein untrüglicher kriminalistischer Spürsinn und ein paar Gläser Weißwein bringen ihn auch dieses Mal auf die richtige Fährte. »Ein scharfsinniger Konsul in der Tradition von Columbo!« LE FIGARO
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jean-Christophe Rufin
Der Tote im Pool
Ein Fall für den Konsul
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Les Trois Femmes du Consul«
© 2019 by Flammarion, Paris
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung einer Illustration von © FinePic®, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50162-9
E-Book ISBN 978-3-608-12251-0
I
Eigentlich verwunderte es niemanden, dass man ihn ertrunken in seinem Swimmingpool gefunden hatte.
Schon lange hatte Béliot, der alte Béliot, wie er sich gern selbst nannte, um sich herum Hass geschürt. Da musste es irgendwann zu einem Gewaltausbruch kommen. Unter den Auswanderern in Mosambik war er zwar bekannt, doch hielten sich alle nach Möglichkeit von ihm fern. Selbst die vor Ort lebenden Franzosen, von denen es in dieser ehemaligen portugiesischen Kolonie ohnehin nicht viele gab, gingen ihm aus dem Weg. Durchreisende, Touristen, internationale Beamte oder leitende Angestellte, die hier für ihre Firmen tätig waren, verirrten sich nur selten in sein Haus.
Dabei war sein Hotel, die Residenz dos Camarões, günstig in der Nähe des Stadtzentrums und des Hafens gelegen. Doch es kursierten zu viele Gerüchte, die dem Ruf des Hotels geschadet hatten. Die wenigen Gäste, die sich dennoch hierher trauten, wurden schnell Zeugen peinlicher Szenen.
Béliot verbrachte seine Tage in einem Korbsessel mit abgenutzten Kissen, von dem aus er den Garten und den Pool im Blick hatte. Auf dem Tischchen vor ihm lagen verstreut Zeitungen, daneben stand zumeist ein Glas Whisky mit halb geschmolzenen Eiswürfeln. Mit einem kleinen Knopf, der unter dem Tisch angebracht war, konnte er eine der Bedienungen rufen. Diese Aufgabe wurde abwechselnd von zwei oder drei jungen Afrikanerinnen übernommen. Wenn der Klingelton ertönte – nie weniger als fünfmal in Folge – näherte sich die jeweils Zuständige widerwillig. Béliot erteilte ihr knappe Befehle, die wie Peitschenhiebe knallten.
Die Mädchen waren daran gewöhnt. Und sie hatten ein probates Mittel gefunden, um den Chef zu besänftigen: Sie zwängten ihr Hinterteil in einen hautengen Rock und knöpften die Bluse bis zum Bauchnabel auf. Wenn sie Béliot dann den georderten Whisky servierten, beugten sie sich tief zu ihm hinab und ließen eine schwarze, samtige Brustwarze vor seinen Augen schwingen, die ihn beschwichtigte. Anschließend kehrten sie hüftwiegend in den Dienstbotenbereich zurück. Auch wenn die Zeit verging, das Alter kam und der Körper schwächer wurde, so war der alte Béliot doch nicht von fleischlichen Begierden befreit. Noch immer war sein vom Verlangen getrübter Blick auf die sich entfernenden Hinterteile und Schenkel geheftet. Bisweilen erlaubte er sich sogar, zuzulangen, was die Mädchen vertragsgemäß akzeptierten. Sie wussten, dass der alte Weiße nicht weitergehen würde, da seine angetrauten Frauen um ihn herum über ihn wachten.
Die Residenz dos Camarões war ein altes Herrenhaus, das aufgestockt und seitlich erweitert worden war. Béliot hatte es in Eigenregie umgebaut. Als ehemaliger Bauleiter hatte er einige Projekte verantwortet – Brücken, Flughäfen, Bürogebäude. Viele offizielle Bauwerke der mosambikanischen Hauptstadt und anderer Städte auf dem gesamten afrikanischen Kontinent waren sein Werk. Doch auf keines war er so stolz wie auf sein Anwesen. Nach der Entkolonialisierung von Mosambik im Jahr 1975 hatte er es sehr günstig erworben. Es handelte sich um das Eigentum eines wenig begüterten Portugiesen, der geflohen war. Der eigentliche Wert lag in dem großen tropischen Garten, der mit einheimischen Mangobäumen und Palmen bepflanzt war, aber auch mit aus Brasilien importierten Arten wie Jakarandas und Paubrasilias. Die dichte Vegetation sorgte für kühlen Schatten, der nun, da sich Maputo in eine verstopfte und laute Hauptstadt verwandelt hatte, besonders wertvoll war.
Beim Kauf des Anwesens hatte Béliot nicht recht gewusst, was er damit anfangen sollte, da er sich zu jener Zeit wegen seiner Bauprojekte häufig im Ausland aufhielt. Damals hieß der Ort noch Lourenço Marques und wirkte wie eine kleine, verschlafene portugiesische Kreisstadt. Der Bauunternehmer machte hier, wo er später auch seinen Ruhestand verbringen wollte, zunächst Urlaub. Nach und nach war das Haus immer größer geworden, und schließlich hatte Béliot es in ein Hotel umgewandelt.
Auf der überdachten Terrasse gegenüber dem Pool verbrachte er jetzt seine Tage. Dieses schattige Plätzchen zwischen quadratischen Säulen war seit der Zeit des kleinen Kolonialpavillons unverändert geblieben: dieselben Stoffkissen in unmodernem Orange, derselbe eiserne Vogelkäfig für den Beo, dieselben Hängetöpfe mit tropischen Pflanzen, die nach modrigem Schwamm rochen. Nur die weiblichen Bedienungen wurden regelmäßig ausgetauscht.
Die anderen Gebäude, die auf dem Grundstück errichtet worden waren – das Hotel, das Restaurant mit den um den Pool verstreuten Tischen, das Büro, das Buchhaltung und Rezeption beherbergte –, schienen nicht zu derselben Welt zu gehören wie der einfache Gartenpavillon. Hier fühlte sich Béliot immer noch ganz zu Hause. Letztlich tolerierte er lediglich die indiskrete Anwesenheit der Gäste und des Personals – soweit ihm das bei seinen Launen möglich war.
In der ersten Zeit genossen es die wenigen Unerschrockenen, die in diesem Etablissement abstiegen, sich wie zu Hause zu fühlen. Weit von der Heimat entfernt oder zu Beginn der schwierigen Auswanderungsphase war die familiäre Atmosphäre eines Privathauses für Reisende angenehm. Doch schon bald verwandelte sich dieser Vorzug in einen Albtraum.
Es begann, wenn Béliot im Laufe des Vormittags aufstand. Mit einem viel zu weiten Unterhemd bekleidet, das seine mageren Arme enthüllte, trat er aus seinem im Erdgeschoss hinter der Terrasse gelegenen Schlafzimmer. Um den Bauch trug er ein breites Bruchband, das dazu diente, mehrere Hernien einzudämmen. Seine dürren, von Krampfadern überzogenen Beine boten sich den Blicken der Gäste dar, die, umrahmt von den leuchtenden Hibiskus- und Tamariskenblüten, im Schatten der Sonnenschirme ihr Frühstück beendeten. Wenn er zu seinem Stammsessel gegenüber dem Pool ging, um sich ein erstes Gläschen zu genehmigen, beglückte er sie sogar mit dem indiskreten Anblick seiner Intimteile, die aus der schlabbrigen Unterhose hingen. Dieses Schauspiel erregte bei den Gästen zunächst Verlegenheit, die jedoch rasch in Abscheu umschlug.
Wenn dann die ersten lauten Rufe ertönten und Béliot begann, sein Personal zu beschimpfen, ergriffen die Eindringlinge die Flucht. Dies war auch den Verfassern von Reiseführern zu Ohren gekommen. Der wichtigste von ihnen lobte Béliots Haus zwar wegen der Schönheit seines Gartens und der Qualität der Zimmer, fand aber sehr strenge Worte für den Charakter des Chefs, die viele Reisende von einem Besuch abhielten.
Also stand das Hotel größtenteils leer. Vor dem Pool sitzend, verbrachte Béliot seine Tage damit, Patiencen zu legen, Zeitungen durchzublättern und zu trinken. Mit zunehmender Anzahl an Whiskys sackte er immer mehr in seinem Sessel zusammen.
Bei Einbruch der tropischen Nacht – um achtzehn Uhr, egal zu welcher Jahreszeit – flammte die Beleuchtung des Schwimmbads auf, und Béliot hielt wie ein König Audienz. Nacheinander besuchten ihn stets dieselben Persönlichkeiten, Afrikaner und Weiße. Sie kamen allein, höchstens mal zu zweit. Béliot besaß eine kleine Fernsteuerung, mit der er die Farbe der Poolbeleuchtung verändern konnte. Waren die Besucher gegangen, spielte er noch lange damit und betrachtete jede Nuance des Wassers. Der Anblick versetzte ihn in eine Träumerei, deren Reiz auch im Laufe der Jahre nicht nachgelassen hatte. Wenn er schließlich eingeschlafen war, fassten ihn zwei Bedienungen unter den Armen und brachten ihn ins Bett.
#
Als Aurel Timescu, stellvertretender Konsul der französischen Botschaft in Maputo, sechs Monate zuvor seinen Dienst in der Hauptstadt antrat, hatte er keine andere Wahl gehabt. Wegen des Afrika-Cups stand nicht ein einziges bezahlbares Zimmer mehr in der Metropole zur Verfügung. Und so hatte er vierzehn Tage in der Residenz dos Camarões beim alten Béliot verbracht, bis die Wohnung seines Vorgängers neu gestrichen und die sanitären Anlagen überholt worden waren. Aurel hatte das Hotel ganz für sich allein, da es außer ihm keine weiteren Gäste gab.
Letzten Endes hatte es ihm dort sehr gut gefallen. Die Kühle und die Ruhe des Gartens mit seinen zarten Farben hatten ihn positiv für das Land eingenommen. Dabei war Aurel Timescu tief betrübt gewesen, anlässlich seiner Versetzung nach Mosambik nach Afrika zurückkehren zu müssen. Nach seinen früheren Erfahrungen war dieser Kontinent ein Synonym für Lärm, Hitze und Staub. Vom Hotelgarten aus wagte er sich in die Umgebung vor und entdeckte, dass das Klima gemäßigter war, als er befürchtet hatte, selbst wenn die Sonne für seinen Geschmack zu intensiv schien. In Mosambik herrschte eine Art ewiger Frühling, der natürlich nicht den Charme eines mitteleuropäischen Herbstes hatte, aber doch erträglicher war als das feuchtwarme Klima der Sahelzone.
Der zweite Grund für seine Vorliebe für die Residenz dos Camarões war die Abwesenheit des Hotelbesitzers während nahezu seines gesamten Aufenthaltes. Am Abend von Aurels Ankunft war Béliot wegen einer der zahlreichen Krankheiten – die ihn plagten, ohne ihn je umzubringen – ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auf dem Wege der Besserung war er zwei Tage vor der Abreise des Konsuls zurückgekehrt, hatte aber sein Zimmer nicht verlassen. So hatte Aurel den Mann, den man jetzt in seinem Swimmingpool gefunden hatte, nur flüchtig als abgemagerte, in einem Rollstuhl zusammengesunkene Silhouette wahrgenommen. Vom Garten aus hatte er die Ankunft des Hotelmonarchen beobachtet und auch, wie seine französische Ehefrau in Begleitung einer jungen Afrikanerin aufgetaucht war, um ihn zu Bett zu bringen. Etwas später, als die beiden wieder verschwunden waren, hatte eine Mosambikanerin um die fünfzig – schmuckbehangen, festlicher Boubou, sorgfältig geflochtene Zöpfe – dem Kranken einen kurzen Besuch abgestattet. Und den ganzen nächsten Tag über hatte sich das Ballett der Bedienungen fortgesetzt. Von Zeit zu Zeit hörte er die wütende Stimme des alten Béliot und stellte sich die Wirkung des Gebrülls auf die ihn umsorgenden Frauenzimmer vor.
Für ihn war es somit unmöglicher denn je, zu einem Glas Weißwein oder einer anderen Bestellung zu kommen, denn das für den Chef mobilisierte Personal ignorierte Aurel vollständig. Diese Atmosphäre erinnerte ihn ein wenig an sein Heimatland Rumänien: Das erdrückende Patriarchat auf dem Land und auf höchster Ebene die autoritäre Diktatur des »Vaters der Nation«, des »Führers«, dessen Apparatschiks sich bis ins letzte Glied bemühten, dieses imperiale Gehabe nachzuahmen und die erlauchten Capricen zu befriedigen.
Die Gleichgültigkeit, die Aurel als einzigem Gast entgegengebracht wurde, hatte aber auch einen Vorteil: Er konnte tun, was er wollte. Ausnahmsweise beachtete ihn niemand. Trotz der feuchten Hitze des Südens trug er seinen dicken Tweedmantel. Seine altmodischen europäischen Anzüge, die zerknitterte Fliege und die Tatsache, dass er trällernd am Pool Partituren schrieb, lösten beim Personal nicht die geringste Verwunderung aus. Alles drehte sich um Béliot, wenn dieser da war – und war er abwesend, schien alles stillzustehen. Entweder ging es zu wie bei Hofe, oder es war wie ausgestorben.
Aurel hatte während seines Aufenthalts sein Privatleben organisiert. Er fuhr mit dem Taxi zum Konsulat und wies unter dem Vorwand, noch nicht eingerichtet zu sein, jegliche Verantwortung von sich. Das war seine bewährte Taktik bei jedem neuen Posten, den er antrat: Zunächst demoralisierte er seine Vorgesetzten und gab ihnen zu verstehen, dass nichts von ihm zu erwarten war. Seine lange Laufbahn entband ihn jeglicher Erklärung – sein Ruf eilte ihm voraus.
Sein Aufenthalt im Hotel dos Camarões war sechs Monate, bevor man Béliot ertrunken im Pool fand, zu Ende gegangen. Aurel hatte es in gewisser Hinsicht bedauert, ihn nicht besser kennengelernt zu haben. Dieses Gefühl bedrückte ihn nicht sonderlich, bekam aber eine andere Bedeutung, als er von seinem Chef, dem Generalkonsul, vom Tod des alten Hoteliers und vor allem von der Verhaftung seiner französischen Frau erfuhr.
#
Aurel Timescus Akte war katastrophal und machte ihn zum Problemfall für die Personalabteilung. Er hatte es erst spät und durch ein untergeordnetes Auswahlverfahren in das Außenministerium am Quai d’Orsay geschafft. Dennoch hätte er durch harte Arbeit und ausgeprägte Unterwürfigkeit aufsteigen können. Doch dazu war er außerstande. Und so wurde er mit über fünfzig Jahren auf Posten versetzt, die normalerweise Anfängern vorbehalten waren, und an Orte, an die niemand wollte. Als Beamter unkündbar, wurde er in Positionen gebracht, die ihn entmutigen sollten. Doch Aurel hatte ganz und gar nicht die Absicht, seine Karriere zu beenden. Diejenigen allerdings, die ihn in ihrem Team ertragen mussten, durchlebten depressive Phasen, denn dieser Neuzugang war eine Strafe für jedes betroffene Konsulat.
Erfahrene Diplomaten verstanden es, die Klippe zu umschiffen. Der Personalabteilung blieben nur zwei Möglichkeiten, Aurel unterzubringen: seine Akte in eine große Zahl von Neueinstellungen zu schmuggeln, wie es bei sehr großen Botschaften üblich ist, oder sie einem Berufsanfänger unterzujubeln. Letzteres war in Mosambik der Fall. Aurels neuer Vorgesetzter, Didier Mortereau, war ein junger Generalkonsul, der gerade erst sein Studium abgeschlossen hatte und zu kurz in diesem Beruf war, als dass er bereits von Aurel Timescu gehört haben könnte. Er war unvorsichtig genug, die Nominierung dieses kleinen Stellvertreters zu akzeptieren, dessen Äußeres sowohl an das Österreichisch-Ungarische Kaiserreich als auch an die Sowjetunion erinnerte, der Opern komponierte und abends auf seinem alten Klavier sein gesamtes Pianobar-Repertoire zum Besten gab.
Als Aurel Mortereau zum ersten Mal traf, hatte er den Eindruck, alles würde problemlos und wie gewünscht verlaufen. Dieser Grünschnabel hatte nicht das Zeug dazu, es mit jemandem aufzunehmen, der fest zum Nichtstun entschlossen war. Da hatte er sich schon gegen wesentlich zähere Vorgesetzte durchgesetzt … Doch leider musste er schon bald feststellen, dass er sich geirrt hatte.
Die Tragödie der Jugend ist, dass sie an die Menschlichkeit glaubt. Und Mortereau noch mehr als andere in seinem Alter. Als Kind eines Lehrerehepaars in Sens aufgewachsen, hatte der kleine Didier schon mit der Muttermilch einen von Humanität geprägten Marxismus aufgesogen. Er war stark von Rousseaus Idealen beeinflusst, jenem Autor, dem er seine Abschlussarbeit in moderner Literatur gewidmet hatte. Als er – zu spät, um ihn noch ablehnen zu können – Kenntnis von Aurels Personalakte nahm, machte Mortereau menschliche Boshaftigkeit für die chaotische Laufbahn seines armen rumänischen Stellvertreters verantwortlich. Ihm würde es gelingen, diesem Entwurzelten, der vermutlich vom Leben gezeichnet war, wieder Selbstvertrauen zu schenken und das Beste aus ihm herauszuholen. Also fasste er den Entschluss, ihn zu retten.
Als der Generalkonsul dies gegenüber Aurel ausführte, stieß jener kleine Dankesrufe aus und schien kurz davor zu sein, seinem Chef die Hände zu küssen. Doch innerlich war er in großer Sorge: Er würde viel Geduld benötigen, um diesen jungen Idealisten zu entmutigen, und er würde recht unangenehme Situationen durchleben müssen, ohne sich dabei vom Mitleid hinreißen zu lassen.
Sechs Monate lang ließ Aurel absichtlich alle Aufgaben, die Mortereau ihm anvertraute, im Nichts versanden. Eine solch methodische Sabotage war harte Arbeit. Er musste dafür sorgen, die Schuld stets jemand anderem in die Schuhe zu schieben, um mögliche Disziplinarmaßnahmen zu vermeiden. Aber Aurel wusste, dass dies der Preis für seine künftige Ruhe war.
Doch kein Misserfolg schien Mortereau entmutigen zu können. Seine Nachsicht war grenzenlos. Nach jeder Katastrophe glaubte Aurel, nun wäre das Maß voll, und der Leiter der Konsularabteilung hätte es begriffen. Er rechnete mit einem Wutausbruch, Drohungen oder Sanktionen – mit Maßnahmen, die seit Jahren an seinem gestärkten Hemd abprallten, jedoch zu einem Bruch zwischen ihm und Mortereau geführt hätten. Aber nichts! Mortereau fand jedes Mal geduldig Entschuldigungen für seinen bedauernswerten Stellvertreter und gab ihm eine neue Chance.
Sechs Monate ging es so, das war nicht auszuhalten. Und dann kam Béliots Tod.
Als Aurel an diesem Tag das Konsulat betrat, ahnte er noch nichts. Er hatte die ganze Nacht lang getrunken und sich eine Reihe rumänischer Filme angeschaut, die seine Schwester ihm im Diplomatengepäck hatte zukommen lassen.
Mortereau hatte ihn gleich nach seinem Eintreffen einbestellt. Aurel nahm an, es sei, um ihn wegen seiner letzten Provokation zur Rede zu stellen: Er hatte in einem heiklen Fall der Familienzusammenführung absichtlich Verwirrung gestiftet. Der Cousin des Justizministers, der in Frankreich lebte, hatte in Roissy angebliche Verwandte abgeholt. In Wahrheit handelte es sich nur um eine Namensgleichheit.
Aber darum ging es nicht.
»Sagen Sie, Aurel, Sie haben doch sicher Béliot, den Hotelier der Residenz dos Camarões, gekannt?«
»Gekannt ist etwas übertrieben …«
»Wenn ich mich nicht irre, haben Sie bei Ihrer Ankunft dort gewohnt?«
»In der Tat habe ich zwei Wochen in diesem Hotel verbracht. Aber er war damals krank.«
»Und jetzt ist er tot.«
»Das wundert mich nicht. Er war bei schlechter Gesundheit. Er hat den Bogen ein wenig überspannt, wie man so schön sagt.«
»Er ist aber nicht an seinen Krankheiten gestorben.«
»An was dann?«
»Er ist ermordet worden. Man hat ihn in den frühen Morgenstunden ertrunken in seinem Pool gefunden.«
»Vermutlich ist er hineingefallen …«
»Das hat man zunächst angenommen. Aber es ist unmöglich.«
»Warum?«
»An seinen Handgelenken sind Fesselspuren und am Hals mehrere blaue Flecke zu sehen. An den Füßen hat man sogar Brandwunden entdeckt. Als wäre er gefoltert worden.«
Aurel horchte auf.
»Wann ist das passiert?«
»Offenbar vor zwei Tagen. Aber wir haben es nicht gleich erfahren. Das Konsulat wurde erst verständigt, als die Mosambikaner seine Frau verhaftet haben.«
»Seine Frau? Welche?«
»Die Französin. Sie ist auch die Mutter zweier seiner Kinder. Kennen Sie sie?«
»Vom Sehen. Sie wohnte im Hotel, aber ich hatte den Eindruck, dass sie es nicht verlassen durfte. Eines Tages kam sie zu mir, als ich meinen Kaffee trank. Sie fing an, über dieses und jenes zu sprechen. Sie fragte mich, ob ich Afrika mag, und ich sah mich gezwungen, ihr zu sagen, dass dies nicht der Fall ist.«
»Das war unvorsichtig, Aurel. Sie sind immerhin Konsul.«
»Vielleicht unvorsichtig, aber zutreffend. Ich ertrage die Hitze nicht. Sonst habe ich nichts gegen die Afrikaner …«
»Wie auch immer!«
»Jedenfalls schien sie das nicht zu schockieren.«
»Was hat sie sonst noch gesagt?«
»Ich hatte den Eindruck, dass sie unbedingt etwas sagen wollte. Aber sie schielte immer wieder zur Bürotür. Plötzlich sah eine der Bedienungen hinaus und entdeckte uns. Daraufhin hat sich ›Madame Béliot‹ – ich weiß nicht recht, wie ich sie nennen soll – überstürzt verabschiedet.«
Mortereau überlegte. Er sah aus wie ein Kind: Große Kulleraugen, pausbäckiges Gesicht, gerötete Wangen, so als hätte ihm die Lehrerin soeben ein paar Ohrfeigen versetzt. Das schien ihm irgendwie bewusst zu sein, denn er versuchte, eine gewichtige Miene aufzusetzen.
»Wie auch immer, jetzt sitzt sie im Gefängnis. Als französische Staatsbürgerin hat sie Anspruch auf konsularischen Beistand. Wir müssen ihr einen offiziellen Besuch abstatten.«
Plötzlich erinnerte sich Aurel an all seine Sabotageakte der letzten Wochen und hoffte, dass Mortereau noch etwas von seiner Barmherzigkeit geblieben war. Denn diese Aufgabe wollte er unbedingt übernehmen. Ein Mord, ein Rätsel, eine verworrene Angelegenheit, die blutig ausgegangen war – das war das Einzige, was ihn noch mit Leidenschaft erfüllte. Vor allem, wenn er, wie im vorliegenden Fall, Zweifel und Ungerechtigkeit witterte … Um nichts in der Welt wollte er sich diese Aufgabe entgehen lassen.
»Ich kenne den Gefängnisdirektor«, erklärte er hastig.
Und sogleich bedauerte er diese Lüge, als er begriff, dass sie unnötig war.
»Umso besser, denn ich wollte Sie gerade bitten, dieser Frau so bald wie möglich einen Besuch abzustatten.«
»Gleich heute!«, rief Aurel und sprang auf. »Auf der Stelle, sofort! Ich gehe hin, ich eile, ich bin schon da!«
Würdevoll knöpfte er sein Doppelreiherjackett zu und eilte zur Tür.
Der junge Mortereau kratzte sich am Kopf. Musste er einen erneuten Sabotageakt befürchten, oder erwies sich sein Glaube an die Menschlichkeit endlich als gerechtfertigt? Die Hoffnung überwog, und er lächelte.
II
Das Gefängnis von Maputo lag nicht weit von der französischen Botschaft entfernt, und so beschloss Aurel, zu Fuß zu gehen. Er hatte versucht, vorher die Zentrale anzurufen, um seinen Besuch anzukündigen, aber die Nummer war gestört. Er hoffte, dass sich die Tore mit seinem Diplomatenpass öffnen würden.
Bei seiner Ankunft in Maputo war Aurel vom Charme der Metropole angenehm überrascht worden. In seiner Erinnerung waren die afrikanischen Städte so chaotisch und staubig, dass man sich quasi nur in einem Wagen fortbewegen konnte. In dem Teil der mosambikanischen Hauptstadt, in dem sich die französische Botschaft und die meisten offiziellen Gebäude befanden, hatten die Portugiesen hingegen breite Straßen angelegt. Sie waren von echten, baumbestandenen Bürgersteigen mit schwarz-weißen Pflastersteinen gesäumt, die zum Spazierengehen einluden.
Nach dem Ende der kommunistischen Episode war das Land reich geworden. Die Nähe zu Südafrika machte es zu einem idealen Urlaubsziel für die reichen Bürger von Johannesburg. Jetzt sah man auf den Straßen große japanische und deutsche Wagen mit getönten Scheiben. Zahlreiche Häuser wurden restauriert und überall neue errichtet. Am Meer entlang bot die Avenida da Marginal Blick auf luxuriöse Gärten und prunkvolle Villen. Für Aurel, der meist zu Fuß ging und gerne durch Städte lief, boten sich so angenehme Spazierwege. Das Einzige, was ihn störte, waren die Straßennamen. Seit der Unabhängigkeit waren die meisten von ihnen nach berühmten Persönlichkeiten des Kommunismus benannt worden. Alle waren vertreten – von Karl Marx über Lenin, Engels und Lumumba bis hin zu Ho Chi Minh. Der Einzige, auf den Aurel bei seinen Spaziergängen zu treffen fürchtete, war Ceauşescu, doch anscheinend hatte das »Genie der Karpaten« in Maputo nicht einmal Anrecht auf eine Sackgasse.
Die Menschen auf den Bürgersteigen interessierten sich kaum für Aurel. Selbst wenn sie seinen Aufzug bemerkten, ließen sie sich nichts anmerken – ausgenommen, wie überall, die Kinder. Sie liefen ihm nach, lachten und schnitten Grimassen.
Doch als sie an diesem Tag sahen, dass er sich auf das Eisentor der Haftanstalt zubewegte, wichen sie zurück und beobachteten die Szene ängstlich. Das Zentralgefängnis von Maputo hatte einen schlechten Ruf. Zwar besitzen Gefängnisse nur selten einen guten Ruf, aber dieses hier war besonders unheilvoll. Es war sowohl während der Kolonialzeit als auch während der folgenden marxistischen Diktatur zu oft Schauplatz von willkürlichen Verhaftungen und dem Verschwinden Verdächtiger gewesen. Vor zehn Jahren war es renoviert worden und somit weniger marode, aber noch immer genauso furchterregend.
In dem Bereich, den man als »gemeines Recht« bezeichnete, wimmelte es von Straßenräubern und anderen Kleinkriminellen. Unzählige Familien brachten ihnen Essen. Es roch nach gegrilltem Fisch und Waschpulver. Durch die afrikanische Gabe, alle öffentlichen Orte, seien es Krankenhäuser, Kasernen oder Gefängnisse, in ein Buschdorf zu verwandeln, herrschte in diesem, vorwiegend von jungen Schwarzen bevölkerten Teil der Strafanstalt eine erstaunliche Lebensfreude. Diese Fröhlichkeit erinnerte Aurel an seine eigene Jugend: Als Heranwachsender war er wegen regimekritischer Äußerungen mehrmals in Bukarest inhaftiert gewesen. In der Tristesse der kommunistischen Kerker hatte er eine ähnliche Lebensfreude entdeckt. Dabei unterschied sich von außen gesehen alles – die Temperatur, die Ausstattung, die strengen Gefängniswärter Ceauşescus … Und doch war die Atmosphäre ähnlich. Die Häftlinge empfanden keine Schuld, weil es für alle offensichtlich war, dass nicht sie selbst schuld waren, sondern das System. Eine fröhliche Bruderschaft vermittelte jedem den Eindruck, dass die anderen geschlossen für ihn einstehen würden. Die träge Passivität war nichts anderes als das Spiegelbild einer durch den Polizeistaat infantilisierten Gesellschaft, die abgeschaltet hatte und nicht die geringste Anstrengung für das Gemeinwohl unternahm.
Ein anderer Teil des Gefängnisses von Maputo war prominenten Persönlichkeiten vorbehalten und trug den Namen »Weißes Haus«. Der Ausdruck war umso treffender, als dort vor allem Ausländer, zumeist Weiße, inhaftiert waren. Hier war die Stimmung bedrückend. Auch wenn es mehr Komfort gab, spürte man, dass der Aufenthalt beschwerlicher war als in der Sektion »gemeines Recht«.
Aurel war schon zweimal hier gewesen, um einen anderen französischen Häftling zu treffen. Der Mann war um die sechzig und wegen eines unklaren Betrugsfalls und Diamantenschmuggels verurteilt. Aurel war nur widerwillig hergekommen und hatte so wenig Eifer bei der Übergabe der Post für den Häftling an den Tag gelegt, dass sich der Gefangene bei der Botschaft über ihn beschwert und darum gebeten hatte, von jemand anderem betreut zu werden.
Immerhin erinnerten sich die Wärter durch diese Besuche an ihn. Sie öffneten ihm die Gitter problemlos. Heute bestand das Team aus einem sehr kleinen Mann mit faltigem Gesicht, der aus dem Süden stammte, und einem großen Schwarzen aus Beira, mit dem sich Aurel die letzten Male lange unterhalten hatte. Der Sohn besagten Isidores hatte Schwierigkeiten mit seinem Schengen-Visum, und Aurel hatte vage versprochen, ihm zu helfen. Vermutlich erinnerte sich Isidore daran, denn er führte den Konsul äußerst beflissen in einen Raum, der als Besucherzimmer diente. Es roch nach feuchter Erde. Der blaue Putz an den Wänden war auf einer dicken Lehmschicht aufgetragen und bröckelte stellenweise ab. Auf Sichthöhe war er mit Graffitis bedeckt. Das Mobiliar bestand aus zwei Stahlrohrstühlen. Isidore nutzte die Gelegenheit für einen Small Talk.
»Wissen Sie, Sie haben Glück, Herr Konsul, dass Sie mich antreffen.«
»Ach ja? Weshalb?«
»Ab morgen arbeite ich nachts.«
Eigentlich interessierte sich Aurel nicht sonderlich für die Arbeitszeiten des Wärters. Aber er brachte es nicht fertig, unhöflich zu sein, wenn ihm jemand so respektvoll begegnete.
»Haben Sie es sich so ausgesucht?«
»Im Leben nicht! Die Nachtschicht gefällt mir ganz und gar nicht. Dann ist man meist allein. Und die Zeit zieht sich. Tagsüber arbeitet man zu zweit und hat einen Kollegen, mit dem man reden kann.«
Und schon brachte der Kollege die Gefangene. Er schob sie ohne besondere Rücksicht in den Raum und nahm ihr die Handschellen ab. Dann verließen die beiden Wärter das Zimmer und warteten draußen.
Aurel hatte Madame Béliot als sportliche Frau mit kurz geschnittenem Haar und großen blauen Augen in Erinnerung. Wenn er sie durch den Hotelgarten gehen sah, trug sie meistens helle Leinenkleider und über der Schulter eine Sporttasche oder einen Tennisschläger. Im hinteren Teil des Parks nahm sie ausgedehnte Sonnenbäder, und Aurel war darauf bedacht, indiskrete Blicke zu vermeiden. Dabei hatte er sich gefragt, ob sie sich diesen Platz vor seinem Fenster nicht ausgesucht hatte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Dieser Gedanke hatte ihn mit Schrecken erfüllt und zu erhöhter Diskretion angetrieben.
Die Frau, die er jetzt im Besucherraum vor sich hatte, unterschied sich vollständig von der, an die er sich zu erinnern glaubte. Dabei handelte es sich um dieselbe Person. Doch jetzt war ihr Haar zerzaust und schmutzig, das Gesicht eingefallen und von tiefen Falten durchzogen. Vermutlich war Schlafmangel die Ursache dafür, aber auch die vielen Tränen, die dunkle Schatten unter den Augen, geschwollene Lider und Salzspuren auf ihren Wangen zurückgelassen hatten.
Als sie Aurel sah, stieß sie einen unterdrückten Schrei aus und warf sich in seine Arme. Das war ihm äußerst unangenehm. Sie presste sich gegen den rauen Tweedstoff seines Mantels, als würde sie dort Schutz suchen.
»Holen Sie mich hier raus, Monsieur le Consul, bitte!«
Panisch klammerte sie sich an Aurels Mantelkragen und zog ihn an sich. Er spürte, wie ihre Haare sein Kinn streiften. Auf dem Gipfel seines Unbehagens warf er verzweifelte Blicke zur Tür und sah durch die Scheibe, dass die Wärter ihn beobachteten. Isidore schien etwas verlegen, aber der Kleine aus dem Süden zeigte seinen ausgestreckten Daumen, als wolle er Aurel ermutigen. Diese Vulgarität stieß ihn ab und führte dazu, dass er die noch immer schluchzende Frau bei den Schultern nahm, sie von sich schob und so energisch schüttelte, wie es ihm möglich war.
»Beruhigen Sie sich, Madame. Ich bin als Vertreter Frankreichs hier.«
Es fiel Aurel stets schwer, solche Sätze zu sagen, denn sein rumänischer Akzent war nicht zu überhören und vermittelte ihm ein Gefühl von Illegitimität.
»Ich bin hier, um Ihnen zu helfen«, berichtigte er sich. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie herauszuholen. Dafür verbürge ich mich.«
Sie sah ihn durch ihren Tränenschleier hindurch an.
»Schwören Sie es?«
In dieser Frage schwang Angst mit, aber auch eine Spur von Verführung.
»Ich schwöre es.«
Kurz befürchtete Aurel, sie könnte ihn küssen, so nah war ihr Gesicht mit den leicht geöffneten Lippen vor seinem. Um einen solchen Zwischenfall zu verhindern, wand er sich brüsk ab, sodass er neben ihr stand. Dann ergriff er ihren linken Arm und führte sie zu einem der Stühle.
»Jetzt setzen Sie sich bitte und erklären Sie mir alles.«
»Ich habe ihn nicht getötet«, sagte sie, während sie ihm folgte.