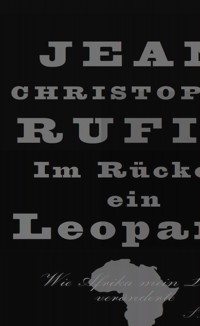
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er war Arzt im Krankenhaus, Pionier in Sachen Humanitäre Hilfe, Goncourt-Preisträger und ist jetzt Botschafter in Senegal. Jean-Christophe Rufin, Autor von Thrillern und historischen Romanen hat eine neues Abenteuer geschrieben, das Abenteuer seines Lebens. Rufin erzählt sehr poetisch und berührend über seine Kindheit, von seinem Großvater, der im Konzentrationslager Buchenwald nur deshalb überlebte, weil er Arzt war. Rufin erzählt, wie er durch diesen Einfluss überhaupt erst Mediziner geworden ist und wie die Medizin nicht nur zu seiner Leidenschaft, sondern zu einer Haltung wurde. Ein ergreifender, sehr persönlicher Bericht eines großen Homme de science et de lettres, eines Menschenfreundes im alten Sinn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Jean-Christophe Rufin
Im Rücken ein Leopard
Wie Afrika mein Leben veränderte
Aus dem Französischen von Anne Braun
Fischer e-books
Ich, edles Pferd vom Sambesi, irrte umher,
galoppierte und schlug nach den Sternen aus,
zerfressen von einem Übel ohne Namen,
als säße mir im Rücken ein Leopard.
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR, Éthiopiques
»Es wird regnen, Exzellenz.«
Über Gorée haben sich dicke Wolken zu einem bedrohlichen Bleigrau am Himmel zusammengeballt, weißfestoniert bei jedem Blitz, der über den Himmel zuckt. Ich sitze auf dem Rasen meiner neuen Residenz und fühle mich verloren zwischen zwei beängstigenden Massen: hinter mir der riesige weiße Palast, als dessen Gefangener ich mich eher fühle denn als Herr, und vor mir, über dem Meer, das sich nähernde Tropengewitter. Ich schaue zu dem afrikanischen Majordomus in der weißen Jacke hinauf, der mit bewegungsloser Miene wartend dasteht. Warum zum Teufel hat er mich »Exzellenz« genannt?
Ich habe größte Mühe, mich außer ans Exil auch an diesen hochtrabenden Titel zu gewöhnen. Ich habe nicht übel Lust, ihn zu bitten, in Zukunft darauf zu verzichten. Aber mir wird noch im selben Moment klar, wie nutzlos dieses Ansinnen wäre. Meine Dienstboten würden sich natürlich daran halten, wenn ich sie bitten würde, dieses Wort nicht zu verwenden. Aber das wäre nur ein weiterer Akt der Willkür, der genauso fügsam befolgt werden würde wie jener, der diesen Menschen, Gott weiß wann, auferlegt hat, einen Botschafter mit »Exzellenz« anzureden.
Der Regen kommt näher. Noch hört man ihn nicht, denn er fällt über dem Meer. Hinter dem Vorhang am Horizont verbirgt sich die Sklaveninsel. Die Palmen im Park, die nicht die federnde Nachgiebigkeit von Weiden oder Pappeln haben, werden von den Sturmböen hin und her geworfen. Unter ihrer Wucht knicken sie wie Skelette um und sehen wie komische, umgedrehte Schirme aus.
»Kein Grund zur Sorge, Massemba, ich werde gleich ins Haus kommen.«
»Gut, Exzellenz.«
Ohne ein weiteres Wort eilt der Majordomus im Laufschritt ins Haus zurück. Er hat bei mir ausgeharrt, so lange es ihm sein Mut erlaubte, doch nun platschen die ersten schweren Tropfen auf den Boden. Als Mann der Tropen erahnt er die Heftigkeit des Kommenden, und er bringt sich in Sicherheit.
Mir selbst ist die Urgewalt von Gewittern an dieser Küste nichts Neues. Wenn ich noch etwas länger draußen bleibe, dann nur, um meine zähflüssige Melancholie der letzten zwei Tage unter den Fausthieben des Regens noch etwas auszudehnen und sie dann abzustreifen. Gerade erst angekommen, beschloss ich, einen Rundgang durch die Gärten der Residenz von Frankreich zu machen, aber schon in Paris und mehr noch im Flugzeug habe ich nicht aufgehört, an Mountolive zu denken. Genauer gesagt ist es eine ganz bestimmte Szene, an die ich denke, jene, in der Mountolive, der Diplomat von Lawrence Durrell, Held des dritten Bands von Das Alexandria-Quartett, als Botschafter in Kairo eintrifft, wo er zwanzig Jahre zuvor als junger Diplomat tätig war. Und mit dieser Rückkehr geht für ihn ein großer Traum in Erfüllung.
Er setzt sich in den Garten; in der Ferne pulsiert die Stadt. Er fühlt sich »angekommen«, aber wo? Die Schlichtheit des Augenblicks und die ihm innewohnende Enttäuschung wären nicht weiter schlimm, wenn ihm die Vergangenheit rückblickend nicht so lächerlich erschienen wäre, weil sie immer nur auf dieses Ziel, dieses Ideal ausgerichtet war.
Ich selbst habe mir nichts Derartiges gewünscht. Dieser neue Posten wurde mir angetragen, ohne dass ich mich beworben hätte. Und doch hat mich Durrells Roman, als ich ihn mit zwanzig Jahren las, so aufgewühlt, als hätte ich geahnt, dass ich eines Tages etwas Ähnliches erleben würde. Das ist heute der Fall. Durchaus möglich, dass meine Melancholie literarischer Art ist; nichtsdestoweniger empfinde ich sie als real.
Dakar ist ein letztes Mal in einer Dunstschneise erschienen. Nun aber umschlingen mich die Regenflechten. Sie fesseln mich, während ein unsichtbarer Gott, bewaffnet mit Wind und Wasser, mich so lange ohrfeigt, bis ich zu Boden gehe. Es gibt keinen französischen Botschafter mehr, nur noch einen Kämpfer auf allen vieren, tropfnass von Regenmassen, so lauwarm und salzig wie Tränen, der versucht, den entfesselten Naturgewalten zu entkommen und sich in Sicherheit zu bringen.
Eine Tür öffnet sich, ich stürze ins Haus. Der Majordomus steht mit unbewegter Miene da, ein Handtuch über dem Arm.
»Ein heftiger Regen, Exzellenz«, sagt er, während er mir einen breiten, landestypischen Stuhl, fast eine Sitzbank, zuschiebt.
Während ich mich noch abtrockne, sinke ich auf den Stuhl. Der Majordomus entfernt sich und verschwindet. Im Halbdunkel der riesigen Eingangshalle fällt das Licht eines Strahlers auf ein monumentales Gemälde, das an einem Ort wie diesem geradezu absurd wirkt und das die Schlacht von Jena darstellt. Vielleicht weil mir das Wasser noch aus den Haaren rinnt, denke ich an La Méduse, die nur zehn Jahre nach der Schlacht bei Jena hierher gekommen war, um den Senegal wieder in Besitz zu nehmen, und deren unheilvolles Floß unweit von hier Schiffbruch erleiden sollte.
In diesem kriegerischen Monumentalgemälde liegt dieselbe Mischung aus Glanz und Untergang. Im Vordergrund führt ein stolzer General, ganz in Weiß gekleidet, auf einem sich aufbäumenden Pferd den Angriff an. Doch ganz in der Nähe, in einer Ecke der Leinwand, antwortet ihm das Bild eines Reiters, durch einen Kugelhagel entwaffnet, der nun zusammengesunken im Sattel sitzt und sich verständnislos umblickt.
Manchmal kommt es mir, wie an diesem Abend, so vor, als sei mein Leben ebenso in absolut entgegengesetzte Extreme gespalten. Abwechselnd Schlacht- und Trümmerfelder, war es nur eine Abfolge von Kämpfen und Teilsiegen, gefolgt von einer großen Melancholie, wenn der Angriff vorbei war, von Gewaltmärschen und neuen Gefechten. Medizin, humanitäre Organisationen, Literatur und heute nun dieser neue Posten, diese neue Herausforderung: Mein Leben war ein langes, ruheloses Umherschweifen. Warum bin ich unfähig, bei nur einer einzigen Sache zu bleiben? Warum bin ich dazu verdammt, mehrere Leben auf einmal zu führen, meinen Stein unablässig immer steilere und mühsamere Felswände hinaufzurollen?
Der nächtliche Horizont, vom Regen rein gewaschen, wirkt so klar, wie eine Nacht aus Meer und dunklem Himmel es nur sein kann. Die kleinen Lichter von Gorée glitzern entlang der Barriere aus Basalt. Meine Frau und meine Töchter schlafen im selben Stockwerk. Das Prasseln der Regentropfen hat sie in den Schlaf gewiegt, genau wie früher der Regen auf den Blechdächern einer anderen Stadt in Afrika, in der wir lebten.
Ich höre ein Gemurmel aufsteigen, das mich zuerst irritiert, dann aber beruhigt. Es ist das Geräusch, das Erinnerungen erzeugen, wenn sie sich geballt nähern. Was wollen sie? Mich zur Ruhe bringen. Mir sagen, dass der Faden meines Lebens einzigartig und stabil ist, auch wenn es von außen betrachtet nicht so aussieht. Aus großer Ferne hallt das Echo der Berufung wider, die mich Arzt werden ließ, in dieses Wort aber so viele Ideale und Hoffnungen legte, dass es die Dimension der ganzen Welt annahm.
Die Medizin ist das Leben, mein Leben, das ganze Leben. Heute, wo ich ihr so wenig treu zu sein scheine, bin ich ihr näher denn je. Und genau das möchte ich erzählen, diese Einheit möchte ich aufzeigen.
Die Medizin ist das eigentliche Thema dieses Buches. Man möge mir verzeihen, dass ich dabei so viel von mir erzähle; doch ein anderes Mittel, um von ihr zu sprechen, fand ich nicht.
1.
Ich wurde in die Medizin hineingeboren, so wie andere das Licht der Welt an einer Küste, am Fuße eines Bergs oder auf dem Lande erblicken. So weit ich mich zurückerinnere, war die Medizin für mich ein Ort, ein Zustand, ein Umfeld, lange bevor ich sie erlernte und sie mein Beruf wurde.
Am Anfang stand, aber das hätte natürlich nicht genügt, in meinem Fall das Skalpell des Chirurgen, der mich aus dem Leib meiner Mutter schnitt. Das geheimnisvolle Wort »Kaiserschnitt«, das ich in meiner Kindheit so häufig hörte, war die einzige Spur, an die ich mich bezüglich meines Eintritts in diese Welt, umgeben von weißen Kitteln, halten konnte. Das war an einem erstickend heißen Hundstag Ende Juni, ein Monat, der ohnehin heißer war als sonst. Mit Hinweis auf die Risiken, die mir drohten, brachte man mich fürs Erste in dem kühlen Haus meiner Großeltern unter, aus dem ich erst im Alter von zehn Jahren wieder ausziehen sollte. Meine Mutter ging nach ihrer Scheidung allein nach Paris, um dort ihr Glück zu versuchen, und mein Vater legte offenbar keinen Wert darauf, mich zu sich zu holen. So landete ich umständehalber in diesem seltsamen Haus, in dem man mit nichts weniger gerechnet hatte als mit einem Kind und in dem eine einzige unausgesprochene Leidenschaft herrschte: die Medizin.
Das große Haus war weder das, was man heute als Arztpraxis bezeichnen würde, noch lediglich der Wohnsitz eines in die Jahre gekommenen praktischen Arztes. Es war ein Tempel, ausschließlich erbaut zum Zelebrieren eines Mysteriums und ihm geweiht. Die in der Nähe gelegene Kathedrale bildete eine Art religiöses Gegenstück dazu. Das majestätische, steinerne Kirchenschiff war einem Gott geweiht, der gleichzeitig lebendig und verstorben war; das Haus meiner Großeltern hingegen war der längst vergangenen und dennoch allgegenwärtigen Verehrung eines nicht weniger aufregenden Götzen gewidmet, den man in Ermangelung eines geeigneteren Ausdrucks als Medizin bezeichnete.
Mein Großvater praktizierte damals schon nicht mehr offiziell. Dennoch behielt er seinen Praxisraum, eine Bibliothek und einen Patientenstamm bei, den er nicht im Stich lassen wollte – aber vielleicht verhielt es sich auch umgekehrt. Den Mittelpunkt des Hauses bildete sein Arbeitszimmer, ein großer, stiller Raum, den zu betreten mir lange Zeit untersagt war. Alles übrige, die Schlafzimmer, Flure und Treppenabsätze, Mansardenzimmer und die Küche waren lediglich die Vorzimmer dieses Heiligtums, ohne das diese Räume jede Bedeutung verloren hätten. Im Übrigen wurde das Haus nach seinem Tod unverzüglich verkauft.
Jedes Mal, wenn es am Nachmittag läutete, hatte ich die Anweisung, mich zu verkrümeln, während gebeugte Schattengestalten über die Schwelle traten und sich durch den Garten auf die Veranda zubewegten. Dieser längliche, schmale, verglaste Raum voller Topfpflanzen sah eigentlich wie ein Wintergarten aus. Erst durch die Patienten, die nachmittags darin Platz nahmen, enthüllte sich seine wahre Bestimmung: Es handelte sich um ein Wartezimmer, eine obligatorische Zwischenstation, in der jeder Halt machen musste, ehe er das Allerheiligste betreten durfte.
Am anderen Ende des Gartens gab es ein recht hässliches, viereckiges Backsteingebäude. Darin stank es nach Öl und Reifen, und wegen der Metallfelgen an der Wand und der auf dem Boden aufgereihten Kanister sah es wie eine Garage aus. In Wirklichkeit handelte es sich um eine etwas unbedeutendere heilige Stätte, die der Aufbewahrung einer weiteren Reliquie diente, nämlich des »Wagens des Doktors«. Sie hatte in der Vergangenheit ansehnliche Fahrzeuge beherbergt, an die immer andächtig erinnert wurde, besonders ein gewisses Modell namens Hodgkiss, das meine Großmutter nie ohne ein wehmütiges Seufzen erwähnte. Angesichts dieser glorreichen Vergangenheit konnte man fast vergessen, dass »der Wagen des Doktors« im Laufe der Zeit immer bescheidener geworden war. Für mich bedeutete es den eher nüchternen Anblick eines Simca Aronde, zuerst grau, dann blau. Mit seinen hervorstehenden Kotflügeln, dem Lenkrad aus hellem Bakelit und den Kunstledersitzen hatte dieser Wagen absolut nichts Majestätisches. Doch mein Großvater brauchte ihn. Mit ihm unternahm er geheimnisvolle Reisen, die ihn außerhalb der Stadt führten, an Orte, die in meinen Augen fast märchenhaft und exotisch weit weg klangen, obschon sie – wie ich später erfahren sollte – höchstens zwanzig Kilometer entfernt lagen. Das Ziel dieser Fahrten war ganz eindeutig medizinischer Art, und das verlieh ihnen eine zusätzliche Bedeutung. Es handelte sich um Besuche bei der Mutuelle agricole oder bei der Staatlichen Sozial- und Krankenversicherung des Departements Cher; Namen, deren Auswirkung man kaum ermessen kann auf ein einsames Kind, das nur selten aus dem Haus, recht selten aus seinem Stadtviertel und noch gar nie aus seinem Geburtsort herausgekommen war. So wie mein Großvater es von seinen früheren, empfindlicheren Wagen gewohnt war, ließ er den Motor vor jeder Abreise fast eine halbe Stunde lang warmlaufen. Die Abgase in der Garage brannten einem in den Augen, und das Tuckern im Leerlauf hallte von den im Halbdunkel liegenden Backsteinwänden wider. Diese feierlichen Vorbereitungen verstärkten in mir den Eindruck, dass es sich nur um eine höchst bedeutende Fahrt handeln konnte.
Lange Zeit war dieser Wagen tabu für mich. Als mir dann endlich einmal die Ehre zuteil wurde, mitfahren zu dürfen, stellte ich fest, dass mein Großvater ein sehr langsamer Fahrer war, der sehr großzügig mit den Verkehrsregeln umging. Doch das hat meine Bewunderung für ihn nicht etwa geschmälert, sondern noch verstärkt. Denn ungefähr zur selben Zeit klärte mich meine Großmutter darüber auf, dass »der Doktor« eines der allerersten Automobile des Departements besessen hatte. In diesen längst vergangenen Zeiten gehörten Autofahrer einer Elite an, der man respektvoll Platz machte. Dass Autofahrer Rücksicht nahmen, lag allein an ihrer Höflichkeit und keineswegs an Verkehrsregeln, die es damals im Übrigen noch gar nicht gab. Wenn sich mein Großvater gewisse Freiheiten im Umgang mit der Straßenverkehrsordnung herausnahm, dann nur deshalb, weil er sie nie erlernt hatte. Er war in gewisser Weise ihr Urahn. Deshalb hätte ich es vertretbar gefunden, wenn er, kraft des Privilegs, das ihm sein Alter verlieh, einfach von ihnen befreit gewesen wäre.
Als mein Großvater eines Tages in aller Arglosigkeit eine rote Ampel überfahren hatte, wurde ich Zeuge, wie er von einem Gendarmen zur Rede gestellt wurde. Dieser Zwischenfall rief in mir zuerst Entsetzen, dann Entrüstung hervor. Das Ganze endete zum Glück aber damit, dass sich der Vertreter der Staatsgewalt der – dreimal gelobten – Autorität des Vertreters der Medizin unterwarf. Der anfangs strenge Polizist starrte verblüfft auf den Führerschein, den ihm mein Großvater wunschgemäß überreicht hatte. Es war ein schlichtes, doppelt gefaltetes Stück Papier mit einer zweistelligen Nummer. Auch die Berufsbezeichnung »Arzt« war aufgeführt. Mit einer respektvollen Verbeugung gab der Gendarm meinem Großvater das Dokument zurück und sagte mit sanfter Stimme: »Herr Doktor, in Anbetracht Ihres Alters und Ihres Berufs werde ich auf eine gebührenpflichtige Verwarnung verzichten. Aber seien Sie in Zukunft etwas vorsichtiger.«
Es war das erste Mal, dass mir die Medizin wie eine Salbung vorkam, als ein ganz besonderer Stand, der jene, die seiner würdig waren, ein bisschen vom Rest der Menschheit abgrenzte.
Wodurch zeichnete sich dieser Stand aus, und wie bekam man Zutritt zu ihm? Wie wurde man Arzt? Das wusste ich nicht. Doch wegen seines elitären Charakters hätte ich es nur als natürlich empfunden, wenn sich diese Eigenschaft vererbt hätte. Dem aber widersprachen die Fakten: Mein Großvater hatte diesen Titel nicht von seinen Eltern erhalten und ihn seinerseits auch nicht an seine Tochter, meine Mutter, weitergegeben. Der Gedanke, dass man als Arzt eine bestimmte Ausbildung brauchte, kam mir erst sehr viel später in den Sinn.
Kinder glauben, die Zauberkräfte eines Zauberkünstlers steckten in seinem Zauberstab, und auf ähnliche Weise suchte ich die geheimnisvolle Macht der Medizin in ihren Instrumenten. Und ich hatte das große Glück, dass das Haus voll davon war.
In einem kleinen Anbau hinter dem Haus, der zugleich mein Schlupfwinkel war, wurde bunt durcheinander alles aufbewahrt, was mein Großvater im Laufe seiner Berufstätigkeit angehäuft hatte. Die Funktion dieser Gegenstände war mir unbekannt, doch die bizarren Formen faszinierten mich und mehr noch die Materialien, aus denen sie gefertigt waren. Emaille, Glas, gebürsteter Stahl, rissiger Gummi, das raue Gewebe der Riemen und Gurte stellten für mich die Wörter einer Sprache dar, deren Grammatik mir unbekannt war, die aber bereits zu mir sprach. Dinge, die besser Informierte als Spritzen, altmodische Blutdruckmessgeräte, Klistiere oder Päckchen mit Kompressen bezeichnet hätten, hatten in meinen Augen eine fast liturgisch anmutende Bedeutung.
Für mich gab es keinen Zweifel, dass diese Gegenstände als Requisiten für Anrufungen, Zeremonien und das Hervorrufen von Trancezuständen dienten. Sie mochten vielleicht am Körper appliziert werden, aber gewiss nur, um die Geister herbeizurufen, die das weitere Schicksal der betreffenden Personen bestimmten.
Leider habe ich nie gesehen, wie mein Großvater sie einsetzte. Das höchste der Gefühle war, dass er mir, als ich einmal eine Bronchitis hatte, ein weißes Taschentuch auf die Brust legte und sein Ohr darauf presste, um meine rasselnden Bronchien abzuhören. Er erwies mir nicht einmal die Ehre, ein Stethoskop zu verwenden … Wenn es mir nicht vergönnt war, den Zeremonien beizuwohnen, die den Einsatz dieser sagenumwobenen Instrumente erforderten, dann vermutlich nur, weil ich es nicht verdient hatte, sprich: weil ich nicht krank genug war. Die ernsten Erkrankungen, die der Medizin aufgrund ihrer Schwere großartige Gelegenheiten boten, sich mit den höheren Mächten zu messen, waren dennoch in unserem Haus präsent, und zwar in Form eines Vokabulars, das gleichermaßen schreckenerregend und unverständlich war.
Worte wie »Gehirnerschütterung«, »Lungenentzündung«, die gefürchtete »tuberkulöse Kaverne« – ein Krankheitsbild, das eher an den Sturz in einen Abgrund denken ließ als an einen inneren Prozess – kamen in all ihrer Trostlosigkeit immer wieder in den Unterhaltungen meiner Großeltern vor. Um derartige Kataklysmen zu erleben, musste man offenbar über eine große Lebenserfahrung verfügen, weshalb ich in nächster Zeit nicht darauf hoffen konnte, mich ihrer würdig zu erweisen. Wenn ich zu schnell gelaufen war und mir einen Knöchel verstaucht hatte, drohte man mir höchstens mit »Gelenkerguss« – eine Krankheit, die mit Sicherheit nicht sonderlich beängstigend war, wenn sie sogar mich treffen konnte. Manchmal schilderte man mir mit dem schlichten Wort »Magenkrampf« in schillerndsten Farben die zwar potentielle, aber durchaus im Bereich des Möglichen liegende Gefahr einer »Magendilatation«. Unglückseligerweise verlor diese anfangs noch beeindruckende Diagnose ihr hohes Prestige in meinen Augen, weil meine Großmutter diesen Begriff geradezu inflationär verwendete, wann immer sie mich zu schnell essen sah.
Weil ich hinter das große Geheimnis kommen und verstehen wollte, welchen Mysterien diese Mischung aus Heilkunst, Priesteramt und Magie, die man gemeinhin als Medizin bezeichnete, huldigte, war ich versucht, mich ins Arbeitszimmer meines Großvaters zu schleichen, um dort nach den Indizien zu suchen, die den Schleier, der sie umgab, gelüftet hätten. Doch als ich irgendwann endlich den nötigen Mut aufbrachte und mich über das Zutrittsverbot hinwegsetzte, entdeckte ich dort nichts, was mir weitergeholfen hätte. Das wichtigste Möbelstück war ein großer Schreibtisch, der sich heute in meinem Besitz befindet und auf dessen mit Stoff bespannter Platte ich die meisten meiner Bücher geschrieben habe. Er war zum Verzweifeln leer, abgesehen von einer Schreibunterlage aus grünem Leder, einer Schreibtischlampe aus Metall und einem Rezeptblock. Der einzig religiös anmutende Gegenstand im ganzen Raum war eine Bronzeskulptur auf einem kleinen Tisch neben dem Schreibtisch, die von zwei auf Griechisch geschriebenen Büchern umgeben war. Heute weiß ich, dass es sich um eine Büste von Äskulap und um die Aphorismen des Hippokrates handelte. Doch in meinen unwissenden Augen von damals wirkte das Ganze eher wie ein kleiner Altar, der entfernt an die doppelte Autorität von Christus und der Bibel erinnerte. Allerdings schien diesen Gegenständen keine Verehrung zuteil zu werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass von ihnen alle Kräfte ausgingen, die dieser Raum ausstrahlte. Das einzig ungewöhnliche Möbelstück war ein schmales Bett, das direkt an der Wand stand. Ich hatte meinen Großvater noch nie woanders schlafen sehen als in seinem Schlafzimmer, und es kam auch nie Besuch, der eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht hätte. Ich musste also davon ausgehen, dass dieses Bett für die Patienten bestimmt war. Doch zu welchem Zweck?
In den Regalen standen gebundene Bücher, deren Titel mir auch keine Anhaltspunkte boten. Erst später sollte ich begreifen, dass es sich hauptsächlich um Romane – Die Thibaults von Roger Martin du Gard, Jules Romains’ Romanserie Die guten Willens sind und das Gesamtwerk von Balzac – sowie um politische Werke über die beiden Weltkriege handelte: gut sichtbar die Kriegsmemoiren von General de Gaulle. An der Wand hing nur ein einziges Bild, das Porträt eines kahlköpfigen alten Mannes, dessen Mund hinter einem riesigen Schnauzbart verborgen war. Anfangs glaubte ich, es handle sich um eine Art Hohepriester des mysteriösen Ordens der Medizin. Später erfuhr ich, dass Clemenceau – um den es sich handelte – hier nicht etwa hing, weil er Arzt gewesen wäre, sondern weil er Frankreich gerettet hatte. War das im Grunde genommen nicht dasselbe? In der Stadt trafen wir häufig Menschen, die meiner Großmutter – mit einem vielsagenden Blick auf mich, damit es mir eine Lehre sein sollte – versicherten, dass »der Doktor« sie gerettet hätte, sie ihm ihr Leben verdankten und ihre Dankbarkeit grenzenlos sei. Die Medizin bewirkte folglich im Kleinen und im Alltäglichen das, was einem Politiker gegeben war, im Großen und recht selten sogar in noch größerem Maßstab für ein ganzes Land zu tun. Diese Gleichwertigkeit zwischen der Medizin und ihrer sozialen Rolle, die für mich später den Namen Engagement tragen sollte, drängte sich mir schon sehr früh auf. Und mein Großvater sowie alles, was ich über seine Person erfuhr, hat diesen offenkundigen Zusammenhang nur noch verstärkt.
2.
Ich habe meinen Großvater abgöttisch geliebt, obwohl er meine Zuneigung nie wirklich erwidert hat. Das war mir egal: Ich hatte keine andere Wahl. Nach der Scheidung meiner Eltern – ich war damals gerade mal ein Jahr alt gewesen – verschwand mein Vater aus meinem Leben, und ich besaß nicht einmal ein Foto, das es mir erlaubt hätte, ihn mir irgendwie vorzustellen. Ich sollte ihn erst sehr viel später kennenlernen, als ich bereits erwachsen war.
Die Zuneigung, die ich für diesen abwesenden Menschen nicht empfinden konnte, brauchte einen anderen Adressaten. Hätte man mich gefragt, warum ich meinen Großvater so liebte, hätte ich gesagt, dass er der beste, wunderbarste und liebste Mensch auf der Welt war. Ich hätte weder mir selbst noch sonst jemandem gegenüber eingestanden, dass ich ihn nur deshalb ausgewählt hatte, weil sonst niemand zur Verfügung stand. In meinem Großvater waren Arzt und Mensch für mich so eng verschmolzen, dass die Liebe, die ich für ihn empfand, ebenso stark war wie die Faszination, die die Medizin auf mich ausübte. Liebe und Bewunderung, Zärtlichkeit und Faszination vermischten sich. So sehr, dass meine Zuneigung die Form einer respektvollen und stummen Verehrung aus der Ferne annahm. Während meiner gesamten Kindheit habe ich keine zehn Sätze an diese hieratische Persönlichkeit gerichtet. Doch das spielte so gut wie keine Rolle. Man kann sein Leben auch einem Gott weihen, dessen Stimme man nie gehört hat.
Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, ist das Bild, das ich von meinem Großvater habe, klarer, genauer und distanzierter als jenes, das ich von ihm hatte, als ich in seiner Nähe lebte. Es bedurfte mehrerer Todesfälle, darunter auch seines eigenen, und des einsamen Sichtens diverser Hinterlassenschaften, alter Schriftstücke und Fotografien, bis sich das heutige Bild meines Großvaters herauskristallisierte, das zwar nicht vollständig, aber doch einigermaßen zutreffend ist.
Als Kind kannte ich ihn nur als strengen alten Mann, stets in einem Dreireiher und mit Krawatte, der mich durch seine runden Brillengläser anstarrte. Das letzte einschneidende Erlebnis seines Lebens – die Deportation – hatte die Spuren seiner früheren Existenz ausgelöscht. Er war ein Überlebender, zurückhaltend und reserviert, schweigsam und unauffällig. Meine Großmutter arbeitete Tag für Tag an der Ausschmückung seiner Legende. Sie wurde nicht müde, die Schrecken zu schildern, die ihm »les Boches« zugefügt hatten. Die ganze Stadt war mit Erinnerungen daran versehen. Wenn wir durch die Rue Michel Servet zum Postamt gingen, zeigte mir meine Großmutter unweigerlich jedes Mal von Neuem das Hauptquartier der Gestapo, in dem mein Großvater verhaftet, verhört und geschlagen worden war. Le Bordiau, auf einem Hügel oberhalb der Sümpfe gelegen, war das Gefängnis, in dem er eingesperrt war. Am Bahnhof erinnerten verrostete Güterwaggons an den Tag, an dem er zusammen mit hundert anderen in einen solchen eingepfercht wurde, um nach Compiègne transportiert zu werden. Es dauerte nie lange, bis sie dann auch den legendären Ort heraufbeschwor, die unglaubliche und grauenvolle Stätte, die für mich mit dem sagenumwobenen Reich der Artus-Legende verschmolz: Buchenwald. Dieser Name hallte während der Gedenkfeiern auf dem Place de la Libération, zu denen man mich mitnahm, in meinen Ohren wider – geschrien, ausgespuckt, verabscheut. Buchenwald war für mich jedoch nichts Vergangenes, sondern ließ mich meine Zukunft erahnen. Die Gewissheit eines weiteren Kriegs war in allen Köpfen präsent, und von den »Nie-mehr«-Rufen ließ sich niemand täuschen. Hinter dieser leeren Beschwörungsformel verbarg sich eine erfolglose Auflehnung gegen das Unvermeidliche, das man mit dem rätselhaften »das Nächste« bezeichnete – der nächste Krieg natürlich, die nächsten Gräueltaten, die nächste Leidenszeit, die, wie ich mir ganz sicher war, mich betreffen würde.
Auch in diesem Punkt hielt ich die Medizin für einen Talisman, mit dessen Hilfe ich eines Tages diese Bewährungsproben bestehen würde. Meine Großmutter hatte mir erzählt, dass es »dem Doktor« drüben das Leben gerettet hatte, dass er die anderen Deportierten ärztlich versorgte. Die Ärzte der KZ-Kapos waren teuflische Marionetten gewesen. In Notfällen zogen die Deportierten den Beistand von Mithäftlingen vor, die praktizierende Ärzte waren. So kam es, dass mein Großvater, der damals schon ein schwächlicher, älterer Herr war, unter dem besonderen Schutz der kräftigen jungen Männer stand, die er behandelt hatte. Nur dank seiner medizinischen Kenntnisse hat er als Nummer 38 619 im Lager Buchenwald zwei lange, albtraumhafte Jahre überlebt. Wie später bei dem Verkehrspolizisten in Berry verschaffte ihm sein medizinisches Wissen Privilegien, auch damals, in einer Welt der Schrecken.
Ich bezweifelte nicht, dass die Medizin auch in meinem Fall die beste Waffe wäre, um eines Tages die schmerzhaften Erfahrungen zu überleben, die mich erwarteten.
Mein Großvater wurde 1884 in Dole im Jura in eine Familie von kleinen Angestellten und Arbeitern hineingeboren. Sexuelle Enthaltsamkeit war das Pfand, das sie für ihren sozialen Aufstieg zahlten. Da sie immer nur ein Kind pro Generation hatten, konnten sie diesem eine gute Ausbildung ermöglichen. Langsam aber sicher erklommen sie so die Stufen der strengen Hierarchie jener Zeit, die durch unüberwindliche Klassenschranken gekennzeichnet war. Mein Urgroßvater hatte nach einem kurzen naturwissenschaftlichen Studium sein ganzes Leben lang einen eher bescheidenen Posten als Ingenieur beim Schienenbau der Eisenbahn gehabt. Ihm verdankten wir die vielen alten Gegenstände im Haus, die während der Bauarbeiten ans Tageslicht gekommen waren. Fossilien, Kristalle, galloromanische Rüstungsteile, antike Münzen – alles, was entdeckt wurde, brachten die Arbeiter dieser Baustellen respektvoll dem Herrn Ingenieur. Dieser Vorfahr, den ich nie kennengelernt habe, manifestierte sich in meinem Leben durch Entdeckungen, die aus dem Bauch der Erde kamen. Ich stellte ihn mir als jemanden vor, der die Eingeweide der Erde durchwühlt hat, eine Tätigkeit, die sich kaum von jener unterscheidet, der die Medizin im obskuren Inneren des menschlichen Körpers nachgeht.
Rührte die Berufung seines Sohnes daher? Ich werde es nie erfahren.
Auf jeden Fall hat sein Sohn, der später mein Großvater werden sollte, unter seinem Einfluss schon in jungen Jahren die Notwendigkeit harter Arbeit und großer Selbstdisziplin begriffen. Unter den anderen Kleinigkeiten, die ich nach seinem Tod erbte, befanden sich zahlreiche Buchpreise. Bei diesen voluminösen Werken mit dem roten, kartonierten Einband war jeweils auf dem Vorsatzblatt vermerkt, wofür es verliehen worden war. Die Auszeichnungen in Latein, Dichtkunst, Arithmetik oder Geschichte sprechen aus meiner heutigen Sicht für eine schulische Karriere, die eher von Fleiß als von Talent zeugt. Es handelt sich selten um einen ersten Platz, häufiger um Belobigungen, um einen zweiten und dritten Platz, was eher ein Beweis für Beharrlichkeit als für Mühelosigkeit ist. Nach dem Abitur ging mein Großvater zum Studium nach Paris. Er schien seine Studienjahre genossen zu haben. Beim Betrachten der Fotos aus jener Zeit spürt man, wie viel Mühe er sich gab, sein jugendliches Gesicht ernsthafter wirken zu lassen: hochgezwirbelter Schnurrbart, Brille, Mittelscheitel. Doch verrieten seine verschmitzten Augen, ein spöttisch hochgezogener Mundwinkel und seine lässige Art Lebensfreude und vielleicht sogar eine gewisse Überschwänglichkeit. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, würde mich aber freuen, wenn dem so gewesen wäre. Der weitere Lebensweg meines Großvaters war von so vielen Prüfungen gekennzeichnet, dass ich – in seinem Interesse – nur hoffen kann, dass seine Studentenjahre etwas sorgloser waren und er tiefe Freundschaften und unbeschwerte Liebschaften genießen konnte. Aber mir ist natürlich bewusst, dass ich in diesem Punkt mehr als Schriftsteller denn als Memoirenschreiber denke …
Am Ende seines Studiums erhielt er eine weitere Auszeichnung. Wieder ein Buch, aber diesmal eines, das er selbst geschrieben hatte: seine Doktorarbeit. Ich habe ein Exemplar aufbewahrt. Der Titel: »Vergleich des Erbgangs bei progressiver Paralyse.« Es handelt sich um eine kommentierte Zusammenfassung von Fällen mit dem Ziel, die Vererbung des … man höre und staune! … Tertiärstadiums der Syphilis zu bestätigen. Ein Vorsatz, über den man heute nur schmunzeln kann. Er führt zurück in eine Zeit, die weit weg und gleichzeitig auch so nah ist, in der man die Rolle des Treponemas gerade erst erkannt hatte. Mit dieser albernen These sollte bewiesen werden, dass eine unbestreitbar ansteckende Krankheit in Wirklichkeit eine genetische Belastung ist, die von Generation zu Generation vererbt wird! Seine Abschlussarbeit, mit der mein Großvater auf Lebenszeit sein medizinisches Wissen unter Beweis stellte, war in Wirklichkeit ein Beweis für seine Ignoranz und die seiner Zeit. Schlimmer noch: Ich fürchte sogar, dass diese Doktorarbeit verrät, dass er am fragwürdigen Kampf gegen die Wahrheit teilgenommen hat. Zur damaligen Zeit hat Pasteur mit seinen neuen Ideen die Welt der Medizin revolutioniert. Die alteingesessenen Hochschulen weigerten sich natürlich wie üblich, zuzugeben, dass sie im Unrecht sein könnten. Sie schickten ihre Studentenscharen in die Schlacht und ließen sie auf verlorenem Posten kämpfen, nur um das Vorrücken des Feinds, sprich des Fortschritts, zu verzögern. Mein Großvater, ein armer Student, der sein Studium möglichst schnell abschließen und sich niederlassen wollte, sah keine Möglichkeit, diese jämmerliche Arbeit abzulehnen. Für die weiteren Schlachten seines Lebens war er besser gerüstet, obschon er wie viele sanfte und freundliche Menschen zeitlebens dazu neigte, immer wieder auf die Nase zu fallen.
Unmittelbar nach Abschluss seines Studiums verschaffte ihm der Lauf der Geschichte übrigens die Möglichkeit, seine Karriere als Infanterist des Wissens fortzusetzen oder, besser gesagt, als Kanonenfutter des Wissens – im wahrsten Sinne des Wortes. Im Jahre 1914 wurde er als Militärarzt an die Front geschickt, wo er vier Jahre damit zubrachte, Beine und Arme abzuschneiden. Ich weiß nicht genau, was er in jener Zeit gemacht hat. Geblieben sind lediglich lobende, ehrenvolle Erwähnungen, unterzeichnet von General Franchet d’Espèrey, militärische Dokumente, in denen die Heimaturlaube und eine Verwundung festgehalten sind – ein Schrapnell-Splitter im Schulterbereich. Ich fand einige schreckliche Fotografien, die meinen Großvater vor einem Lazarettzelt zeigen, gekleidet wie ein Schlachter, blutbesudelt, mit leerem Blick und sichtlich mitgenommen von den Schrecken und Schmerzensschreien.
Diese Reliquien sind erst seit kurzem in meinem Besitz. Bevor ich sie entdeckt habe, konnte – oder wollte – ich mir diese Epoche einfach nicht vorstellen. Ich wusste natürlich, dass mein Großvater an diesem Krieg teilgenommen hatte. Doch die Medizin war für mich eine schweigsame und subtile Tätigkeit, und ich zog es vor zu glauben, dass er sie in den Schützengräben ähnlich ausgeübt hat wie später in seiner gemütlich eingerichteten Praxis. Niemals hatte ich mir die brutale, blutige, barbarische Version der Kriegsmedizin vorgestellt: verstümmelte Gliedmaßen, zerfetztes Fleisch, Wundbrand. Ich glaube, mit solchen Bildern vor Augen hätte ich mich niemals für den Arztberuf entschieden. Der Anblick blutiger Szenen, von Menschen, deren Kräfte schwanden, das schmerzhafte Eindringen in Körper von Menschen oder Tieren kann ich nur schwer ertragen. Glücklicherweise habe ich die Medizin nie so gesehen. Sie war für mich im Gegenteil schon immer die Wissenschaft der Körperharmonien, Hüterin der Gesundheit und Garantin des Wohlbefindens. Und ich war immer der Ansicht, dass die geschickten und gerissenen Gegenspieler, die man als Krankheiten bezeichnet, ihre natürlichen Feinde sind, nicht aber grobe Eindringlinge wie Säbel oder Gewehrkugeln. Später, als ich für humanitäre Organisationen arbeitete, überließ ich das Operieren von Kriegsverletzten anderen, die es mit größerer Leidenschaft betrieben; ein Gebiet, das in meinen Augen mehr zum allgemeinen Universum des Helfens als zum komplexen und heiklen Gebiet der Medizin gehört.
Man hatte im Übrigen wahrlich nicht den Eindruck, als hätte mein Großvater Gefallen an dem gefunden, wozu er während dieses abscheulichen Kriegs gezwungen worden war. Kaum kehrte wieder Frieden ein, ließ er sich fernab des Geschehens nieder, um etwas ganz anderes zu tun. Er entschied sich für Bourges im Departement Cher, ich weiß nicht warum. Ich erfuhr gerade mal, dass die Frau, die er vor Kriegsanbruch heiratete, ihn verlassen hatte (wie sie aussah, weiß ich nicht, denn meine Großmutter hat sich die Mühe gemacht, das Gesicht ihrer Rivalin auf allen Fotos, auf denen sie zu sehen war, herauszuschneiden). Der junge Arzt war folglich ein freier Mann, und ich nehme an, dass die Aussicht auf einen guten Patientenstamm für seine Wahl ausschlaggebend gewesen war. In der Provinz galt ein Arzt damals als angesehener Mann. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land waren noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und obwohl seine Praxis zwar in der Stadt lag, machte mein Großvater auch Hausbesuche bei Bauern auf ihren Höfen. Er wurde oft in Naturalien bezahlt und brachte von seinen Krankenbesuchen Käse, Weißwein oder auch mal ein Huhn mit. Wenn er unterwegs war, hatte er in einem grauen Filztäschchen stets eine kleine Browning-Pistole bei sich, die den freilaufenden Hunden vorbehalten war, die ihn manchmal verfolgten.
Bei einem dieser Hausbesuche lernte er meine Großmutter kennen, und wieder einmal sollte die Medizin sein Schicksal lenken. Die junge Frau war nicht sehr hübsch, doch mein Großvater war ein langmütiger Mann, der nur allzu gern bereit war, Jugend mit Schönheit zu verwechseln. Was meine Großmutter betrifft, so vermute ich, dass sie es geschickt verstand, den unglücklich Geschiedenen vergessen zu lassen, dass die Natur sie nur wenig mit körperlichen Vorzügen ausgestattet hatte, indem sie eine Sanftheit, Leidenschaft und Sinnlichkeit an den Tag legte, die ihm den Kopf verdrehten. Ihr ärmliches Elternhaus – ihr Vater, ein Bergmann und Alkoholiker, war sehr früh verstorben und hatte eine Frau und acht Kinder zurückgelassen – ließ ebenfalls über ihre eher mageren Qualitäten hinwegsehen. Meine Großmutter war keine Jungfrau mehr – sie war es, die während des Kriegs ihren ersten Ehemann verlassen hatte. Aber manche Frauen haben eine so überzeugende Art, sich bei einer Untersuchung durch Abtasten oder mit dem Stethoskop hinzugeben, eine so zärtliche Eleganz, dem Arzt Symptome zu schildern, von denen sowohl er als auch sie selbst wissen, dass es sie nicht gibt, sondern sie nur ein Vorwand sind, um zuerst zu seufzen und zu klagen und anschließend voller Dankbarkeit über eine angebliche Heilung für den Wohltäter zu entflammen, der sich dieser nur schwer entziehen kann. Im Übrigen war meine zukünftige Großmutter auf ihre Art sogar aufrichtig: vielleicht nicht, was ihre Liebe zu meinem Großvater anging, aber doch in Bezug auf ihre Leidenschaft für die Medizin. Ihr langes Leben (sie starb mit dreiundneunzig) war ein Paradebeispiel für eine selten robuste Gesundheit und eine enorme körperliche Widerstandskraft. Und doch stand es ganz im Zeichen des Leidens und Klagens, immer wieder gekennzeichnet durch endlose Tage der Bettlägerigkeit und durch Wehwehchen, die sie in den Stand unheilbarer Krankheiten erhob. Ihre außerordentliche Fähigkeit zum Selbstmitleid stellte sie dadurch unter Beweis, dass sie nach der Rückkehr ihres Mannes aus dem Konzentrationslager die Glanzleistung vollbrachte, sich als wesentlich kränker auszugeben als er. Zu einem Skelett abgemagert, von der Ruhr schwer gezeichnet und am ganzen Körper mit Eiterbeulen übersät, wurde mein Großvater bei seiner Rückkehr umgehend in ein Zimmer gesteckt und ihm jeglicher Besuch verboten. Aber nicht etwa, damit er seine Ruhe hatte. Denn im Zimmer nebenan, nur durch eine dünne Wand getrennt, die sämtliche Worte und alle Seufzer durchließ, defilierte ein beständiger Besucherstrom am Bett meiner Großmutter vorbei, um sie zu bemitleiden. Sie hatte während des Kriegs einen leichten Autounfall gehabt, anschließend dann so viele Monate im Bett gelegen, dass sie sich eine Venenentzündung holte und sogar die ersten Symptome einer Lungenembolie auftraten – ein Wort, das allerdings nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurde. Die damalige Behandlung sah vor, die Patienten in kalte, feuchte Tücher einzuwickeln, eine Methode, von der man inzwischen weiß, dass sie auch die robusteste Konstitution angreift. Jedenfalls ist es meiner Großmutter allein durch Willenskraft und mit diversen Behandlungen gelungen, die Todkranke zu spielen, ohne dass sie ernsthaft krank gewesen wäre. Sie schaffte es, die Annehmlichkeiten des Lebens einer eingebildeten Kranken zu genießen und dabei immer wieder von der drohenden, aber höchst unwahrscheinlichen Möglichkeit ihres baldigen Todes zu sprechen, bis mein Großvater sich vom Verfall und den Schrecken der Gefangenschaft erholt hatte. Dann erst konnte er seine Kollegen ablösen und seiner Frau die aufmerksame Behandlung angedeihen lassen, die letztendlich zu ihrer Genesung führte.
Ich wurde leider viel zu spät geboren, um Zeuge dieser denkwürdigen Ereignisse zu werden. Als ich im Haus meiner Großeltern eintraf, war der Stern der Medizin schon fast erloschen. Geblieben waren nur die toten Instrumente und das Lichtlein in Form des Behandlungsraums, die darauf hindeuteten, dass es noch immer ein geheiligter Ort war. Das einzige Mal, dass ich eine Ahnung vom Glanz der Medizin bekam, war während der Konvaleszenzphase meiner Mutter gewesen, die an einer Virushepatitis erkrankt war. Die Arme musste Tag für Tag schmerzhafte Spritzenkuren über sich ergehen lassen. Man hatte ihr Leberextrakte verschrieben, eine Behandlung, die, wie ich erst in der Folge erfuhr, ebenso nutzlos wie gefährlich war. Am Ende ihrer Kräfte infolge der Krankheit und erschöpft von den Behandlungsmethoden, flüchtete sie für einige Wochen zu ihren Eltern und somit auch zu mir, um umsorgt und behandelt zu werden. Ich verfolgte die Ereignisse höchst fasziniert. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich eine echte Kranke vor mir. Zu sehen, wie die Augen meiner Mutter immer gelber wurden, aus der Ferne die Ärzte und Krankenschwestern um sie herumtanzen zu sehen, die kleinen Flakons mit Injektionslösungen, die ihr solche Schmerzen bereiteten, in die Hand zu nehmen und die weißliche Flüssigkeit im Licht funkeln zu sehen – das alles fand ich ungemein spannend. Diese ungewohnte Betriebsamkeit ging mit einem wohltuenden Eindruck von Zärtlichkeit einher. Meine abwesende Mutter arbeitete in Paris und besuchte mich nur alle vierzehn Tage. Während ihrer Krankheitszeit hatte ich sie endlich ganz für mich. Ich glaube, ich kann sagen, dass diese drei Wochen die glücklichsten Wochen meiner Kindheit waren. Und dieses Glück verdankte ich einer Krankheit.
Intensiv gelebte Momente waren in der Tat höchst selten. Der Großteil meiner Kindheit bei meinen Großeltern war langweilig. Wenn etwas zu mysteriös ist, erlahmt irgendwann das Interesse daran. So ging es mir irgendwann auch mit der Medizin. An einem gewissen Punkt wurde sie für mich zu einer altmodischen, verstaubten, abgestandenen Sache. Der Tod meines Großvaters – ein schreckliches, wenngleich vorhersehbares Drama – brachte mich vollends von dieser Wissenschaft ab, zumindest glaubte ich das.
Doch das Leben, das wahre Leben, verschaffte sich trotz allem Zutritt in unser einsames Haus. Paris Match – die gesammelten Ausgaben auf unserem Dachboden waren mein größter Schatz – brachte allwöchentlich Fotos von der Eroberung des Weltraums bis zu uns: die Hündin Laika, Gagarin, John Glenn … Um ihre Abende auszufüllen, hatte sich meine Großmutter einen Fernseher zugelegt, einen kleinen Apparat mit einem grünen Bildschirm, an dem wir abends flimmernde Schwarzweißbilder sehen konnten. Wir hörten Georges Guétary, Luis Mariano und Tino Rossi singen. Und wir erfuhren das Neueste über den Krieg in Algerien – aha, es gab also immer noch Krieg, trotz der Rückkehr meines Großvaters und aller »Nie-mehr«-Rufe. Wenn meine Mutter zu Besuch kam, brachte sie Illustrierte mit, in denen sich Filmstars und Starlets am Steuer offener Cabrios zur Schau stellten.
Draußen pulsierte also das Leben. Unsere Provinzstadt, meine Großeltern und die Medizin gehörten offenbar nicht zum wirklichen Leben, trotz allen Respekts, den ich ihnen schuldete. Ich fühlte mich wie in einem Grabmal eingesperrt und träumte davon, ihm endlich zu entkommen.
Doch das gelang mir erst im Alter von zehn Jahren. Nachdem meine Mutter so weit Fuß gefasst hatte, dass sie eine Zweizimmerwohnung mieten konnte und Platz für mich hatte, durfte ich zu ihr nach Paris ziehen. Bald schon hatte ich die Medizin völlig vergessen. Ich träumte davon, Architekt, Schauspieler oder Diplomat zu werden. Bis Christiaan Barnard kam.
3.
Er trug einen grünen Kittel und einen sterilen Mundschutz. Die langen, schönen Hände, die reinsten Zauberinstrumente, hatte er vor sich gefaltet. Und er schaute den Leser mit einem charmanten, geheimnisvollen Lächeln an, dem Lächeln eines Menschen, der lange von diesem Augenblick geträumt hat. Er schien noch zu zögern, an der Schwelle zum Ruhm, der auch Schatten mit sich brachte, die das plötzliche und grelle Licht, das ihn anstrahlte, noch nicht ganz ausgelöscht hatten. Er war Südafrikaner, Sohn eines Pastors und hieß Christiaan Barnard.
Dieses Bild war um die ganze Welt gegangen und unweigerlich auch auf dem Titelblatt von Match gelandet, mit der sensationellen, unglaublichen Schlagzeile: »Erste Herzverpflanzung in Kapstadt. Patient lebt!« Eine Operation, die heutzutage fast banal erscheint. Nicht, dass sie harmlos geworden wäre. Sie bleibt eine eher seltene, heikle Sache, ist aber an der Tagesordnung. Doch sie riecht nach dem Geist der sechziger Jahre, der Zeit der Hängebrücke von Tancarville und der Luftkissenschwebebahn, dem Aérotrain. Sie ist avantgardistisch und etwas primitiv zugleich. Die großen Fortschritte finden neuerdings auf dem Gebiet der Genforschung, der Nanopartikel und im Mikrokosmos der Zellen statt. Mit Hilfe von Skalpellen, Gefäßklemmen sowie Nadel und Faden im Fleisch herumzustochern lässt eher an Jules Verne als an unser virtuelles Zeitalter denken. Eine Herztransplantation bildet die Krönung der Chirurgiekunst und steht am Beginn der zellulären und wirklich wissenschaftlichen Medizin. Sie schließt die Ära der operativen Medizin ab, die von Ambroise Paré eröffnet wurde und in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts große Triumphe feierte. Doch die konkrete Bedeutung dieser Operation ist nebensächlich. Es ging um etwas ganz anderes, zumindest in meinem Fall. Barnards immenses Verdienst bestand darin, die Medizin auf den gleichen Rang erhoben zu haben wie die anderen großen Abenteuer der modernen Wissenschaft und vor allem der emblematischsten unter ihnen: der Eroberung des Weltalls.
Bei der Inszenierung der ersten Herzverpflanzung war alles darauf ausgerichtet, ein unbewusstes Band zwischen dieser chirurgischen Operation und dem Start eines bemannten Raumschiffs herzustellen. Dieselbe sterile Atmosphäre, dasselbe Umfeld an Instrumenten, die darauf abzielten, das Überleben in einer total feindseligen Umgebung zu sichern (in einem Fall der luftleere Raum, im anderen der extrakorporale Blutkreislauf), dieselben ungewohnten Stoffe, glanzlos und rau beim Operationsfeld, weich und glänzend bei den Weltraumanzügen, und im Mittelpunkt ein Menschenleben, fragil und rühmenswert. Natürlich hatte die Heldentat eines John Glenn nichts mit der Reise ohne Wiederkehr des armen Louis Washkansky gemeinsam. Dennoch handelte es sich bei beiden um Freiwillige. Als ehemalige Soldaten waren sie bereit, ihr Leben für eine Mission zu opfern, die der ganzen Menschheit zugutekommen sollte. Da spielt es im Grunde genommen keine große Rolle, dass der eine wiedergekommen ist, der andere die Operation nur um achtzehn Tage überlebt hat.
Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Abenteuern, dem im Weltraum und dem auf dem Gebiet der Medizin, war, dass Letzteres durch einen einzelnen Mann verkörpert wurde. Beim Abschuss einer Rakete ins Weltall sind zu viele Personen beteiligt, als dass dieses Ereignis nur einem einzelnen Dirigenten zugeschrieben werden könnte. Während Barnard, obschon er ein Team leitete, gleichzeitig auch Kopf und Hand des ganzen Unternehmens war … Er allein hatte – zusammen mit seinem Bruder – die Operation konzipiert, Spender und Empfänger ausgewählt und das Skalpell angesetzt, um diese nicht wieder rückgängig zu machende Handlung auszuführen: einem lebenden Menschen das Herz zu entnehmen und durch das eines Toten zu ersetzen. Dadurch wurde er zur Personifikation eines Helden, der von der Presse zu Recht bejubelt wurde.
Sehr viel später nahm ich mir die Zeit, das Groote-Schuur-Krankenhaus in Kapstadt zu besuchen, in dem die Operation stattgefunden hatte. Es ist ein Ort voller Energie und Charme, am Fuß der gewaltigen Felsbarriere des Tafelbergs gelegen. Mehrere Gebäude im holländischen Stil, mit weißen Frontgiebeln und grünen Dächern, im Halbkreis angeordnet, bilden das historische Zentrum des Hospitals – das heute natürlich sehr viel größer ist. Professor Barnards Abteilung wurde im ersten Stock des Zentralpavillons rekonstruiert. Sie ist für Kardiologen aus der ganzen Welt zu einem Wallfahrts-, wenn nicht gar Kultort geworden, auch für Ärzte anderer Spezialgebiete.
Mein Besuch hat mich davon überzeugt, dass Barnards Meisterleistung in Wirklichkeit nur sehr wenig mit Technologie zu tun hatte. Das Ganze vermittelt einem denselben Eindruck wie eine Besichtigung in der Concorde: völliges Fehlen von EDV – natürlich; noch sehr primitive Materialien (Glas, Holz, Metall, rudimentäre Kunststoffe). In dem nachgebauten OP





























