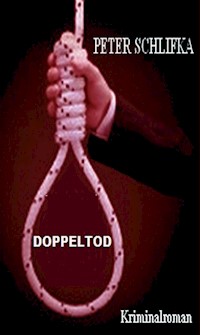9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mordserie bringt die Berliner Polizei zur Verzweiflung. Die Opfer sind Politiker, Journalisten und andere Aktivisten, die sich für die Erhaltung der Demokratie und im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus stark machen. Ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr schart auf einen alten Bauernhof im Norden Deutschlands junge Neonazis um sich, bildet sie aus und verübt mit ihnen diverse Anschläge. Zuerst nur in Berlin. Geplant sind aber Anschläge in ganz Deutschland mit dem Ziel die Menschen zu verunsichern. Als einer der Neonazis beschließt auszusteigen und Unterlagen über die Gruppierung an sich bringt, spitzt sich die Lage zu. Für die Polizei und nicht nur für diese, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1
Der Wind, der durch die leeren, dunklen Straßen des Prenzlauer Bergs pfiff war trotz des fortgeschrittenen Frühlings noch kalt und unfreundlich. Die Podiumsdiskussion im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin war an diesem Abend schon gegen neun zu Ende gewesen, aber die anschließende Fragestunde hatte sich in die Länge gezogen. Der Saal war brechend voll gewesen, die Luft stickig. Außer Sophia Brandt-Ndiaye hatten ein Redakteur der marxistisch orientierten Tageszeitung “Junge Welt“, eine Abgeordnete der Bundestagsfraktion der Linken, ein Aktivist der Hausbesetzerszene und ein Vertreter der Polizei, auf dem Podium gesessen. Angesichts des Themas „Hausbesetzungen - ein sinnvolles Mittel selbstorganisierter Sozialpolitik?“ war es schwierig gewesen, einen Polizeibeamten zu finden, der sich zur Verfügung stellte. Zu frisch waren die Erinnerungen an die Krawalle des gerade vor einer Woche stattgefundenen Ersten Mai, um einen positiven Zusammenhang zwischen Hausbesetzern und Sozialpolitik zu finden.
Hinterher waren alle hitzig diskutierend die Straße entlanggestiefelt und schließlich aus irgendeinem Grund in einer der Kneipen am Volkspark Friedrichshain gelandet, wo das aufgeregte Gespräch fortgeführt wurde. Sophia hatte sich neben dem Beamten von der Polizei gesetzt. In dieser persönlichen Runde hatte er sich entspannt und mehr von sich selbst erzählt, als nur wie vorhin, ständig von Deeskalation und polizeilichen Hoheitsrechten zu faseln. Seine widersprüchlichen Gefühle waren an die Oberfläche gedrungen, seine Liebe zum Job, die Unzufriedenheit mit der Polizeiführung, die nie ausreichend Unterstützung gab, das Gefühl, von der Presse verfolgt und missverstanden zu werden. Auch von Sophia, wie er freimütig zugab. Diese war erstaunt, denn nie hatte sie erwartet, dass ein Polizist ihre Blogs las. Natürlich war sie darin nicht immer fein mit den Polizisten umgegangen, aber sie hatte nun einmal oft genug erlebt, mit welcher Brutalität die Polizei auf linke Demonstranten losging. Unnötige Gewalt, wie sie fand. Er hielt dagegen, dass es die Polizei auch nicht leicht habe, sich gegen Molotowcocktails und Pflastersteine zu wehren. Am Ende hatten sie sich richtig gut unterhalten.
Als Sophia schließlich gegen halb eins zur Straßenbahn ging, war sie bester Laune, leicht beschwipst von mehreren Gläsern Wein und dem wohltuenden Gefühl, sich mit anderen Menschen tatsächlich ausgetauscht und sich nicht nur aus Schützengräben heraus beschossen zu haben.
Sie freute sich darauf nach Hause zu kommen und war inzwischen schon rechtschaffend müde. Zum Glück hatte sie morgen früh keine festen Termine. Freischaffend zu sein hatte eben auch seine Vorteile. Den Artikel über die Podiumsdiskussion konnte sie auch später in ihrem Blog setzen. Ihr Mann und ihre sechsjährige Tochter schliefen bestimmt schon. Sie würde duschen, sich noch ein spätes Käsebrot in der Küche gönnen und dann zu ihrem Mann ins Bett kriechen. Die Straßenbahn war leer. Trotzdem blieb sie für die zehnminütige Fahrt an der Tür stehen. Sie musterte sich selbst im Fenster. Klein, rund, mit großen, fröhlichen Augen unter dem blonden, lockigen Haar. Sie zwinkerte sich zu.
Kurz darauf stieg sie an der Albertinenstraße aus und begann den Rest des Heimweges in Angriff zu nehmen. Die Straße war wie ausgestorben und in den Häusern brannte kein Licht. Es war zwar schon Mitte Mai, aber die Nächte waren noch kühl, aber die Bäume in dem großen dunklen Park zu ihrer Rechten hatten schon auszuschlagen begonnen und der Duft von feuchter Erde und Gras war betörend. Irgendwo weiter hinten am Weissen See quakte verschlafen eine Ente. Fröstelnd hielt Sophia mit der Hand den Kragen des Mantels zusammen. Auf der Hälfte der Strecke klingelte ihr Handy. Es war ihr Mann.
„Du schläfst noch nicht?“, fragte sie erstaunt und gleichzeitig froh. Vielleicht konnten sie noch ein Weilchen in der Küche zusammensitzen und über den Verlauf der Veranstaltung sprechen. Darauf zu hoffen hatte sie nicht gewagt, denn er war Bauarbeiter und musste früh aufstehen.
„Nein, Martin und Lisa sind noch vorbeigekommen und wir haben bis vor kurzem zusammengesessen. Wo bist du? Wann kommst du?“
„Ich bin fast da. Kannst du mir einen Tee aufsetzen?“
„Natürlich. Wenn du kommst, ist er fertig. Ich warte auf dich. Bis gleich Liebes“, sagte er und legte auf. Sophia lächelte beim Weitergehen versonnen. Sie sah ihn vor sich, die tiefschwarzen, muskelbepackten Arme, die das T-Shirt zu sprengen drohten, der aber doch so unglaublich sanft zu ihr war. Die Eltern ihres Mannes waren aus Kenia, er selber aber in Deutschland geboren. Als sie ihr Handy in die Tasche zurücksteckte, entdeckte sie ein Stück weiter oben einen weißen Transporter mitten auf dem Fußweg parken. Das sah seltsam aus, zumal auf dieser Seite, am Park. Sie blieb stehen, betrachtete, den Wagen und sah eine Bewegung im Fahrerhaus. Ihr Misstrauen regte sich. Sophia war nicht ängstlich, aber sie hatte sich geschworen, niemals ihre innere Stimme zu ignorieren. Sie machte ohne lange zu zögern auf dem Absatz kehrt und begann zur Hauptstraße zurückzugehen. Ihr Mann würde sie dort abholen kommen. Lieber einmal zu vorsichtig sein, als einmal zu wenig.
Während sie in ihrer Tasche nach dem Handy kramte, hörte sie wie der Lieferwagen angelassen wurde. Zu ihrem Erstaunen kam das Geräusch näher, und als sie sich umdrehte, sah sie entsetzt, wie er in voller Fahrt auf sie zuraste.
Sie begann zu rennen. Sie war allein auf der Straße. Die Fenster der Wohnhäuser auf der anderen Seite waren dunkel, die wenigen Geschäfte geschlossen. Sie konnte schräg durch den Park laufen, zu den Villen auf der anderen Seite, die jedoch mehrere hundert Meter entfernt waren. Wenn der Mann aus dem Lieferwagen heraussprang und sie verfolgte, wäre es ihm ein Leichtes sie einzuholen.
Das Motorengeräusch kam rasch näher. Sophia blieb mit klopfenden Herzen stehen, erstarrte förmlich vor Angst. Sie wagte nicht sich umzudrehen, erwartete jeden Moment von dem heranrasenden Wagen überrollt zu werden.
Das Motorengeräusch erstarb zu einem leisen Blubbern. Nichts geschah. Zögernd drehte sie sich um. Sie konnte dem Mann am Steuer direkt in die Augen sehen. Er war schwarz gekleidet, eine Skimaske verdeckte sein Gesicht. Nur seine Augen funkelten hasserfüllt im Licht der Straßenlaterne. Sie wollte schreien, Hilfe herbeirufen, aber ihr versagte die Stimme.
Er öffnete die Tür, sprang auf den Bürgersteig und kam langsam auf sie zu.
2
Die Gegend um den Bahnhof Lichtenberg war trotz des leichten Nieselregens, auch an diesem Morgen belebt wie immer. Die Menschen hasteten, die Gesichter unter Schirmen oder Kapuzen verborgen, ihren Zielen entgegen. Nur ein Mann schlenderte, unbeeindruckt vom Wetter, langsam den Bürgersteig entlang, eine Zigarette im Mundwinkel, den Kopf unbedeckt. Mit seiner Größe und der kräftigen Statur, hatte er keine Mühe, die anderen Passanten davon zu überzeugen, ihm aus dem Weg zu gehen. Dafür sorgten auch seine Augen, die gefährlich und misstrauisch unter dem dichten schwarzen Haar mit der grauen Strähne hervorschauten. Er schien kein bestimmtes Ziel zu haben, sondern schlenderte langsam die Straße entlang, aber sein Blick tastete unaufhörlich die Umgebung ab, als suche er etwas.
Vor einem Zeitungskiosk blieb der Mann stehen. Sein Interesse schien geweckt. Er studierte ein paar Titelblätter am Ständer vor dem Kiosk.
Die neuen Ausgaben der großen Tageszeitungen zeigten groß aufgemachte Schlagzeilen und das Foto einer Frau, Anfang Dreißig mit hellen, lockigem Haar. Darunter prangten in schwarzen Lettern: - NEUER NEONAZIMORD Sophia Brandt-Ndiaye heute Morgen tot aufgefunden. Bekannte Bloggerin ermordet.-
Er nahm eine Zeitung aus dem Ständer, bezahlte und verzog sich in einem Hauseingang. Eine ganze Doppelseite hatte das Blatt den Morden an bekannte linke Aktivisten gewidmet. Den größten Teil natürlich dem neuen Mord an dieser Frau.
Sophia Brandt-Ndiaye war eine bekannte gesellschaftskritische Bloggerin gewesen. Sie hatte ein gutes Stück links von den Sozialdemokraten gestanden, hatte sich aber immer als Parteiunabhängig erklärt. Über eine Reihe von Jahren hatte sie bissige Artikel über Sozialabbau, über rückgratlose Politiker und verwirrte Beamte auf allen Ebenen, über Frauendiskriminierung, die Gleichberechtigung Homosexueller, gewalttätiger Polizisten, über rechte und linke Chaoten und in letzter Zeit über Flüchtlingspolitik, geschrieben. Da sie Humor besaß und sich als eine umgängliche, aber auch streitbare Frau erwiesen hatte, war sie ein willkommener Gast in etlichen Talkshows gewesen.
Eine halbe Seite wurde von einem unscharfen Foto eingenommen, das den mit Plastikbändern abgesperrten Fundort der Leiche zeigte. Im Hintergrund des Fotos war undeutlich ein weißer Fleck, neben einem Polizisten zu sehen. Ein Fleck, der die Leser erschauern lässt und ihre Fantasie anregt.
Es gab auch Berichte von dem Gerichtsverfahren gegen zwei junge Neonazis, die die Tote im letzten Jahr bedroht hatten. Sie hatten angerufen, SMS und E-Mails geschickt und waren zu Geldstrafen verurteilt worden.
Zum Mord selbst stand erstaunlich wenig in der Zeitung. Die Polizei wollte weder etwas darüber verlauten lassen, ob sie Spuren gefunden hatten, noch ob das Opfer am Fundort ermordet worden war. Aus der Tatsache, dass die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Berlin geführt wurden, zog die Zeitung den Schluss, dass es sich auch in diesem Fall um einen politisch motivierten Mord handelte. Auch wenn nichts verlautbart wurde, ging man davon aus, dass auch diesmal dem Mordopfer eine Münze aus dem dritten Reich, mit Reichsadler und Hakenkreuz in die Hand gedrückt worden war, zusammen mit einem Zettel auf dem, kleingedruckt, nur das eine Wort -heimgezahlt – stand. Allerdings gab es auch diesmal keinen einzigen Hinweis auf einen Tatverdächtigen.
Die Zeitung schloss damit, dass Sophia Brandt-Ndiaye einen Mann und eine sechsjährige Tochter hinterließ. Auf dem dazugehörigen Foto war sie zusammen mit einem tiefdunklen Schwarzafrikaner und einem etwas helleren kleinem Mädchen mit niedlichen Zöpfen zu sehen.
Der Mann las aufmerksam jedes Wort. Dann faltete er die Zeitung zusammen und nahm seine Wanderung wieder auf. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen und ab und zu riss die Wolkendecke auf und es zeigte sich die Sonne. Er zündete sich eine weitere Zigarette an und bog einige Straßen weiter in eine stille Seitenstraße ein. Vor einer Eckkneipe blieb er stehen, schnippte seine Kippe auf die Straße und ging hinein. Auf der Türschwelle blieb er für einen Moment stehen, bis er sich an das Dämmerlicht im Inneren gewöhnt hatte. Er blickte sich taxierend um.
Zu dieser frühen Stunde war es ruhig, und nur vereinzelt saßen Gäste an den Tischen. Am Tresen standen zwei, die eher der lautstarken Kneipenklientel zuzuordnen waren, aber um diese Tageszeit waren sie offenbar noch nicht auf der Höhe. Etwas verschlafen hingen sie förmlich an der Bar und murmelten leise.
Ihr Anblick ließ ihn vage hoffen, auch wenn er sich nicht allzu viel versprach. Seit mehr als zwei Wochen bewegte sich Robert Brinkmann nun im Umfeld der Neonazis und versuchte Kontakt zu der Organisation zu bekommen, die für die Morde an den Personen verantwortlich war, die von ihrer Abneigung gegen die sogenannten nationalen Bewegungen keinen Hehl machten. Alle vier der bisherigen Opfer waren Personen gewesen, die mehr oder weniger in der Öffentlichkeit standen und dort ihre Meinung offen vertraten. Trotz aller Bemühungen war es dem Landekriminalamt Berlin bisher nicht gelungen, eine Spur zu dem oder die Mörder zu finden. Es wurde befürchtet, dass die Mordserie längst nicht zu Ende war. Daher hielt man die Einschleusung eines Mannes in die Neonaziszene für notwendig. Dieser Mann war er. Dazu hatte man ihn vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg ausgeliehen. Stuttgart war nicht Berlin, das war ihm gleich von Anfang an klar geworden und auch, dass es nicht einfach sein würde, Zugang zu den Verantwortlichen zu finden.
Auch wenn er es sich vereinfacht in etwa so vorstellte, konnte er ja schlecht auf den nächstbesten Glatzkopf zugehen und fragen: „Sag mal wer von euch mordet denn hier rum? Ich will mitmachen.“
Hinter dem Tresen stand ein kleiner, grauhaariger Mann mit einem Lederschurz um den ansehnlichen Bauch und polierte Gläser. Er hob den Blick, als der Neuankömmling auf ihn zukam, sich auf einen Barhocker neben die beiden Zechkumpanen setzte, die Zeitung auf den Tresen warf und um ein Hefeweizen bat. Der Wirt stellte ein Glas vor ihn. Er nickte und schnippte die Zeitung mit den Fingern weg, dass sie ein Stück über den Tresen glitt.
„Dieser Mord da“, sagte er. Seine Stimme war heiser und rau, und sie war im ganzen Lokal zu hören, ohne dass er sie hob. Es wurde still. Die Atmosphäre war plötzlich gespannt, als hätte sich die Luft mit unsichtbaren Substanzen gefüllt, die die Gäste Gefahr wittern ließ.
„Diese verdammt linke Schlampe ist doch selbst schuld“, fuhr er fort. „ Wer mit dem Feuer spielt, muss eben verdammt noch mal damit rechnen, dass er sich die Finger verbrennt.“
Mit einem herausfordernden Lächeln betrachtete er die Burschen neben sich.
„Oder?“
Die erhoffte Reaktion blieb aus. Sie zogen nicht so mit, wie er es sich gedacht hatte. Ihre Blicke flackerten, und sie stimmten mürrisch zu, ohne die Stimme zu erheben, ohne größeren Enthusiasmus. Die Gäste hinter ihnen wirkten ein wenig verschreckt, warteten aber gebannt auf die Fortsetzung.
Brinkmann beugte sich ein wenig zu den beiden hinüber und musterte sie. Sie waren um die zwanzig, hatten Totenköpfe und Flammenschwerter auf die Unterarme tätowiert, sie trugen beide Hosen mit Tarnmuster und T-Shirts mit kurzen Ärmeln, so dass ihre muskelbepackten Oberarme gut zur Geltung kamen. Ihre Ähnlichkeit wurde noch durch die kahlgeschorenen Schädel betont, wobei dem einen schon der erste rotblonde Flaum nachwuchs. Er nahm seine halb gerauchte Zigarette aus dem Mund und verwandte viel Zeit darauf, sie im Aschenbecher auszudrücken. Dann drehte er betont langsam seinen Kopf zu Brinkmann und starrte ihm aus wenigen Zentimeter Entfernung ins Gesicht, sagte aber kein Wort.
„Warum sagst du nichts, verdammte Scheiße. Hörst du nicht, dass ich mit dir rede?“
„Es reicht, wenn ich mir denke, was ich denke“, antwortete der hellblonde Stoppelkopf ohne auch nur eine Miene zu verziehen. „Und darüber bin ich dir wohl kaum Rechenschaft schuldig.“
Brinkmann hob die Augenbrauen. Sein Lächeln wurde sarkastisch, als wären Schwäche und Feigheit das Einzige, was man von der Menschheit erwarten konnte, und als hätte er bereits mehr als genug davon erlebt. Er wartete ein paar Sekunden, während der es im Gastraum totenstill war, ehe er antwortete.
„Wirklich? Hör zu, du, ich sag dir, warum du so feige die Klappe hältst. Du sagst nichts, weil es in diesem Land zu viel von dieser verfluchten politischen Korrektheit gibt. Sie unterdrücken deine natürlichen Instinkte. Du hättest diese Schlampe gern selbst fertiggemacht, aber du traust dich nicht es zuzugeben. Ist es nicht so?“
Er redete etwas lauter, und er wusste, wenn die Leute mehr Mumm hätten, würden sie lieber einer nach dem anderen diskret verschwinden, als hier zusammen mit ihm in diesem Lokal zu bleiben. Sie saßen alle da wie stille, unbeteiligte Zuschauer und starrten in ihre Biergläser. Keiner sagte etwas. Jeder hoffte, dass der Fremde von sich aus verschwinden würde und sie wieder in Ruhe ihr Bier trinken könnten.
Der kleine Wirt hinter dem Tresen hörte mit zusammengekniffenen Lippen zu. Er wünschte sich ebenfalls, dass der unangenehme Gast wieder gehen, oder zumindest Ruhe geben würde. Aber die Spannung in der Luft wollte nicht nachlassen. Er rang einen Augenblick mit sich, dann brach er die Stille.
„Wie können Sie so etwas sagen. Haben sie denn kein Mitgefühl für die arme Frau die ermordet worden ist?“, fragte er aufgebracht. Mehrere der Gäste griffen verstohlen nach ihren Handys, um im Notfall die Polizei zu rufen. Der Wirt bemerkte dies aus den Augenwinkeln, wusste aber nur zu gut, dass die Polizei nicht rechtzeitig da sein konnte, wenn sich der arrogante Faschist vor ihm entschloss, handgreiflich zu werden. Er trat sicherheitshalber einen Schritt hinter dem Tresen zurück, bis er mit dem Rücken an dem Regal mit den Flaschen stieß. Er hatte Angst, aber er musste jetzt weitermachen, er musste einfach seine Meinung sagen.
„Sie hatte auch Familie, haben sie daran gedacht“, sagte er leise. „Ich habe ihre Artikel manchmal gelesen. Sie setzt sich immer für die Schwachen und Ausgestoßenen ein, aber Leute wie ihr, ihr denkt nicht, ihr zerstört nur. Das hier ist nichts worüber man grinsen kann, das hier ist Ernst, es ist eine Tragödie!“, fuhr er lautstark fort, als er sah, wie ein Lächeln die Lippen des Fremden umspielte. „Ich kann nicht zulassen, dass sie hier vor meinen Gästen solche Reden führen, das geht nicht. Ich muss Sie auffordern, mein Lokal zu verlassen.“
Immer noch herrschte in der Gaststätte atemlose Stille. Niemand rührte sich. Es erschien allen, wie die Ruhe vor dem Sturm. Aller Augen hingen gebannt an den Geschehnissen an der Theke. Nur die beiden glattrasierten Jungs am Tresen sogen scheinbar ungerührt an ihren Zigaretten und schauten in ihre Gläser.
Scheiße, dachte Brinkmann. Falsches Lokal. Er beugte sich über den Tresen und grinste den zurückweichenden Wirt triumphierend an.
„Richtig, gut so. So soll das klingen!“, sagte er. „Das hier ist dein Lokal, und du bist der einzige, der hier das Sagen hat. Du bestimmst wer hier bedient wird. Kein verfluchter Politiker oder abhängiger Journalist. Nur du. Das ist die Freiheit, die wir in unserem Land brauchen! Wir, das Volk sollten bestimmen, wen wir hier haben wollen und wen nicht!“
Der Wirt lief rot an.
„Raus hier. Verschwinden Sie!“, sagte er heiser.
Brinkmann ließ noch immer das Grinsen in seinem Gesicht stehen. Innerlich bewunderte er den Wirt wegen seines Mutes. Langsam wurde es für ihn Zeit sich zurückzuziehen, ehe einer der Gäste doch noch den Mumm aufbrachte die Polizei zu rufen. Sein ganzes Gequatsche hatte wieder einmal nichts gebracht. Während sich weiterhin Totenstille um ihn herum ausbreitete, leerte er sein Glas, warf einige Münzen auf den Tresen, nahm irritierend langsam seine Zeitung an sich und rutschte vom Barhocker. Auf dem Weg zum Ausgang hob er die Hand zu einem ironischen Gruß an alle im Lokal und verschwand auf die Straße.
Die Anspannung löste sich. Die wenigen Gäste atmeten auf, sahen einander an, in der zufälligen, wohltuenden Gemeinschaft, die eine angewendete Gefahr verursacht und schüttelten die Köpfe. Dann sahen sie auf den Wirt und nickten ihm verkrampft lächelnd zu. Er nickte zurück, ohne zu lächeln und wandte sich wieder dem Polieren der Gläser zu.
Brinkmann stand auf der Straße und wartete ohne große Zuversicht, ob doch noch einer der beiden Burschen vom Tresen herauskommen und Kontakt zu ihm aufnehmen würden. Aber die Tür blieb geschlossen.
Er zuckte mit den Schultern, zündete sich eine neue Zigarette an und schlenderte weiter. Zwei Querstraßen entfernt war die nächste Kneipe. Er las den Namen über der Tür, öffnete sie und ging hinein.
3
Knapp fünf Kilometer Luftlinie weiter südlich glitten die breiten Glastüren vor dem Foyer eines ziemlich neuen Bürogebäudes auf und ließen einen jungen Mann ein, der schon rein äußerlich nicht in die kühle, distanzierte, aber doch Eleganz verströmende Umgebung passte. Zu einer ungebügelten dunklen Hose trug er ein kariertes Jackett über einen dünnen Rollkragenpullover, schien sich in diesem Outfit aber nicht recht zu Hause zu fühlen. Er hieß Sven, war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte trotz seiner Jugend schon einen ansehnlichen Speckgürtel um die Hüften. In dieser für ihn ungewohnten Umgebung fühlte er sich sichtlich unwohl und stand unschlüssig um sich blickend herum, während die anderen Menschen zielstrebig über den Marmorboden zwischen den Fahrstühlen und dem Eingang eilten.
Er studierte lange die Glastafel auf der die Firmen und Mieter des Hauses aufgelistet waren, und stieg dann in den Fahrstuhl, fuhr einige Stockwerke hoch, fand die Tür mit dem Schild „Katharina und Dirk Fiedler, Rechtsanwälte“ , klingelte und trat mit dem sanft schnarrenden Türöffner ein.
Der große Empfangsraum war mit einer schwarzen Sofagruppe, einem Glastisch und einem Flachbildschirm an der Wand, auf dem NT-v lief, ausgestattet.
Ein halbrunder Tresen trennte den Wartebereich von den Arbeitsräumen. Hinter dem Tresen saß eine etwa fünfzigjährige Frau und schaute ihn freundlich, fragend an. Offenbar die Sekretärin. Sie hieß Bergmann, das wusste er von dem kurzen Telefonat, dass er von seinem Handy aus mit ihr geführt hatte. Zwischen einer Kaskade von Grünpflanzen und dem Fenster stand ein weiterer Schreibtisch mit einer weiteren Angestellten, einer Junganwältin namens Maria Lechner, wie aus dem Namensschild auf ihrem Schreibtisch hervorging. Sie war knapp dreißig, etwas mollig und trug ihr Haar zu einem Pagenschnitt frisiert. Im Hintergrund gab es zwei Türen, die zu den Büros der beiden Anwälte führten mussten. Katharina und Dirk Fiedler hatten im Internet gestanden. Vermutlich verheiratet. Aber das spielte für ihn keine Rolle. Die eine Tür stand halb offen und Sven konnte lebhafte Stimmen hören, die nach draußen drangen.
Die Sekretärin blickte ihn immer noch geduldig fragend an. Er ging zum Tresen und stellte sich vor. Sie wirkte nett und irgendwie mütterlich mit ihrem, von grauen Strähnen durchzogenen, schwarzen Haar und den freundlich blickenden Augen, und das beruhigte ihn ein wenig.
„Eigentlich muss man ein paar Tage im Voraus einen Termin machen, aber Frau Fiedler wird gleich mit Ihnen sprechen. Sie müssen es aber kurz mache, sie hat nicht lange Zeit“, sagte sie. „Setzen sie sich, und warten sie bitte so lange.“
Sven nickte und nahm in einem Besuchersessel Platz. Auf dem Tisch daneben lagen etliche Tageszeitungen. Er las die Schlagzeilen über eine Sozialarbeiterin, die am gestrigen Abend ermordet worden war. Die Zeitung zitterte in seinen Händen und sein Blick huschte unruhig umher.
Die Mollige beendete ihr Telefongespräch. Sie ging zu dem kleinen Durchgang, der zu der kleinen Kochnische, der Garderobe und der Toilette führte. Als sie den Wartenden sah, bot sie ihm einen Kaffee an. Sie schien zu merken, wie unbehaglich ihm zu Mute war, was ihn ärgerte, weil sie ihm deshalb irgendwie überlegen vorkam.
„Okay“, entgegnete er schroff.
Das klang nicht sehr höflich, und er bereute es sofort. Aber sie schien ihm diese Antwort nicht zu verübeln. Ein paar Augenblicke später kehrte sie mit dem Kaffee zurück und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln, widmete sich wieder ihrem Schreibtisch und vertiefte sich in einer dicken Akte.
Es war befremdlich hier zu sitzen. Er kam sich völlig fehl am Platz vor und war von seinem Vorhaben gar nicht mehr so überzeugt, wie noch vor ein paar Stunden. Aber er wusste sich keinen anderen Rat. Aber der Kaffee war stark und heiß und half ihm die lauernde Angst in Schach zu halten.
Die Sekretärin sah auf ihre Armbanduhr, griff nach einer Fernbedienung auf ihrem Schreibtisch und warf Sven einen kurzen, fragenden Blick zu. Als er keine Miene verzog, machte sie den Ton des Fernsehers lauter. NT-v übertrug eine Pressekonferenz aus dem Berliner Polizeipräsidium. Auf dem Podium saßen zwei Personen, ein Mann Mitte fünfzig und eine Frau blond e Frau, die etwa fünf Jahre jünger sein mochte. Beide waren in Zivil. Im Saal drängten sich aufgebrachte Journalisten, die alle durcheinanderredeten. Keiner hatte Zeit, die warme Frühlingssonne zu beachten, die den Weg auch durch die Fenster des Polizeigebäudes gefunden hatte.
„Hauptkommissarin Merk, wo wurde Frau Sophia Brandt-Ndiaye gefunden?“, rief ein Journalist.
Susan Merk schüttelte unwillig den Kopf. Sie wusste, dass sie bei der Presse bekannt war wie ein bunter Hund. Früher waren die Journalisten nicht sehr freundlich mit ihr umgesprungen. Jetzt, wo sie diesen Job beim Landeskriminalamt hatte und spektakuläre Erfolge vorweisen konnte, war sie eine gefragte Gesprächspartnerin. Trotzdem, Gerd war der Ermittlungsleiter. Sollten sie doch ihn ausquetschen. Susan hasste Pressekonferenzen und hielt sie für vertane Zeit. Daher klang sie jetzt auch leicht genervt.
„Wie Hauptkommissar Dreyer gerade in seinen Einleitungen gesagt hat, in einem Park am Weissen See, ganz in der Nähe ihrer Wohnung.“
Gerd Dreyer warf ihr einen verwunderten Blick zu und übernahm schnell das Wort: „Ihr Mann hat sie gesucht, als sie nicht nach Hause kam, gefunden wurde sie aber von einem Jogger eine Stunde später. Zu dem Zeitpunkt hatte ihr Mann gerade die Polizei verständigt.“
„Ist es sicher, dass sie ermordet worden ist?“, fragte der Korrespondent der ARD.
„Ja“, erwiderte der Ermittler kurz.
„Wie?“
„Es ist noch zu früh, um darüber eine endgültige Aussage zu treffen, wir müssen die Resultate der Obduktion abwarten.“
„Ist sie sexuell missbraucht worden?“, fragte eine smart aussehende dunkelhaarige Frau aus der hintersten Reihe.
„Auch darüber können wir noch nichts sagen, aber wir haben keine äußerlichen Hinweise darauf gefunden.“
„Das hier ist der fünfte Mord in weniger als acht Wochen an einem Menschen, der aktiv gegen den Rechtsextremismus in Deutschland angekämpft hat“, sagte der ARD-Reporter mit lauter Stimme, leicht verärgert, darüber, dass die weitaus weniger bekannte Journalistin sich auf ein Terrain gedrängt hatte, das er als das seine betrachtete. „Bei den anderen Morden hat der Mörder eine Münze aus dem Dritten Reich bei den Opfern zurückgelassen. Dieses Mal auch?“
„Kein Kommentar.“
„Haben sie die letzten Stunden des Opfers rekonstruieren können?“, warf die Dunkelhaarige schnell ein, während der ARD-Mann Atem holte. Zum ersten Mal wurde es still im Saal.
Sven nahm den Blick vom Bildschirm und sah die Sekretärin an. Sie hielt ihren Blick wie festgenagelt auf den Fernseher gerichtet und zwischen ihren Augenbrauen hatte sich eine bekümmerte Falte gegraben.
„Sie hat gestern Abend eine Podiumsdiskussion im Haus der Demokratie und Menschenrechte geleitet zum Thema „Hausbesetzungen ein sinnvolles Mittel selbstorganisierter Sozialpolitik?“, übernahm Oberkommissarin Merk das Wort. „Mit auf dem Podium waren eine Abgeordnete der Bundestagsfraktion der Linken, ein Aktivist der Hausbesetzerszene und ein Vertreter der Polizei. Im Anschluss daran gingen alle in eine Gaststätte am Friedrichshain. Gegen halb eins brach Sophia Brandt-Ndiaye auf, um mit der Straßenbahn nach Hause, nach Weissensee zu fahren. Soweit wir wissen, ist sie auch damit gefahren. Die anderen Diskussionsteilnehmer blieben noch in der Gaststätte.“
„Könnte der Mörder auf sie gewartet haben?“, fragte die Dunkelhaarige nach.
„Dafür gibt es keine Indizien.“
Der ARD-Korrespondent schien es an der Zeit zu sein, der Pressekonferenz eine andere Richtung zu geben.
„Fünf Morde mit einem Täter aus offensichtlich nationalsozialistischen Kreisen in knapp acht Wochen, und wie es scheint, haben Sie nicht eine einzige Spur“, sagte er anklagend. „Was tun Sie eigentlich? Sie konnten doch davon ausgehen, dass es zu weiteren Morden kommen würde. Hätte Sophia Brandt-Ndiaye noch leben können, wenn Sie Ihren Job ordentlich gemacht hätten? Ist der Täter gerade damit beschäftigt, den nächsten Mord zu planen?“
Hauptkommissar Gerd Dreyer beugte sich vor.
„Die Ermittlungen laufen auf vollen Touren. Es wird alles Erdenkliche getan um den oder die Mörder zu finden. Mehr dazu kann ich Ihnen nicht sagen.“
In der hinteren Reihe erhob sich wieder die Dunkelhaarige.
„Was würden Sie dem Mörder sagen wollen?“
Wieder herrschte Stille im Raum.
Gerd Dreyer sah zu Susan hinüber und erkannte, dass sie dazu etwas sagen wollte. Er beugte sich hastig zum Mikrofon.
„Das führt uns jetzt nicht weiter. Ich denke wir brechen hier ab“, sagte er und sah auf die Uhr. „Ich danke Ihnen allen. Sie erfahren mehr, wenn wir mehr zu sagen haben.“
„Haben sie denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein Täterprofil erstellt?“, fragte der ARD- Mann. „Ist vielleicht ein Verrückter unterwegs?“
Die beiden auf dem Podium standen wortlos auf und verschwanden durch eine Tür, verfolgt vom Blitzlichtgewitter und den lauten Fragen der Reporter. Der ARD-Mann warf sich vor der Kamera in Pose und begann mit einer Zusammenfassung.
Die Sekretärin schaltete den Ton wieder aus. Es wurde still, als hätte sie die Tür zu einer anderen Welt geschlossen. Sie schüttelte den Kopf und wandte sich wieder ihren Unterlagen zu. Sven wurde immer unruhiger, sah ununterbrochen auf seine Uhr und schielt immer wieder in Richtung des Büros mit der halb geöffneten Tür.
An der Schmalseite des Konferenztisches saß ein Mann, offenbar der Anwalt. Ihm gegenüber saßen eine großgewachsenen, hagere Frau mit grauem Haar und ein kleiner schmächtiger Mann. Zwischen ihnen auf dem Tisch lagen Dokumente und ein aufgeschlagener Aktenordner. Alle drei schienen hocherfreut über etwas zu sein und redeten lebhaft miteinander.
Sven musterte den Anwalt. Er war etwa Mitte vierzig, mit einem freundlichen Gesicht, humorvollen Gesicht, war schlank und hatte blondes kurzes Haar. Er trug einen dunkelgrauen Anzug, das Jackett über einem weißen Hemd und einem leicht gelockerten Schlips geöffnet. Er sah recht gut aus und hatte nichts von der Autorität und Hochmütigkeit an sich, die Sven schon bei Anwälten kennengelernt hatte. Gerade jetzt saß dieser in jeder Hinsicht vergnügt und zufrieden zurückgelehnt, in seinem Stuhl, als könne ihn nichts auf der Welt bekümmern. Aber er vermittelte auch den Eindruck von Bescheidenheit. Ein Mann zu dem er Vertrauen haben könnte, dachte Sven. Hoffentlich war die Anwältin auch so. Sven wurde nervös. Er würde viel lieber mit dem Mann zu tun haben. Aber immerhin waren beide Anwälte im mittleren Alter und damit schon eine Weile im Geschäft. Sie würden wissen was zu tun war, wenn es darauf ankam.
Er betrachtete die Frau am Tisch. Sie trug eine Art Poncho mit schwarz- weißem Muster und wirkte trotz ihrer beeindruckenden Erscheinung zurückhaltend, während der Schmächtige auf dem Stuhl neben ihr fast vor Selbstvertrauen platzte und mit seiner selbstsicheren Art den ganzen Raum zu füllen schien. Er konnte kaum still sitzen.
Der Anwalt griff nach dem Ordner und begann darin zu blättern.
„Ich denke, damit ist die Angelegenheit zu Ihrer Zufriedenheit beendet“, sagte er. „Wann kommt denn nun das neue Auto?“
„Nächste Woche“, entgegnete der Kleine stolz.
„Es ist schön, dass wir die Sache so schnell regeln konnten“, sagte die Frau. „Unglaublich, dass es funktioniert hat!“
„Klar hat das geklappt, war doch vorauszusehen, bei unserem Anwalt“, antwortete der Kleine generös. Der kriegt kein Bein mehr auf dem Boden, dieser verfluchte Trunkenbold!“
„Er heißt Trubold“, sagte die Frau.
„Das spielt doch keine Rolle. Ob er nun Trubold heißt oder John Lennon. Oder Gandhi. Es ist einfach phänomenal, dass wir alles komplett ersetzt bekommen haben!“
„Was hätte er tun sollen? Er hatte ja keine Wahl“, sagte der Anwalt bescheiden.
Sven fragte sich, wer Gandhi war. Aus den Augenwinkeln bemerkte er eine Bewegung und wandte hastig den Kopf. In der anderen Tür stand eine kleine, schlanke Frau in einem grauen Kostüm. Sie hatte warme, braune Augen, dunkelhaarig und älter als die Mollige. Sie sah ihn auffordernd an und lächelte ihm etwas erschöpft zu. Sven warf der Sekretärin einen fragenden Blick zu, diese nickte, er stand auf und ging an der Anwältin vorbei, die die Tür hinter ihm schloss.
Zehn Minuten später verließ er die Kanzlei, nahm zusammen mit zwei Männer in Anzügen, die ihn nicht weiter beachteten, den Aufzug nach unten, durchquerte die belebte Lobby und trat auf die Straße hinaus. Jetzt fühlte er sich weitaus wohler, als bei seiner Ankunft. Der Verkehr lärmte, die Luft war kühl, es hatte zu nieseln begonnen und Passanten strömten gehetzt, mit gesenkten Köpfen, in beiden Richtungen über die Bürgersteige. Sven blickte sich unsicher um. Wohin jetzt? Dann entschied er sich und ging mit raschen Schritten die Straße hinunter. Er würde seine Freundin anrufen und sich mit ihr verabreden. Sie würde sauer auf ihn sein, weil er so lange nichts von sich hören lassen hatte. Aber es würde ihm schon gelingen sich mit ihr zu versöhnen. Plötzlich verspürte er Sehnsucht nach ihr und beschleunigte seine Schritte.
Nach zwanzig Meter schloss ein Auto zu ihm auf. In dem lebhaften Verkehr überhörte er zunächst das Motorengeräusch, und als er das Auto endlich bemerkte, war es schon neben ihm. Er zuckte zusammen und machte einen schnellen Schritt zurück in Richtung Hauswand. Das Auto hielt am Bürgersteig, und das Seitenfenster wurde herabgelassen. Jemand sprach zu ihm. Sven blickte sich nach beiden Seiten um, suchte einen Fluchtweg. Nachdem er ein paar Augenblicke gezögert hatte, stieg er widerwillig hinten ein. Das Auto spurt auf die Straße ein und mischte sich mit dem fließenden Verkehr. Niemand hatte die kurze Szene bemerkt, die Fußgänger eilten weiter als wäre nichts geschehen und doch war es das letzte Mal, dass irgendein Mensch die Gelegenheit gehabt hätte, Sven lebendig zu sehen.
4
Fünf Uhr morgens. Eine junge Frau, eine Krankenschwester, die in der Gustav-Meyer-Allee am Volkspark Humboldthain wohnte, stolperte atemlos den Weg in den Park hinein, eine Leine in der Hand, gezogen von einer eifrigen französischen Bulldogge.
„Paulette!“, rief sie.
Die kleine dicke Hündin hielt inne und warf ihrem Frauchen einen ungeduldigen und zugleich nachsichtigen Blick zu, ehe sie auf ihren kurzen Beinen weitersauste.
Die junge Frau, die sich nur eine Jeans und einen weiten Pullover ihres Mannes über den Pyjama gezogen und ihre Füße in ein paar Gummistiefeln gesteckt hatte, hatte nicht die Geduld noch viel weiter in den Park hinein zu gehen. Schließlich war heute ihr freier Tag und sie wollte noch einmal ins Bett. Gemeinsam mit dem Hund folgte sie an den Büschen entlang dem Fußweg, vorbei an den noch im Halbdunkel liegenden großen Rasenflächen. Es gab noch mehr Hundebesitzer in der Gegend, aber heute konnte sie keinen von ihnen entdecken, und ihr war ein wenig unbehaglich zu Mute. Der Park war im trüben Licht der Morgendämmerung ebenso leer wie die Straße. Die Wolken hingen tief und regenschwer über den Bäumen, deren beginnendes Grün zu dieser Zeit nur zu erahnen war.
Wenn der Mörder hier auf sie lauerte war sie chancenlos. Die Zeitungen waren in den letzten Wochen voll von den sogenannten Nazi-Morden. Aber sie war weder ausgesprochen linksgerichtet, noch ging sie mit ihrer politischen Gesinnung hausieren. Und prominent war sie schon gar nicht. Die Ermordeten waren alles in der Öffentlichkeit auftretende Personen gewesen.
Er würde sich gar nicht für sie interessieren.
Sie ging bis zum Wasser des kleinen Teiches hinunter, bevor sie abbog und am Ufer entlangging. Durch die hohen Büsche mit grün sprießenden, jungen Blättern zum Wasser zu kommen, war herrlich. Sie sog die frische Luft ein, und erwog kurz, die Stiefel auszuziehen und mit nackten Füßen durch das Gras zu laufen. Fand aber, dass es dafür doch noch zu kalt wäre.
Sie bückte sich und ließ Paulette von der Leine. Die Hündin schoss übermütig los, ohne auch nur zu ahnen, dass ihre Stammmütter vor einigen tausend Jahren Wölfe gewesen waren, während sie selbst nur dreißig Zentimeter über den Boden ragte. Ihr Frauchen folgte ihr auf dem Fußweg, stolperte über Wurzeln, die den Asphalt unter ihren Füßen angehoben, und blieb stehen, um den Blick über die Wasserfläche und den Rosengarten bis hin zum großen Bunkerberg zu genießen. Sie ließ ihren Blick schweifen. Auf der anderen Seite des Parks ragte die Silhouette des historischen Flakturmes auf. Das Morgenlicht schimmerte wie matte Seide und die dunklen Wolken hatten sich verzogen, um den Anfängen eines blauen Himmels Platz zu machen. Sie liebte diesen Park. Der Aufstieg zum historischen Flakturm war zwar etwas mühsam, aber die Mühe ist es wert. Oben angekommen belohnt die Aussicht auf Berlin.
Der Hund war vorgerannt, hatte jede Parkbank, jeden Baum und jeden Abfalleimer inspiziert, hatte ein paar verschlafene Enten aufgescheucht und sprang jetzt zwischen den Steinen am Wasser umher. Sie gingen weiter. Am Ende des Teiches neigte sich eine große Trauerweide mit rauem Stamm ins Wasser. Ihre Äste berührten fast die Oberfläche. Die junge Frau erinnerte sich an ein Picknick, das sie vor einigen Jahren mit ihrem Mann dort unter dem Baum veranstaltet hatte. Nun wühlte dort Paulette bei etwas Schwarzem am Boden. Es konnte ein alter Mantel sein der dort lag, oder ein vergessenes Paket, dachte die Krankenschwester hoffnungsvoll. Aber natürlich war es wohl wieder einmal ein Müllsack, den jemand aus einem der Behälter gezerrt hatte, die entlang des Weges aufgestellt waren. Um diese Tageszeit war der Park voll von allem möglichen Dreck. Die Leute saßen bis in die Nacht hinein auf dem Rasen, tranken Bier und Wodka, redeten, lachten und lärmten, verteilten benutzte Pappteller, Flaschen und Kippen um sich herum, ehe sie mit geröteten Augen und wackeligen Beinen nach Hause wankten. Aber je schrecklicher man sich morgens fühlte, umso schöner musste es gewesen sein.
So war es tatsächlich dachte sie und erinnerte sich an vergangenen schöner Frühlings, und Sommermorgen, an denen sie fröstelnd und vom Wein benebelt, umgeben von ebenso benebelten Freunden, auf dem Bunkerberg gestanden und zugesehen hatte, wie die Sonne langsam über Berlin aufging.
Die Hündin unten am Wasser schien verwirrt zu sein. Sie witterte, wich ein Stück zurück und pirschte sich wieder an die Mülltüte heran. Jeden Augenblick würde sie anfangen, sie aufzureißen, und alte stinkende, eklige Essensreste herausscharren. Die Krankenschwester beschleunigte den Schritt und sah schon vor sich, wie sie ihren Hund unter die Dusche verfrachten musste. Paulette verabscheute duschen und es würde für alle Beteiligten keine Freude sein. Und es konnten schließlich auch andere, gefährliche Dinge in der Tüte sein. Fixerbestecke. Glasscherben.
Als sie näher kam, erkannte sie zu ihrer Erleichterung, dass es ein Mann war, der am Boden lag und schlief. Er lag so dicht am Wasser, dass über der Böschung nur Kopf und Schulter zu sehen waren. Offenbar ein Obdachloser. Entweder schlief er fest, oder er hatte Angst vor Hunden, dachte sie ungeduldig. Sie musste Paulette zurückrufen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Dann kam sie darauf und erschrak. Obdachlose liegen nicht ohne Unterlage auf dem Boden. Und sie haben ihre Habseligkeiten bei sich. Plastiktüten oder einen Einkaufswagen.
Sie blieb vor dem Mann stehen. Er wirkte leicht aufgedunsen, sein blondes Haar war stopplig kurz, fast noch eine Glatze. Er trug eine grüne Bomberjacke und hatte Springerstiefel an den Füßen. Ein Neonazi dachte die Krankenschwester automatisch, ärgerte sich aber zugleich über ihr Vorurteil. Sie hatte den Eindruck, dass er noch jung war. Er lag halb auf der Seite, und seine Arme und Beine waren eigentümlich verdreht, als wäre er aus einem Auto geschleudert worden und zur Wasserkante hinunter gerollt. Sein Gesicht war schwer misshandelt worden, die Gesichtszüge kaum mehr erkennbar. Die dunkle Jacke war blutdurchtränkt.
Sie sank neben ihm in die Hocke und fühlte nach seinem Puls. Nichts. Sein Körper war kalt. Er hatte schon eine Weile hier gelegen.
Paulette sah sie winselnd an.
Die Krankenschwester hatte schon viele Tote gesehen. Friedlich im Bett gestorbene, aber auch wie hier, durch Mord oder Schlägerei zu Tode gekommene. Kinder, Frauen, Männer.
Scheiße dachte sie. Scheiße. Dass das nie aufhört. Dass die Menschen sich nicht in Ruhe leben lassen können.
Sie griff nach ihrem Handy und wählte die 110. Es dauerte einen Moment, bis sie durchkam. Sie nannte das Wichtige und beschrieb, wo sie sich befand. Dann wählte sie die Nummer ihres Mannes und überzeugte ihn zu Hause zu bleiben und seinen gewohnten Tagesablauf zu beginnen. Hier könne er doch nicht helfen.
Dann wartete sie bei dem Toten, bis Polizei und Krankenwagen eintrafen. Sie kniete neben ihm und hatte gerade begonnen, ihn auf die unmittelbare Todesursache hin zu untersuchen, als ihr einfiel, dass sie das gar nicht tun musste. Das war nicht ihre Aufgabe. Sie hatte nichts, womit sie ihn hätte zudecken können. An ihren Knien, war die Feuchtigkeit des Bodens durch ihre Jeans und Pyjamahosen gedrungen. Sie stand auf, nahm Paulette an die Leine und zog sich ein paar Meter zurück. Sie blickte über das still daliegende Wasser, sah das alte vorjährige Schilf, den, mit einem Geländer eingefassten kurzen Steg, die vermoderten Holzbalken ein paar Zentimeter über dem Wasser. Ein Balken hatte über den Winter nachgegeben und ragte unter das Wasser. Eine Ente paddelte vorbei. Es war ein schöner Ort. Sie fragte sich, was dem Toten wohl widerfahren war.
Nach wenigen Minuten kamen drei Streifenwagen mit Blaulicht und lauten Sirenen den Hauptweg heruntergefahren und blieben ein Stück entfernt stehen. Um eventuelle Reifenspuren nicht zu zerstören, dachte sie. Die Türen öffneten sich und die Polizeibeamten stiegen aus. Zu ihrem Erstaunen waren es nicht nur Polizisten in Uniform, sondern auch ein Paar in Zivil. Ein Mann im mittleren Alter und eine Frau etwas jüngere Frau. Hinter ihnen ertönte die Sirene einer Feuerwehr.
Der Krankenschwester wurde plötzlich übel. Ihr wurde plötzlich klar, dass hier ein Mord geschehen war und der Mörder erst vor kurzen hier gewesen sein musste, genau hier an diesem Platz. Überall waren jetzt Polizisten. Einige von ihnen sperrten den Tatort ab. Der Mann in Zivil streckte die Hand aus.
„Dreyer, Landeskriminalamt. Das ist meine Kollegin Oberkommissarin Merk. Sie haben die Leiche gefunden?“
Die Krankenschwester nickte. Susan Merk warf ihr einen forschenden und zugleich mitfühlenden Blick zu, ehe sie den Toten musterte.
„Meinen Sie, dass Sie sich kurz mit uns unterhalten können?“
„Ja, natürlich“, sagte die Krankenschwester.
„Dann beginnen wir mal am Anfang.
5
Zwei Stunden später stand die Sonne bereits hoch über den Dächern Berlins.
Verschlafen wirkende Berufstätige blinzelten gähnend ins Licht, während die S-Bahn über die Brücken ratterte. An der Spree, am Helgoländer Ufer schrien die Möwen, Lieferwagen fuhren vor den Geschäften vor und aus einer Bäckerei duftete es verführerisch nach frischem Brot.
In der Wohnung des Rechtsanwaltpaares Dirk und Katharina Fiedler ging die zwölfjährige Tochter Lara aus ihrem Zimmer in die Küche. Sie hatte noch ihren Schlafanzug an, trug nichts an den Füßen und ihre halblangen, braunen Haare fielen lose über ihre Schultern. Mit einem Buch in der Hand querte sie die Diele, ging an dem großen Wohnzimmer mit seinen hohen Fenstern, Bücherregalen und Ledersesseln und an der Tür die ins Schlafzimmer ihrer Eltern führte, vorbei. In der Küche holte sie sich Milch aus dem Kühlschrank, schaltete den kleinen Fernseher auf der Anrichte an und setzte sich an den Tisch. Die Milch war ein bisschen zu kalt. Sie hätte lieber einen heißen Tee oder Kakao getrunken, aber sie war noch zu faul und schläfrig um sich etwas Warmes zu machen.
Es dauerte noch über eine Stunde bis die Schule anfing. Lara war müde und fröstelte, aber es gefiel ihr, wach zu sein, während ihre Eltern noch schliefen. Es war ein aufregendes und geborgenes Gefühl zugleich. Außerdem war das Buch interessant. Es war ein Sachbuch über das Leben und Aussterben der Dinosaurier. Sie hatte bis nach Mitternacht im Bett darin gelesen und das Licht erst ausgemacht, als ihr das Buch immer wieder aus der Hand fiel. Anschließend floss das Gelesene auf mystische Weise mit ihren Träumen zusammen.
Im Fernsehen hatten gerade die Frühnachrichten begonnen. Kurz hörte sie dem Nachrichtensprecher zu, der von dem gestrigen Mord an der Sozialarbeiterin berichtete. Dann versank sie wieder in ihrem Buch. Warum kann man nicht in der Zeit reisen? , dachte sie.
Sie hatte keine Schwierigkeiten sich die Welt vor fünfundsiebzig Millionen Jahren vorzustellen. Sie sah vor ihrem inneren Auge, die Sonne die über rauchende Berggipfel und Farnwälder schien, sie sah die riesigen Leiber der Brachiosaurier über die Steppe ziehen, hörte die Laute der Tiere und die Schreie der Pterodaktylen. Wenn sie das so intensiv erlebte, warum konnte sie sich dann nicht dorthin bewegen? Das musste doch gehen.
Sie blätterte um und sah einem riesigen, behäbigen, grau-grünen Brontosaurus direkt in die Augen, der mit erhobenem Kopf aus der Buchseite blickte. Er hatte einen plumpen Körper mit dicken Beinen, ledriger Haut und einem, im Vergleich zum Körper, winzigen Kopf am Ende eines langen Halses.
Lara horchte kurz in Richtung des elterlichen Schlafzimmers, bevor sie die nächste Seite umblätterte.
Es ist heiß. Mittagszeit. Die grelle Sonne hat den Boden am Rande des Dschungels aufgeheizt und blendet in den Augen. Ringsherum Explosionen. Schwaden von Pulverdampf und Rauch ziehen vorüber. Der dunkelhäutige Mann, höchstens achtzehn, zwanzig Jahre alt, fast noch ein Kind, starrt ihn mit ängstlichen Augen an. Er hält das Mädchen vor seinem Körper, den rechten Arm um ihren Hals. In der Hand ein Messer an ihrer Kehle. Die Linke umklammert den Kolben einer Kalaschnikow, die in seiner kleinen Hand unnatürlich groß erscheint. Er versucht, das Mädchen in den Dschungel zu zerren. Sie trägt ein weißes Baumwollkleid. Beide sind barfuß. Alle beide, das Mädchen und der Mann, schreien ihn an. Sie in Todesangst, der junge Mann aus Furcht, Verzweiflung, Verwirrung. Aus naher Ferne sind Schreie und Schüsse zu hören. Wieder drängt der Rauch brennender, aus Zweigen und Plastikplanen mit der Aufschrift UNHCR, errichteter Hütten, heran und beißt in Augen und Nase. Unbarmherzig brennt die Sonne herunter. Er schwitzt. Seine Jeans und sein T-Shirt sind staubig und kleben am Körper. Der Geruch von verbranntem Gras, Rauch und Pulverdampf ist unerträglich. Er schreit zurück, schreit den Mann an, geht auf ihn zu, versucht ihn zu überzeugen. Lass sie los, lass das Messer und diese verdammte MP los. Lass alles los! Schließlich nimmt er seine Pistole und richtet sie auf den Mann, will ihn zwingen das Mädchen loszulassen.
Der Traum endet abrupt, wie immer an dieser Stelle. Atemlos und mit klopfenden Herzen fiel er aus ihm heraus, presste die Arme an seinen Körper und war verwirrt, als er merkte, dass sie nicht gefesselt waren. Er starrte an die Zimmerdecke. Mehrere Sekunden verstrichen, bis ihm bewusst wurde, wo er sich befand.
Dirk rollte sich auf die Seite, die Arme über das Gesicht gelegt und atmete tief und langsam aus. Inzwischen war es lange her, aber manchmal kam es zurück, genauso wirklich, als wäre er erst am Vorabend aus Afrika zurückgekehrt und hätte es noch nicht geschafft, seine Taschen auszupacken.
Ich muss es einfach kommen lassen, dachte er. Es dorthin lassen, wohin es will, damit es sich danach wieder zurückziehen kann. Es zieht sich jedes Mal wieder zurück. Und es kommt immer seltener. Was geschehen ist, ist weit weg. In einer anderen Zeit, in einer anderen Welt, an einem anderen Ort. Das war damals, jetzt ist jetzt. Es tut noch immer weh. Na und? Wer bist du denn, dass gerade du dir die Hände nicht schmutzig machen darfst? Komm darüber weg!
Er betrachtet den Raum. Das war ihre gemeinsame Welt. Ein großes, gemütliches Schlafzimmer mit einem großen Bett. Auch hier Bücherregale, ein Fernseher auf einem Sideboard. Die Morgensonne drang durch Jalousien. Ruhe und Frieden.
Es war ein langer, beschwerlicher Weg gewesen, seit seiner Kindheit in der kleinen Wohnung seiner Eltern in der Eifel, aber jetzt war er hier. Das hier war sein Zuhause und daran würde sich nichts ändern.
Er warf einen Blick auf die Uhr neben dem Bett. Kurz nach halb sieben. Wieder war er früh wach geworden.
Katharina lag neben ihm. Dirk fühlte die Wärme ihres Körpers unter der Decke. Sie lebte hier und jetzt, heil und unversehrt, ihre Augen waren nicht dunkel vor Angst, ihr waren weder die Beine weggesprengt, noch der Kopf mit einer Machete abgeschlagen worden. Vorsichtig nahm er ihre Hand und küsste sie. Der Albtraum verblasste endgültig und verschwand.
Katharina bewegte sich, und er rutschte näher, legte seinen Arm um sie. Sie war weich und warm, duftete gut und vertraut.
„Guten Morgen, Liebste“, flüsterte er.
Sie drehte ihm verschlafen das Gesicht zu und schlug die Augen auf.
„Hallo Dirk“, sagte sie heiser.
In ihren dunklen Haaren zeigten sich vereinzelte silberne Strähnen, ihre Augen waren dunkelbraun. Jetzt waren sie vom Schlaf eine Spur verschwollen, aber in ihnen lagen Wärme und ein leises Lachen. Kleine Krähenfüße zogen sich bis an die Schläfen. Sogar nach sechzehn Jahren und obwohl sie zerzaust und verschlafen aussah, durchfuhr ihn ihr Anblick immer noch wie ein Blitz.
„Ausgeschlafen?“, fragte er.
„Ich weiß nicht“, murmelte sie. „Ich bin so müde. Ich fühle mich als wäre ich aus Blei. Kann mich kaum rühren. “
„Das brauchst du auch nicht. Willst du weiterschlafen?“
„Nein…doch…nein“, sagte sie zögerlich.
Plötzlich brach sie in Tränen aus. Er stützte sich erschrocken auf seine Ellenbogen.
„Was ist? Ist etwas nicht in Ordnung?“
„Nichts! Es ist nichts, Liebling“, schluchzte sie. „Ich bin nur so verdammt müde.“
Dirk blickte sie prüfend an. Sie lachte zwischen den Tränen auf und vergrub ihr Gesicht in seiner Hand, als suche sie Schutz.
„Schau mich nicht so an! Es ist nichts. Ich schwöre!“
„Es ist aber offensichtlich, dass etwas ist. Was ist passiert? Sprich mit mir!“
„Es ist nichts passiert. Du hast nichts getan. Ich bin nur so erledigt.
Er setzte sich auf, zog sie wieder an sich und wickelte die Decke um sie. Sie schniefte, kramte ein Papiertaschentuch aus dem Nachttisch und schnäuzte sich. Obwohl er sich Sorgen um sie machte, lag zugleich etwas Schönes in der Alltäglichkeit und Zerrissenheit des Ganzen, wie sie neben ihn trompetete. Er legte seinen Kopf an ihren.
„Sag es mir. Warum weinst du?“
„Ich weiß nicht. Es war einfach alles zu viel. Vielleicht ist es dieses blöde Paar, die Lohmeiers. Diese Scheidung, wie sie sich um jeden Cent streiten und um das Kind. Das nimmt mich mit.“
„Vergiss sie einfach. Wenn du damit anfängst dich emotional zu engagieren, wird daraus nur eine Quälerei.“
„Aber ich will etwas tun! Ich arbeite doch gern“, erwiderte sie aufgewühlt. „Es ist so dumm, Dirk. Es wächst mir alles über den Kopf. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich kann mich nicht mehr erinnern was ich gestern getan habe! Ich habe vergessen, was ich heute tun soll!“
Er strich ihr die Haare aus der Stirn.
„Du übernimmst dich. Wenn du so weitermachst, bist du bald ausgebrannt. Mach einfach nichts. Erhol dich. Die Lohmeiers übernehme ich.“
„Aber du kannst doch nicht anfangen meine Mandanten zu übernehmen. Wo soll das enden?“
„Ach was. Das ist doch kein Problem.“
„Das ist es schon“, sagte sie düster. „Mein IQ muss im Moment irgendwo bei fünfzig liegen.“
Sie ruhte schlaff in seinen Armen, und er überlegte, was er tun sollte. Er würde sie gern noch eine Weile einfach festhalten, was sogar sehr schön wäre, aber auf Dauer würde ihr das nicht helfen. Er entschied sich, sie zu provozieren.
„Das macht doch nichts, dass du ein bisschen dämlich bist, wo du doch so wahnsinnig sexy bist“ sagte er mit einem beschützenden Lächeln und küsste ihren Nacken.
Plötzlich kam Leben in ihre Augen. Sie drehte sich schnell wie der Blitz um und knuffte ihn fest. Er hob die Hände und lachte. Das machte sie noch ärgerlicher und sie schlug ihn wieder. Er versuchte sich zu wehren, aber sie rang ihn nieder, halb spielerisch, halb ernst, und er ließ es sich gefallen, legte seine Arme um sie und sie schmiegte sich zufrieden und froh hinein.
Er hatte nicht die mindeste Lust, sie loszulassen und wollte kuscheln, aber sie hatten keine Zeit mehr.
„Hungrig?“, fragte er.
„Wie ein Wolf, ab in die Küche“, antwortete sie.
Sie zog sich die Bettdecke bis unters Kinn und sah ihn erwartungsvoll wie ein kleines Mädchen an. Widerwillig klettert er aus dem Bett, schlüpfte in seine Pyjamahose, wuschelte ihr durchs Haar, machte einen Abstecher ins Bad um zu pinkeln und sich zu waschen, und ging weiter in die Küche.