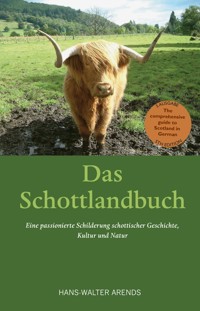
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luath Press
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
· Das Schottlandbuch - kein herkömmlicher Reiseführer, sondern Literatur, die einen tiefgehenden Einblick in die schottischen Regionen, Kultur und Geschichte gibt · Geschrieben von einem deutschen Reiseleiter, der seit über 20 Jahren in Schottland lebt · Gibt Antworten auf viele Fragen, die bei deutschsprachigen Touristen dieses Landes immer wieder aufkommen · Das ideale Buch zum Vor- und Nachbereiten einer Schottlandreise · Mit Karten und 32 Fotos versehen Fünfte, stark erweiterte Neuauflage! Wer kennt sie nicht, die vielen Vorurteile gegenüber Schottland und seinen Bewohnern - Schotten seien geizig, das Essen schmecke nicht, es regne immer und die Landschaft sei sehr grau. Dieses Buch, das ganz bewusst kein herkömmlicher Reiseführer sein will, räumt mit vielen dieser Ressentiments auf. In liebevoll ausgearbeiteten Texten gibt Hans-Walter Arends einen Überblick über schottische Mythen, Fakten und Klischees und einen tiefgehenden Einblick in die verschiedenen Regionen Schottlands und die turbulente Geschichte dieses faszinierenden Landes - von seinen prähistorischen Ursprüngen über die Stewarts und Jakobitenaufstände bis hin zu spannenden politischen Entwicklungen im Schottland unserer Tage wie dem 2014 Referendum. Dabei wird schnell klar, dass die Schotten eine ganz eigene, sehr interessante Kultur haben - deren Hauptmerkmal es ist, anders zu sein als der Rest der Welt und besonders die englischen Nachbarn. Dieses Buch ist ein Muss für Schottland-Interessierte und eignet sich besonders gut zur Vor- und Nachbereitung von Reisen in dieses wunderschöne Land!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS-WALTER ARENDSist ein anerkannter Reiseleiter und Mitglied der Scottish Tourist Guides Association. Schottland lernte er schon 1966 kennen und seit 1992 lebt er in Edinburgh. Als Reiseleiter stellte er dann sehr bald fest, dass es leider immer noch nicht genug Hintergrundinformationen für deutschsprachige Besucher gibt. Somit hat sichDas Schottlandbuch, das ursprünglich schon in zwei Ausgaben alsDie kleine Schottlandfibelerschien, in einer nochmals erweiterten fünften Auflage fast zwangsläufig ergeben.
Der Autor ist entschlossen und sieht es als eine seiner Hauptaufgaben an, Schottland durch sein Wissen und seine Informationen bekannter zu machen und besonders den deutschsprachigen Tourismus zu fördern.
Seine Homepage findet der Leser unter:
http://www.schottland.co.uk.
Das Schottlandbuch
oder eine passionierte Schilderung schottischer Geschichte, Kultur und Natur
Hans-Walter Arends
LuathPress Limited
EDINBURGH
www.luath.co.uk
Erste Ausgabe 2001, Nachdruck 2005
Zweite, erweiterte Ausgabe 2006
Dritte, erweiterte Ausgabe 2010, Nachdruck 2011
Vierte, erweiterte Ausgabe 2012, Nachdruck 2013 und 2014
Fünfte, erweiterte Ausgabe 2015
© Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werks darf ohne Einwilligung des Urhebers in irgendeiner Form, sei es durch Fotokopien, Mikrofilm oder andere Verfahren, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verarbeitet werden.
ISBN: 978-1-910021-87-3
ISBN (EBK): 978-1-910324-53-0
Karten
Jim Lewis
Illustrationen
Anthony Fury
Umschlagfotos und Fotos im Innenteil
© Hans-Walter Arends
für Sandra
Inhaltsverzeichnis
Landkarten
Vorbemerkungen
Schottland – Land unter dem Regenbogen
TEIL 1:
Mythen, Klischees und die harte Welt der Fakten
Geografie
Klima
Fauna und Flora
Kultur
Sprache
Rechtssystem
Bildungswesen
Religion
Traditionen: Dudelsack & Co.
TEIL 2:
Geschichte
Prähistorisches Schottland
Die Römer in Britannien
Dark Ages – Jahrhunderte der Finsternis?
Die Pikten
Kingdom of Scotia
Wars of Independence: Die Unabhängigkeitskriege
Die Stewarts
Exkurs: Mary Queen of Scots
Union of the Crowns: Bürgerkrieg und
Killing Times
Exkurs: Das Clanwesen und seine Geschichte
Die Jakobiteraufstände
Die schottische Aufklärung
19. Jahrhundert: Wandel zur
Industriegesellschaft
20. Jahrhundert Dezentralisierung
und Neubeginn
TEIL 3:
Die Regionen
Einige geografische Superlative
Tiefland – Southern Uplands
Dumfries und Galloway
Ayrshire und die Inseln im Clyde
Bordersregion
Exkurs: Textilgeschichte der Borders
Central Lowlands
Die Lothians
Edinburgh
Old Town
New Town
Leith – der Hafen von Edinburgh
Stirlingshire, die Trossachs und Loch Lomond
Glasgow
Exkurs: Charles Rennie Mackintosh – Architektur im schottischen Jugendstil
Die Ostküste und das Herz Schottlands
Angus und Dundee
Perthshire
Hochland
Grampians und Aberdeenshire
Aberdeen
Der Royal Dee
Exkurs: Dem Whisky auf der Spur
Speyside
Das große Tal – the Great Glen
Die Nordostküste
Inverness
Der Norden–Caithness und Sutherland
Die Westküste
Schottlands Inselreichtum Westliche Inseln
West Highland Route und Innere Hebriden
Skye
Argyll und südliche Innere Hebriden
Äußere Hebriden – Inseln im Atlantik
Nördliche Inseln
Orkney
Shetland
TEIL 4:
Anhang
Die schottische Geschichte auf einen Blick
Literaturhinweise für Lesehungrige
Schottland von A – Z
Antiquitäten
Apotheken
Ärzte und Behandlungen
Baden
Banken
Behinderte
Botschaften und Konsulate
Fähren
Feiertage
Festivals
Führungen
Geschäftszeiten
Getränke
Highland Games
Kleidung und Ausrüstung
Maße und Gewichte
Mücken
Natur und Denkmalschutz
Notfälle
Edinburgh
Glasgow
Inverness
Öffentliche Verkehrsmittel
Post
Presse
Sehenswürdigkeiten
Schottische Küche
Souvenirs und Shopping
Strom
Telefonieren
Touristeninformation
Trinkgeld
Unterkunft
Unterhaltung
Verkehr
Währung
Websites – Internetseiten
Wetter
Wolle
Zeit
Vorbemerkungen
BEKANNTLICH UNTERLIEGTunser blauer Planet einer langsamen aber konstanten Veränderung und oft wird Gewesenes wieder zu Tage gebracht. Auch in Schottland, als nur kleiner Teil dieses Erdballs, ist das nicht anders. Seit Erscheinen der ersten beiden Ausgaben derkleinen Schottlandfibel, die offensichtlich und erfreulicherweise eine Marktlücke füllten, hat Schottland tiefgreifende Änderungen erfahren. Nach fast 300 Jahren bekam das Land wieder ein Parlament und – sei es auch nur zu einem Großteil – seine Unabhängigkeit. All das wurde zwar der Welt in Teilen bekannt gemacht, oft ist viel davon aber in der Schnelllebigkeit unserer Zeit schon wieder vergessen worden oder gar nicht richtig einzuordnen gewesen.
In der gar nicht so fernen Vergangenheit war dieses Land am Rand Europas für viele Besucher fast so exotisch wie eine der sehr viel weiter entfernt liegenden Ecken dieser Welt. Zum Glück hat sich das etwas geändert. Über Schottland wurde in den letzten Jahren sehr viel geschrieben und das Land ist in einer ganzen Reihe von Dokumentar und Unterhaltungsprogrammen im Fernsehen und in anderen Medien vorgestellt worden.
Mit diesen Veröffentlichungen ist das Interesse an allem, was britisch und insbesondere schottisch ist, auch international derart stark gewachsen, dass der Duden inzwischenanglophilals ein neues Wort aufnahm. Mit einiger Sicherheit ist dieser wachsende Besucherstrom aber auch einem veränderten Währungswechselkurs zu verdanken. Somit wundert es nicht, wenn der Tourismus inzwischen mit über £4 Mrd. die vierte Stelle in der schottischen Wirtschaft einnimmt.
Viele deutschsprachige Besucher werden vielleicht den ersten persönlichen Kontakt mit Schottland im Rahmen einer Gruppenreise suchen. Überraschend viele Besucher kommen aber wieder und erkunden das Gesehene und das noch Unbekannte dann mehr im Detail. Andere wiederum werden durch die enthusiastischen Berichte der Zurückkehrenden zu einem Besuch dieses Landes am nordwestlichen Rand Europas inspiriert.
Trotzdem sind mit dem Begriff Schottland leider immer noch eine ganze Reihe von Klischees verbunden und von weitverbreiteten Landeskenntnisse kann auch noch keine Rede sein. Als Reiseleiter führe und begleite ich seit 1995 Besucher dieses Landes. Sehr bald fiel mir das große Interesse an Schottland und alles, was damit zusammenhängt, auf. Viele Fragen wurden und werden immer wieder gestellt, die Antworten möglicherweise bald aber oder bis zum nächsten Mal vergessen. Aus diesem Grund habe ich mit dem vorliegenden Buch versucht, einige dieser Antworten aufzuzeichnen oder wieder in Erinnerung zu rufen. Zuvorderst ist es aber für die Interessierten gedacht, die zum ersten Mal schottischen Boden betreten.
Die aufgeführten Fakten sind aus vielen Quellen zusammengetragen und so weit wie möglich recherchiert worden. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Historische Quellen sind manchmal recht widersprüchlich und aus den meines Erachtens wichtigsten Ereignissen musste eine Auswahl getroffen werden, da sonst die schiere Faktenfülle den Rahmen des Buchs gesprengt hätte. Für hinter Personennamen angeführte Daten gilt durchweg: Bei Königen handelt es sich grundsätzlich um Herrscherjahre, bei allen übrigen Personen bezeichnen diese das Geburts und Todesjahr. Was den Namen der Stewart-Dynastie angeht, habe ich mich für die ursprüngliche, ältere Schreibweise entschieden, obwohl die französische Form (Stuart) für die Zeit nach Mary Queen of Scots ebenso gebräuchlich ist.
Für den einen oder anderen Leser sind einzelne Themen sicherlich nicht ausführlich genug behandelt. Es seien daher die Literaturhinweise am Ende des Buchs erwähnt.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Sarah Fißmer, die mir mit ihrem Wissen und unendlicher Geduld zur Seite stand und das Buch redigierte. Gleiches und mehr gilt aber meinem Verleger Gavin MacDougall, der auch diesmal mit seinen professionellen Ratschlägen einen wesentlichen Teil zur Gestaltung beigetragen hat. In besonderem Maße hat das zurückliegende Referendum ihn darin bestärkt, noch einmal eine Edition heraus zu bringen und somit ist dies die fünfte Ausgabe des Buches.
War es zunächst eine nicht zu unterschätzende Pioniertat Gavins dieses Buch in Schottland in deutscher Sprache herauszugeben, so sind die darauf folgenden Ausgaben innerhalb der vergangenen 14 Jahre dank ihm zu einem beachtenswerten Erfolg gebracht geworden.
Bleibt hier abschließend nur dieses Zitat eines leider Unbekannten:
Schottland – dieses herrliche Muss –
verborgen liegt es in den Tiefen wohl vieler Herzen.
Bleibt die Frage, wann Du es Dir erfüllst.
(Unbekannt)
Fàilte! Willkommen!
Hans Walter Arends
Edinburgh, im März 2015
Schottland –Land unter dem Regenbogen
IM NORDWESTZIPFEL EUROPAS GELEGEN, ist Schottland für viele Reisende ein einzigartiges Ziel. Der Einzelne ist trotz der vielen Bilder und Beschreibungen, die wahrscheinlich seinem ersten Besuch vorausgingen, immer wieder überrascht und von der Schönheit des Landes beeindruckt.
Der Variantenreichtum der Landschaften Schottlands auf dem vergleichsweise kleinen Raum sucht weltweit seinesgleichen. Die Skala reicht denn auch von sanft bis urwüchsig und ähnlich sind auch das Klima und das Wetter: Selten ist es rau, meistens ist es mild und oft, so unglaublich es auch klingen mag, sogar sehr schön. Bekanntlich gibt es gerade darüber und zu Unrecht im deutschsprachigen Raum immer noch Voreingenommenheit. Fakt ist, dass die fast permanenten Wetterwechsel eine buchstäblich heilsame Atmosphäre und dazu in jeder Jahreszeit die breiteste Palette klarer, harmonierender Farben schaffen. Das kommt besonders am von Sternen übersäten Nachthimmel ausserhalb der Städte zum Ausdruck. Es ist diese Verbindung von offenem Raum, der Natur in den verschiedenen Jahreszeiten, reiner Luft und der Wolken, die dem Betrachter nicht selten dieses traumhafte Gefühl vermittelt, alles schon einmal gesehen und eine Ewigkeit vermisst zu haben.
Schottland ist wirklich nicht groß. Es ist aber in seiner Geografie recht eindeutig gegliedert, so dass jeder Besucher von Großstadt bis Einsamkeit leicht das findet, was er sucht. Viele möchten das alte Schottland mit den zahllosen Burgen, Klöstern, Kirchen und den anderen historischen Gebäuden sehen, die an die ereignisreiche Vergangenheit des Landes erinnern. Doch Schottland ist sehr vielseitig und damit ein Land für fast jeden Geschmack. Zu der sehr speziellen Geologie und hochinteressanten Geografie gesellen sich die turbulente und nicht selten gewalttätige Geschichte seines Volkes, dessen Kultur und eine eng damit verbundene Entwicklung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik. Schottlands Wirtschaft hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine drastische Veränderung erlebt. Das steht einmal in direkter Beziehung zu den Ölfunden, hängt andererseits aber mit der verbesserten allgemeinen wirtschaftlichen Situation in Großbritannien zusammen. Hinzu kommt noch der Strukturwandel von der Schwer zur Elektronikindustrie und trotz seiner bedeutsamen Schwierigkeiten der Finanzsektor und ein Großteil der Serviceindustrie. Auch die weitreichende Unterstützung derEU, die Schottland sehr geholfen hat, spielt eine Rolle.
In der politischen Geschichte dieses Landes hat erst vor wenigen Jahren ein neues Kapitel begonnen. Schottland, das noch immer ein Teil des Vereinigten Königreichs ist, hat nach fast dreihundert Jahren – genauer seit dem 1. Juli 1999 – wieder ein eigenes Parlament.
Nach fast 300 Jahren der politischen Vereinigung hat in der Geschichte dieses Landes erst vor wenigen Jahren ein neues Kapitel begonnen. Seit dem 1. Juli 1999 hat Schottland nach einer Devolution vom Britischem Parlament wieder ein eigenes Parlament.
Trotz dieses ersten Dezentralisierungsschritts war der Drang nach völliger Unabhängigkeit aber immer noch so sehr mit der Landesgeschichte verwurzelt, dass die Scottish National Party (SNP) – als Regierungspartei des 2011 gewählten Parlaments – beschloss, am 18. September 2014, ein Referendum zur Frage der Unabhängigkeit Schottlands abzuhalten. Über seine gesamte Laufzeit, vom Entschluss bis zum Wahltermin, war dieses Referendum ein hitziger und letztendlich folgenreicher Diskussionspunkt zwischen den Regierungen in London und Edinburgh und ganz besonders unter den Parteien des Schottischen Parlaments und der Bevölkerung Schottlands. In diesen Auseinandersetzungen, die ein gewaltiges Spektrum von neuen Fragen beinhalteten, waren dabei zwei der wichtigsten: die wirtschaftliche Machbarkeit und die politischen Folgen innerhalb des Vereinigten Königreichs und derEU.
Die ab 16 Jahren wahlberechtigte schottische Bevölkerung wurde gefragt: ‚Soll Schottland ein unabhängiges Land sein? Ja oder Nein?’ Nach einer extrem leidenschaftlich geführten Wahlkampagne und einer Beteiligung von über 85% wurde diese Frage schließlich von 55% mit einem klaren Nein beantwortet.
Nach den Versprechungen der Unions Parteien, die letztlich das Referendum zu diesem Ergebnis führten, bekommt Schottland tatsächlich wesentlich erweiterte Rechte für das Schottische Parlament und seiner Regierung. Zukünftig bestimmt Schottland die Höhe der Einkommenssteuer und einen Großteil seiner Sozialbereiche selbst. Besonders diese Selbstbestimmung seiner Einkommen und Finanzen und auch mit Hinsicht auf die Energieversorgung könnte diese Eigenständigkeiten das Startzeichen dafür sein, dass Schottland eine wesentlich bedeutsamere Rolle innerhalb des Vereinigten Königreichs und damit auch derEUzugesprochen wird.
Wie immer sich auch die Realitäten in der Zukunft entwickeln werden, ist in jedem Fall das Motto der größten Stadt dieses Landes – Glasgow – auch auf Schottland angebracht:
‚Lass Schottland erblühen‘
TEIL 1:
Mythen, Klischees und die harte Welt der Fakten
VON DEN MYTHEN UND KLISCHEEShalten sich nach wie vor die altbekannten und stereotypen Vorstellungen: Männer in Röcken, Whisky, dazu der eigenartige Klang des Dudelsacks, und das ebenso geheimnisvolle wie liebenswerte Monster Nessie. Das aber wohl bekannteste und doch höchst unzutreffende Klischee ist leider der Geiz, der den Schotten nachgesagt wird. Dann gibt es noch die Frage, was der Schotte wohl unter dem Kilt (Schottenrock) trägt und den Witz, dass viele beim Weltuntergang am liebsten in Schottland sein wollen – weil dort alles erst einhundert Jahre später passiert.
Männer in Kilts gehören tatsächlich zum schottischen Alltagsbild. Die Frage, was der Schotte wohl darunter trägt, wird allerdings so gut wie nie verbal beantwortet, allenfalls demonstriert – in Ausnahmefällen. Auch die Frage nach dem besten Whisky wird sich nicht endgültig klären lassen. Und Nessie? Wer wagt es denn, ihre Existenz zu bestreiten? Kaum jemand! Die Beweise liefern viele Besucher selbst. Während einer Fahrt entlang Loch Ness halten sie mit ihren Blicken auf den See die Existenz des Monsters für vielleicht doch nicht ganz abwegig?
Tatsächlich sind die Menschen in Schottland – wie überall – durch Umwelt und geografische Gegebenheiten, soziale, geschichtliche und religiöse Hintergründe geprägt. Längst kommt heute aber der alte schottische Gegensatz zwischen der zurückschauenden und in einer Traumwelt lebenden, gälischen Hochlandbevölkerung und den sich der harten Realität stellenden und mehr pragmatischen Menschen der Lowlands nicht mehr so zum Ausdruck wie in der Vergangenheit. Wo immer die Schotten auch leben, wie aufgeschlossen oder wortkarg sie auch sein mögen, eines ist ihnen allen gemein: Besuchern begegnen sie mit Warmherzigkeit und Gastfreundschaft. Besonders im Hochland haben die Menschen zu lange unter kargen Verhältnissen leben müssen. Schon allein deswegen zeugt der Gebrauch des Klischees der geizigen und zurückgebliebenen Schotten nicht unbedingt von der Kenntnis dieses Landes und seiner Bewohner. Vielmehr ist zu bedenken, dass die schottische Wirtschaft in Europa nicht ohne Grund einen verhältnismäßig hohen Rang einnimmt. Trotz des Rückgangs der Schwerindustrie ist Schottland noch eines der industrialisiertesten Länder und ist in den letzten Jahren u.a. ein Zentrum der Elektronikindustrie geworden. Die Pioniertaten und Entdeckungen durch schottische Wissenschaftler, Mediziner und Ingenieure waren nicht nur Merkmale des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Auch im Schottland unserer Zeit werden sie – und nicht selten – vollbracht, selbst wenn die Ergebnisse nicht immer so spektakulär sind wie das geklonte Schaf Dolly.
Der aufmerksame Besucher möge bedenken, dass das Nationalgefühl der Schotten tief in ihrer Geschichte verwurzelt ist: Sie sind – egal ob in den Highlands oder den Lowlands – Schotten, gegebenenfalls noch Briten, aber nie Engländer.
Geografie
Während seiner geologischen Geschichte von rund 3,5 Milliarden Jahren war Schottland bis vor ca. 380 Millionen Jahren noch Teil des heutigen Nordamerika. Schon davor begann die Landmasse, als Teil eines Riesenkontinents, zu wandern. Der Weg führte über rund 80 Breitengrade mit den entsprechenden Klimazonen: vom 30. Breitengrad südlich des Äquators, ungefähr des jetzigen Breitengrades von Argentinien, bis in die heutige Position ca. 55° – 61° nördlicher Breite. Im Laufe seiner langen Entstehungsgeschichte hat das Land dadurch eine der komplexesten geologischen Formationen in Europa erhalten.
Sehr vereinfacht ausgedrückt, wurde die tektonische Platte, auf der Schottland sich einst befand, durch den ständigen Ausbruch am atlantischen Rücken durchtrennt. Der gewaltige und andauernde Druck presste das heutige Schottland mit Nordirland auf andere Teile Europas. Die metamorphen und die magmatischen Gesteine im Norden Schottlands gehören der sogenannten kaledonischen Faltungsära des Erdaltertums an. In dieser Zeit wurden die auch heute noch sehr markanten Gebirgszüge geformt. Die Berge bilden eine Fortsetzung des sich diagonal von Nordosten nach Südwesten durch ganz Schottland ziehenden skandinavischen Gebirgssystems.Nach Südwesten setzt sich dieses sogar noch in die Berg und Hügelregionen Nordirlands fort. Darüber hinaus besteht auch zwischen den Bergen in Cumbria im englischen Lake District und Nordwales und dieser Bildungsphase ein Zusammenhang.
Die einst zahlreichen aktiven Vulkane in Schottland sind vor ca. 80 bis 300 Millionen Jahren erloschen und natürlich gibt es hier und jetzt keine Eiszeiten und keine Gletscher mehr.
Vom rund 2.5 Milliarden Jahre altenLewisian Gneiss(Gneis) bis hin zum ‚nur’ 80 Millionen Jahre alten Vulkangestein ist in den drei Hauptgebieten des Landes ein beeindruckendes Spektrum an Gestein zu finden. Viele Geologen der Welt kommen allein deshalb zu Studienzwecken nach Schottland.
An drei Seiten ist das Land von Meer umgeben: im Osten von der Nordsee, im Westen und Norden vom Atlantischen Ozean. Im Südwesten wird es durch den Nordkanal von Nordirland getrennt. Kaum ein Punkt des Landes ist weiter als 65 km ist vom Meer entfernt. Schottland, und das kommt dazu, ist deutlich erkennbar in drei Hauptgebiete unterteilt:
• dassüdliche Hochland (Southern Uplands)mit den beiden RegionenBordersundDumfries und Galloway
• den Graben desCentral Beltoder des zentralen Gürtels Mittelschottlands, in dem die beiden großen Städte Edinburgh und Glasgow liegen und
• dasHochland (Highlands)und dieInselnim Norden und Westen.
Dieser Hochland und Inselbereich umfasst alles, was nördlich der sogenannten Hochlandbruchlinie liegt. Sie ist eine markante Berg- und Hügelkette, die sich von Helensburgh im Südwesten bis Stonehaven im Nordosten diagonal durch ganz Schottland zieht. Politisch, geschichtlich und wirtschaftlich ist entlang dieserHighland Boundary Faultschon seit dem frühen Mittelalter eine soziale, kulturelle und später auch wirtschaftliche Trennlinie zwischen Hochund Tiefland gezogen worden.Lowlandsheißt jedoch nicht unbedingt, dass diese Region ein geologisches Flachland ist; manche Gegenden sind ebenso hügelig und unwegsam wie der Norden des Hochlandes. Das Tiefland ist aber wesentlich fruchtbarer und reicher an Bodenschätzen. Folglich entwickelte es sich im Laufe der Geschichte des Landes wirtschaftlich bedeutsamer und in vielen Bereichen deutlich einflussreicher als das Hochland.
Klima
An der Westküste und auf den Inseln macht sich der warmeGolfstrombemerkbar, der sogar das Wachstum von Palmen und anderen subtropischen und gar tropischen Pflanzen ermöglicht.
Reisezeit
Die besten Reisemonate sind Mai und Juni, allein schon wegen der Farbenpracht des Rhododendrons und des Ginsters und der oft bereits sehr angenehmen Temperaturen. Doch Schottland ist zu jeder Jahreszeit mit brillanten Farben gesegnet. Besonders gilt das im Sommer, wenn die blühende Heide die unzähligen Hügel und die weiten Landschaften mit einem violetten Teppich überzieht. Der Herbst bringt dann in seiner klaren Luft die Farben der Wälder vor der Kulisse der schneegepuderten Bergspitzen und des blauen Meeres zum Leuchten.
Von Frühsommer bis Herbst wehen aus westlicher Richtung jedoch kühle und meistens feuchte Winde, die für häufig starken Regen in den Bergen sorgen. Im Spätherbst und im Winter dagegen sind es eher trockene Nordwinde, die das Thermometer aber selten unter -7°C fallen lassen. Traumhafte Sandstrände laden verlockend oft zum Baden ein, was jedoch ausschließlich und das ganze Jahr hindurch nur abgehärteten Zeitgenossen zu empfehlen ist. Die durchschnittlichen Wassertemperaturen liegen im Sommer um 13°C! Bei Lufttemperaturen um 20°C können daher die meisten Sommerurlauber höchstens ein ausgiebiges Sonnenbad genießen. Wie sich das Klima Schottlands durch den weltweiten Treibhauseffekt verändern wird, bleibt noch abzuwarten. Möglicherweise werden die Sommer länger und wärmer – aber auch nasser.
Fauna und Flora
Schafein ihrer großen Zahl fallen als erstes ins Auge – so ist es verständlich, dass die ersten Fragen das Land betreffend sich fast immer um diese genügsamen Tiere drehen. Ideal geschaffen für das karge Land leben sie das ganze Jahr über auf den Weideflächen der kahlen Höhen. Felsen und Büsche oder die wenigen vereinzelten Bäume geben dort nur einen geringen Wind und Regenschutz. In einen Stall kommen sie nur bei extremen Wetterverhältnissen und wenn sie lammen. Die verbreitetsten Rassen sind die Blackface-Schafe mit der charakteristischen schwarzweißen Färbung am Kopf und das robuste weiße Cheviot Schaf mit der markanten römischen Nase.
Vorsicht – Schafe
Schafe haben ausser Fressen scheinbar nicht viel im Sinn. Häufig stehen sie gedankenverloren mitten auf der Straße oder überqueren diese unerwartet. Vorsicht ist daher bei der Autofahrt durch Schottland ständig geboten – ganz besonders gilt das im Frühjahr und Frühsommer, wenn die Muttertiere mit ihren Lämmern unterwegs sind!
Gemütlich und knuddelig sieht es aus, das rötlich-braune bis schwarzeHochlandrindoderHighland Cattle. Im Allge-meinen sind diese Tiere mit dem charakteristischen zotteligen Langhaarfell friedlich. Die Kühe mit ihren Kälbern werden allerdings sehr unruhig, wenn sie sich gestört fühlen. Äußerste Vorsicht ist dann geboten, denn sie können blitzschnell sein und die geschwungenen Hörner sind unangenehm spitz!
Zu den klimatisch besonders angepassten Rinderrassen zählen auch die schwarzweiß gestreiftenBeltiesund die ursprünglich aus dem Süden Schottlands stammendenGalloways. Deren Haut ist so dick und wirkt so isolierend, dass, so wird gesagt, noch drei Tage nach dem letzten Schneefall, Schnee auf ihren Rücken zu finden ist.
In der Frühgeschichte Schottlands gab esRentiere,Luchse,Biber,Wölfe,WildschweineundBären. Die meisten Tierarten sind mittlerweile bis auf die wieder eingebürgerten Rentiere verschwunden. Doch nach neusten Nachrichten werden versuchsweise auch wieder Biber aus Norwegen eingeführt. Weiterhin schließt die immer noch relativ artenreiche schottische TierweltRotwild,Füchse,Dachse,Kaninchen,MarderundWildkatzenein. Besonders im Winter, wenn der Schnee die Tiere von den Höhen in die Flussniederungen treibt, ist Rotwild gut von der Straße aus zu sehen. Zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Förderung der natürlichen Auslese will die Organisation Scottish Natural Heritage auch Wölfe wieder einführen. Dagegen gibt es allerdings durch verschiedene Interessengruppen vehemente Proteste. Selbst in den abgelegensten Regionen wird gejagt, deshalb ist bei Wanderungen durch unmarkierte Gebiete während der Jagdsaison auch Vorsicht geboten! Dachse und Füchse sind im ganzen Land zu finden. Die Tollwut ist durch die einst strikten Quarantänebestimmungen von der Insel ferngehalten worden, somit ist die Verbreitung des Fuchses auch in Stadtgebieten keine Seltenheit und eine Begegnung mit ihm stellt normalerweise keine Gefahr dar.
Die Heidegebiete sind der bevorzugte Lebensraum derKreuzotter, der einzigen Giftschlange in Großbritannien. Meistens wird sie verschwinden, wenn Menschen in die Nähe kommen, doch Unfälle sind in der Einsamkeit der kahlen Hügel schon vorgekommen und nicht ungefährlich.
Zerfranste und von zahllosen Löchern durchsiebte Grashügel weisen auf Kaninchen hin. Zu Hunderten sind sie oft besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden zu sehen. Sie sind zur Plage für viele Bauern und auch Archäologen geworden, denn Kaninchen unterhöhlen viele historische Stätten, so dass diese letztlich zerstört werden können. Aber diese Kaninchenpopulationen sichern auch den Fortbestand vieler Raubvögel und so sind heute u.a. in Schottland wiederSteinadler(Golden Eagle),See-undFischadler, Bussarde, Turm-undWanderfalken, MilaneundKolkrabenzu sehen. Zum Glück sind alle diese Raubvögel heute geschützt, aber es gibt leider immer noch Frevler, die ihre Gelege plündern oder versuchen sie durch Giftköder auszurotten. Neben Raub- und Greifvögeln sind in den verschiedenen Regionen SchottlandsSingvögel, Raufußhühnerund besonders eine Fülle von Seevögeln an den Küsten zu finden. DasBirk- undSchneehuhn, sowie dasMoorhuhn(Grouse) zählen zu den Hühnervögeln. Diese werden von den Landbesitzern ebenso eifrig gejagt wie das Rotwild. Der riesige, spektakuläre und wieder eingebürgerteAuerhahn(gälischCapercailliefür Waldpferd) ist zum Glück ebenfalls vor Jägern geschützt. Damit ist hoffentlich sichergestellt, dass das eigentümliche Klick-Klock seines Rufes auch in Zukunft zu hören sein wird. Zwei der interessantesten Jahreszeiten sind der farbenprächtige Herbst und das frühe Frühjahr, wenn riesige Schwärme vonZugvögelnüberall in Schottland auf abgeernteten Feldern, Wiesen und an den Seen Zwischenstation machen, bevor sie weiterfliegen. Inzwischen werden die betroffenen Bauern mit bis zu zehn Pfund pro Gans subventioniert, damit sie für die Tiere genügend Restgetreide auf den Feldern lassen, die von ihnen als Rastplätze ausersehen werden. Manche Bauern sollen sich inzwischen tatsächlich überlegen, ob sie Schafe halten oder sich nicht lieber auf diese Zugvögel konzentrieren sollten. Von Island und aus den nordischen Regionen kommen zahlreiche Seevögel teils zum Überwintern, teils zur Brutzeit in die Küstengebiete und auf die vorgelagerten Inseln im Westen. Für Besucher mit einem Faible für diese Tiere bieten sie ein immer wieder eindrucksvolles Schauspiel. So findet der interessierte Vogelbeobachter von den 28 verschiedenen Arten der an Großbritanniens Küsten brütenden Zug- und einheimischen Vögel allein an den schottischen KüstenSilber-, Dreizehen-undRaubmöwen, Brand-, Fluss-undKüstenschwalben, Pfeif-, Spieß-undKrickenten, verschiedeneWildgänse, Sturmtaucher, Trottellummen, Basstölpel, Tordalke, Kormorane, EissturmvögelundStrandläuferund die immer beliebtenPapageientaucheru.v.m. Großbritanniens Küsten sind die Winterheimat von über 1.5 Millionen Watvögeln. Viele Inseln und Orte der Hebriden, auf Orkney und Shetland sowie an verschiedenen Küsten des Festlandes wurden zu Vogelschutzgebieten erklärt. Besonders erwähnenswert sind an dieser Stelle St. Kilda, die Fair Isles, St. Abb’s Head, Canna und Unst, die sich alle im Besitz des National Trust for Scotland befinden. Auf diesen Inseln und an zahlreichen Küstenplätzen allein leben schätzungsweise915000Vögel in oft riesigen Kolonien an meist steil aus dem Meer aufragenden Felsen.
Vogelkolonien
Die sehr schwer zugängliche Gruppe der felsigen St. Kilda-Inseln, die rund 70 km westlich von North Uist (Äußere Hebriden) im Atlantik gelegenen ist, bietet mit ca. 617 000 Seevögeln verschiedener Arten die größte Kolonie. Unter ihnen sind auch die flinken und putzigen Papageientaucher (Puffins) zu finden. Diese sehr exotisch aussehenden, farbenprächtigen Seevögel nisten allerdings schon im Mai/Juni mit ihrem einzigen Jungen in Erdhöhlen und ziehen nach vollendetem Brutgeschäft hinaus aufs Meer. Nachdem er in den 1950er Jahren verschwunden war, zählt auch der Fischadler (Osprey), von dem es jetzt wieder über 100 Paare in Schottland gibt, zu den geschützten Vögeln. Bei Boat of Garten und Dunkeld (Loch of Lowes Naturreservat) hat die Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Unterstände eingerichtet, von denen diese seltenen Vögel mit Feldstechern und per Video am Brutplatz beobachtet werden können. Noch strenger geschützt werden allerdings die vor wenigen Jahren wieder eingeführten Weißschwanz Seeadler. Dieser mit 2,5 Metern Spannweite größte Vogel Schottlands ist gelegentlich majestätisch kreisend an den Küsten zu sehen.
In abgelegenen und kaum besuchten Buchten haltenSeehunde(North Atlantic Grey SealundCommon Seal) ihr faules Mittagsschläfchen. Von diesen Tieren gibt es an den Küsten Schottlands z. Zt. rund 105 000.
Vor den Küsten tummeln sichDelfineundWale. Sie ziehen zur Geburt und Aufzucht ihrer Jungen die Westküste entlang und entweder hinunter in den Atlantik oder in die andere Richtung nach Norden zu ihren Futtergebieten.Buckel-und sogarPottwalesind auch im Firth of Forth vor Edinburgh gesichtet worden. Mit etwas Glück lässt sich an der Westküste einer der größten Fische der Welt sehen: Der bis zu13m lange, friedliche, planktonfressendeRiesenhai(Basking Shark) zieht im Frühjahr auf seinem Weg hinüber nach Norwegen durch die Irische See und die Westküste hinauf. Mit noch mehr Glück lässt sich vielleicht in einem der Sealochs der Westküste ein Otter sehen. Erfreulicherweise steigt die Zahl dieser einst in Schottland vom Aussterben bedrohten Küstenbewohner und heute gibt es in Großbritannien schätzungsweise wieder6500Tiere. An der Südküste Skyes schloss der Autor Gavin Maxwell wunderbare Freundschaften mit einigen dieser Tiere. Sein BuchRing of Bright Waterwurde ein weltweiter Erfolg, verfilmt und mit einem Oscar ausgezeichnet.
Nachrichten tauchen hin und wieder auf, dass es daneben auch andere Lebewesen in Schottland und in anderen Teilen Großbritanniens gibt, die nicht unbedingt zur ursprünglich einheimischen Tierwelt zählen. Diesmal ist aber nicht Nessie damit gemeint, sondern größere, katzenartige Tiere– wahrscheinlich Pumas oder Panther. Sie sind in mehreren Gegenden Großbritanniens gesichtet worden und haben nach Aussagen von Bauern im schottischen Hochland schon Viehschaden angerichtet.
Angesichts der vielen kahlen Berge und Hügel ist es vielleicht unvorstellbar, dass Schottland einmal mit dichtemWaldbedeckt war. Der einstige Urwald, der nach der letzten Eiszeit fast ganz Schottland bedeckte, wurde in Teilen zunächst durch klimatische Veränderungen dezimiert. Die wachsende Bevölkerung trug ihren Teil dazu bei: Auf brauchbarem gerodeten Terrain wurden schon im Mittelalter Felder angelegt. Aus den verschiedensten Gründen wurden aber vom 18. Jahrhundert an Schottlands Wälder immer weiter abgeholzt. Der Schiffbau hatte schon vorher große Mengen Holz verschlungen und hinzu kam, dass für kleinere und größere Eisenschmelzen im Hochland riesige Waldflächen zu Holzkohle verarbeitet wurden. Viel Wald musste auchnoch der weiter wachsenden Bevölkerung Platz machen.Die neuen Landbesitzer änderten die Situation auch nicht, ganz im Gegenteil, sie machten ihren Wald zu Kapital.Auf dem harten Granit und Schist entstanden kahle Moorflächen. Glücklicherweise dachten aber nicht alle Landbesitzer so: Schon im späten18. Jahrhundert erkannte z. B. der Herzog von Atholl den Wert der Wälder. In seinen Besitztümern und anderswo wurden viele Millionen Bäume gepflanzt. Doch vom einstmals berühmtenKaledonischen Wald,der zu einem Großteil aus einheimischem Nadelbaum, derSchottischen Kiefer(Scots Pine), bestand, ist heute nur noch ein winziger Bruchteil erhalten. Der Bestand kann sich aber leider nicht von selbst erholen. Schafe und Rotwild fressen die Schösslinge immer wieder ab. Jetzt wird das Wild durch Zäune von den Bäumen ferngehalten. So sind vom alten Kiefernwald und dem gesamten historischen Mischwaldgebiet in Schottland gerade einmal noch90 000ha (900km²) vorhanden.
In Großbritannien hat inzwischen ein Umdenken stattgefunden. DieForstkommission(Forestry Commission) entwickelt seit den1920er Jahren Programme zur Aufforstung des Waldbestandes. Diese Initiativen sind später auch von privaten Grundeigentümern und Investoren aufgegriffen worden. Im Vordergrund stand dabei in erster Linie die Schaffung von Wirtschaftsholz durch schnell wachsende Monokulturen von Nadelbäumen. Dazu kamen aber bald andere Aspekte wie der Schutz des Bodens vor Erosion und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wald- und Holzwirtschaft. Auf diese Weise ist so in Schottland und dem übrigen Großbritannien der größte von Menschenhand gepflanzte Wald der Welt entstanden. Heute sind mit etwas über einer Million Hektar knapp15% der Landfläche Schottlands bewaldet. Davon wird wiederum etwas mehr als die Hälfte durch die Forestry Commission bewirtschaftet. Diese Forstverwaltung beschäftigt in ganz Großbritannien rund15 000Mitarbeiter und produziert rund3,5Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr. NebenSitkafichtenundNorwegischen FichtenwerdenLärchen, Blau-und andereTannensowieKieferngepflanzt, leider aber oft nur unter dem wirtschaftlichen Aspekt der Holzgewinnung. Das wird heute aus ökologischen Gründen zunehmend kritischer gesehen. Monokulturen dieser Art sind meistens nicht besonders schön anzusehen, weil viele Täler und Höhen des Hochlands durch diese Anpflanzungen ihren besonderen Charakter verlieren. Sie sind darüber hinaus auch sehr anfällig gegen Schädlinge. Die Forstverwaltung ist inzwischen klüger geworden und hat aufgrund ihrer neuen Erkenntnisse an den Rändern dieser Gebiete Laubbäume wieBirken, Eichen, ErlenundHaselnusssträuchergepflanzt und damit teilweise auch Neuanpflanzungen von koniferen Wäldern gemischt.
Große schottische Waldgebiete sind u. a. derGalloway Forest Park, derBorder Forestim Grenzgebiet zwischen Schottland und England in den Cheviot Hills und derQueen Elizabeth Forestin den Trossachs.
Die Baumgrenze der Aufforstungen liegt in Schottland im Durchschnitt zwischen550und600m über dem Meeresspiegel. Das ist unterschiedlich und richtet sich nach den Temperaturen, dem Boden und natürlich auch nach der Richtung und Stärke des Windes. Im offenen, windigen Norden und auf den windzugekehrten Seiten der Inseln haben es Bäume natürlich besonders schwer. Auf den windexponierten Flächen im Westen in Atlantiknähe sinkt die Grenze fast bis auf Meereshöhe ab.
Die Vegetation lässt sich am besten anhand der Höhenstufung darstellen. Vom Wetter und von den Einflüssen des Atlantiks abhängig variieren die Stufen erheblich, können aber leicht erkannt werden: In den Lowlands, den Küstenebenen, den Southern Uplands und den östlichen und südwestlichen Highlands wächstEichenwaldbis etwa 200-250 m über dem Meeresspiegel. Vor allem in diesen letzteren Gebieten finden sich noch kleine Reste des einstigen Naturwaldes. Der ist nach Jahrhunderten der Abholzung in den letzten Jahrzehnten durch meist großflächige Aufforstungen mit Nadelhölzern ersetzt worden. In der östlichen Küstenebene wird das fruchtbare Land durch Ackerbau genutzt. Dazu kommt in diesen Regionen Grasland für die Viehwirtschaft in den Uplands und den östlichen Grampian Mountains. Im nassen Westen dagegen gedeihen üppigeRhododendronheckenundGinsterbüsche. Vielerorts wachsen sie im Überfluss und oft entlang der Straßenränder. Dieses Gebüsch hat sich inzwischen auf dem sauren Boden wild vermehrt und ist bei Naturschützern und Waldbesitzern gar nicht gern gesehen, darum werden heute Teile der Wälder und Flächen wieder davon gerodet. Rhododendron wurde im vorletzten Jahrhundert eingeführt und in vielen Gärten und Parks in zahllosen Varianten kultiviert. So sind der Royal Botanical Garden in Edinburgh und der Inverewe Garden an der Westküste nur zwei von zahlreichen Gärten, die für ihre riesigen, farbenprächtigen Rhododendronbestände bekannt sind.
Geschützte Pflanzen
Die Schönheit und Vielfältigkeit der Pflanzenwelt ist von hohem biologischen und wirtschaftlichen Wert und darüber hinaus im wahrsten Sinne des Wortes eine Augenweide. Der Reisende möge daher bitte bedenken, dass sich alle Menschen an der Vielzahl der Pflanzen erfreuen möchten, die meistens geschützt sind, und das Ausreißen oder graben von wildwachsenden Pflanzen jeder Art schlichtweg verboten ist.
Kiefern-undBirkenwald(zwischen 200-250 und 400-600 m über dem Meeresspiegel) wächst besonders in den mittleren Höhenlagen der Grampians. Überwiegend ist das aber auch Weideland für Schafe und Naturgrasland, sogenannterough pastures. Der Wald ist bis auf geringe Reste verschwunden und auf dem kargen, sauren Boden hat sich Heide ausgebreitet. Im Grasland gedeiht meistBorstengrasund je nach Untergrund und FeuchtigkeitHeidekraut,Ginster,BeerenundFarne. Vor allem wuchertAdler- oderKönigsfarn(Bracken) oft weitflächig, wo die Heide nicht bewirtschaftet werden kann.Besen- undStechginstergedeihen auf Basalt, einem Gestein, das in weiten Teilen Schottlands buchstäblich die Basis bildet, einen kargen Boden hervorbringt und das nach dieser genügsamen Pflanze mit dem einheimischen NamenWhinstonebenannt wurde. An den Ufern flacher Süßwasserseen (Lochs) wachsenThymian, gelbblühendeIris,WickeundGlockenblume,während in anderen auchSeerosenblühen.Lobelienwachsen im Inland auf den oft morastigen Flächen und Hängen.
StrauchheidenundMooresind von300bis650m über Null im Westen zu finden. Früher gediehen in diesen Landschaften Kiefern- und Birkenwälder, jetzt herrschen oft nasse Heideflächen (wet heath) und Hochmoore (Raised Bogs) vor. In diesen Regionen ist fast überall die in Deutschland ebenfalls bekannteErikazu finden. Moore überziehen ganze Landstriche an Hängen und auch als weitflächige Deckenmoore (Blanket Bogs). Diese Moore werden durch starke Niederschläge auf undurchdringlichem Untergrund (Fels) gebildet. Sie werden ausschließlich von weitgehend anspruchslosen Pflanzen besiedelt, die beim Absterben eine sauerstofflose Torfschicht entstehen lassen. Typische in diesen Mooren vorkommende Pflanzen sind:Sauer-undBinsengräser,Schilfrohr,Wollgras,Fingerkrautarten, verschiedene Arten vonTorfmoosen,Sonnentauund sogar einigeOrchideenarten. Diese Pflanzenvielfalt zeigt dann an, dass es sich hier oft um Flachmoore (bogs) mit einem guten Nährstoffangebot handelt. Bei Hochmooren schließen meist mächtige Torfdecken jeden Kontakt zum nährstoffhaltigen Grundwasser aus. So ist die typische Moorpflanze dasSpagnummoos. Als einfacher Brennstoff ist Torf in den ländlichen Regionen auch heute noch gebräuchlich. Die Nutzung von Torf als Gartenmaterial hat allerdings auch in Schottland dazu beigetragen, dass Moore trockengelegt wurden, was zur Verödung einiger Landstriche führte. Neuerdings werden daher Teile der ehemaligen Moore wieder bewässert und kultiviert. Ein anderer Grund für die Rekultivierung ist die inzwischen gewonnene Erkenntnis über den ökologischen Wert der Moore: Die dort wachsenden Pflanzen binden große Mengen von Kohlenstoff und tragen damit ganz erheblich zur Reduktion des Treibhauseffektes bei. Im Gegensatz zu den Mooren bergen die Äußeren Hebriden auf ihren meist kargen Inseln mit ihrenMachairseinen einzigartigen Pflanzenschatz. Diese nur dort wachsenden Küstenwiesen sind reich an seltenen Blumen und kleinen Orchideen wie demKnabenkraut. Der saure Boden der Moore über dem harten Lewis Gneis wird vom Flugsand des davorliegenden Strandes überweht. Das dadurch entstehende Bodengemisch ist die fruchtbare und ideale Basis für dieMachair, ein Grasland vollerStrandbeifuß,Seapinks, rosablühendem Klee, kleiner Orchideen,Dotter- und anderer Blumen.
Die Berge der Grampians und das nordwestliche Hochland sind bis zur Höhe von etwa900m – auf den Hebriden bereits ab etwa550m über dem Meeresspiegel – meist von kargemarktisch-alpinem Graslandbedeckt. Selbst für die genügsamen Schafe lässt sich das nicht mehr nutzen, und so wachsen auf den Plateaus und Gipfelregionen der Cairngorms vorwiegendMooseundFlechten.
Kultur
An dieser Stelle die gesamte kulturelle Vielfalt Schottlands zu schildern, würde den Rahmen des Buches sprengen. So bleibt eigentlich nur eine relativ kurze Aufzählung der wichtigsten Institutionen und Persönlichkeiten, sowie der Hinweis auf die entsprechende Fachliteratur, um dem Leser einen Überblick zu geben.
Der NameWilliam Bruce(1630-1710) ist den meisten europäischen Besuchern sicher unbekannt. Dieser Architekt der frühen Neuzeit hinterließ dem Land jedoch mit dem Palast von Holyroodhouse, dem Hopetoun House, Prestonfield und seinem eigenen Wohnhaus Kinross House Paläste und Gebäude in einem im wahrsten Sinne nur als großartig zu bezeichnenden Maßstab. Er war es, der mit den ihm folgenden Architekten wieWilliam Adam(1689-1748) und dessen SöhnenRobert (1728-92) undJames(1730-94) die schottische Architektur so nachhaltig prägte. Adams georgianischer Baustil der Edinburgher New Town wurde in ganz Großbritannien kopiert und ist auch in St. Petersburg zu sehen. Weiter beeinflusst wurde diese Architektur im19. und20. Jh. durch Männer wieDavid Bryce,F.T. Pilkington,Alexander ‘Greek’ ThomsonundCharles Rennie Mackintosh(1868-1928),Robert Lorimer, sowieSir Stirling Maxwell, deren Bauten noch heute zu sehen und z.T. auch international bekannt sind.
Zu den auch über Schottland hinaus bekanntesten Porträtmalern zählen in jedem Fall die SchottenAllan Ramsayder Jüngere (1713-1784),Sir Henry Raeburn(1756-1823) und auchSir David Wilkie(1785-1841), der mit seinen sozialkritischen Bildern einen schottisch-historischen Stil schuf. Die National Gallery ist stolz, einige der zahlreichen Porträtwerke dieser Künstler in ihrem Besitz zu haben. Einer der wichtigsten Zeitgenossen Ramsays war der in Rom lebende Doyen der dortigen MalerGavin Hamilton(1727-1798). Er war auch ein persönlicher Freund des MalersAlexander Runciman(1736-1785), dessen Werke wiederum durch MacphersonsOssianbeeinflusst worden sind. Die Landschaftsbilder vonAlexander Naysmyth(1758-1840) haben für manchen Betrachter gewisse Ähnlichkeiten mit Kasper David Friedrichs Werken. Doch neben zahlreichen anderen schottischen Künstlern wurden vor allem auch die moderneren Maler wie die sogenannten ‘Glasgow Boys’William McTaggart(1835-1910),James Guthrie(1859-1930) undE.A. Walton(1860-1922) in Deutschland bekannt. Schließlich waren es aber die vier ‘Scottish Colourists’ –S.J. Peploe(1871-1935),Leslie Hunter(1871-1931),F.C.B. Cadell(1883-1937) undJ.D. Ferguson(1874-1961), die mit ihren farbenreichen und kraftvollen Bildern den Beginn und auch international den Ruf der modernen schottischen Malerei begründeten. Diese Art zu malen wird vonJohn Bellany(1942-2013), einem der anerkannten großen Maler unserer Zeit, fortgesetzt. In die Kategorie der gegenwärtigen Kunst gehört ebenfalls der in Edinburgh geborene BildhauerSir Eduardo Paolozzi(1924-2005). Er arbeitete lange Jahre auch in Hamburg, Berlin, München und Köln und galt in der Kunstwelt durch seine surrealen Grafiken als einer der Wegbereiter der Pop Art-Bewegung.
Die Schriftsteller und DichterRobert Burns(1759-96),Sir Walter Scott(1771-1832),Robert Louis Stevenson(1850-94) undJames Boswell(1740-1795) haben in den letzten drei Jahrhunderten den Ruf der klassischen schottischen Literatur begründet. Daneben gibt es aber noch eine Reihe anderer, in Deutschland nicht sonderlich bekannter Autoren, die aber nicht unerwähnt bleiben dürfen. Dazu zählt sicherlichJames Macpherson(1738-1796). Auch wenn ein Teil seiner Werke vom Ursprung her problematisch ist, hat er durch seine (angeblichen) Übersetzungen gälischer Heldenballaden des Ossian – evtl. vergleichbar mit der Nibelungensage – europaweiten Ruhm erlangt. In viktorianischer Zeit wurdeHugh Miller(1802-1856) vor allem durch seine Werke zur Geologie und seine religiös-wissenschaftlichen Abhandlungen bekannt. Letztere erschienen sogar drei Jahre vor Darwins umstrittenem BuchOrigin of the Species(1859) und können sich durchaus mit diesem messen. Weltruhm erlangte des Weiteren der gebürtige EdinburgherArthur Conan Doyle(1859-1930) mit seiner Kriminalbuchreihe vonSherlock Holmes. Leider ist auch nur wenig bekannt, dassPeter Pan, der Junge, der nie erwachsen werden wollte, von dem SchottenJ.M. Barrie(1860-1937) erdacht wurde. Der2004mit großem Staraufgebot gedrehte HollywoodfilmFinding Neverlanderzählt seine Geschichte. Ein weiterer bekannter Kinderbuchautor, der oft irrtümlich für einen Engländer gehalten wird, istKenneth Grahame(1859-1932). In Deutschland wurde er durch seinen RomanThe Wind in the Willows(Der Wind in den Weiden) (1908) bekannt. Besonders bedauerlich ist es, dass Autoren wieHugh MacDiarmid(1892-1978), der Autor des schottischen NationaleposA Drunk Man Looks At The Thisle,Edwin Muir(1887-1959),Neil M. Gunn(1891-1974), James Leslie Mitchell aliasLewis Grassic Gibbon(1901-1935) sowie die großen OrkadiansEric Linklater(1899-1974) undGeorge Mackay Brown(1921-1995) im deutschsprachigen Raum nur sehr wenig gelesen werden. Schottische Frauen drängen seit der Nachkriegszeit mehr und mehr an die literarische Front.Dame Muriel Spark(1918-2006) ist vielleicht die außerhalb Schottlands bekannteste schottische Autorin. Sie wurde besonders bekannt durch ihren RomanThe Prime of Miss Jean Brodie(Die Blütezeit der Miss Jean Brodie) (1961). Ein auch in Deutschland viel gelesener Autor war der Erzähler und HistorikerNigel Tranter(1909-2000). Gegenwärtig machen vor allem Autoren wieIain Banks(1954-2013) und schließlichIan Rankin(1960-) mit seiner Romanreihe desInspector Rebus,Alexander (Sandy) McCall-Smith(1948-) u.a. mit den Romanen derNo. 1 Ladies’ Detective AgencyundIrvine Welsh(1958-) mitTrainspottingundSkagboysvermehrt von sich reden. Ganz besonders trifft das aber aufJoanne K. Rowling(1966-) zu. Sie ist zwar eine gebürtige Engländerin, doch sie lebt in Schottland und schrieb in Edinburgh anfangs unter schwierigen persönlichen Umständen die in den letzten Jahren wohl auch international bekannteste und begehrteste BuchreiheHarry Potter.
Musik wird in Schottland nicht nur auf den verschiedenen Arten des Dudelsacks, der großenHighland Bagpipeoder der kleinerenBorder Bagpipe,gemacht. Die FamilieMacCrimmonbrachte über mehrere Generationen (17.-19. Jahrhundert) die herausragendsten Spieler dieses Instruments hervor. Die berühmtesten Musiker des 18. Jahrhunderts waren der FolkmusikerNeil Gow(1727-1807) mit seiner Geige oderfiddle, wie sie in Schottland genannt wird, und der Geiger und KomponistWilliam McGibbon(1695-1756). Wer sein Herz für die gälische Kultur und Musik geöffnet hat, kommt nicht umhin, das jährliche Winterfestival im JanuarThe Celtic Connectionund im Laufe des JahresThe National Mod, das seit 1892 an wechselnden Austragungsorten an der Westküste stattfindet, zu besuchen. Die zeitgenössische SchlagzeugerinEvelyne Glennie(1965-), die absolut taub ist, wie auch die trotz ihrer Jugend zu Weltruhm gelangte ViolinistinNicola Benedettiobe(1987-) sind zwei der größten Musikerinnen, die Schottland je hervorgebracht hat. Zur gereifteren und doch ewig jungen Folkszene zählen Musiker mit dem Format des AkkordeonspielersJimmy Shand(1908-2000) undAndy Stewart(1933-1994).
International bekannt wurden von den 1960er Jahren an Musiker wieLonnie Donegan(1931-) und schottische Popstars wieGerry Rafferty(1947-2011),Rod Stewart,Annie Lennoxobe,Lulu,Sheana Easton. Gleiches gilt für Bands wie dieBay City Rollers,Simple Minds,Capercaillie,Runrigund die jüngeren Bands wieTexas,TravisundFranz Ferdinandund auchGlasvegas.
Filme haben das Bild und die Geschichte Schottlands in die ganze Welt getragen, wobei wohlBraveheart,Rob RoyundTrainspottingzu den bekanntesten Streifen zählen. Deren Akteure, dazu gehören natürlich besonders der gebürtige EdinburgherSir Sean Connery(1930-) und seit wenigen Jahren auchEwan McGregor, werden weltweit mit dem Land in Verbindung gebracht. Gerade durch sein breites kulturelles Erbe hat Schottland Ende des 20. Jahrhunderts eine besondere Art von neuem Selbstvertrauen gefunden, das auch in der jetzt dezentralisierten schottischen Politik eine große Rolle spielt.
Sprache
Englischist seit dem 18. Jahrhundert die Amtssprache in Schottland. Bis dahin wurde in den entlegenen Dörfern des HochlandsGälischgesprochen und Englisch musste als Fremdsprache erst erlernt werden. In den Lowlands wurden dagegen eine Vielzahl von Dialekten gesprochen, von denen es bis zu 70 gegeben haben soll.
Seit dem 10. Jahrhundert wurde in ganz Schottland Gälisch gesprochen. Später änderte sich das in den südwestlichen Regionen: Dort bildete sich das aus dem Northumbrischen kommende Scots (oderLallans) als eigene Nationalsprache aus, während im Hochland und auf den Inseln aber weiterhin Gälisch vorherrschte.
In den dünnbesiedelten Regionen des Nordwestens und auf den Inseln wird heute das Gälisch wiederbelebt. Mit ca. 58 000 (2011) Menschen, die diese Sprache wieder sprechen, erfährt Gälisch nach Jahren des Verbots und der Unterdrückung (s. a. im Geschichtsteil des Buchs) derzeit eine Renaissance: Gälisch wird jetzt dort an Schulen unterrichtet, Fernsehstationen (z.B. dieBBC) strahlen gälischsprachige Sendungen aus und Zeitungen und Magazine werden zweisprachig gedruckt. Straßenschilder sind, je weiter sich der Reisende der gälischsprechenden Region nähert, zweisprachig und erst in Gälisch und dann in Englisch beschriftet. Im neuen Schottischen Parlament gehen Bestrebungen dahin, ganz offiziell neben Englisch auch Gälisch und gelegentlich Scots zu sprechen.
Besuchern begegnen gälische Wörter am häufigsten in Ortsbezeichnungen. Berge heißen auf Gälischbeinn(in der anglizierten Formben), z.B. Ben Hope, währendlochdas Wort für einen See oder eine Meeresbucht ist, z.B. Loch Ness und Loch Linnhe.
Scots hat englische, französische, germanische und skandinavische Einflüsse aufgenommen und war im 16. und 17. Jahrhundert die Sprache am Hofe von JamesVI. Doch nach dessen Wegzug nach London im Jahr 1603 und der anschließend ins Englische übersetzten und nach ihm benannten Bibel hatte diese Sprache keine Chance mehr, sich auszubreiten. Verstärkt wurde dies noch durch die parlamentarische Union 1707, als Englisch zur Verwaltungssprache in ganz Großbritannien erhoben wurde.
Der schottische Dichter Robert Burns schrieb aber noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts die meisten seiner Gedichte und Lieder in Scots – seine Werke sind in der schottischen Tradition heute noch sehr hoch angesiedelt.
Dann ist da noch Aberdeen. Die Menschen in dieser Stadt, die Aberdonier, sprechen heute noch unter sich dasDoric– eigentlich eine eigene Sprache, die manche als Dialekt abtun.
Die Schotten, wie die Menschen vieler englischsprachiger Länder, haben allerdings ganz offenbar einen Nachholbedarf in Bezug auf Fremdsprachen. Neuere Statistiken belegen, dass nur knapp über 30% der erwachsenen Schotten eine Fremdsprache beherrschen. Dabei ist die Zahl der Schulabsolventen mit einem Fremdsprachenabschluss in den letzten 25 Jahren aber schon um die Hälfte gesunken.
Doch die meisten europäischen Schüler lernen ja Englisch als Zweitsprache, warum sich da also mühen? Das senkt natürlich für britische Schüler die offensichtliche Notwendigkeit noch weiter.
Rechtssystem
Seit dem 17. Jahrhundert bezieht Schottland eine besondere Position in der Rechtswelt, denn es ist auch heute noch kein souveräner Staat. Es ist aber das einzige Land, das sein eigenes, autonomes Rechtssystem mit eigenen Quellen, Gerichtshöfen, Verfahrensabläufen und Berufsständen hat, obwohl es politisch Teil eines anderen Staates ist.
Staat und Justiz
Wissenschaftler der Harvard Universität und der Universität von Chicago haben eine Liste der am ,besten’ und am ,schlechtesten’ regierten Länder der Welt zusammengestellt. Die Kriterien dabei waren Effizienz, persönliche Freiheit und das Maß, bis zu welchem Grad Regierungen einen Einfluss auf die Justiz nehmen. Dabei haben acht der zehn zum Schlusslicht dieser Liste zählenden Länder der Welt Rechtssysteme, die mehr oder weniger ausschließlich auf dem napoleonischen Rechtscode basieren. Die Länder allerdings, die ein Rechtssystem haben, das auf dem englischen Common Law basiert, tendieren dazu, ,besser’ regiert zu sein. Der napoleonische Rechtscode stellt die Rechte des Staats über die des Individuums, während das englische Common Law nach der Verteidigung der Eigentumsrechte strebt. So suchen die Richter in Schottland auch heute noch gerechte Urteile z. T. unter Heranziehung und Interpretation dieser alten angelsächsischen Rechte, durch die von ihren Vorgängern gefällten Urteile (Präzedenzfälle) und anhand der Aufzeichnungen der institutionellen Rechtsverfasser des 17. – 19. Jahrhunderts.
Ein Aspekt des schottischen Rechts ist besonders bemerkenswert. Schottische Gerichte haben drei Urteilsmöglichkeiten und können neben den Urteilen ‚schuldig’ und ‚nicht schuldig’ seit 300 Jahren noch das rechtmäßige Urteil ‚not proven’ (nicht bewiesen) aussprechen. Das ist ein Urteil und ist nicht mit dem deutschen ‚Freispruch aus Mangel an Beweisen’ zu verwechseln. Damit unterscheidet sich das nicht nur vom englischen Recht, sondern ist – bis auf die Länder und Gesetzgebungen in Südafrika, Louisiana, Quebec und Puerto Rico – einzigartig in der Welt.
Wie in Deutschland basiert das schottische Recht teilweise auf demrömischen Recht. Der Großteil des schottischen Rechtssystems hat seine Wurzeln aber in der Landesgeschichte und anderen Rechtsquellen. Schottland hat ein gemischtes Recht, das von dem römischen Recht, dem englischenCommon Law, demKirchenrechtund dem französischenCode Napoleonabgeleitet ist.
Schottisches Recht besteht im Grunde aus zwei Teilgebieten: demÖffentlichen Recht, das sich mit den staatlichen Rechten und Pflichten sowie dem Kriminalbereich befasst und demZivilrecht, das alle weiteren Bereiche einschließt. Beide Bereiche haben ihre eigenen Systeme, Personal und Gerichte, wobei letztere in Schottland nicht so diversifiziert sind wie in Deutschland.
Zivilrechtsfälle beginnen ihren Weg imSheriff Court. Allerdings gehen die wichtigeren Bürgerrechtsfälle gleich vor die nächsthöheren Instanzen desCourt of Sessionmit dessen Inner und Outer House. Dieser Court of Session ist schon seit 1532 die höchste schottische Rechtsinstanz. Dagegen ist Londons Westminster mit dem dortigenHouse of Lordsz.Zt. noch die höchste Instanz und Berufungsmöglichkeit im zivilrechtlichen Bereich. Das ist einer der großen Unterschiede zum deutschen Recht, wo es keinerlei Verbindung der Justiz zu den gesetzgebenden Organen gibt. Neueste Pläne der britischen Regierung, die allerdings sehr umstritten sind im Schottischen Parlament, sehen in den nächsten Jahren die Schaffung eines Supreme Courts (Oberster Gerichtshof) in England vor.
Der Rechtsweg der Kriminalgerichte beginnt imDistrict Courtund geht ebenfalls über den Sheriff Court, der aber nur bis zu einer gewissen Höhe Urteile verhängen kann. Allerdings werden schwerere Fälle gleich imHigh Court of Judiciarybehandelt. Der wiederum ist aufgeteilt in die Verfahrensinstanzen des Trial Courts und desAppeal Courts(Berufungsgericht). Besonders an dieser Institution ist klar erkennbar, dass Unterschiede zwischen England und Schottland, die seit der Union von 1707 in vielen Bereichen aufgehoben erscheinen, sehr wohl existieren.
So sei der Reisende des 21. Jahrhunderts, wenn er die Grenze überschreitet, gewarnt: Manche Gesetze und die Rechtsprechung unterscheiden sich auch heute noch beträchtlich von denen jenseits der Grenze.
Bildungswesen
Die Union mit England unter Queen Anne vollzog sich 1707 unter großem politischen und wirtschaftlichen Druck für Schottland. In den Verhandlungen darüber wurden aber trotzdem einige fundamentale Eigenarten des Landes herübergerettet, die Schottland von England seither deutlich unterscheiden. Neben dem Rechtssystem gehörte dazu auch das Recht, eigene Geldnoten zu drucken und ein selbständiges Schulsystem. John Knox hatte schon Mitte des 16. Jahrhunderts die erste allgemeine Schule gegründet, die zunächst eine rein religiöse Basis hatte. Von da an entwickelte sich das Schulwesen anders als in England. Das gilt bis heute, obwohl der Lehrplan im Großen und Ganzen ähnlich ist.
In Schottland herrscht heute für Kinder zwischen dem fünften und sechzehnten Lebensjahr die allgemeine Schulpflicht. Die Eltern haben von Anfang an oder auch später die Möglichkeit, zwischen derPublic School(allgemeinen Schule) – in England sind dies paradoxerweise die Privatschulen – oder einer unabhängigen, privaten Schule zu wählen. Diese privaten Schulen und Colleges sind schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren schließen nicht die Kosten für Kost und Logis, Uniformen, Bücher und auch nicht die Fahrt- und Reisekosten ein. In Edinburgh sind z. B. Fettes College, die Mary Erskine School, Watson’s, George Herriot und das Stewart’s Melville College solche Institutionen. Jede Privatschule wird aber im Rahmen desassisted place schemebei der Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Schülern aus finanziell schwächer gestellten Familien subventioniert. Für Kinder unter fünf Jahren gibt es die sogenannteNursery School– eine Vorschule. Zwischen dem fünften und dem zwölften Lebensjahr wird diePrimary School(Grundschule) besucht. Danach ist für mindestens vier Jahre der Besuch derSecondary SchoolPflicht. Der Abgang von der allgemeinbildenden Schule erfolgt danach mit dem sogenanntenStandard Grade. Die Schüler haben fortan die Möglichkeit, Kurz- oder Vollkurse in berufsausbildenden Schulen zu besuchen. Zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr können dann noch individuell ein bzw. zwei Jahre an derSecondary Schoolangehängt werden. Der Ausbildungsplan mit einer erweiterten Kursauswahl führt nach dem erfolgreichen Examen im fünften Schuljahr derSecondary SchoolzumSCE Higher Grade, der Mittleren Reife.
Studiengebühren
Das britische Parlament hat 1998 Verordnungen herausgegeben, die das sogenannte grant system (ähnlich dem BAföG) abschafften und durch ein Darlehenssystem zu günstigen Bedingungen ersetzten. Gleichzeitig wurde eine Studiengebühr von 1000 Pfund pro Studienjahr von den Universitäten erhoben. Diese Darlehenslasten konnten für den Studenten nach vorsichtigen Kalkulationen von Experten auf bis zu 18 000 Pfund anwachsen und waren ein umstrittenes Thema im Wahlkampf und in der ersten Legislaturperiode des neuen schottischen Parlaments. Die linksliberale Regierungskoalition beschloss im Januar 2000 eine tiefgreifende Änderung: Diese Gebühren werden an den schottischen Universitäten abgeschafft. Die Studenten haben dagegen nach Abschluss ihres Studiums und einem Jahresgehalt von mindestens 10 000 Pfund einen Pauschalbetrag von 2000 Pfund in einen Fonds zu zahlen. Doch auch dieses Modell schaffte das Schottische Parlament ab. Während von 2011 an in England die Studiengebühren auf £9000 p.a. angehoben wurden, werden hier für schottische und EU Studenten bis zum BA Abschluss keine Gebühren erhoben.
Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Schullaufbahn wird allerdings erst im sechsten Schuljahr, nach dem Examen in mindestens drei oder mehr Fächern, mit demAdvanced Highers(entspricht dem Abitur), erlangt. Allein an der Mary Erskine School und am Stewart’s Melville College in Edinburgh schlagen fast 90% der 2700 Schüler den weiterführenden Bildungsweg ein. Ähnlich ist es auch an anderen Schulen in Schottland. Eine zeitgemäße und ständige Neuorientierung passt sich diesen Ansprüchen und Herausforderungen an. So wurden die Prüfungen zum Standard Grade durch eine neue Qalifizierung, dieIntermediate 2, ersetzt.
Mit dem ‚Higher’ und mit dem ‚Advanced Higher’ hat der Schüler dann die Wahl zwischen einer ganzen Reihevon Weiterbildungsinstitutionen oder Colleges. 2014 gab es in Schottland über 20 Hochschuleinrichtungen, darunter 16Universitätenund drei Institutionen für akademische Ausbildung. Unter den weltweit besten 200 Universitäten sind allein vier in Schottland: University of Edinburgh, University of St. Andrews, University of Glasgow und die University of Aberdeen. Schottische Studenten können sich aber auch in England um einen Platz an einer dortigen Universität bewerben. Die Studienzeit für ein BA oder BSc (Bachelor of Art oder Bachelor of Science) beträgt mindestens drei Jahre. Um aber sein Honours Degree zu erlangen, muss der Student in Schottland vier Jahre studieren. Das Studienjahr ist an den meisten schottischen Universitäten in drei sogenannteTerms(Trimester) aufgeteilt. Lediglich an der progressiven Universität Stirling ist das Studienjahr in Semester unterteilt.
Religion
DieChurch of Scotlandist eine presbyterianische Kirche auf der Basis der calvinistischen Lehre. Sie wurde von John Knox mit der Reformation 1559 in Schottland verbreitet und 1696 endgültig in ihren Dogmen festgelegt. Der Unterschied zur anglikanischen Kirche in England liegt vor allem in der freien und demokratischen Verfassung, die kein Bischofsamt kennt. Stattdessen wählt in Schottland eine Gruppe von Pfarrern und gewählten Gemeindevertretern, während der jährlichen Generalversammlung in Edinburgh, ihr Oberhaupt – denModerator of the Church of Scotland. Die Church of Scotland hatte Mitte des letzten Jahrzehnts rund 770 000 Mitglieder. Sie besteht weitgehend aus selbstverwalteten Gemeinden. Die Kirche ist vollkommen frei in ihrer Doktrin, Ordnung und Disziplin. Unter ihrer presbyterianischen Form der Verwaltung haben alle Pastoren den gleichen Status und jede der rund 1600 Gemeinden hat ihre eigene Administration, die sich aus dem Pastor und den Ältesten zusammensetzt. Dieses Presbyterium schickt dann ausgewählte Pastoren und Laienälteste zur jährlichen Generalversammlung, auf der aktuelle Themen diskutiert werden. Die Königin hat hierauf keinen direkten Einfluss, obwohl Schottland Teil ihres Königreichs und sie das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England ist. Sie wird aber bei der Assembly von einem Vertreter (demLord High Commissioner) repräsentiert, den sie selbst auswählt. Dieser ist von hohem Rang und residiert für die Dauer der General Assembly der Church of Scotland im Palast von Holyroodhouse.





























