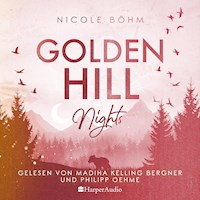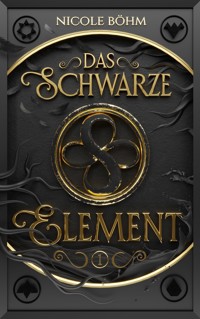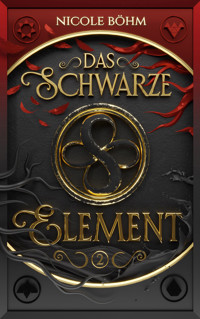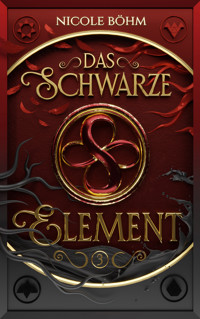
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arkani Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das schwarze Element
- Sprache: Deutsch
Matthews lang ersehnte Freiheit ist nicht das Paradies, das er sich erhofft hatte. Das Leben an der Seite seines Bruders bringt Herausforderungen mit sich, mit denen er nicht gerechnet hatte, und in seiner Überforderung wendet er sich wieder Bishop zu. Dieser offenbart ihm eine Realität, die noch abstruser und unberechenbarer ist als jeder Tag hinter Gittern. Währenddessen steht Rose im Zentrum eines Sturms, den sie selbst entfacht hat. Nach dem Vorfall an der Lagerhalle in San Francisco muss sie nicht nur Rechenschaft ablegen, sondern auch eine folgenschwere Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Schicksal ihres Teams unwiderruflich verändern wird. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, werden Beziehungen auf die Probe und Loyalitäten infrage gestellt. Wer wird am Ende bestehen? Und zu welchem Preis?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das schwarze Element3
1. Kapitel5
2. Kapitel10
****18
3. Kapitel19
4. Kapitel24
5. Kapitel31
6. Kapitel42
7. Kapitel53
8. Kapitel68
****74
9. Kapitel77
10. Kapitel84
****91
11. Kapitel92
12. Kapitel98
13. Kapitel104
14. Kapitel112
****115
15. Kapitel116
16. Kapitel122
17. Kapitel126
18. Kapitel129
19. Kapitel137
20. Kapitel141
21. Kapitel146
****152
22. Kapitel153
23. Kapitel167
24. Kapitel172
Impressum189
Das schwarze Element
Eine Geschichte aus der Welt der Seelenwächter
Von Nicole Böhm
Das schwarze Element
Teil 3
Von Nicole Böhm
1. Kapitel
Matthew
»Guten Morgen, Chicago. Willkommen an diesem wundervollen Tag. Wir freuen uns auch heute über herrliche fünfundzwanzig Grad bei leichtem Südostwind. Dieses perfekte Wetter wird uns auch in den nächsten Tagen begleiten. Hoch Rosemarie verwöhnt uns also ganz schön mit seinen …«
Ich schlug auf den Radiowecker. Der viel zu gut gelaunte Sprecher verstummte. Zurück blieb eine angenehme Stille. Fast. Die Vögel zwitscherten, irgendwelche Kids rannten lachend am Haus vorbei, in der Ferne rumpelte ein Müllauto. Dazu wehte eine laue Brise durch das halb offene Fenster, die Luft roch nach Wasser und Sommer. Es war derart harmonisch, dass es an meinen Nerven kratzte.
Ich blinzelte, drehte mich auf dem harten Boden auf den Rücken und starrte an die Decke. Ich war erst seit zwei Tagen in den USA bei meinem Bruder und hatte mich noch nicht daran gewöhnt, in diesem Bett zu schlafen. Die Matratze war mir zu weich, zu groß, zu alles. Gestern hatte Amy mich gefragt, ob sie mir eine andere kaufen sollte, aber ich hatte verneint.
Sowohl Vincent als auch sie gaben sich Mühe mit mir. Sie übten sich in Geduld, hielten sich mit Fragen zu meiner Zeit im Knast zurück und versuchten zu vertuschen, dass sie was am Laufen hatten. Aber ich hatte sofort bemerkt, dass sie miteinander vögelten. Es lag an der Art, wie Vincent auf ihre Nähe reagierte. Wie er lächelte, wenn sie ihn ansprach, wie er die Schultern leicht anzog und wie seine Stimme einen anderen Ton annahm.
Im Grunde war es mir egal, wen mein Bruder flachlegte, aber bei Amy wurmte es mich. Sie war bei Vincent gewesen, als er das erste Mal wieder hatte sehen können. Sie hatte sich diesen Anteil von ihm genommen, den ich gern gehabt hätte. Und nun wurde durch ihre körperliche Nähe das Ganze noch bedeutungsvoller.
Ich richtete mich auf, gähnte und rieb mir über den Kopf, den sie mir im Knast regelmäßig geschoren hatten. Meine Haare wuchsen zum Glück schnell nach und waren bereits wieder länger als nur fünf Millimeter. Müde erhob ich mich, trottete ins Bad, das ans Gästezimmer grenzte und das ich nur für mich hatte. Meine Haut juckte, als ich unter die Dusche trat und das Wasser eiskalt stellte. Ich mochte es, auf diese Art wach zu werden, weil es mir vergegenwärtigte, wo ich war und was mit mir passierte. Meistens blieb ich so lange drunter, bis ich vor Kälte zitterte und alles wehtat.
Als ich fertig war, trocknete ich mich ab, zog meine neuen Sachen an – die mir natürlich auch Amy besorgt hatte – und widmete mich einem weiteren harmonischen Tag im Paradies.
Ich nahm mein Handy von der Kommode, verließ mein Zimmer und trat in den Essbereich. Vincent hockte an der großen Tafel und blätterte in einem Buch. Neben ihm auf dem Stuhl stand ein Paket.
»Dass ich das noch mal erleben darf«, sagte ich.
Er zuckte zusammen und drehte sich zu mir um. Er schien kräftiger zu werden, seine Haut hatte nicht mehr diesen gräulichen fahlen Ton und er wirkte insgesamt wacher. Aber er hatte schon gesagt, dass er spätestens bei der nächsten Behandlung alle Reserven seines Körpers wieder aufbrauchen und wieder herumlaufen würde wie das wandelnde Elend. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. In seinen Augen funkelte der Lebensmut.
»Guten Morgen«, sagte er gut gelaunt. »Und was meinst du genau? Dass du frei bist und nicht mehr in einem Wohnwagen lebst?«
Ich deutete auf das Buch vor ihm. »Dass du liest.«
»Oh, stimmt. Ich ... Es ist erstaunlich, wie schnell ich mich wieder ans Sehen gewöhnt habe.«
»Was liest du denn?«
Er klappte das Buch zu und hob es hoch, sodass ich den Einband sehen konnte. Es war ein Sachbuch übers Fotografieren. Mir fuhr ein Stich durchs Herz, weil es mich daran erinnerte, was ich einst hatte tun wollen.
Fotografieren. Herumreisen. Momente festhalten.
Hätte sich mir drei Jahre früher die Gelegenheit geboten, in die USA zu reisen, hätte ich sie mit Kusshand ergriffen. Ich hatte immer davon geträumt, mit der Kamera bewaffnet auf Fototour in die Rocky Mountains zu gehen. Das Fotografieren war ein fester Bestandteil meines Lebens gewesen. Aber nun hatte ich das Gefühl, dass das Gift des Knastes diesen Teil aus mir hinausgeätzt hatte. »Seit wann interessierst du dich für so was?«
»Ich brauchte Fachwissen, damit ich das Richtige für dich kaufe.« Er deutete auf das Paket neben ihm und hob es an. »Willkommen in deinem neuen Leben, Matt.«
»Noch mehr Zeug? Es reicht schon, dass ihr mir eine komplette Garderobe gekauft habt.«
»Pft. Das gehört doch wohl zur Grundausstattung. Das hier«, er tippte auf das Paket, »plane ich schon seit Jahren. Ich wollte dich damit überraschen, wenn du rauskommst.«
Ich nahm neben Vincent Platz. Er stellte das Paket auf dem Tisch ab. Ich starrte es an.
»Es ist keine Bombe, du kannst es ruhig öffnen.«
Ich brummte und klappte vorsichtig den Deckel zur Seite.
»Ist das ... Sind das ... Kameras!« Zwei Stück.
»Ja, und Objektive dafür. Ich hoffe, ich hab die richtigen besorgt.«
Ich zog das Gehäuse heraus und drehte es in der Hand herum. »Scheiße, Vinc, die kosten zusammen vorneweg an die zehntausend Dollar!«
»Ist mir nicht entgangen.«
»Woher zum Teufel hast du so viel Kohle? Hat Amy das bezahlt?«
»Nein.« Er verlagerte sein Gewicht von einer Seite auf die andere und rieb sich über den Nacken. »Das Geld ist von der Studie.«
»Was?«
»Ich hab es dir nicht erzählt, weil ich es unpassend fand, als du noch im Gefängnis warst. Ich bekomme nicht nur Gesundheit durch das hier.« Er zeigte auf seine Augen. »Ich werde auch bezahlt, und das ziemlich gut. Nach jeder Behandlung überweisen sie mir Geld. Dafür muss ich natürlich akribisch Buch führen und jede noch so kleine Nebenwirkung aufschreiben. Außerdem geb ich Blut- und Urinproben ab, das volle Programm eben.«
»Das ist ... Was?« Ich rieb mir über die Stirn, erinnerte mich daran, dass Stanley, der mich aus dem Knast geholt hatte, sagte, sie hätten mir ebenfalls ein Konto eingerichtet. Noch hatte ich keinen einzigen Blick darauf geworfen.
Ich starrte auf die Kameras, von denen ich früher nicht einmal gewagt hätte zu träumen. Und dazu die besten Objektive. »Ich bin ... Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
Er legte eine Hand auf meine Schulter. Ich zuckte zusammen, weil diese Geste so vertraut und fremd zugleich war. »Ich wollte dir eine Freude machen, weil ich weiß, wie viel dir das Fotografieren bedeutet.«
Aber war es noch immer so? Ich presste die Lippen aufeinander. Der Gedanke, eine dieser Kameras in Händen zu halten, ängstigte mich. Nicht weil ich es verlernt hatte, sondern weil ich fürchtete, diese alte Leidenschaft zu beschmutzen. Die Fotografie war immer etwas Reines, Pures für mich gewesen. Ich hatte alles um mich herum vergessen können, war verloren gewesen in dieser Welt aus Lichtern und Farben. Ich hatte durch Bilder geträumt, meine Seele festgehalten, Augenblicke konserviert. Was, wenn es jetzt nicht mehr so war?
Ich schloss die Augen, und natürlich war da sofort wieder Rose. Wir. Die Lichtung. Bilder. Sonne und Küsse und sehr viel Unbeschwertheit.
Ich schüttelte mich und schloss das Paket. »Das kann ich nicht annehmen.«
»Natürlich kannst du das.«
»Nein, ich bin nicht ... Das geht nicht. Spar dein Geld für wichtigere Dinge.«
»Du bist wichtig. Du bist der andere Teil meiner Seele. Ich hab dich vermisst und ich freu mich, dass du wieder da bist. Mehr als Worte je ausdrücken könnten.«
»Ich freu mich auch, aber das hier ... Es ist zu viel. Ich ... Ich kann das nicht.« Ich stand auf, warf dabei fast den Stuhl um und durchquerte den Essbereich.
»Matt.«
Ich drehte mich nicht um, stapfte einfach weiter Richtung Ausgang. Amy kam mir auf halbem Weg entgegen. Sie blieb am Fuß der Treppe stehen, die Haare noch feucht vom Duschen.
»Alles in Ordnung?«
»Ein Scheiß ist in Ordnung.« Ich riss die Tür auf, trat ins Freie, wo mich das grelle Morgenlicht blendete. Auf einmal wurde mir alles zu viel. Die Freiheit. Die frische Luft. Die Möglichkeiten.
»Yo, Kreese! Bleib stehen, wir haben Geschäfte zu erledigen.«
Maddocks Stimme dröhnte in meinem Schädel. Ich fasste mir an die Schläfe, eilte weiter. Nach links, die Straße runter, nach rechts, weiter. Keine Ahnung, wohin.
»Wir brauchen einen Kurier. Du bist perfekt dafür geeignet.«
Das Dröhnen in meinem Kopf wurde lauter. Ich roch den süßlichen Qualm vom Pott, die Ausdünstungen der anderen, die abgestandene Luft, fühlte das beengte Leben. Es fraß sich in meine Zellen, würgte mich, bis ich kaum noch atmen konnte.
»Mal sehen, ob dich das Loch wieder zur Vernunft bringt.«
Ich taumelte, jemand hupte, ich zuckte zusammen und sprang erschrocken zurück auf den Gehsteig. Die Frau im Auto warf mir einen grimmigen Blick zu, ehe sie an mir vorbeirauschte.
Ich hielt inne, blickte mich das erste Mal um, seit ich losgelaufen war. Keine Ahnung, wohin diese Straße führte, aber da vorne kam ein Bus an der Haltestelle an. Ohne weiter darüber nachzudenken, eilte ich darauf zu, winkte dem Fahrer, damit er wartete, und stürzte beinahe in das Gefährt. Ich zahlte mit der App auf meinem Handy, die mir natürlich auch Amy eingerichtet hatte, und ließ mich benommen auf einen der hinteren Sitze sinken. Dort lehnte ich den Kopf gegen die Scheibe. Mein Atem kam stoßweise, mir rann der Schweiß den Rücken hinunter. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als einen Joint.
Und ein langsameres Leben. Eins, das mich nicht mit all der Harmonie und Liebe erdrückte, eins, mit dem ich umgehen konnte, in dem ich mich wohlfühlte.
Und in dem mein Bruder noch mein Bruder war.
2. Kapitel
Rose
Eiskalte Luft flirrte um meinen Körper, strich über meine Haut, drang unter meine Kleidung und in meine Seele. Die Welt war zu einem Kaleidoskop aus Licht, Schatten und Farben geworden. Ich war losgelöst von allem Irdischen, der Welt, den Menschen, meinen Problemen.
Aber ich war nicht losgelöst von ihm.
Alec klammerte sich mit all seiner Kraft an mich. Seine Hände lagen auf meinem Bauch, seine Arme um meinen Oberkörper, seine Brust drückte gegen meinen Rücken. Wir bewegten uns im Takt der Welten. Galoppierten in diesem wahnwitzigen Tempo der Zeit. Unter mir pulsierte die Kraft meines Parsumis. Er hatte alle Grenzen überschritten und trug uns um den halben Erdball unserem Ziel entgegen.
Zurück nach Hause.
In der Ferne erkannte ich das Ende. Das Portal würde uns gleich ausspucken und in die Realität werfen. Eine Realität, in der Alec und ich gegen die Regeln der Seelenwächter verstoßen hatten.
Wir hatten unschuldigen Menschen geholfen, ihre Freiheit wiederzuerlangen. Wir hatten sie zurück auf ihre Insel gebracht, uns eingemischt, wo wir hätten wegschauen sollen. Der Preis war hoch gewesen. Alec war verletzt. Noch immer klaffte die Wunde in seinem Bauch, und das Gift des Titaniumpfeils, den er abbekommen hatte, waberte in seinem Blut. Auch mir tat alles weh. Meine Schulter. Mein Bauch. Meine Muskeln. Mein Herz.
Vor allen Dingen mein Herz.
Die Narbe, die sich quer darüber zog, pochte und hämmerte gegen meine Seele.
Wir hatten das Verbotene getan.
Wir hatten uns in das Leben fremder Menschen eingemischt.
Wir hatten gekämpft. Für sie und gegen sie.
Und es hatte sich so gut und so richtig angefühlt.
Das Licht wurde greller, der Sog stärker. Ich presste die Knie gegen Petes Flanke, weil der Ausstieg aus dem Portal manchmal holprig wurde. Alec stöhnte vor Schmerz. Er spannte die Muskeln, seine Hände packten fester zu, und kurz flackerte die Angst in mir hoch. Nicht meine. Seine. Als Empath konnte er seine Emotionen auf mich übertragen oder mir meine nehmen. Alec hatte sehr viel Furcht getankt in diesen letzten Stunden. Sicher waberte sie noch durch seine Seele und suchte ein Ventil.
Es knallte laut, Pete machte einen Satz, kam ins Straucheln, fing sich aber zum Glück wieder. Er schnaubte schwer, kam sichtlich an seine Grenzen. Er war genauso verwundet worden wie wir und brauchte dringend eine Pause.
Neben mir knallte es noch mal, und Alecs Parsumi Quinn schoss ebenfalls aus dem Portal.
Alec lockerte seinen Griff, als wir langsamer wurden, und fast augenblicklich ließ die Angst in mir nach. »Tut mir leid. Ich wollte dir das nicht schicken.«
»Schon gut. Ich trag das gern für dich mit.«
Er brummte, sein warmer Atem streifte meinen Nacken und löste eine Gänsehaut aus. Ein angenehmes Kribbeln wanderte von meinem Bauch her durch meinen gesamten Körper. Alec und ich hatten nun zwei dieser Abenteuer hinter uns. Erst hatten wir Darius, einem Kellner, der seinen Job verloren hatte, geholfen und jetzt diesen Menschen aus Nias.
Ich parierte zum Schritt durch, tätschelte Pete den Hals und strich die Eiskristalle aus seiner Mähne. Auch auf meinem Körper schmolzen sie bereits.
Unser Anwesen zeichnete sich als Umriss vor dem Sonnenuntergang ab. Die Vögel zwitscherten, die Luft roch angenehm mild nach Sommer und Leichtigkeit. Es war schön und gleichermaßen beunruhigend, wieder hier zu sein. Alec löste eine Hand von meinem Bauch, jetzt da wir nur noch im Schritt gingen. Die Stelle prickelte sanft und hinterließ Kühle, wo vorher Wärme gewesen war.
»Ich freu mich auf ’ne Flasche Heilsirup. Oder am besten gleich zwei«, sagte er.
»Tut es noch sehr weh?«
»Durch den Ritt blutet die Wunde wieder, aber es ist auszuhalten. Ich geh den Rest zu Fuß.« Alec wollte absteigen, doch ich kam ihm zuvor.
»Bleib sitzen. Ich laufe.« Ehe er widersprechen konnte, sprang ich ab. Kaum spürte ich festen Boden unter meinen Füßen, schwankte ich auch schon. Schwindel schoss mir durch den Kopf, und für den Bruchteil einer Sekunde hörte ich eine lachende Frau. Hell und klar und sehr weit weg. Ich drehte mich um, aber da waren nur das Rauschen des Windes und das Rascheln der Blätter.
»Alles in Ordnung?«
»Hast du das eben gehört?«
»Nein. Was?«
Ich lauschte noch mal, aber es blieb still. Mein Herz pochte allerdings schneller, und eine nagende Unruhe kroch in meinen Bauch. Ich hatte das Gefühl, dass jemand hinter mir stand und mich beobachtete. »Glaube, ich schnappe Gedanken von anderen auf.«
»Deine Sinne sind überdreht. Was kein Wunder ist, nach allem was wir erlebt haben.«
Ich schüttelte mich und folgte dem ausgetretenen Pfad zu unserem Anwesen. Es war ein gigantisches Areal, umfasst von einer hellen Mauer. Wir hatten verschiedene Ein- und Ausgänge, und da wir nicht mitten durchs Haupttor marschieren wollten, wählten Alec und ich eine der Holztüren an der Seite. Kaum passierten wir die Schwelle, merkte ich schon das sanfte Kribbeln der Schutzzauber.
»Bleiben wir eigentlich bei unserem Plan?«, fragte ich. »Wir erzählen Kala und Daniel, was vorgefallen ist. Danach gehen wir zurück in die Lagerhalle in San Francisco, suchen nach dem Dolch und diesen Leuten, die uns angegriffen haben, damit wir ihnen die Erinnerung nehmen können.« Und sobald wir mehr Infos hatten, konnten wir dem Rat alles beichten – oder auch nicht. Je nachdem, wie schlimm die Lage war.
»Ja.« Alec stöhnte und rieb über die Wunde an seinem Bauch. »Ich brauch nur echt erst Heilung.«
»Natürlich.« Wie Kala und Daniel wohl darauf reagieren würden? Ich musste daran denken, was Alec mir vorhin über sie erzählt hatte, als wir noch auf der Insel Nias gewesen waren. Wie Kala vor Jahren mit Prue und anderen Seelenwächtern gegen etliche Regeln unserer Welt verstoßen hatte und dafür bestraft worden war. »Vielleicht wäre es klug, wenn wir Kala und Daniel nichts von den Flüchtlingen erzählen. Ich will nicht, dass sie Ärger deshalb …«
Alec machte ein Geräusch, das mich innehalten ließ. Ich blickte zu ihm. Er deutete mit einem Nicken rüber zur großen Wiese, wo zwei Parsumi grasten, die eigentlich nicht hier lebten. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter.
»Oh, Scheiße.«
Will und Anna waren hier.
»Geh in den Stall«, sagte ich sofort. »Versorg die Parsumi und dich, ich lote die Lage aus.«
»Aber …«
»Geh. Ich schaff das.«
Alecs Mund klappte auf, er verzog das Gesicht und nickte schließlich.
»Ich komm so schnell ich kann zurück. Erzähle niemandem etwas ohne mich, klar?«
»Ja.«
Alec seufzte, führte die Parsumi aber Richtung Stall. Ich blickte ihm nach, atmete erst mal durch und setzte meinen Weg zum Haus fort. Es herrschte reges Treiben, viele Seelenwächter trugen bereits ihre Kampfmonturen, um auf die Jagd zu gehen, aber alle strömten zur großen Versammlungswiese. Ich schloss mich den Leuten an und hielt nach Kala und Daniel Ausschau.
»Hey, Rose«, sagte Kristjan auf einmal neben mir.
»Hab gerade keine Zeit für dich und deine Sticheleien.«
»Ich wollte nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Du siehst aus, als wärst du von einer Parsumiherde überrannt worden.«
Ich runzelte die Stirn. »Du brauchst dich nicht einzuschleimen. Frag einfach, weshalb Will und Anna hier sind, das ist doch der Grund, warum du mich gerade von der Seite anquasselst.«
Ein zaghaftes Lächeln zuckte an seinen Mundwinkeln. Er überholte mich und versperrte mir den Weg. Ich schnaubte und war kurz davor, ihn einfach wegzuschieben, aber der Ausdruck auf seinem Gesicht ließ mich innehalten. Mir fiel der Moment im Training ein, als ich für einige Sekunden in seinen Gedanken gewesen war und einen Blick auf seine Vergangenheit hatte erhaschen können. Wieder sah ich den kleinen Jungen, der mit nackten Beinen weinend auf dem Boden in Reiskörnern hatte knien müssen.
»Ich weiß nicht, warum Will und Anna hier sind«, sagte ich weicher und sah hinüber zu den beiden. Sie waren von einigen Seelenwächtern eingekreist. Ihre Gesichter wirkten angespannt und ernst. Den Ausdruck kannte ich. Genauso hatten sie mich damals angeschaut, als sie erkannt hatten, dass ich sie hintergangen hatte. Ich schluckte trocken. Meine Narbe pochte sofort und zog dumpf.
Kristjan trat näher an mich heran. Der Geruch nach Erde stieg mir in die Nase und löste ein wohliges, ruhiges Gefühl in mir aus. »Ich wollte nicht fragen, warum die beiden hier sind.«
»Ach ja?«
»Ich würde mich gern in Ruhe mit dir unterhalten. Irgendwann. Ich glaube, wir beide hatten nicht den besten Start und …«
»Rose!«, hörte ich Daniels Stimme über die Menge hinweg. Ich wandte mich zu ihm.
»Sorry«, sagte ich zu Kristjan, schob ihn zur Seite und eilte Daniel entgegen. Kaum erreichte er mich, lag ich auch schon in seinen Armen.
»Es tut mir so leid!«, sagte er.
»Was?«
Er drückte mich so fest, dass etwas in meinem Rücken knackte.
»Dass ich vorhin so zickig war. Bei unserem Gespräch.«
»Oh.« Er hatte mich vorhin von Nias aus angefunkt, weil Alec und ich noch lang allein unterwegs gewesen waren. Dabei hatte ich Daniel ins Gesicht gelogen, weil ich ihm persönlich alles erklären wollte, was Alec und ich getan hatten, und nicht über unsere Elemente. »Schon ... schon gut. Ich muss mich eher bei dir entschuldigen.«
Daniel schob mich von sich, hielt mich aber an den Schultern fest. »Es ist nicht leicht für mich, meinen Platz in einer Gruppe zu finden. Daher reagiere ich schnell über, wenn ich das Gefühl habe, ausgeschlossen zu werden. Du bist natürlich nicht daran schuld, dass es mir so geht! Du bist super. Cool. Hübsch – nicht, dass das eine Rolle spielt, und du hast es drauf. Ich bin froh, dass du ein Teil unseres Teams bist.«
Ich biss mir auf die Unterlippe und überlegte, wie Daniel reagieren würde, wenn er die Wahrheit erfuhr.
»Ist noch so ein Ding aus meiner Menschenzeit«, fuhr er fort. »Ich war nie wirklich ... Es ist schwer ... Ich war immer der Außenseiter, okay? Deshalb triggert es mich, wenn ich das Gefühl hab, dass meine Freunde Dinge ohne mich unternehmen. Ich bemühe mich, es abzustellen.«
»Das musst du nicht. Wenn es dir nicht gut geht, teil uns das mit. Tut mir leid, dass ich dir das Gefühl überhaupt vermittelt habe.«
Er seufzte und blickte mich erleichtert an. »Dann ist wieder alles gut?«
Ich verlagerte mein Gewicht von einem Bein auf das andere. »Wir sollten in Ruhe reden. Du. Kala. Alec und ich. Wir müssen euch …«
Ein greller Lichtblitz durchzuckte den Himmel, kurz darauf knallte es und Akil trat mit seinem Parsumi aus dem Portal. Ein Raunen ging durch die Menge, ich merkte, wie viele der Anwesenden sich anspannten.
»Mal sehen, was Akil heute anhat«, hörte ich jemanden hinter mir flüstern.
»Hoffentlich was, worin man seine Muskeln gut erkennt«, antwortete ein anderer.
»Nachher«, sagte ich zu Daniel und griff nach seiner Hand. Er drückte meine Finger und sandte seine naturgegebene Wärme meinen Arm hinauf.
Akil galoppierte an die Stelle, wo Will und Anna warteten. Er bremste neben ihnen ab, strich sich die Eiskristalle von den Schultern und blickte sich um. Auch in Akils Gesicht standen Anspannung und Sorge geschrieben. Die kinnlangen Haare waren verstrubbelt von dem Ritt zwischen den Welten.
»Tut mir leid, dass wir euch vom Jagen abhalten«, sagte Akil laut genug, dass es alle hören konnten. Er sprang elegant von seinem Pferd und trat vor die Menge. »Aber heute wird das ausfallen.«
»Was?«, rief jemand.
»Warum denn?«
»Was ist passiert?«
Akil hob die Hände, die Stimmen verebbten. Er rang sichtlich um Fassung, und nun machte ich mir wirklich Sorgen. »Gestern gab es ein Unglück. Wir ... wir haben zwei Seelenwächter verloren.«
Das Raunen, das dieses Mal durch die Menge ging, zeugte nicht mehr von Bewunderung.
»Bei allen Elementen«, sagte jemand.
Mir wurde übel und schwindelig gleichzeitig. Die Bilder unseres Kampfes schossen mir durch den Kopf. Wie Alec und ich verwundet worden und nur knapp davongekommen waren.
»Es hat Jayne und Jon erwischt«, sagte Akil.
»Was?«, rief Prue einige Meter vor mir. Ich hatte sie bisher gar nicht bemerkt, aber jetzt entdeckte ich ihre dunklen Haare in der Menge. »Das kann nicht sein.«
»Leider doch«, sagte Akil.
Jon.
Der Jon, von dem Alec mir im Lagerhaus erzählt hatte? Der früher ein Teil von Prues und Kalas Team gewesen war?
»Es sollte ein Routineeinsatz sein. Leider ist er ausgeartet, weil sie gefeiert haben und …« Akil schüttelte den Kopf. »Ich hab ja echt nichts dagegen, wenn ihr es mal krachen lasst, und verstehe, dass es manche von euch brauchen. Ihr seid hier nicht gefangen, ihr dürft am Leben teilnehmen, aber reißt euch bitte zusammen und passt auf! Ist das echt so schwer? Klar nerven die Regeln! Doch sie sind zu eurem Schutz da, nicht um euch einzuschränken. Wenn ihr zu übermütig werdet und so einen Scheiß abz…«
»Akil«, erklang Wills ruhige Stimme. Er schüttelte den Kopf und Akil stieß einen Fluch in seiner Muttersprache Persisch aus.
»Was passiert ist, ist schlimm«, sprang Will ein. »Jon, Jayne, Amelia und Kenji waren auf einem Einsatz und sind danach in eine Bar, wo sie so viel getrunken haben, dass sie kaum noch gerade gehen konnten. Schattendämonen sind ihnen gefolgt und haben sich dort auf die Menschen gestürzt.«
Ich blickte mich nach Amelia und Kenji um, aber sie waren nirgendwo zu sehen.
»Bis auf Weiteres wird es keinen Titaniumstaub mehr für euch geben«, sagte Akil. »Und wehe, ich erwische einen, der das Zeug von seinen Waffen kratzt. Mir ist durchaus klar, dass ihr Wege kennt, euch den Staub zu beschaffen.«
»Jon und Jayne sind mittlerweile im Ratstempel aufgebahrt«, sagte Will ruhig. »Amelia und Kenji sind bereits dort, um in Ruhe Abschied von ihren Teammitgliedern zu nehmen. Wir werden sie heute nach Seelenwächtertradition im Beisein der gesamten Gemeinschaft beerdigen. Alle Einsätze sind für drei Tage gestrichen. Wir treffen uns heute Abend im Ratstempel für die Beerdigung.«
Stille legte sich über uns, nur durchbrochen von dem Rauschen des Windes und dem Zwitschern der Vögel. Jemand schluchzte.
»Das war erst mal alles.« Kaum war Will fertig, ging das Gerede los. Viele strebten zu den dreien, vermutlich, um mehr Einzelheiten zu erfahren.
»Wie furchtbar.«
»Hab mit einigem gerechnet, aber nicht damit.« Auch Daniels Miene war blass und leblos geworden.
»Weißt du, wo Kala ist?«
»Vorhin war sie da vorne irgendwo.« Er deutete nach rechts, aber es herrschte so viel Gewusel, dass ich sie nicht sah. Alle plapperten wild durcheinander, fragten, wie und wo es passiert war.
Auf einmal fröstelte es mich. Ich schlang die Arme um meinen Körper. Meine Narbe pochte und ich merkte wieder dieses komische Kribbeln im Bauch, das ich auch am Hafen wahrgenommen hatte, kurz bevor wir die Leute in dem Verschlag gefunden hatten. Ich strich mit der Hand darüber und versuchte herauszufühlen, was es zu bedeuten hatte, aber ich konnte es nicht richtig greifen. Es war, als würde sich ein Teil von mir freuen, dass heute zwei Seelenwächter gestorben waren.
****
Wie wundervoll.
Wie lebendig.
Wie echt.
Ihr gebt mir so viel.
Nährt mich.
Stärkt mich.
Ich danke euch.
Meine einzigartigen Kinder.
Bald ist es soweit.
Bald seid ihr nicht mehr allein.
3. Kapitel
Matthew
Ich hockte auf einer Bank, löste Teile des Brötchens, das ich in der Hand hielt, und warf sie den Tauben hin, die sich um mich versammelt hatten. Sie gurrten und stritten sich um die Beute, eine hackte der anderen in den Nacken, als diese nicht schnell genug aus dem Weg kam. Ich schnaubte, zerbröselte das letzte Stück und verteilte es großzügiger, sodass alle etwas abbekamen. Mit einem Seufzen lehnte ich mich zurück, legte den Kopf auf die Lehne der Parkbank und atmete die warme Luft ein.
Ich war irgendwo Downtown in Chicago. Als der Busfahrer gesagt hatte, ich müsste aussteigen, weil wir die Endstation erreicht hatten, hatte ich es einfach getan und war seither ziellos umhergezogen. Touris und Einheimische wuselten um mich herum, Geschäftsleute, die mit dem Handy am Ohr an mir vorbeifegten, Gruppen, die Selfies schossen und ganz entzückt über das schöne Wetter waren. Überall irrten Leute durch die Straßen, versuchten, ihre Termine einzuhalten und ihren Träumen nachzujagen. Sie waren ein Teil dieser Gesellschaft und hatten ihren Platz gefunden. Im Gegensatz zu mir.
Dafür beruhigte mich das Lärmen der Stadt, mit dem ich erstaunlicherweise besser klarkam als mit der Stille zu Hause. Das Rufen und Hupen, der Gestank nach Abgasen und Müll – ich mochte es.
Mein Handy klingelte. Ich zuckte zusammen. Bestimmt war es wieder Vincent. Er hatte mich schon viermal angerufen, seit ich aus dem Haus gestürmt war. Ich hatte nicht abgenommen, ihm nur kurz zurückgeschrieben, dass ich meine Ruhe brauchte und wir später redeten. Seither schickte er mir Nachrichten. Es tat ihm leid, wenn er mich überrumpelt hätte, er hätte mir nur eine Freude machen wollen, ich sollte mir Zeit nehmen und so weiter.
Hinter meiner Stirn pochte es. Ich rieb darüber, ignorierte das Gebimmel meines Handys und atmete durch. Mit einem Mal kam mir alles so sinnlos vor. Seit Jahren wünschte ich mir, endlich aus dem Knast zu kommen, damit ich mit meinem Bruder zusammen sein konnte, und nun hatte ich genau das. Mehr noch: Er konnte wieder sehen! Er hatte Geld, ein schönes Heim. Wir bekamen das, was uns seit dem Tod unserer Eltern verwehrt geblieben war. Dennoch konnte ich mich nicht darüber freuen und zerging lieber in diesem elenden Selbstmitleid.
»Hey, Matthew«, sagte auf einmal jemand neben mir.
Ich zuckte vor Schreck zusammen, ballte automatisch die Hände zu Fäusten und wollte reflexartig von der Bank aufspringen.
»Ich bin’s nur.«
Ich blinzelte, rieb mir über die Augen und starrte den Mann an, der sich gegen den blauen Mittagshimmel abhob. »Bishop?«
Er lachte leise und trat näher. »Schön, dich zu sehen.«
»Ich ... Du …« Ich blickte mich um. »Was machst du denn hier?« Mein Magen zog sich zusammen, weil ich Bishops Stimme nur mit dem Knast in Verbindung brachte. Mir stieg Güllegeruch in die Nase, der Lärm um mich herum schien lauter zu werden.
Er nahm sein Handy aus der Tasche und deutete auf das Display. »Hab dich eben angerufen, aber du bist nicht rangegangen, also hab ich deinen Standort getrackt.«
»Du hast was?«
»Wollte ein bisschen mit dir plaudern, und wie es der Zufall so wollte, warst du sogar in der Nähe.«
»Und da trackst du mich einfach?«
»Hey, wenn du nicht willst, dass ich dich aufspüren kann, musst du das abstellen. Im Moment teilst du deinen Standort mit deinen Kontakten.«
»Ich hab nicht drauf geachtet.«
»Darf ich?« Er deutete auf die Bank neben mir. Ich nickte und machte ihm Platz.
Bishop hatte sich verändert. Auf seiner Glatze wuchsen ebenfalls die Haare nach, er trug dunkelblaue Jeans, saubere Schuhe, ein maßgeschneidertes Hemd, darüber ein schickes Sakko. Auch seine Hände wirkten gepflegt, die Fingernägel schienen frisch manikürt. Ich musterte ihn unverhohlen, versuchte diesen Bishop mit dem aus dem Loch in Verbindung zu bringen, mit dem Typen, der jede Nacht vor Angst so laut geschrien hatte, dass jeder von uns um den Schlaf gebracht war.
»Danke für deine Hilfe unten im Loch. Das werde ich nicht vergessen.«
Bishop griff in die Innentasche seines Sakkos und zog eine Packung Zigaretten heraus. Er bot mir eine an. Ich nahm sie sofort. Er steckte sich ebenfalls eine in den Mund, zündete seine und meine an. Schon beim ersten Inhalieren merkte ich, dass es kein gewöhnlicher Tabak war.
»Was …«
»Gut, oder?«
Ich nahm einen weiteren Atemzug und schloss die Augen. »O Gott, ja.«
Bishop lachte. »Lass dich bloß nicht erwischen, die Bullen in Chicago sind nicht so tolerant wie die im Knast.«
Ich inhalierte erneut, genoss den süßlichen Rauch und den leichten Schwindel, der sich einstellte.
»Ich mach die selbst. Hier.« Er gab mir die Packung. Die Dinger waren auf den ersten Blick nicht als Joints erkennbar. »Hab noch genug davon.«