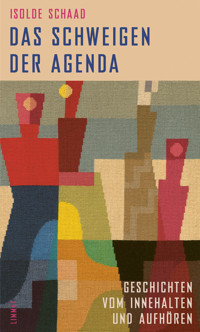
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch eine Jugendrevolte bleibt nicht ewig jung, die Revolutionärinnen beginnen die Haare zu färben, dann hören sie damit wieder auf und beugen sich über ihre Patientenverfügung. Sie sitzen am Fenster und schauen von oben auf das Leben, das nicht mehr ihres ist. Es findet in weissen Turnschuhen statt, mit blossen Knöcheln in überlangen Mänteln, Jogging-Dresses und Strickmützen. Seit Jahrzehnten wirft Isolde Schaad ihr Argusauge auf die akuten gesellschaftlichen Vorgänge, ihre eigene Generation eingeschlossen. Ein satirisches Auge, wenn die Bürogemeinschaft, die über vollen Aschenbechern den Journalismus revolutioniert, dann in die Falle der eigenen Fantasie tappt. In kaltem Licht erscheint der frühe Tod der Jahrhundertkünstlerin Sophie Taeuber-Arp, wenn ein lokales MeToo-Komitee ihn als Kriminalfall aufrollt. Ob nun eine ältere Dame am Grab der besten Freundin um die ausbleibenden Tränen bittet oder überm Ozean ein berühmter Grossschriftsteller den ersten Tag nach dem Schreiben begeht, immer erfrischt das Erzählen von Isolde Schaad mit maliziösem Humor und menschenfreundlicher Ironie. Und dazwischen funkt als Warnung vor der ausbleibenden Genderkorrektheit die allerneueste Auflage des Grossen Duden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Auch eine Jugendrevolte bleibt nicht ewig jung, die Revolutionärinnen beginnen die Haare zu färben, dann hören sie damit wieder auf und beugen sich über ihre Patientenverfügung. Sie sitzen am Fenster und schauen von oben auf das Leben, das nicht mehr ihres ist. Es findet in weißen Turnschuhen statt, mit bloßen Knöcheln in überlangen Mänteln, Jogging-Dresses und Strickmützen.
Seit Jahrzehnten wirft Isolde Schaad ihr Argusauge auf die akuten gesellschaftlichen Vorgänge, ihre eigene Generation eingeschlossen. Ein satirisches Auge, wenn die Bürogemeinschaft, die über vollen Aschenbechern den Journalismus revolutioniert, dann in die Falle der eigenen Fantasie tappt. In kaltem Licht erscheint der frühe Tod der Jahrhundertkünstlerin Sophie Taeuber-Arp, wenn ein lokales MeToo-Komitee ihn als Kriminalfall aufrollt. Ob nun eine ältere Dame am Grab der besten Freundin um die ausbleibenden Tränen bittet oder überm Ozean ein berühmter Großschriftsteller den ersten Tag nach dem Schreiben begeht, immer erfrischt das Erzählen von Isolde Schaad mit maliziösem Humor und menschenfreundlicher Ironie. Und dazwischen funkt als Warnung vor der ausbleibenden Genderkorrektheit die allerneueste Auflage des Großen Duden.
Foto Ayșe Yavaș
Isolde Schaad, geboren 1944 in Schaffhausen, lebt seit 1967 in Zürich und gehört zu den namhaften Schweizer Autorinnen der 68er-Generation. Ihre Spezialität ist die kritische Gesellschaftsbetrachtung, die sie mit Scharfsinn, Humor und hohem sprachlichen Können ausführt. Ihre mehrfach preisgekrönten Bücher erscheinen seit 1984 im Limmat Verlag, zuletzt «Giacometti hinkt. Fünf Wegstrecken, drei Zwischenhalte. Erzählungen». Im Frühjahr 2014 erhielt sie für ihr literarisches und publizistisches Schaffen die Goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich.
Isolde Schaad
Das Schweigen der Agenda
Geschichten vom Innehalten und Aufhören – im Auge des großen Duden, Neudeutscheste Fassung
Limmat VerlagZürich
Für meine Mutter
Inhalt
Leitmotiv
Im inneren Ausland
Der große Duden, neudeutscheste Fassung
Eine Andere
Der letzte Kameltreiber
Der große Duden, neudeutscheste Fassung
Verfehlte Anklage
Der große Duden, neudeutscheste Fassung
Der Tag danach
Der große Duden, neudeutscheste Fassung
Das Schweigen der Agenda
Der große Duden, neudeutscheste Fassung
Leitmotiv
Aufhören! Dieser Zeigefinger auf den Jahrgang, dieser Imperativ des Kalenders, der uns als ausgemustert anzeigt – was tun wir, wenn die Endlichkeit an die Türe klopft? Ergreifen wir die Flucht nach vorn, eine, wie es heute heißt, proaktive Maßnahme, um sich gegen Enttäuschung und Resignation zu schützen? Aufhören, der schwerste Anfang.
Alte Frauen schauen zum Fenster hinaus, die Umwelt im Blickfeld.
Sie möchten den Anschluss an das Leben nicht verpassen, denn das Leben spielt sich jetzt außerhalb ihrer Wohnung ab, sie stellen sich vor, von oben, aus der Vogelschau den Überblick zu haben, aber das Leben, das sie von oben erblicken, ist nicht mehr ihres, es findet in weißen Turnschuhen statt, mit bloßen Knöcheln in überlangen Mänteln, Joggingdressen und Strickmützen. Die Eleganz, die ihre Generation gepflegt hat, ist verschwunden, Eleganz ist ein Fremdwort geworden.
Alte Frauen werden übersehen, es sei denn, sie sind Künstlerinnen, die oft erst im Alter eine blendende Karriere hinlegen, Stichwort Louise Bourgeois. Als Autorinnen sind sie hingegen bloß das unscheinbare Pendant zu den überaus präsenten alten weißen Herren, die von jungen Genderbewegten, von farbigen Zeitgenossinnen abgetischt werden wollen. Alte weiße Frauen? Ein Seitenwagen der MeToo-Bewegung, die einen neuen Sexismus entfacht? Das könnte noch kommen. Bald werden alte weiße Frauen eine identitäre Minderheit sein, die dann jemand für schützenswert erklärt. Dann kommen sie in den Zoo der Genderkorrektheit. Das ist nicht der Himmel, oh nein.
Aufhören, der schwerste Anfang.
Aufhören, die Haare zu färben.
Aufhören, High Heels zu tragen.
Aufhören, wütende Pamphlete in die Maschine zu hämmern, oder Leserbriefe zu verfassen, die dann doch im Papierkorb landen.
Aufhören, die Kalorien zu zählen, aufhören, abnehmen zu wollen, abnehmen als der seit Jahrzehnten diktierte verinnerlichte Weiblichkeitsreflex.
Aufhören, von alpinen Landschaften zu träumen, die man in Schneeschuhen überquert.
Aufhören, Reisen zu planen, die seit Jahren auf der Pendenzenliste stehen, das Gebirge, den Gipfel, das Land, die Stadt der Sehnsucht zu sehen, bevor es zu spät ist. Es ist längst zu spät.
Überhaupt aufhören mit den unstillbaren Wünschen, etwa nach einem unsichtbaren, lautlosen Heinzelmann, der alles Unangenehme stillschweigend erledigt, die administrativen Unannehmlichkeiten, die Bürde des Haushalts. Ein Heinzelmann, der mit starken Armen und großem Herzen einfach und arglos ist.
Aufhören mit Widerworten, die sich impulsiv regen und nach außen wollen – anlässlich der haarsträubenden Ansichten, die etwa Gäste äußern, die der Nachbar, sogar die beste Freundin von sich gibt.
Heißt das auch aufhören, sich zu wehren? Gegen Missverstehen, gegen falsche Annahmen, gegen Verleumdungen, gegen abstruse Behauptungen?
Ist dann das Aufhören die kampflose Preisgabe einer Lebenshaltung, die einen rebellischen Charakter mit kritischem Intellekt zusammenballt und bis dato ankert? Wäre dann Aufhören ein Akt der Feigheit, Ingeborg Bachmann würde sagen «die Preisgabe der Tapferkeit vor dem Freund». In ihrem Gedicht Alle Tage ist das Ende der Zivilisation angesagt: «Das Unerhörte ist alltäglich geworden.» Weiterdenken ist gefährlich, weiterdenken führt zur letzten Konsequenz. Die schieben wir in der Vorstellung immer hinaus.
Nehmen wir uns das Handlichere vor. Die Quizfragen, die die Tage der Rentnerin begleiten. Die Kreuzworträtsel-Beschäftigungen, die uns die letzten Fragen vom Leib halten. Wie lautet der Schlusssatz von Thomas Manns Zauberberg? Wie heißt die Hauptstadt von Kolumbien? Wie hieß der Mann, der den Nordpol entdeckte?
Was steht am Ende von Elfriede Jelineks Kinder der Toten, ihrem ungelesenen Monumentalroman?
Von Beethoven, dessen Jubeljahr wegen Corona so ziemlich in die Hosen ging, heißt es, dass er seine Kompositionen nicht abzuschließen wusste; am wenigsten gelang ihm das bei seinen Klavierkonzerten, die sich ins Finale stürzen, dort in ein brausendes Crescendo steigern bis zum erwartbaren Schlussakkord, der noch und noch einen draufgibt; das Hämmern hört nicht auf. Der Mann soll tagelang um seinen geliehenen Flügel herumgestampft, gewütet haben, weil ihm kein plausibler Schluss einfiel. Diese zur schnöden Anekdote geronnene Annahme ist zu bezweifeln.
Weiter. Wie lautet die letzte Zeile von Goethes Wahlverwandtschaften, einem Schlüsselwerk der Moderne? Wie schließt Marcel Proust seine nicht enden wollende Suche nach der verlorenen Zeit ab? Hat er sie überhaupt abgeschlossen? Robert Musils unvergänglicher Roman Der Mann ohne Eigenschaften hat nie einen Schluss gefunden, er gilt als unvollendet, obschon kein Leser, keine Leserin einen Schluss vermisst. Das Ende ist schwieriger als der Anfang, das ist keine sklerotische Altersweisheit.
Werden wir persönlich: Wann haben Sie aufgehört, Französisch zu lesen oder sich ein Buch auf Spanisch vorzunehmen? Warum quittierten Sie den Konversationskurs in Englisch? War’s die Aussichtslosigkeit, vorwärtszukommen, oder der Umstand, dass die Lektüre mit Wörterbuch wesentlich an Reiz verliert?
Warum haben Sie aufgehört, ein Instrument zu spielen? Ist es die Frustration über das Unvermögen oder die Erkenntnis, dass Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis stehen?
Wann haben Sie sich entschlossen, den Führerschein abzugeben? War der Anlass die Vernunft oder der Druck der Öffentlichkeit?
Haben Sie aus eigenem Antrieb mit einer Tätigkeit, mit einem Ansinnen, mit einem Verhalten aufgehört oder wurde Ihnen nahegelegt, damit aufzuhören?
Diese Erwägungen liefen mir durchs Vorderhirn, als ich zur Busstation tappte, mein Knie spürte, diesmal war’s das linke, das nie durch einen Sturz oder eine Verletzung tangiert gewesen war, es muss Arthrose sein, was es zwackt und zwickt, nahm ich an, um das Wort Schmerz zu vermeiden.
Ich stand also an der Bushaltestelle mit diesem Klumpen im Magen, ein schwer zu beschreibendes Unbehagen, das auf die Seele drückt und den Atem flach hält, diese Ganzkörperempfindung des Nichtmehr, des Allesvorbei, die tiefer geht als die manchmal ganz angenehme Nostalgie. Dann hielt mein Blick an der Litfaßsäule nebenan, die ich sonst nie betrachte, doch jetzt fiel mir unter kunterbuntem Popgeschmeiß der ahnungsvolle weißhaarige Kopf mit den verwitterten Zügen auf, ein grantiger Kerl, aber ein Kerl, der eine Gitarre in der Linken hielt und sich als John Mayall herausstellte. So ein alter Sack, dachte ich, was will der hier und heute? Ich war beleidigt, dass dieser ausgelaugte Greis sich erlaubte, mein Jugendidol gleichen Namens zu beschatten, ja, regelrecht zu beschämen. Ich war hingerissen gewesen von der Platte Turning Point, die in mir ausgelöst hatte, was gewöhnlich das ganz große Gefühl heißt, das sonst nur für den berühmten Coup de foudre reserviert ist.
Auch der nicht enden wollende Mick Jagger gefiel mir nicht. Wenn er in seiner provokant lasziven Ledrigkeit vor den Teenies im Hallenstadion herumstakte. Ich rümpfte die Nase, als eine Kollegin fragte: Kommst du mit? Der alte Knabe ist immer noch auf Achse. Nein. Auf keinen Fall. Und ich ging in mich, um nach den Gründen zu fahnden, weshalb diese Oldies, die mich früher begeistert haben, heutzutage anwidern, besonders wenn sie sich in ihrer Erfolgsgeilheit vor der Jugend produzieren.
Und die alten schwarzen Herren? Die störten mich nicht, im Gegenteil, ich empfand den Auftritt von schwarzen Jazzstars jeden Alters als angemessen und würdig, Oscar Peterson etwa oder Erroll Garner, B. B. King oder McCoy Tyner, die durften in alle Ewigkeit auftreten, nicht zu reden von den schwarzen Sängerinnen von Soul und Blues.
Hatte das damit zu tun, dass die schwarzen Jazzmusiker für helle Augen von vornherein neutraler wirken, angezogen und alterslos, während Nacktheit auf der Bühne ein weißes Phänomen bleibt? Außerdem benehmen sich die alten schwarzen Herren des Jazz selten anzüglich dem Publikum gegenüber.
Dann trat ich zurück und fragte mich, weshalb alte weiße Musiker keinen Heranschmeiß-Blues mehr offerieren sollen, der über Jahrzehnte Millionen von Fans beglückt hat. Sie können nicht aufhören. Das irritiert mich. Sie wollen immer noch das Eine, und das Eine ist das Alte. Sie schmeißen sich an die Jugend heran, in himmelhoher Selbstüberschätzung und pochen auf ihren offenbar auf ewig geltenden Kredit. Sprich Sex-Appeal.
Ein schwerwiegenderer Fall war Bob Dylan. Hatte sich das Nobelpreiskomitee in der Kategorie getäuscht oder war das eine schamlose Anbiederung bei der Popularität? Ich konnte nicht fassen, dass das, was ich bisher für eine Festung der Integrität gehalten hatte, über Nacht in sich zusammengekracht war. Und das Nachspiel sprach Bände. War das ein Witz? Eine Verhöhnung all der seriösen Schriftstellerinnen, die ein bedeutendes Stück Weltliteratur verfasst hatten?
Dann, eines Tages, in heftiger Auseinandersetzung mit dem Freund der Freunde wurde ich eines Besseren belehrt. Meine in Blei gegossenen Qualitätsmaßstäbe begannen zu schmelzen, denn als rettungslos konservative Seele denunziert zu werden, tat weh.
Plötzlich sah ich ein, dass es auch befreiend wirken kann, wenn nun in den Künsten der Eklektizismus regiert und daher Äpfel durchaus mit Birnen verglichen werden können. Kriterien ändern sich, gerade und vor allem in dem, was bürokratisch das Kulturschaffen heißt.
Ich stand an der Haltestelle und verpasste den Bus. Tief in Gedanken ging ich zu Fuß. Nein, die Alten sollen, die Alten dürfen, die Alten müssen, war schließlich mein Befund. Aufhören ist keine Option für arrivierte Kulturtäter – international nicht und auch nicht lokal. Nicht für Adolf Muschg oder Franz Hohler, und sie war auch keine für Christa Wolf und Friederike Mayröcker. Währenddessen sich ein Max Frisch schon Ende sechzig fragte, ob sein Schreiben noch etwas tauge. Bekanntlich hat er das vierte Tagebuch nicht autorisiert zur Publikation, es genügte seinem hohen Anspruch nicht. Ob sein Leben ohne Publikation angenehmer war, hätte ich gerne gewusst.
Meine Umfrage schlitterte in die Sackgasse, der Befund war zu vielfältig, die Sachlage zu divers, um eine Theorie daraus abzuleiten. Die Schlussfolgerung war in ungefähr diese: Die Trägheit ist die Mutter des Aufhörens, selten die Einsicht. Der Aufwand, Dinge zu tun, die nicht lebensnotwendig sind, wird mit vorrückendem Alter beschwerlich. So lässt sich das Schreiben, Singsongwriten inbegriffen, bis zum letzten Atemzug durchaus als lebensnotwendig erachten, während das Tragen von hohen Absätzen sich mit der Zeit von selbst erübrigt. Wie so oft in Interviews, waren die Fragen interessanter als die Antworten. Die Erkenntnis, dass das Thema Aufhören linear und entsprechend brutal zum Thema Entsorgung führt, blieb spürbar, doch unausgesprochen. Sie war keine Linderung des Unabänderlichen, das dahintersteht. Das Endgültige.
Im inneren Ausland
Die große Blonde, die ich im Blick habe, um genau zu sein, die ehemalige Blonde, jetzt Blondierte, die neben dem wächsernen Rhododendron sitzt, scheint auf jemanden zu warten. Vorname: Barbara, Nachname: Kunert, Beruf: Übersetzerin, Zivilstand: verheiratet, ein erwachsener Sohn, Habitus: unauffällig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau unrechtmäßig Sozialhilfe bezieht. Sie wurde mir zugeteilt, dabei bin ich ein Greenhorn als Sozialdetektivin, alles andere als ein Traumjob, aber es sei mit meiner Qualifikation der einzige einigermaßen zumutbare, und überhaupt, besser als an der Kasse zu sitzen. Wir treten jetzt ja alle kurz, heißt es beim RAV, der regionalen Arbeitsvermittlung, ich muss froh sein um diesen Job, als studienmüde Dreiviertelsoziologin, dabei habe ich keine Ahnung, wie ich vorgehen soll, trotz des Crashkurses im Observieren.
Die Kunert schreckt plötzlich auf, und ich erschrecke mit ihr. Zum Glück bin ich in Deckung hinter der mit künstlichem Efeu verkleideten Säule. Sie war offenbar in einem Flow der Entrücktheit, und jetzt tut ihr der Hintern weh, denn sie rutscht auf der ketchupfarbenen, leicht wippenden Kunststoffkonstruktion hin und her, Blick auf das Handy, neben der leeren Kaffeetasse. Jetzt steht sie auf und erscheint nach fünf Minuten mit einer zweiten Tasse, in der sie eifrig rührt.
Ich denke, sie wartet auf einen Anruf, wie jeden Dienstag um diese Zeit. So viel habe ich bisher herausgefunden, jeden Dienstag um die gleiche Zeit, am frühen Nachmittag, trifft Kunert eine andere Frau, vermutlich eine Freundin. Nun wartet sie auf deren Anruf, da die andere regelmäßig verspätet ist. Ich zücke das Notizbuch, notiere: Freundin wie jeden Di verspätet, K. wird sichtlich nervös. Ich erwäge, ob ich auch einen Latte von der Theke holen soll, um mich nicht verdächtig zu machen. Verhalten Sie sich wie eine normale Kundin, hieß es im Crashkurs. Was ich bereits weiß, ist, dass die Freundin, eine kleine Dunkle mit grauen Strähnen im Pony, keinen Latte trinken darf, weswegen die Große, Blondierte, Rücksicht nimmt, und das Modegetränk vorher hinunterkippt, nein, falsch, sie trinkt langsam, in kleinen Schlucken, aber jetzt, jetzt hat sie es hörbar eilig und schlürft, da die kleine Dunkle im Anzug ist. Ich kann sie an den klackenden Absätzen erkennen, die in meinen Ohren aufploppen wie der ruchbare Elefant im Raum. Nein, falsches Bild, und überhaupt, die High Heels der Freundin sind ja nicht mein Thema. Die Kunert trägt bequemere Schuhe, halbhohe Lederstiefel von Qualität. Ich notiere: K. trägt teure Bottinen, und setze ein Fragezeichen dahinter. Dann erschrecke ich über mich selbst: Solide Schuhe sollten doch drinliegen, in einem Sozialhilfebudget. Gute Schuhe sind elementar für die Lebensqualität.
Das Unding von einer Sitzgelegenheit quietscht leicht, als die Kunert aufsteht, und die kleine Strähnige umarmt. Hallo Bab, der Bus ist mir vor der Nase abgefahren. Ich bin den ganzen Weg hergelaufen. Die Freundin, außer Atem, reißt das Béret vom Kopf, ich hoffe, du bist nicht sauer.
Gleich hätte ich dich ausrufen lassen.
Echt jetzt?
Ach komm, unser Stammtisch ist leider besetzt, du musst mit dieser Rutschbahn vorliebnehmen.
Ich bin so froh, dass du da bist, Bet, schallt jetzt die Kunert. Ja, sie hat ein schallendes Organ. Dann stecken die beiden die Köpfe zusammen, und ich verstehe Bahnhof.
Bet für Betty, Bettina, Bertha? Das werde ich noch rauskriegen müssen, und wenn ich ihren Nachnamen kenne, könnte der Servility-Check fällig werden. Das ist ein Fachausdruck der Branche für das Befragen von Nachbarn und Freunden. Richtig, eine Zumutung, ja, Observieren ist eine Zumutung, kein Beruf. Aushorchen und schnüffeln, habe ich beruflich so etwas angestrebt? Doch was habe ich für eine Wahl? Putzen bei den Happy Few am Zürichberg wäre die Alternative.
Mal sehen, ob nun zwischen den beiden etwas geschieht. Die Kunert zerknüllt das Staniolpapierchen, in dem die Praline war, die sie aus der Handtasche gefischt hat, hier, in der Imbissecke des erfolgreichen Großverteilers wird nichts gratis gereicht, hier braucht man sich nicht um Kundschaft zu bemühen, die kommt von selber, in Scharen kommt sie, sodass die Frauen im Ausschank oft überfordert sind. Kein Lächeln für die Wartenden an der Theke, jedes außerdienstliche Wort ist zu viel.
Diese Imbissecke des Großverteilers ist ein Stilgemisch von Pomp und Gemütlichkeit, und wohl gerade darum eine Oase der Globalisierung. Allein schon diese tropisch aufgemotzte Tapetenkulisse, ergänzt von lockenden Kübelpalmen, die ein Ferienparadies vortäuschen, zweifellos verkappte Werbung für das Reiseunternehmen Hotelplan, das der Großverteiler unter anderen Unternehmen führt. Die Kübelpalme ist eine sanfte Mahnung an ehemalige Traumdestinationen, die neuerdings verpönt sind, die Klimajugend überschreit sie jeden Freitag.
Ich rücke mit meinem Kaffee an den Nachbartisch vor und versuche, etwas vom Gespräch am roten Wipptisch zu erhaschen. Fehlanzeige, jetzt flüstern die beiden.
Also wende ich mich wieder der Betrachtung der Ausstattung zu.
Jeder Nische ihre eigene Exotik. Sie gewährt eine gewisse Privatheit, die gesucht ist. Verfehlt ist freilich der dekorative Zeigefinger auf die adressierte Kultur, ob goldene Buddha-Statuen, indische Baldachins oder Elefantensafari, die wenigen Subsahara-Afrikaner, die hier verkehren, denken nicht daran, sich in die Werbevision ihrer Herkunft zu setzen. Sie haben andere Sorgen.
Sie waren zu Hause die Hoffnungsträger der Sippe, die ihre Heimat verließen, um in Europa ihr Glück zu machen. Hier werden sie proletarisiert in einem mit Hindernissen gespickten Arbeitsmarkt, dabei gibt ihnen die Bürokratie kaum eine Chance. Jetzt erfahren sie eine Ausweglosigkeit, die den mitgebrachten Ehrenkodex brüskiert; um jeden Preis müssen sie den Schein des Erfolgs wahren, was der Not besondere Blüten abknöpft, nicht selten die kleine und dann die große Delinquenz.
Auch in der Nische mit der fotografisch aufgeblasenen Sphinx sitzt niemand, jedenfalls würdigen sie die zwei unweit davon im Gespräch vertieften Ägypter mit keinem Blick, sie tragen Poloshirts mit dem für Arriviertheit bürgenden Label Lacoste und ihnen ist schnuppe, wo sie sitzen, solange das Menü erschwinglich ist und das Geschäft läuft, hinter dem sie her sind. Denn die Schattenwirtschaft blüht in diesen Gefilden, Kundenberater trifft Offshore-Spezialist und dergleichen, wovon ich zwar keinen Deut verstehe, was aber meine Fantasie anregt. Am redlichsten kommt mir der Beratungsbetrieb vor, der an den Fensterplätzen läuft. Dort findet Sprachunterricht für Sans Papiers und Asylbewerberinnen statt.
Leise, rasch, diszipliniert – als wär’s eine glückende Inklusion! Obschon das Wort schon seine eigene Abschreckung ist. Man will ja nicht in die Kultur eingesperrt werden, deren Sprache man lernt, man will die Freiheit haben, anders zu sein und als Andersheit respektiert zu werden. Deshalb sieht man hier kaum ethnisch gemischte Gruppen. Die Andersheit bleibt unter sich.
Die Kunert und ihre Freundin. Jeden Dienstag um drei Uhr fünf. Oder drei Uhr zehn, eher aber drei Uhr fünfzehn. Das nächste Mal muss es klappen. Das nächste Mal observiere ich die beiden aus einer nahen Polsterbank mit Rückwand. Sie plaudern, doch von den vernehmbaren Äußerungen fällt nichts für mich ab. Also packe ich mein Schreibzeug in meine Tasche und gehe durch die doppelstöckige Verpflegungshalle, die man ebenso gut eine Landestelle der Migration nennen könnte.
Fremde Laute zirkulieren im Pendelverkehr, rundherum versammeln sich Stammesbrüder an ihren Stammtischen, sie sind von einer urtümlichen, geradezu archaischen Ländlichkeit, wo das Patriarchat auch in der Kleiderfrage vorherrscht. Diese bärtigen, vom Überlebenskrampf verschlissenen Mannen haben das levantinische Kafenion durch das halbwegs stylish aufgemöbelte Kunststoffabteil ersetzt, Ersatzheimat, hörbar. Da fuchtelt und dröhnt ein eingeschworenes Altensyndikat, das keine Frauen zulässt, denn Frauen sind dazu gemacht, zu Hause am Herd zu stehen, um dem Herrn und Gebieter das Abendbrot herzurichten.
In gebührendem Abstand residiert eine kopftuchvermummte Frauenrunde, die ihre Einkaufsschnäppchen auf der Tischfläche aufhäuft. Es handelt sich um günstig erworbene Wäsche, spitzenbesetzte Nylonnachthemden, im halben Dutzend billiger, Herrenhemden für Mann und Söhne, hier erlaubte der Zahltag die Drei-für-zwei-Milchmädchenrechnung. Die beiden Stammtischrunden sind autonom, nehmen keine Notiz voneinander, sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, aber eines verbindet sie: dass dieser Aufenthalt unfreiwillig ist, dass er das Exil bedeutet. Von Wahlheimat kann nicht die Rede sein, man muss Arbeit suchen, wo es sie gibt.
Taucht eine Einheimische auf, wenden die Migrantinnen ihre Köpfe nach innen, nichts könnte sie weniger interessieren als die Schweizerin, am allerwenigsten aber interessieren sie die verlockend gestalteten Küchenbreviere mit Rezepten, die überall ausliegen. Die haben nicht die geringste Chance bei diesen verwitterten Frauen, denen die Küche Heimat ist, ihr Wirkungsort, den ihnen niemand abspenstig machen kann. Daraus spricht der Stolz der Tradition.
Da, die serbische Matrone kenne ich schon ein bisschen, ich habe mitbekommen, dass sie sich bemüht, die Adresse eines Arbeitsamtes auszumachen, wobei ihr der herumflottierende Dreikäsehoch unterm Tisch assistiert, indem er kleine Rülpser von sich gibt, während er der mutmaßlichen Oma die Schnürsenkel löst. Wohin sich wenden mit einem über fünfzigjährigen Pater familias, der keine Stelle mehr findet, obschon er ein qualifizierter und erfahrener Elektriker ist?





























