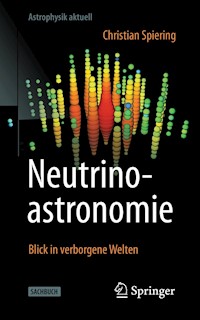Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine bestohlene Physikerin und ein verschwundener Forscher: Die spannende Jagd nach dem Neutrino, erzählt in sieben Porträts durch die Zeit Wenn in der Welt der physikalischen Teilchen ein Preis für Rätselhaftigkeit verliehen würde, dann ginge er an das Neutrino. Während Sie diesen Text lesen, fliegen unbemerkt Billionen Neutrinos durch Ihren Körper. Die »Geisterteilchen« sind ein Schlüssel zum Verständnis des Universums. Wie aber fängt man etwas ein, das sich nicht fangen lassen will? Christian Spiering ist ein international renommierter Neutrinoforscher. Hier erzählt er die spannende Geschichte einer seit 100 Jahren andauernden Jagd, die Physikerinnen und Physiker an den Südpol, tief unter die Erde, zwischen die Fronten des Kalten Kriegs und nicht selten an den Rand der Verzweiflung geführt hat - von Lise Meitner über Wolfgang Pauli bis mitten hinein in die Gegenwart. Verständlich und spannend wie ein Wissenschaftskrimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine bestohlene Physikerin und ein verschwundener Forscher: Die spannende Jagd nach dem Neutrino, erzählt in sieben Porträts durch die ZeitWenn in der Welt der physikalischen Teilchen ein Preis für Rätselhaftigkeit verliehen würde, dann ginge er an das Neutrino. Während Sie diesen Text lesen, fliegen unbemerkt Billionen Neutrinos durch Ihren Körper. Die »Geisterteilchen« sind ein Schlüssel zum Verständnis des Universums. Wie aber fängt man etwas ein, das sich nicht fangen lassen will? Christian Spiering ist ein international renommierter Neutrinoforscher. Hier erzählt er die spannende Geschichte einer seit 100 Jahren andauernden Jagd, die Physikerinnen und Physiker an den Südpol, tief unter die Erde, zwischen die Fronten des Kalten Kriegs und nicht selten an den Rand der Verzweiflung geführt hat — von Lise Meitner über Wolfgang Pauli bis mitten hinein in die Gegenwart. Verständlich und spannend wie ein Wissenschaftskrimi.
Christian Spiering
Das seltsamste Teilchen der Welt
Auf der Jagd nach dem Neutrino
Hanser
Prolog
Wenn im Zoo der Elementarteilchen ein Preis für Extravaganz und Rätselhaftigkeit verliehen werden würde, dann dürfte er mit ziemlicher Sicherheit an das Neutrino gehen. Neutrinos sind die eigenartigsten und befremdlichsten aller bekannten Teilchen. Im Vergleich zu ihren eher prosaischen Mitbewohnern im Teilchenzoo nehmen sie sich wie regelrechte Zauberwesen aus. Ihre verblüffendste Eigenschaft ist ohne Zweifel die äußerst geringe Neigung, mit ihrer Umwelt in irgendeine Form von Wechselwirkung zu treten. Darum können sie riesige Materieschichten durchdringen, ohne auf ein anderes subatomares Teilchen zu prallen. Von den 60 Milliarden Sonnenneutrinos pro Quadratzentimeter und Sekunde etwa, die von der Sonne kommend auf die Erdoberfläche treffen und dann die Erde durchqueren, stoßen im Mittel kaum ein Dutzend mit einem Atom des Erdinnern zusammen. Unbemerkt durchqueren sie auch unseren Körper, dringen an der Schulter ein und eilen durch die Fußsohlen hinaus, jagen durchs Herz, preschen durch den Magen und huschen durchs Gehirn, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen.
Am Anfang der Geschichte des Neutrinos stehen Ungereimtheiten bei radioaktiven Zerfallsprozessen. Lise Meitner, die erste Heldin dieses Buches, hat ihnen einen Großteil ihres Lebens gewidmet — lange bevor sie durch ihre Rolle bei der Entdeckung und Erklärung der Kernspaltung berühmt wurde. Um die erwähnten Widersprüche auflösen zu können, »postulierte« unser zweiter Protagonist, der Physiker Wolfgang Pauli, im Jahr 1930 die Existenz des Neutrinos. Wenige Jahre später gelang es, die Eigenschaften des hypothetischen Teilchens zu berechnen. Das Ergebnis war allerdings niederschmetternd: Das Neutrino glich eher einem Geisterteilchen als einer realen Existenz. Dass man Paulis seltsames Teilchen je würde nachweisen können, glaubte darum niemand — einschließlich Pauli selbst.
Aber das war ein Irrtum. In den Vierzigerjahren entstanden die ersten Kernreaktoren, und sie erzeugten eine so gigantische Menge von Neutrinos, dass ein Nachweis in den Bereich des Möglichen rückte. 1956 gelang es zwei amerikanischen Physikern, Frederick Reines und Clyde Cowan, an einem Reaktor in den USA Neutrinos nachzuweisen. Aus dem Fluss von Abermilliarden Neutrinos, die in jeder Sekunde durch ihr Nachweisgerät strömten, lösten nur ein bis zwei pro Stunde ein Signal aus. Frederick Reines, der dritte Held unserer Erzählung, erhielt dafür den Nobelpreis für Physik. Anders als Meitner und Pauli hat er fast sein ganzes Forscherleben der Untersuchung von Neutrinos gewidmet, mit einer einzigartigen Mischung aus Ausdauer, Ideenreichtum und Besessenheit. An Ideenreichtum steht ihm unser vierter Held in nichts nach. Bruno Pontecorvo ist in der Neutrinoforschung nachgerade allgegenwärtig. Auch die Ergebnisse des IceCube-Neutrinoteleskops am Südpol, an dem ich selbst beteiligt bin, wären ohne Pontecorvos Idee von »Neutrino-Oszillationen« nicht verständlich. Drei seiner Ideen haben zu Nobelpreisen geführt — und in allen drei Fällen gehörte er nicht zu den Ausgezeichneten!
Eine der drei Ideen Pontecorvos betraf den Nachweis von Neutrinos. Zwar wurden die Neutrinos aus Kernreaktoren mithilfe eines anderen Nachweisprinzips entdeckt, aber dem US-Amerikaner Raymond Davis gelang es 14 Jahre später, mit der Pontecorvo-Methode erstmalig Neutrinos aus der Sonne nachzuweisen. Anders als Pontecorvo war Davis vor allem ein Mann der Ausdauer, ein Dickbrettbohrer par excellence. Davis, Nobelpreisträger von 2002, ist die fünfte der porträtierten Personen. Die sechste ist John Bahcall, der Davis als theoretischer Astrophysiker begleitete und Beharrlichkeit mit einer erstaunlichen Vielseitigkeit verband. 17 Jahre nach Davis’ ersten Resultaten gelang die Messung von Sonnenneutrinos — mit einem völlig andersgearteten Gerät — auch dem Japaner Masatoshi Koshiba, der siebenten porträtierten Person. Zudem schenkte das Schicksal ihm ein astronomisches Jahrhundertereignis: die Explosion einer Supernova in einer Satellitengalaxis unserer Milchstraße. Weltweit wurden zwei Dutzend Neutrinos aus dieser Supernova registriert, die Hälfte davon mit Koshibas Detektor. Auf spektakuläre Weise bestätigten sie die Vorstellungen von dem, was im Innern eines kollabierenden Sterns passiert, und eröffneten endgültig die Ära der Neutrinoastronomie.
Die Persönlichkeiten der Hauptdarsteller in unserer Neutrinosaga könnten unterschiedlicher nicht sein. Da sind die peniblen Ausdauerläufer, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte beharrlich einer Fragestellung widmen. Lise Meitner, Raymond Davis und John Bahcall sind Beispiele dafür. Daneben die genialen Vordenker, die mit einem Schlag einen gordischen Knoten durchtrennen, wie Wolfgang Pauli. Dazu Physiker, die von ihrem Forschungsobjekt regelrecht besessen sind und von einer Entdeckung und einer Idee zur nächsten eilen, wie Bruno Pontecorvo und Fred Reines. Und schließlich solche, denen ein astronomisches Jahrhundertereignis verdientermaßen zu Nobelpreisehren verhilft, wie Masatoshi Koshiba. Bewundernswert sind sie alle, jeder auf seine Weise.
Ihre Biografien sind jedoch nicht nur durch ihren Forschungsgegenstand, das Neutrino, geprägt, sondern auch durch die Weltgeschichte: durch ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, durch Diktaturen wie die von Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien und Stalin in der Sowjetunion. Durch Emigration, durch die Entdeckung der Kernspaltung und den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki und durch den Kalten Krieg zwischen West und Ost. Lise Meitner und Bruno Pontecorvo werden durch die geschichtlichen Ereignisse um den Nobelpreis gebracht, die eine, weil sie aus Nazideutschland emigrieren musste, der andere, weil er über den Eisernen Vorhang hinweg vom Westen in den Osten wechselte und kaum Chancen hatte, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Fred Reines, der Entdecker des Neutrinos, wäre möglicherweise nie auf das Neutrino als Lebensprojekt gestoßen, wenn er nicht vorher in Los Alamos für das Atombombenprojekt gearbeitet hätte. Und der Lebensweg des Japaners Masatoshi Koshiba wäre vielleicht ganz anders verlaufen, wenn nicht 1945, als er gerade 19 Jahre alt war, Atombomben über seinem Heimatland abgeworfen worden wären und Japan bedingungslos kapituliert hätte.
Zurück zu den Neutrinos selbst: Sie sind schon allein wegen ihrer physikalischen Eigenschaften ein fesselndes Forschungsobjekt. Für mich und viele meiner Kollegen sind sie aber in einer völlig anderen Hinsicht interessant: als kosmische Informationsträger. Teilchen, die nur äußerst sporadisch mit ihrer Umwelt reagieren, können uns nämlich aus kosmischen Regionen erreichen, aus denen nie ein Lichtstrahl zu uns dringen kann. Vereinfacht könnte man sagen: Was der Röntgenstrahl für die Medizin, das ist das Neutrino für die Astrophysik.
So haben uns Neutrinos entscheidende Informationen aus dem Innern der Sonne geliefert, von dort, wo die Kernreaktionen ablaufen, aus denen unser Zentralgestirn seine Energie bezieht. 1987 haben sie uns, wie schon erwähnt, Kunde aus dem Innern einer Supernova überbracht. Die zwei Dutzend weltweit registrierten Supernova-Neutrinos hatten die Wirkung eines Paukenschlags. Von heute auf morgen nahmen selbst Skeptiker die Neutrino-Astronomie ernst, auch wenn die meisten von deren Pionieren immer noch als seltsame Exoten angesehen wurden. Auch für mich selbst stellte dieses Ereignis ein Schlüsselerlebnis dar: Ich schloss mich einem Projekt für ein Neutrinoteleskop im Baikalsee an.
Im Mittelpunkt des Baikal-Projekts stehen nicht Neutrinos aus der Sonne oder aus Supernovae, sondern solche aus kosmischen Beschleunigungsprozessen. Deren Energie ist zwar Millionen Mal größer als die von Sonnenneutrinos, aber ihre Anzahl auf der Erde dafür viele Billionen mal geringer. Der Nachweis solcher Neutrinos erfordert darum Detektoren von gigantischen Ausmaßen. Er gelang erst im Jahr 2013 mit dem IceCube-Neutrinodetektor am Südpol. An diesem Projekt (und seinen Vorstudien) bin ich selbst seit 1995 beteiligt und durfte mich darum zusammen mit 200 Mitstreitern über diesen fantastischen Erfolg freuen. Inzwischen konnten wir auch einige solcher Neutrinos bestimmten Quellen zuordnen — sogenannten Aktiven Galaxien bzw. dem Band der Milchstraße.
Die häufigsten Neutrinos im Kosmos sind ausgerechnet die, von denen wir noch nicht genau wissen, ob wir sie jemals nachweisen können: die Neutrinos, die seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, unbeeinflusst vom Rest der Materie, den Kosmos durcheilen — die berühmten »Relikt-Neutrinos«, von denen jeder Kubikzentimeter des Kosmos etwa 340 enthält. Ihre geringe Energie lässt ihren Nachweis fast aussichtslos erscheinen — aber geben muss es sie, zumindest wenn unsere Vorstellungen vom frühen Universum nicht völlig falsch sind.
Übrigens sind auch Sie und ich Neutrinoquellen. Unser Körper enthält radioaktive Isotope von Kalium und Kalzium, bei deren Beta-Zerfällen Neutrinos erzeugt werden. Etwa 5000 Neutrinos pro Sekunde strahlt der Körper eines Achtzig-Kilo-Menschen aus. Verschwindend wenig im Vergleich zu den 1021 Neutrinos, die ein 1-Gigawatt-Kernreaktor pro Sekunde emittiert, aber eben auch nicht null.
Dieses Buch soll Ihnen keine systematische Einführung in die Neutrinophysik und die verschiedenen kosmischen Neutrinoquellen bieten. Wenn Ihnen das am Herzen liegt, dann verweise ich auf mein eigenes Buch Neutrinoastronomie — Blick in verborgene Welten oder, wenn Sie es wesentlich kürzer und ohne eine einzige Formel wollen, auf das Buch Neutrino von Frank Close. Hier soll es in erster Linie um Schicksale gehen. Um Porträts von Menschen, die nicht nur großartige wissenschaftliche Leistungen erbracht haben, sondern auch interessante, vielschichtige, manchmal komplizierte und fast immer faszinierende Persönlichkeiten waren. Die Betonung liegt auf »waren«, denn ich habe mich, was die sieben Porträtierten betrifft, auf Personen beschränkt, die schon verstorben sind. Vier von ihnen habe ich selbst kennenlernen dürfen, zwei — Lise Meitner und Wolfgang Pauli — hätte ich allerdings schon aus Altersgründen nicht selbst treffen können (zumindest nicht als Erwachsener). Die Tatsache, dass die wissenschaftlichen Schlüsselergebnisse der Porträtierten fast alle 40 Jahre oder länger zurückliegen, bringt es mit sich, dass ihre Lebensgeschichten die Fragen nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung offen lassen. In einem letzten, kurzen Kapitel skizziere ich daher die Entwicklung der Neutrinoforschung nach dem Tod meiner Protagonisten. Ganz zum Schluss habe ich für diejenigen Leser, die nichts mit Teilchenphysik zu tun haben und sich durch die unterschiedlichen Bezeichnungen für Neutrinos (mal nach Typ, mal nach Herkunft) verwirrt fühlen könnten, eine Definition der wichtigsten Begriffe hinzugefügt.
Ich habe mich entschlossen, jedes Kapitel mit einer kleinen persönlichen Episode zu beginnen. Zumindest bei jenen, denen ich selbst begegnet bin, gibt mir das die Gelegenheit, ein kleines Schlaglicht aus meinem Blickwinkel auf die Betroffenen zu werfen.
1 Ein Rätsel und ein Ausweg: Lise Meitner und Wolfgang Pauli
Juni 2008. Ich schlendere mit meinem Kollegen Josef Jochum durch Tübingen. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser geschichtsgesättigten Stadt bin. Wir durchstreifen das wunderschöne alte Zentrum Tübingens. Über den Neckar hinweg, der sich still durch die Stadt schlängelt, werfen wir einen Blick auf den berühmten Turm, in dem der Dichter Friedrich Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens in geistiger Umnachtung verbracht hat. Am Holzmarkt stöbern wir ein wenig in der Buchhandlung Heckenauer, in der Hermann Hesse von 1895 bis 1899 seine Buchhändlerlehre absolviert hat. Orte, die in jedem Stadtführer verzeichnet sind.
Josef ist Professor an der Universität Tübingen. Er beschäftigt sich, wie auch ich selbst, mit der Untersuchung von Neutrinos, jenen geisterhaften Teilchen, die so schwer dingfest zu machen sind. Am Abend dieses milden Junitages soll ich einen populärwissenschaftlichen Vortrag zur Astronomie mit Neutrinos halten. »Bis jetzt sehen wir noch nichts«, wird mich am übernächsten Tag das Schwäbische Tagblatt zitieren und hinzufügen: »So fröhlich können diesen Satz nur Physiker sagen.« In der Tat läuft im Jahr 2008 unser Neutrinoteleskop am Südpol erst im Teilbetrieb, und bis zu unserer ersten Entdeckung sollen noch fünf Jahre vergehen. 2008 kann ich nur Versprechungen und eine gehörige Portion Optimismus anbieten.
Die Sonne beginnt schon lange Schatten zu werfen. Wir müssen uns beeilen, um rechtzeitig zu dem Hörsaal zu kommen, in dem ich vortragen soll. Plötzlich deutet Josef auf ein stattliches Gebäude zu unserer Linken und sagt: »Hier war’s!«
Ich weiß sofort, was er meint.
Vor meinem Auge erscheint eine zierlich gewachsene Frau von etwa fünfzig Jahren. Sie ist sorgfältig gekleidet. Ein Scheitel, nicht ganz in der Mitte, teilt ihre dunklen Haare, die sie hinten zu einem Knoten zusammengebunden hat. Die Frau sitzt im Frühstücksraum eines Hotels, nur ein paar Minuten von dem erwähnten Gebäude entfernt. Ihr Kaffee ist noch nicht ganz ausgetrunken. Gerade zündet sie sich eine Zigarette an. Von einem Nachbartisch schauen zwei militärisch anmutende Herren missbilligend hinüber. Wir schreiben das Jahr 1930. Zwar sind gerade erst die »Goldenen Zwanziger« zu Ende gegangen, wo alles, was einst verpönt war, mit einem Mal erlaubt zu sein schien. Aber eine Dame mittleren Alters, ohne Begleitung, ohne Ehering (wie die beiden Herren sofort konstatieren), aber rauchend: Das mochte in Berlin angehen. In Tübingen eher nicht. Selbst wenn die beiden geschniegelten Herren wüssten, dass da eine Professorin für Physik sitzt, würde ihre Skepsis nicht weichen, sondern sich womöglich noch verstärken.
In einer halben Stunde soll in dem stattlichen Gebäude eine Physiktagung beginnen. Lise Meitner — so heißt die Frau — zieht aus ihrer Handtasche einen Brief hervor, den ihr am Abend zuvor ein Kollege übergeben hat, mit der Bitte, ihn auf der Tagung zu verlesen. Der Verfasser ist Wolfgang Pauli — Physikgenie, Nachtschwärmer und Mitschöpfer der modernen Quantenmechanik. Er könne, so der dreißigjährige Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, »leider nicht persönlich in Tübingen erscheinen«, da er »infolge eines in der Nacht vom 6. zum 7. Dez. in Zürich stattfindenden Balles dort unabkömmlich« sei. Das Schreiben ist einer der berühmtesten Briefe in der Geschichte der modernen Physik. Es zeigt die Lösung für ein zwei Jahrzehnte altes Rätsel auf. Und niemand sonst auf der Welt hat dieses Rätsel länger und akribischer untersucht als die zierliche Frau am Frühstückstisch.
Lise Meitner hat ihre Zigarette zu Ende geraucht. Sie greift ihre Tasche, zieht sich sorgfältig ihren Mantel an und geht eilig zum Tagungsgebäude hinüber. Noch eine Stunde, und eine kleine Schar von »Radioaktiven Damen und Herren«, wie Pauli sie scherzhaft anredet, wird von seinem verrückten Vorschlag hören. Die Geburtsstunde des Neutrinos hat geschlagen!
Lise will mehr
Lise Meitner wird am 7. November 1878 in Wien geboren. Oder war es der 17. November? Dieses Datum verzeichnet das Geburtsregister der jüdischen Gemeinde in Wien. Als Lise etwa zehn Jahre alt ist, vergisst jedoch ein Beamter, die Eins in ein Dokument einzutragen, und so wird aus der Siebzehn eine Sieben. Lise Meitner wird als Erwachsene ihren Geburtstag stets am 7. November feiern. Auch von ihrem korrekten Geburtsnamen, Elise, wird sie später keinen Gebrauch machen. Sie ist »Lise«.
Lises Geburtshaus liegt in der Kaiser-Josephs-Straße, in der Mitte zwischen dem kaiserlich-königlichen Augarten und dem Praterstern. Der regierende Kaiser heißt Franz Joseph, biederer Ehemann der bildschönen Elisabeth (»Sisi«). Ganz jung sind beide in Lises Geburtsjahr nicht mehr: Ein Jahr später werden sie ihre Silberhochzeit feiern. Als Sechsjährige wird Lise einen Blick auf Sisi erhaschen, als die mit ihrer kaiserlichen Kalesche zum Augarten prescht. Franz Joseph regiert die österreichisch-ungarische Monarchie seit 30 Jahren und wird noch vier weitere Jahrzehnte auf dem Thron bleiben. 1916 erspart der Tod dem Greis, den Untergang der Monarchie miterleben zu müssen.
1878 ist Wien eine blühende Stadt, eine Stadt der Musik und der Kultur. Als Lise zehn Jahre alt ist, wird das Wiener Burgtheater eröffnet, und als sie 13 ist, das Kunsthistorische Museum: Pilgerstätten für Theater- und Kunstinteressierte. Wien ist die Hauptstadt eines Vielvölkerstaates, dessen Kulturen einander beeinflussen und in dem Tradition und Moderne, Rückwärtsgewandtheit und Fortschritt miteinander verschmelzen. Gerade erst ist erlaubt worden, dass Frauen die Maturitätsprüfung ablegen können. Mehr noch: Nach einer Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht können Frauen »ausnahmsweise« und nur als Gasthörerinnen zu Vorlesungen an der Universität zugelassen werden. Eine Studienberechtigung ist das noch nicht. Aber immerhin mehr, als im Deutschen Reich möglich ist. Und zwei Jahrzehnte später wichtig für Lise Meitner!
Einwohner aus allen Landesteilen strömen nach Wien. Wenige Jahre vor Lises Geburt hat die Einwohnerzahl eine Million überschritten. Unter den Zuwanderern sind viele Juden, deren formale Gleichstellung 1867 gesetzlich festgeschrieben wurde. Und unter ihnen auch Lises Eltern, Philipp und Hedwig Meitner, er in Mähren geboren, sie in der Slowakei.
»Früh vom orthodox Religiösen emanzipiert«, wird Stefan Zweig später über diese Juden schreiben, »waren sie leidenschaftliche Anhänger der Zeitreligion des ›Fortschritts‹. … Wenn sie aus ihrer Heimat nach Wien übersiedelten, passten sie sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit der höheren Kultursphäre an, und ihr persönlicher Aufstieg verband sich organisch mit dem allgemeinen Aufschwung der Zeit.«
Philipp Meitner kommt 1862 nach Wien, studiert dort Jura und wird Rechtsanwalt. 1875 heiratet er Hedwig. Die beiden haben acht Kinder, fünf Töchter und drei Söhne. Lise ist das dritte Kind. Die Meitner-Kinder werden zwar alle in das Geburtenregister der israelitischen Kultusgemeinde eingetragen, erzogen werden sie aber protestantisch. Erst am 29. September 1908 wird Lise Meitner offiziell aus der Kultusgemeinde austreten — und sich am gleichen Tag evangelisch taufen lassen.
Mit zwei älteren und fünf jüngeren Geschwistern lernt Lise zwei wichtige Verhaltensmuster: Unterordnung für den Fall, dass sie eine Person respektiert — neben den Eltern auch die beiden älteren Schwestern Gisela und Auguste —, und die Fähigkeit, sich zu kümmern und zu lenken im Falle der jüngeren Geschwister. Weit später, als Professorin, wird sie ihre Studenten »wenn nötig mit eiserner Hand« führen, wie ihr Neffe Otto Robert Frisch schreibt.
Davon ist aber bei der jungen Lise noch nichts zu spüren. Aufgeweckt ist sie, aber auch schüchtern. Eine gewisse Scheuheit wird sie auch als Erwachsene nie ganz ablegen. Einstein, der sie sehr schätzt und später gerne als »unsere Marie Curie« bezeichnen wird, attestiert ihr nach einem Vortrag, zu dem sie sich regelrecht überwinden musste, eine »Kleinmädchenverschämtheit«. Auf den Fotografien der Zwanzigjährigen blickt sie einen nachdenklich an, manchmal schüchtern und ernst, manchmal verschämt lächelnd, den Mund leicht schief verzogen. Eine aparte Erscheinung ist die grazile junge Frau aber allemal.
Die Meitners lassen ihre Kinder am Wiener Kulturleben teilhaben. Sie nehmen sie in die Oper und zu Theater- und Museumsbesuchen mit. Die Mutter bringt ihnen Lesen und Schreiben bei, der Vater unterrichtet die vier ältesten Geschwister in Englisch, Französisch und Latein. Die Kinder können sich in der umfangreichen Bibliothek der Eltern bedienen und werden so schon früh mit guter Belletristik vertraut gemacht. Zweimal in der Woche erscheint ein Klavierlehrer bei den Meitners. Auguste wird später als erste junge Frau am Wiener Konservatorium Kompositionslehre und Klavier studieren. Aber auch Gisela und Lise sind recht gute Pianistinnen.
Alle Kinder lesen, doch die buchstäbliche Leseratte unter ihnen ist Lise. Wie schlafwandlerisch läuft sie häufig durch die Wohnung, ein Buch vor der Nase. Schöne Literatur, geschichtliche Werke und irgendwann auch Bücher physikalischen Inhalts. Für Arbeiten im Haushalt macht sie die Leserei nicht unbedingt geeigneter, und ihre Geschwister machen sich gerne über sie lustig: »Das kann die Lise nicht, das steht nicht im Physikbüchl.«
Die erste Anregung dafür, dass sich der schöngeistigen Literatur die Physik zugesellt, war angeblich eine ölige Pfütze. Lise war vom Schillern des Ölflecks gefesselt und wollte wissen, wie das Farbenspiel zustande kommt. Die Erklärung muss sie nachhaltig beeindruckt und ihr Interesse an physikalischen Problemen geweckt haben. Von nun an fragt sie häufiger nach, wenn sie etwas Erklärungsbedürftiges sieht. Und irgendwann reichen ihr die mündlichen Antworten nicht mehr aus. Irgendwann muss es ein »Physikbüchl« sein.
Ein ebenso behütetes wie förderndes Elternhaus. Lise wird sich später mit Dankbarkeit daran erinnern, wie viel sie »an Gutem und Schönen von zuhaus mitbekommen« hat. »Letzten Endes«, schreibt sie, »ist es noch heute der Boden, auf dem ich stehe.«
Von 1884 bis 1889 besucht Lise die Volksschule. Begabte Knaben wechseln danach ins Gymnasium. Dessen Besuch ist Mädchen damals noch verwehrt. Lise geht stattdessen auf die »Bürgerschule«. Deren Besuch beendet sie 1892, und damit gilt die Schulbildung der knapp Vierzehnjährigen als abgeschlossen.
Aber Lise will mehr. Lise möchte studieren. Mathematik, Physik, vielleicht auch Medizin.
Um zu studieren, muss man jedoch zuerst die Matura (also das Abitur) ablegen, und dazu hätte Lise das Gymnasium besucht haben müssen. Allerdings gibt es einen Umweg zur Hochschulreife: eine externe Matura. Für deren Vorbereitung muss man teure Privatstunden nehmen. Und: Man muss sich sicher sein, dass sich die Investition später auch gelohnt haben wird. Diese Gewissheit hat Philipp Meitner nicht. Darum lässt er Lise zunächst eine Ausbildung zur Französischlehrerin absolvieren. Damit würde sie — Matura hin, Matura her — ihren Lebensunterhalt notfalls auch selbst bestreiten können. Zwei Jahre dauert die Ausbildung, danach kann Lise eigenständig zum Familieneinkommen beitragen und, besonders wichtig, die Privatstunden zur Vorbereitung auf ihr Matura-Examen selbst bezahlen.
1901 hat sie es geschafft: Sie besteht die Matura-Prüfung! Damit hat sie die erste große Hürde auf dem Weg zu ihrem Ziel genommen. Drei Monate nach der Prüfung schreibt sie sich als Studentin der Mathematik und Physik an der Universität Wien ein (die seit 1898 auch Frauen zum Studium der meisten Fächer zulässt, und zwar nicht nur »ausnahmsweise« und als Gasthörerinnen). 23 Jahre zählt sie jetzt, ein Alter, in dem männliche Studenten damals meistens schon kurz vor der Promotion stehen.
Lise Meitner belegt zunächst die Fächer Physik, Mathematik und — da die Naturwissenschaften dem Fachbereich Physik der Philosophischen Fakultät zugeordnet sind — Philosophie.
Sie stürzt sich als Erstes auf die Mathematik und hört Vorlesungen zur Differenzial- und Integralrechnung, wichtigstes Handwerkszeug der theoretischen Physiker. Die Vorlesungen zur Theoretischen Physik selbst fallen zunächst aus, denn der designierte Lehrstuhlinhaber befindet sich noch in Leipzig. Es ist Ludwig Boltzmann, der unschätzbare Beiträge zur Thermodynamik und zur statistischen Physik geleistet hat. Tatsächlich gibt es heutzutage keinen Grundkurs der Physik, in dem man nicht mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, der Boltzmann-Konstante oder der Boltzmann-Verteilung Bekanntschaft schließt. Boltzmann ist ein glühender Verfechter der Existenz von Atomen, unbeirrt von bissigen Anfeindungen konservativer Physiker und Philosophen. Für Lise Meitner ist der bullige Mann mit dem Rauschebart und den funkelnden Augen hinter der kleinen Nickelbrille mehr. Er ist ein Guru, ein Kämpfer für wissenschaftliche Wahrheit. Sie wird sich später erinnern: »Boltzmann hatte keinerlei Hemmungen, seinen Enthusiasmus, während er sprach, zu zeigen; diese Tatsache riss natürlich seine Hörer mit … Ich erinnere mich besonders daran, auf wieviel Schwierigkeiten und Opposition er traf, weil er von der Existenz von Atomen überzeugt war, und wie er von philosophischer Seite angegriffen wurde …« Später hat Lise auch privaten Kontakt zu Boltzmann und wird zu Musikabenden in dessen Haus eingeladen. Boltzmann spielt sehr gut Klavier, und eigentlich möchte man sich vorstellen, wie er und Lise gelegentlich vierhändig spielen. Aber das haben sie in Wirklichkeit nie getan. Lise — die Leser ahnen es! — ist zu schüchtern.
Nach acht Semestern beginnt Lise Meitner an ihrer Dissertation zu arbeiten. Ihre halb theoretische, halb experimentelle Arbeit mit dem Titel Wärmeleitung in inhomogenen Körpern wird 1906 in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Dahin schafft es beileibe nicht jede Dissertation. Kurz zuvor, im Dezember 1905, hat sie ihre Abschlussprüfungen mit Auszeichnung bestanden, und am 1. Februar 1906 wird sie promoviert. Jetzt ist sie Fräulein Dr. Meitner.
Kann sie davon leben? Mitnichten. Junge Wissenschaftler sind damals Hungerkünstler. Oder zumindest Lebenskünstler, es sei denn, sie haben ein familiäres finanzielles Polster. Für Frauen gilt das noch viel gnadenloser als für Männer. Darum bereitet sich das junge Fräulein Doktor auf eine Lehramtsprüfung in Mathematik und Physik vor: Als Lehrerin würde sie sich in jedem Fall selbst ernähren können. Nun bestreitet sie vormittags Probestunden an einer Mädchenschule, nachmittags geht sie in die Universität, um wissenschaftlich zu arbeiten. Noch im Jahr ihrer Promotion ergibt sich aus dieser Halbtagsbeschäftigung ihre zweite wissenschaftliche Veröffentlichung. Eine rein theoretische Arbeit. Diesmal geht es um die Reflexion von Licht an der Grenzfläche zweier Medien.
Aber dann, noch im gleichen Jahr, begibt sich Lise Meitner auf das Gebiet, dem sie ihr Leben lang treu bleiben wird: die Radioaktivitätsforschung.
α, β, γ — das radioaktive Alphabet
Am 1. März 1896, gerade ein Jahrzehnt zuvor, hat der französische Physiker Henri Becquerel zu seiner Überraschung festgestellt, dass Fotoplatten, die er einige Tage zusammen mit einem Brocken Uransalz in völliger Dunkelheit liegen gelassen hatte, leicht geschwärzt waren. Er schloss daraus, dass Uran irgendeine Art von Strahlung aussendet. Becquerel nennt sie der Einfachheit halber Uranstrahlen. Erst später prägen Marie und Pierre Curie den Namen radioaktive Strahlen.
In den folgenden drei Jahren untersucht der Neuseeländer Ernest Rutherford an der Universität in Cambridge die Absorption von Uranstrahlen und stellt fest, dass sie aus zwei Komponenten zu bestehen scheinen. Die eine wird schon von einer 20 Mikrometer dicken Aluminiumfolie absorbiert, die andere kann Rutherford noch nach mehreren Millimetern Aluminiumabschirmung nachweisen. Rutherford nennt die erste Form der Strahlung Alpha-Strahlung und die zweite Beta-Strahlung. Im Jahr 1900 identifiziert der Franzose Paul Villard schließlich eine noch durchdringendere Strahlung, die er folgerichtig Gamma-Strahlungnennt. α, β, γ — die ersten Buchstaben des griechischen Alphabets.
Das große Vorbild für Lise Meitner ist Marie Curie. 1895 hat die aus Polen stammende angehende Physikerin in Paris den Physikprofessor Pierre Curie geheiratet. Ein gutes Jahr, nachdem Becquerel seine Entdeckung verkündet hat, beschließt Marie, ihre Doktorarbeit diesem seltsamen Befund zu widmen. Unterstützt durch Pierre, untersucht sie zahlreiche uranhaltige Metalle und stellt fest, dass die Strahlung nicht vom chemischen Bindungszustand des Urans abhängt. Sie muss also eine Eigenschaft der Atome selbst sein, nicht der Moleküle. Und mehr noch: Als die Curies Pechblende untersuchen, ein schwarzes, glänzendes Mineral, stellen sie fest, dass die Pechblende weit stärker strahlt als das darin enthaltene Uran. Mühsam trennen die Curies die einzelnen Bestandteile der Pechblende voneinander; eine chemische Meisterleistung. Allerdings ruinieren sich beide dabei ihre Gesundheit — zu dieser Zeit sind die Gefahren radioaktiver Strahlung noch weitgehend unbekannt. 1898 dann der Durchbruch. Die Curies stellen fest: Die starke Strahlung stammt von zwei bisher völlig unbekannten Elementen. Sie nennen sie Radium und — zu Ehren von Maries polnischer Heimat — Polonium. 1903 wird den Curies, zusammen mit Becquerel, der Nobelpreis für Physik zugesprochen.
Inzwischen ist schon ein weltweiter Radioaktivitäts-Rummel im Gange. Nicht nur bei Physikern: Man kann Kosmetika und Zahnpasten mit Radiumzusatz kaufen, wer an Gicht leidet, kann sich in Radium-Kurorte begeben und dort in leicht radioaktivem Wasser baden, und Radiologen setzen sich auf abenteuerlichste Weise Bestrahlungen mit radioaktiven Stoffen aus, um deren medizinische Wirkung zu untersuchen. Der Radiumhype erreicht, mit einiger Verspätung, auch Lise Meitner in Wien.
Wien bietet die besten Voraussetzungen für diese Art von Forschung. Die Pechblende, mit der die Curies gearbeitet haben, stammt aus den Minen im böhmischen Joachimsthal, damals zum österreichischen Kaiserreich gehörend. Sie ist dem Forscherpaar von der Kaiserlichen Akademie zur Verfügung gestellt worden. Für ihre eigene Forschung lässt nun die Akademie aus 10 Tonnen Pechblende 4 Gramm Radiumchlorid isolieren, weltweit das stärkste Präparat des begehrten Stoffes. Was den Radiumvorrat im Jahr von Lise Meitners Promotion betrifft, befindet sich die Wiener Universität also in einer Spitzenstellung.
Lises Vorgesetzter Stefan Meyer gehört zu den über ganz Europa verteilten Forschern, die ein paar Jahre zuvor, unabhängig voneinander, nachweisen konnten, dass die Beta-Strahlen aus elektrisch negativ geladenen Teilchen bestehen. Einer der Mitentdecker ist Becquerel. Der kann ein Jahr später auch die Masse der Teilchen bestimmen. Aus dem Verhältnis von Ladung zu Masse schließt er, dass es sich bei den Beta-Strahlen um nichts anderes als um Elektronen handelt.
Meyer hat seine Forschungen zur Radioaktivität unbeirrt fortgeführt. Er hilft Lise Meitner bei ihren ersten Schritten in das Gebiet. Gerätetechnisch ist das Feld attraktiv für Neulinge, denn eigentlich braucht man nicht viel mehr als eine radioaktive Quelle und ein Messgerät.
Eines dieser Messgeräte im Wiener Physikalischen Institut ist das Blattelektroskop, ein ebenso einfaches wie ausgeklügeltes Instrument. Es besteht aus einem dünnen Metallplättchen, das sich in einem luftdicht verschlossenen Glaskolben befindet. Das bewegliche Plättchen ist mit einem Metallstab verbunden, der aus dem Glaskolben ragt. Wenn man den Metallstab elektrisch auflädt, stoßen sich Plättchen und Metallstab ab. Das Plättchen steht jetzt abgespreizt vom Stab. Nun bringt man ein radioaktives Präparat in die Nähe des Kolbens. Die radioaktive Strahlung ionisiert die Luft im Glaskolben, und die freigesetzten Ionen und Elektronen gleichen den Ladungsunterschied zwischen Stab und Plättchen aus: Das Blättchen kehrt in seine Ausgangsstellung zurück. Je stärker die Strahlung, umso schneller der Ladungsausgleich und umso schneller klappt das Blättchen zurück. So einfach das Prinzip ist, so zeitaufwendig und vertrackt sind die Messungen. Nichts, was Lise Meitner abschrecken würde. Es ist ihre erste rein experimentelle Arbeit.
Zuerst untersucht sie die Alpha- und Beta-Strahlung von Thorium und Aktinium, zwei der kürzlich erst entdeckten radioaktiven Elemente. Eine sorgfältige Arbeit, wenngleich noch ohne durchschlagenden Neuigkeitswert. Danach geht sie der Frage nach, ob Alpha-Teilchen bei ihrem Durchgang durch Materie nur absorbiert oder gelegentlich lediglich abgelenkt (»gestreut«) werden. Lise Meitner findet heraus, dass Alpha-Teilchen tatsächlich gestreut werden, und auch, in welcher Weise die Streuung vom Atomgewicht der streuenden Folie abhängt.
Fünf Jahre später werden Streuversuche mit Alpha-Teilchen den Physiker Rutherford und seine Assistenten Madsen und Geiger (der Geiger, nach dem später der Geigerzähler benannt wird) zur Entdeckung des Atomkerns führen. So weit kommt aber Lise mit ihrem einfachen Versuchsaufbau noch nicht. Eine Veröffentlichung in einem Fachjournal sind die Ergebnisse allemal wert.
Kurz nach Lises Promotion wird die europäische Physikgemeinde durch eine traurige Nachricht erschüttert: Ludwig Boltzmann, der seit einiger Zeit unter Depressionen und vielfältigen körperlichen Gebrechen litt, hat seinem Leben ein Ende gesetzt. In Duino, einem mondänen Badeort an der Adria, hat er sich erhängt, während eines Familienurlaubs.
Nach Berlin zu Max Planck
Damit verschwindet eine Vaterfigur aus Lises Leben. Aber genau dieser Umstand sorgt dafür, dass eine neue auftaucht: Max Planck. Nicht lange nach Boltzmanns Tod besucht Planck Wien, um mit einem Vortrag an der Universität dem Toten seinen Respekt zu erweisen. Planck, knapp 50 Jahre alt, ist damals Ordinarius für Theoretische Physik an der Berliner Universität, Koryphäe auf dem Gebiet der Thermodynamik und hochgeschätzter Hochschullehrer. Zum Auftakt des neuen Jahrhunderts, also sieben Jahre zuvor, ist ihm eine Entdeckung gelungen, die das Ehrfurcht gebietende Gebäude der zeitgenössischen Physik zum Einsturz bringen sollte. Ein Gebäude, von dem viele meinten, es sei vollendet und bestenfalls noch winzigen Verschönerungsarbeiten zu unterwerfen.
Planck hatte sich der Strahlung gewidmet, die von erhitzten Körpern ausgesendet wird. Deren Abstrahlung ändert sich bei Temperaturerhöhung — von glutrot über gelb bis weißglühend. Niemandem war bis dahin gelungen, diese Strahlung über ihren gesamten Spektralbereich mit einer einzigen Formel zu beschreiben. Erst Planck glückte das Kunststück. Er fand heraus, dass eine einheitliche Beschreibung möglich ist, wenn man annimmt, dass die Energie, die die Atome als Licht abstrahlen, in Form von winzigen Portionen abgegeben wird, die er Quanten nannte.
Zunächst war das nicht viel mehr als ein Rechentrick. Zumindest für Planck. Konservativ, wie er war, lag ihm nichts ferner als die Annahme, Licht sei tatsächlich »gequantelt«. Plancks Quanten machten darum auch nicht viel Furore — bis ein in der Fachwelt gänzlich unbekannter Angestellter des Berner Patentamts eine kühne Hypothese aufstellte, nach der Plancks Annahme mehr als bloß ein mathematischer Kunstgriff war. Sein Name: Albert Einstein. Einsteins Erklärung der Lichtemission ging beim besten Willen nicht mehr als rein mathematischer Behelf durch. Sie wurde die erste von Einsteins Arbeiten, die der guten alten klassischen Physik das Genick brechen sollten.
Planck ist wenig angetan von Einsteins »Lichtquantenhypothese«. Auch bei seinem Vortrag in Wien verbirgt er das nicht. Aber das ficht Lise nicht an. In ihrem Wiener Institut hat man bisher sowieso wenig von den Quantendisputen mitbekommen. Für sie ist neben Plancks Ruf als Physiker etwas ganz anderes wichtig: die persönliche Ausstrahlung von Planck. Ganz anders als Boltzmann, der mal Berserker, mal Weltumarmer und manchmal beides zugleich war, strahlt Planck Zurückhaltung, Integrität und Noblesse aus. Lise ist beeindruckt. Und langsam beginnt ein Gedanke in ihr zu reifen: Sie will nach Berlin, sie will zu Planck.
Ganz so einfach geht das aber nicht. Ihre Nebenverdienste als Privatlehrerin fallen weg, und ein Zimmer in Berlin wird auch bezahlt werden müssen. Philipp Meitner müsste in die Tasche greifen und Geld dazugeben. Und er tut seiner Tochter den Gefallen. Er verspricht, sie zu unterstützen.
An einem Septembertag des Jahres 1908 ist es schließlich so weit. Begleitet von Eltern und Geschwistern fährt Lise in einer Mietdroschke zum Bahnhof, um in den Zug nach Berlin zu steigen. Gänzlich unwahrscheinlich, aber verlockend ist die Vorstellung, dass ihr auf dem Bahnhofsplatz ein sieben- oder achtjähriger Knabe über den Weg läuft, nach der Mode der Zeit in ein Matrosenkostüm gekleidet. »Wolfi!«, könnte die Mutter des Jungen vielleicht rufen, »Wolfi, lauf nicht so weit vorneweg!« Aber anstatt zu gehorchen, dreht der Kleine sich um und steckt seiner Mutter die Zunge heraus. Wolfgang Pauli, hier sieht man’s schon, war schon als Kind nicht ganz einfach!
Forschen in der Holzwerkstatt: Lise Meitner und Otto Hahn
Nun also Berlin. 36 Jahre nach der deutschen Reichsgründung ist Berlin zur modernsten und dynamischsten Hauptstadt Europas geworden. Die Stadt ist das größte Industriezentrum Deutschlands, Firmen wie Agfa, Borsig, AEG und Siemens machen es zu einer Hochburg moderner Technologie. Wie Wien, so nimmt auch Berlin Jahr für Jahr Massen von Zuzüglern auf, aus dem Brandenburger Umland, aus Ostpreußen oder Schlesien, darunter, wie in Wien, auch viele Juden. Ein paar Jahre zuvor hat die Einwohnerzahl die Zwei-Millionen-Grenze überschritten. An zehn Fernbahnhöfen strömen die Neuankömmlinge in die Stadt, und während oben der Autoverkehr tobt, wühlen sich gleich daneben die Erbauer der U-Bahn durch den märkischen Sandboden.
Was die Zahl der Museen, Theater und Opern betrifft, stellt Berlin Lises heimatliches Wien in den Schatten. Und auch was die Bildung angeht, spielt Berlin in der Spitzenklasse. Die Friedrich-Wilhelms-Universität (heute Humboldt-Universität) steht in der Tradition von Wilhelm von Humboldt und seinem Ideal der Einheit von Lehre und Forschung. Mit den in den vorhergehenden Jahrzehnten gebauten Instituten für die Naturwissenschaften verfügt die Universität über modernste Forschungs- und Lehreinrichtungen. Nicht mehr lange wird es dauern, bis im Jahre 1911 die »Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften« (die Vorgängerin der heutigen Max-Planck-Gesellschaft) gegründet wird und in ihren Instituten nochmals verbesserte Bedingungen bietet.
Überall geht es aufwärts. Auf jeden Fall in den westlichen Vierteln der Stadt — anders als im Norden und Osten, wo viele der Neuankömmlinge in heruntergekommenen Mietskasernenvierteln stranden. Solche Viertel sind es, die einen sozialdemokratischen Abgeordneten zu dem Schluss kommen lassen: »Man kann einen Menschen mit einer Wohnung geradeso gut töten wie mit einer Axt.« Dort möchte Lise Meitner natürlich nicht landen, so begrenzt ihr Budget auch sein mag. Als sie auf die Suche nach einem möblierten Zimmer geht, beschränkt sie ihre Erkundungen auf Charlottenburg im Westteil der Stadt. Sie hätte gerne ein Zimmer mit Klavier. Bei der ersten Wohnung klappt das allerdings noch nicht.
So fortschrittlich Berlin in puncto Wissenschaft ist, so rückständig ist es im Hinblick auf das Frauenstudium. Gasthörerinnen durften Frauen schon seit 1896 sein, aber ein vollwertiges Studium bleibt ihnen bis 1908 verwehrt. Preußen hinkt damit allen anderen deutschen Ländern hinterher, mit Ausnahme Mecklenburgs, wo Frauen erst ab 1909 studieren dürfen. In einer Umfrage von 1897 haben sich etwa die Hälfte der befragten Professoren gegen das Frauenstudium ausgesprochen, selbst der von Lise Meitner so geschätzte Max Planck. »Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet naturwidrig«, hat er geschrieben. »Bei einzelnen praktischen Aufgaben, wie z.B. in der Frauenheilkunde, mögen die Verhältnisse anders liegen, im Allgemeinen aber kann man nicht stark genug betonen, dass die Natur selbst der Frau ihren Beruf als Mutter und Hausfrau vorgeschrieben hat, und dass Naturgesetze unter keinen Umständen ohne schwere Schädigungen, welche sich im vorliegenden Falle besonders an dem nachwachsenden Geschlechte zeigen würden, ignoriert werden können.« Immerhin hält er Ausnahmen für möglich: »Wenn eine Frau, was nicht häufig ist, aber doch bisweilen vorkommt, für die Aufgaben der theoretischen Physik besondere Begabung besitzt und den Trieb in sich fühlt, ihr Talent zur Entfaltung zu bringen, so halte ich es, in persönlicher wie auch in sachlicher Hinsicht, für Unrecht, ihr aus prinzipiellen Rücksichten die Mittel zum Studium von vorneherein zu versagen.«
Lise Meitner weiß nichts von dieser Äußerung. Und so steht sie eines Tages in Plancks Zimmer in der Friedrich-Wilhelms-Universität und bittet ihn, sich als Hörerin für seine Vorlesungen einschreiben zu dürfen. Planck, höflich, freundlich, aber doch erstaunt, fragt zurück: Sie habe doch schon einen Doktortitel — was denn nun noch? Lise antwortet, dass sie »gerne ein wirkliches Verständnis von der Physik gewinnen möchte«. Und Planck, erstaunlich, geht darauf ein. Offenbar hält er Lise Meitner für eine der von ihm selbst deklarierten Ausnahmen. Vielleicht ist er auch einfach von der Mischung aus Schüchternheit und Entschlossenheit des Fräulein Doktor beeindruckt.
Im Vergleich zu Boltzmanns mitreißenden Vorlesungen sind die von Planck nüchtern. Lise Meitner ist die einzige Frau im Hörsaal. Trotzdem findet sie rasch Kontakt zur Gemeinde der Berliner Physiker — aller Zurückhaltung zum Trotz. Zwei Monate nach ihrer Ankunft wird sie in die Physikalische Gesellschaft aufgenommen. Später wird sie auch in Plancks privaten Kreis einbezogen. Anders als der erste, würdige Eindruck vermuten ließ, kann Planck äußerst herzlich sein. Er spielt nahezu professionell Klavier, dazu auch Cello, und ist ein vorzüglicher Sänger. Die Hauskonzerte bei den Plancks sind legendär. Nachdem Planck später Einstein überredet hat, nach Berlin zu kommen, wird sich auch Einstein daran beteiligen (und sich galant für seine Fehler beim Violine-Spielen entschuldigen). Einstein spielt begeistert, aber nicht annähernd auf dem Niveau von Planck. Planck ist zudem kein Kind von Traurigkeit. Im Sommer werden Lauf- und Fangspiele veranstaltet, an denen er sich »mit geradezu kindlichem Eifer beteiligt«, wie Lise später vermerken wird. Kein preußischer Geheimrat also, zumindest privat.
Vorlesungen allein (und Nachhilfestunden, die Lise gibt) reichen natürlich nicht als Lebensinhalt. Lise Meitner möchte auch experimentell arbeiten, so wie sie es von Wien gewohnt ist. Darum hat sie gleich nach ihrer Ankunft in Berlin Kontakt zu einem jungen Radiochemiker aufgenommen, der einen physikalisch versierten Mitarbeiter für seine Experimente zur Radioaktivität sucht. Sein Name ist Otto Hahn. Er wird über 30 Jahre hinweg Lise Meitners engster Kollege und Freund bleiben. Lise fragt ihn nach seinen Plänen, bittet um eine Woche Bedenkzeit und sagt dann zu.
Hahn ist vier Monate jünger als Lise Meitner. Nach dem Studium in München und Marburg ist er erst zum Forschen nach London und dann nach Montreal gegangen. Eigentlich hat er vorgehabt, später als konventioneller Chemiker in der Industrie zu arbeiten, aber dann ist er schon in London bei der Radiochemie gelandet. Fast auf Anhieb entdeckt er ein Isotop des Thoriums, das er Radiothorium tauft. Ein neues Element, denkt man zunächst, denn was ein Isotop ist (Variationen ein und desselben Elements, bei denen der Atomkern zwar die gleiche Anzahl von Protonen, aber eine unterschiedliche Neutronenanzahl besitzt), das weiß man damals noch nicht. In Montreal arbeitet Hahn bei Rutherford und publiziert mehrere wichtige radiochemische Arbeiten.
Nun ist er wieder in Berlin. Gerade hat er sich habilitiert. Radiochemie ist an der Berliner Universität etwas Neues, und wie immer, wenn etwas neu ist, gibt es Krittler und Ignoranten. »Es ist ja unglaublich, was sich heutzutage alles habilitiert«, säuselt einer der missgünstigen Kollegen hinter vorgehaltener Hand.
Karriereunterschiede zwischen Wissenschaftlern wird es auch ein Jahrhundert später zuhauf geben, und nicht immer kann man sie darauf schieben, dass der eine ein Mann und die andere eine Frau ist. Ein neues Feld, ein stimulierender Lehrer, die Arbeitsbedingungen und vieles mehr können eine Rolle spielen. Dass aber, wie in diesem Fall, der eine von zwei Gleichaltrigen mit knapp 30 Jahren schon habilitiert ist, während es die andere, sicherlich nicht weniger begabt, gegen viele Widerstände und mit vielen Umwegen, gerade mal zur Promotion geschafft hat, und dass ihr jetzt eine lumpige Zweijahresstelle, unbezahlt, angeboten wird, zeigt deutlich, um wie viel steiniger der Weg von Wissenschaftlerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts ist.
Zwei Jahre, unbezahlt. Lise Meitner nimmt trotzdem an. Sie akzeptiert auch, dass der Institutsdirektor Emil Fischer, Nobelpreisträger von 1902, ihr das Betreten des Instituts untersagt. Mit Frauen, meint Fischer, habe man nur Ärger — vor ein paar Jahren hätten sich die Haare einer Russin, der er ausnahmsweise den Zutritt erlaubt hatte, fast an einem Bunsenbrenner entzündet. Lise Meitner darf darum nur die ehemalige Holzwerkstatt des Instituts betreten. Glücklicherweise hat Hahn schon 1906 in dieser Werkstatt ein kleines Laboratorium für radioaktive Messungen eingerichtet, mit einem schweren Eichentisch für die Instrumente, daneben ein winziger Schreibtisch. Seine chemischen Untersuchungen führt er ein Stockwerk höher im Institut selbst durch. Nun muss er unten nur noch »nachrüsten«. Immerhin kann Otto die Institutstoilette benutzen, Lise dagegen muss in irgendeine nahe gelegene Gaststätte gehen. Und selbst wenn sie das Institut betreten dürfte: Es gibt schlicht und einfach keine Damentoilette!
Was alles leichter macht: Hahn ist eine hessische Frohnatur, meist ein fröhliches Lächeln unter dem fesch gestutzten Schnurrbart. Seine angenehme, offene Art erleichtert es Lise, die angeborene Schüchternheit zu überwinden. Und auch in wissenschaftlicher Hinsicht sind die beiden ein ideales Paar. Er im thematischen Ansatz eher intuitiv, in der Durchführung aber extrem gründlich und ausdauernd, sie das systematische und theoretisch versierte Gegenstück zu ihm. Er der Chemiker, sie die Physikerin. »Hähnchen«, wird sie später öfter sagen, »von Physik verstehst Du nichts.« Noch siezt man sich aber. Fräulein Meitner und Herr Hahn. Erst 15 Jahre später, als Lise die Patentante für Ottos Sohn wird, werden sie zum Du übergehen.
Das Autorenpaar Hahn/Meitner macht sich schnell einen Namen. Gleich im ersten Jahr ihrer Zusammenarbeit bringen sie es auf drei Veröffentlichungen, im zweiten Jahr werden es sogar sechs. Zunächst nehmen sich die beiden vor, alle greifbaren radioaktiven Quellen von Beta-Strahlung zu untersuchen. Lise stört es, dass frühere Ergebnisse, von verschiedenen Forschern unter den unterschiedlichsten Bedingungen erzielt, nicht gemeinsam unter einen Hut zu bringen sind. Daher also eine vergleichende Studie.
Da haben wir die ganze Lise Meitner: eine klare Fragestellung, ein klares Programm. Weil sie verstehen will, was »dahintersteckt«. Schon im April 1908 wird die 12-seitige Arbeit der beiden veröffentlicht. »Offenbar waren wir damals sehr fleißig!«, wird sich Hahn später erinnern. Und von nun an wird, wenn das Wort Beta-Strahlung fällt, irgendwann auch der Name Lise Meitner fallen.
Einen ganz unterwarteten Effekt entdecken die beiden bei der Untersuchung der Alpha-Strahlung. Die Alpha-Strahlung besteht aus Helium-Kernen, und immer wenn ein radioaktiver Kern ein Alpha-Teilchen ausspuckt, erhält er einen gehörigen Rückstoß. Der Rückstoß kann unter Umständen so heftig sein, dass der betreffende Kern (der »Tochterkern«) aus der dünnen Schicht des radioaktiven Materials regelrecht herausgeschleudert wird, in aller Seelenruhe durch die Gegend schwebt und sich irgendwo als Niederschlag absetzt. Und natürlich, bemerkt Lise, muss man den neu entstandenen Tochterkern in diesem Niederschlag viel leichter nachweisen können als in der Ausgangssubstanz. Im Niederschlag müsste er hochgradig angereichert sein. Und so ist es auch. Lise und Otto finden in den Niederschlägen eine Reihe neuer radioaktiver Substanzen, viel unkomplizierter, als wenn sie versucht hätten, sie aus der Ausgangssubstanz zu isolieren. Die »Rückstoßmethode« ist geboren.
Zurück zur Beta-Strahlung.
Beta-Strahlung: Runde 1
Viele Untersuchungen zur Beta-Strahlung werden damals mit einer einfachen Anordnung gemacht. Auf der einen Seite eine Beta-Quelle, auf der anderen ein Nachweisgerät wie das oben erwähnte Blattelektroskop. Dazwischen Absorberplatten, deren Zahl man variieren und so das Durchdringungsvermögen der Beta-Strahlen untersuchen kann. Reine Substanzen, so meinen Otto und Lise und mit ihnen die meisten anderen Forscher, senden Beta-Strahlung einer ganz bestimmten Energie aus, deren Absorption nach einem Exponentialgesetz erfolgt. Je mehr Platten, umso geringer die Intensität der Strahlung, die hinter den Platten noch zu messen ist. So sehen ihre Befunde tatsächlich auch aus. Und dann, wenn der Abfall bei wachsender Plattenzahl einmal nicht exponentiell ist, stellt sich heraus, dass ihre Substanz nicht nur einen, sondern zwei oder drei verschiedene Beta-Strahler enthält. Auf diese Weise haben sie tatsächlich mehrere bisher unbekannte Substanzen entdeckt.
Aber Mitte des Jahres 1909 berichtet William Wilson, ein Assistent Rutherfords, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Wilson hat seine Beta-Strahlung — von der man inzwischen längst weiß, dass sie aus Elektronen besteht — durch ein Magnetfeld laufen lassen. Die negativ geladenen Elektronen werden abgelenkt, und zwar umso stärker, je geringer ihre Energie ist. Wenn man nun hinter dem Magnetfeld eine Lochblende anordnet, so kann man Elektronen einer ganz bestimmten Energie herausfiltern. Wunderschön — also müssten diese monoenergetischen Elektronen Ottos und Lises Hypothese zufolge einem exponentiellen Absorptionsverhalten folgen. Das tun sie aber nicht. Der Intensitätsabfall ist linear und nicht exponentiell!
Hahn und Meitner sind skeptisch. Sie weisen Wilson auf Unklarheiten bei seiner Anordnung hin und beschließen, das Experiment zu wiederholen. Diesmal ordnen sie aber hinter dem Magneten keine Lochblende an und weisen die Strahlung nicht durch ein Blattelektroskop nach. Nein: Sie lassen die Elektronen auf eine fotografische Platte prallen. Wenn die Elektronen monoenergetisch wären, dann müssten sie immer auf die gleiche Stelle des Films treffen bzw. eine einzelne geschwärzte Linie erzeugen (die Fokussierung durch den Magneten funktionierte nur in einer Dimension).
Im Chemischen Institut der Universität gibt es keinen starken Magneten. Der nächstgelegene geeignete Magnet befindet sich im Physikalischen Institut. Lise Meitner wird sich später erinnern, wie sie und Hahn nach Herstellung von Substanzen mit kurzer Zerfallszeit »wie aus der Pistole geschossen« zum einen Kilometer entfernten Physikinstitut rannten, um dort zu messen. Wenn die Zerfallszeit besonders kurz ist, muss es auch schon mal ein Taxi sein. Die Ergebnisse sind jedoch nicht eindeutig. Häufig sieht man wie erwartet eine einzelne klare Linie. Manchmal scheinen es aber auch zwei, drei oder mehr zu sein. Meitner, Hahn und ihr Kollege Otto von Baeyer, in dessen Labor der Magnet steht, erhöhen die Magnetfeldstärke, um die Auflösung der Spektrallinien zu verbessern. Gleiches Ergebnis! Zudem erscheinen die Linien hoher Energie keinesfalls scharf, sondern verwaschen und diffus.
Die ursprüngliche, einfache Hahn/Meitner-Hypothese ist also nicht zu halten. Etwas ratlos sammeln Otto und Lise in den nächsten Jahren einfach Daten. Noch eine Substanz und noch eine und noch eine. Alles sorgfältig protokolliert und veröffentlicht, aber ohne einen klaren Schlussstrich ziehen zu können. Im Juni 1912 schicken die beiden ihre vorerst letzte Arbeit zu diesem Thema an eine Zeitschrift. Tatsächlich soll sich der Beta-Zerfall als weitaus komplexer erweisen, als alle Beteiligten denken. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Zahl der widersprüchlichen Befunde wachsen und immer neue Fragen und Hypothesen aufwerfen.
Das Jahr 1912 bietet für Lise Meitner zwei erfreuliche Neuerungen. Erstens ernennt Max Planck sie zu seiner Assistentin — das erste Mal, dass es eine Frau an einer preußischen Universität auf eine solche Stelle schafft. Zwar besteht der größte Teil ihrer Arbeit darin, schriftliche Arbeiten von Plancks Studenten zu korrigieren, eine nervtötende Beschäftigung, aber: Sie wird dafür bezahlt! Viel ist es nicht, aber immerhin ist es ihr erstes selbst verdientes Geld als Wissenschaftlerin.
Zweitens wird in Berlin Dahlem, der zukünftigen vornehmen Villengegend im Südwesten Berlins, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie eingeweiht. Hahn erhält dort eine kleine Abteilung für Radiochemie. Sofort stellt er Lise Meitner ein, zunächst als unbezahlten Gast, kurz darauf als bezahlte offizielle Mitarbeiterin. Die Abteilung für Radiochemie trägt jetzt den Namen »Laboratorium Hahn/Meitner«. Trotz der organisatorischen Gleichstellung verdient Meitner nur ein Drittel von Hahns Gehalt. Allerdings ist sie im Gegensatz zu ihm nicht habilitiert und hat damit einen niedrigeren akademischen Rang als er. Noch dürfen Frauen in Deutschland sich sowieso nicht habilitieren.
Lise Meitner ist inzwischen auch mental gänzlich in Berlin angekommen. Schon in den Jahren zuvor hat sie einen beachtlichen Freundeskreis aufgebaut. Da ist die Botanikerin Elisabeth Schiemann, die ihr lebenslang eine enge Vertraute bleiben wird. Auch zu den beiden Planck-Töchtern hat sie ein freundschaftliches Verhältnis. Häufig unternehmen die vier Frauen Ausflüge in die Umgebung von Berlin. Mit Elisabeth Schiemann wandert sie sogar durch die Alpen. Und dann sind da die etwa gleichaltrigen Kollegen. Max von Laue, James Franck und Gustav Hertz, alles spätere Nobelpreisträger. In den Planck-Kreis ist sie sowieso integriert.
Planck ist und bleibt für Lise die hochverehrte Vaterfigur, eine schon damals weltweit anerkannte Koryphäe. Ähnlich prominent ist Fritz Haber, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für Chemie, an dem Lise jetzt arbeitet. Für die Entdeckung des Verfahrens zur Herstellung von Ammoniak wird er 1919 den Nobelpreis bekommen, ein Jahr nachdem Planck ihn für die Entdeckung seines Wirkungsquants bekommen hat. Anders als bei Planck wird die Verleihung des Preises an Haber im Ausland aber auf heftigen Protest stoßen: Er ist der Vater der deutschen Giftgasproduktion im Ersten Weltkrieg und wird zeitweilig als Kriegsverbrecher gesucht. Als Wissenschaftler rangiert er aber auf der gleichen Götterebene wie Planck, auch für Lise. Im April 1914 trifft noch ein weiterer Halbgott in Berlin ein: Albert Einstein. Max Planck hat ihn überreden können, von Zürich nach Berlin zu wechseln. Zwar ist Einstein nicht viel älter als Meitner, Franck und von Laue, aber die weltumstürzenden Erkenntnisse seines »Wunderjahres« 1905, darunter die Lichtquantenhypothese und die Relativitätstheorie, haben ihn unwiederbringlich in die Koryphäen-Kategorie katapultiert.
Kriegsjahre
Eine bezahlte Festanstellung, eine erfüllende wissenschaftliche Arbeit, ein Kreis guter und interessanter Freunde, wachsende internationale Anerkennung: Was kann sich Lise Meitner mehr wünschen? Ihre Welt scheint in Ordnung. Am 2. August 1914 bedankt sich Lise aus Wien, wo sie in Urlaub ist, bei Emil Fischer dafür, dass er eine gerade erfolgte Aufwertung ihrer Stelle unterstützt hat. Derselbe Fischer, der sie damals nicht in das alte Universitätsinstitut lassen wollte, schätzt sie inzwischen seit Langem. Schon 1909 hat er das Zutrittsverbot zum Institut aufgehoben und — auch preußische Professoren sind sozial lernfähig! — extra für sie eine Damentoilette einbauen lassen.
Im Sommer 1914 aber hat sich die Welt innerhalb weniger Wochen geändert. Sie ist nun alles andere als »in Ordnung«. Am 28. Juni ist der österreichische Thronfolger von einem serbischen Attentäter ermordet worden. Einen Monat später erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Russland, Schutzmacht Serbiens, tut daraufhin das Gleiche mit Österreich, kurz darauf Deutschland das Gleiche mit Russland, ein paar Tage später ist auch Frankreich Kriegspartei. Am 4. August schickt schließlich England eine Kriegserklärung nach Deutschland. Der Weltkrieg ist da, Europa ist nachgerade schlafwandlerisch in die blutigste Auseinandersetzung seiner Geschichte hineingestolpert.
Von Katastrophenstimmung ist in Deutschland und Österreich allerdings nichts zu spüren, im Gegenteil, es herrscht eine trunkene Kriegsbegeisterung. Auch Lise Meitner begrüßt den Krieg. Natürlich wünscht sie sich sehnlichst, dass er schnell und mit einem Sieg für Österreich und Deutschland zu Ende gehen möge. Sie hat all die Jahre an ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft festgehalten, aber sie fühlt sich inzwischen selbst »ein bisl deutsch«. Aus Wien schreibt sie ihrer Freundin Elisabeth Schiemann: »Es herrscht hier allgemein ein außerordentlich großes Vertrauen in unsere deutschen Kampfgenossen, und ich freue mich ganz persönlich darüber, weil ich mit einem gar nicht so kleinen Stückl meines Herzens zu Euch gehöre.« Ein bisl, ein Stückl — österreichische Einfärbungen können nationaler Begeisterung auch eine anrührende Note verleihen. Weniger anrührend lesen sich Äußerungen in einem Brief an eine befreundete schwedische Physikerin: »Aber trotzdem ich fast immer wie in einem bösen Traum umhergehe, empfinde ich, dass doch etwas Großes und Schönes darin liegt, dass die Menschen einmal für etwas ganz anderes kämpfen als für die gemeine Notdurft des Tages.« Gut, das hätte auch von Thomas Mann stammen können. Aber dass eine gebürtige Jüdin schreibt, »rein entwicklungsgeschichtlich« sei »die französische Rasse minderwertiger wie die deutsche und darum müssen wir siegen. Denn jetzt sind die Germanen die aufsteigenden Völker« — das erstaunt dann doch. Dass der deutsche Rassismus sie selber aus ihrem geliebten Deutschland und Millionen ihrer jüdischen Brüder und Schwestern in den Tod treiben wird, das ahnt sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht.
Viele deutsche Wissenschaftler sind begierig, dem Vaterland mit ihrem Fachwissen zu dienen, allen voran Fritz Haber. Als gebürtiger Jude ist er schon vor seinem Studium zum Christentum konvertiert und ist glühender deutscher Patriot. Mit seiner Glatze, dem Kneifer auf der kräftigen Nase und dem altmodischen Stehkragen ähnelt er eher einem strammen preußischen Beamten als einem Wissenschaftler. Die Liste seiner Erfolge ist lang, allen voran die erwähnte synthetische Herstellung von Ammoniak — die Grundlage für die Massenproduktion von Stickstoffdünger. Ein Wohltäter der Menschheit, möchte man meinen. Nun aber, im Ersten Weltkrieg, dient dasselbe Verfahren zur Herstellung von Sprengstoff. In seinem Institut, das schon bald der Heeresverwaltung unterstellt wird, lässt er die Methoden vervollkommnen. Und er beginnt, mit etwas ganz anderem zu experimentieren: mit Giftgas! Aus dem Wohltäter der Menschheit wird binnen weniger Monate der Vater des Gaskriegs.
Haber sieht das anders. Die Franzosen, führt er an, entwickelten schließlich auch Giftgas. Und das, obwohl es der Haager Landkriegsordnung widerspricht. Und außerdem: Der Giftgaseinsatz verkürze den Krieg und rette somit Menschenleben. Punkt, aus!
Auch Otto Hahn und Lise Meitner sind für dieses Argument empfänglich. Hahn meldet sich Anfang 1915 sogar freiwillig für Habers chemische Spezialtruppe. Am 22. April 1915 überwacht Haber in der Nähe von Ypern den ersten Einsatz seiner Erfindung. Hahn ist nicht dabei, er ist einen Tag zuvor nach Galizien an die Ostfront verlegt worden. Erst dort sieht er erstmals nach einem Giftgaseinsatz die elend erstickenden Soldaten. Er wird den Anblick nie vergessen.
Lise Meitner ist natürlich keine Augenzeugin des Grauens. Fern in Berlin nährt sie weiterhin die Hoffnung, den Krieg durch den Gaseinsatz schneller und mit weniger Opfern zu beenden. »Ich beglückwünsche Sie zu diesem schönen Erfolg bei Ypern«, schreibt sie einige Tage nach dem Einsatz von Ypern an Hahn, ihn immer noch an der Westfront wähnend.
Haber wird zum Hauptmann befördert, eine bis dahin nicht da gewesene Auszeichnung für einen Wissenschaftler. Am 1. Mai 1916 feiert er in seiner Villa in Berlin seine Beförderung. Während drinnen eben noch die letzten Sektkorken geknallt haben, greift sich Habers Frau Clara seinen Dienstrevolver. Sie ist selbst ausgewiesene Chemikerin. Teils wegen ihrer unglücklichen Ehe, teils wohl auch aus Verzweiflung über den Pakt, den ihr Mann mit dem Teufel geschlossen hat, erschießt sich Dr. Clara Haber, geborene Immerwahr, im Garten seiner Villa …
Im Sommer geht Lise Meitner als Röntgenschwester an die Front. Damit ist sie durchaus keine Ausnahme unter Wissenschaftlerinnen. Auch die Wiener Physikerin Marietta Blau dient als Röntgenschwester, ebenso wie auf der anderen Seite Marie Curie und ihre Tochter Irène. Am 4. August bringt ein Eisenbahntransport 200 österreichische Soldaten, 10 Ärzte und 50 Krankenschwestern von Wien nach Lemberg in Galizien, unter ihnen Lise. Zunächst steht keine Röntgenausrüstung zur Verfügung, und Lise arbeitet im Operationssaal. »So schrecklich habe ich es mir nicht vorgestellt«, schreibt sie an ihre Freundin Elisabeth. »Man macht sich seine eigenen Gedanken über den Krieg, wenn man all das hier sieht.« Menschen mit abgerissenen Gliedern, verurteilt zu einem Leben als Invalide (oder zum Tod), sterbende junge Männer, die kläglich nach ihrer Mutter rufen. Ihre Kriegseuphorie ist mit einem Mal wie verflogen. »Ich weiß momentan eigentlich keinen schöneren Wunsch als den nach Frieden«, fügt sie ein paar Tage später hinzu.
Der lässt allerdings noch auf sich warten. Insgesamt drei Jahre und drei Monate.
Irgendwann ist endlich die Röntgenstation eingerichtet, und Lise Meitner kann sich der Aufgabe widmen, deretwegen sie an die Front gezogen ist. Glücklich wird sie aber als Röntgenschwester nicht. Das Gefühl, Menschen zu helfen, das sie im Operationssaal hatte — hier will es sich nicht einstellen. Um nicht auf die Tätigkeit einer Röntgengehilfin eingeengt zu sein, repariert sie nach Dienstschluss alles, was irgendwie reparaturbedürftig erscheint. Aber auch das kann die zunehmend leerer werdenden Tage nicht ausfüllen. Sie beschleicht das Gefühl, überflüssig zu sein. Macht es noch Sinn, in Lemberg zu bleiben? Nein, sagt sie sich schließlich. Im Januar 1916 sucht sie um ihre Entlassung nach, meldet sich in Wien aber gleich wieder als Röntgenschwester. Nach fünf langen Monaten Wartezeit kann sie endlich zu einer neuen Stelle in einer Röntgenabteilung aufbrechen. Diesmal ist es Trient in Südtirol, damals noch zum Habsburgerreich gehörend. Aber sie kommt vom Regen in die Traufe. Auch hier fühlt sie sich überflüssig. Drei Wochen später verlässt sie Trient. Auch eine dritte Stelle, diesmal in Lublin, etwas westlich von Lemberg, stellt sich als Enttäuschung heraus.
Unter diesen Umständen, meint Lise Meitner, solle sie vielleicht doch besser versuchen, in ihrem eigentlichen Fachgebiet etwas Gutes für Deutschland zu leisen, auch ohne unmittelbare Kriegswichtigkeit. Im Oktober kehrt sie ins KWI nach Dahlem zurück.
Nummer 91: ein neues Element
Im Institut setzt sie eine Arbeit fort, die sie schon vor dem Krieg zusammen mit Otto Hahn begonnen hat. Sie wollen die Muttersubstanz von Aktinium finden, einem radioaktiven Element, das ein französischer Physiker im Jahr 1899 entdeckt hat und mit dem sie selbst schon vor Jahren experimentiert haben. Das Aktinium ist ein Zerfallsprodukt, und seit Anfang des Jahrhunderts stand die Frage im Raum: wovon? Welches Element ist die dazugehörige Muttersubstanz? Dieser Stoff würde den bisher leeren Platz 91 im Periodensystem der Elemente ausfüllen. Uran, das bisher schwerste bekannte Element, hat die Nummer 92.
Meitner macht also weiter, unterstützt durch Hahn, wenn er denn gelegentlich auf Heimaturlaub ist. Anfang 1917 wird er nach Berlin versetzt und kann jetzt häufiger vorbeischauen. Trotzdem: Die Hauptarbeit leistet eindeutig Lise Meitner. Sie kann inzwischen auch schon ohne Hahns Hilfe die chemischen Arbeiten ausführen. Und Anfang 1918 kann sie Erfolg vermelden. Element 91 ist identifiziert, und Meitner schreibt an Hahn: »Jedenfalls können wir jetzt wirklich bald ans Publizieren denken.« Am 16. März 1918 erscheint die Arbeit in der renommierten Physikalischen Zeitschrift. Für die neue Substanz schlagen die beiden den Namen Proaktinium vor. Lises ehemaliger Lehrstuhlinhaber aus Wien, Stefan Meyer, legt scherzhaft nahe, das Element Lisolenium zu nennen. Aber selbst wenn der Vorschlag ernst gemeint wäre: Lise Meitner würde ihn niemals akzeptieren. Dazu ist sie zu bescheiden. Oder zu schüchtern — wie man’s nimmt. Erst 29 Jahre nach ihrem Tod, im Jahr 1997, wird ein Element nach ihr benannt werden: Meitnerium (Mt). Es steht auf Platz 109 des Periodensystems.
Im August 1918 berichtet Lise Meitner im physikalischen Mittwochskolloquium über die Entdeckung. Otto Hahn ist nicht dabei. Er liegt in einem Militärkrankenhaus, vermutlich wegen einer Vergiftung mit Phosgen. Vor Lise im Auditorium aufgereiht: Max Planck, Albert Einstein, Heinrich Rubens (der Direktor des Physikalischen Instituts der Universität) und andere Größen, dazu die Riege derjenigen jüngeren Physiker, die nicht an der Front sind. Lise kann danach an Otto vermelden, dass Planck, Einstein und Rubens »jeder extra« gesagt hätten, wie »hübsch« die Arbeit sei. »Woraus Sie sehen können, dass ich ganz vernünftig vorgetragen habe, obwohl ich dummerweise wieder sehr befangen war.« Sie sei aber »mit einem freundschaftlichen Scherz Plancks und einer sehr wohlwollenden psychologischen Betrachtung Einsteins über meine Schüchternheit davongekommen.« Es dürfte diese Gelegenheit sein, bei der Einstein seine oben erwähnte Bemerkung zu Lises »Kleinmädchenverschämtheit« macht. Einstein, unkonventionell und drollig, will eben ganz besonders lieb sein …
Vor großem Publikum auftreten mag Lise immer noch nicht. Sie ist ein Mensch der kleinen Runde oder des Vieraugengesprächs. Berta Karlik, nach dem Zweiten Weltkrieg Leiterin des Wiener Radiuminstituts, wird sich später erinnern: »Jeder, der ihr begegnete, hatte sogleich den Eindruck einer starken Persönlichkeit. Die Intensität, mit der sie Gespräche führte, wird jedem, der sie persönlich kannte, unvergesslich bleiben. Scharfer Verstand, kritischer Geist und große Konzentrationsfähigkeit zeichneten sie aus.« Für ihre Studenten wird sie in den Zwanzigerjahren sowieso unangefochtene Respektsperson sein. Da zählt es nicht, dass sie nicht viel größer als anderthalb Meter ist und deshalb hinter ihrem Rücken liebevoll als »Lischen« tituliert wird. Öfter ist sie dank ihres klaren Durchgriffs und ihrer Kompetenz »die Meitnerin«.
»Von jeher stark demokratisch«: Lise Meitners Aufbruch in die Goldenen Zwanziger
Im Herbst 1918 geht es mit Deutschland und Österreich-Ungarn an den Kriegsfronten rapide bergab. Auch die Unzufriedenheit im Landesinneren wächst, und bald darauf fegt die Novemberrevolution die Kaiser-, Königs- und Fürstenhäuser in beiden Ländern von ihren Thronen. Am 9. November wird in Berlin die Republik ausgerufen. Sogar zweimal: zum einen durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann, zum anderen durch Karl Liebknecht, den Anführer des linken Spartakusbundes. Der Kampf zwischen gemäßigten Sozialdemokraten, Spartakisten, Nationalisten und Kaisertreuen wogt hin und her und fordert in dem halben Jahr nach der Revolution gut 3000 Todesopfer, darunter auch Liebknecht und seine Mitstreiterin Rosa Luxemburg. Lise Meitner liegt die radikale Richtung von Liebknecht und Luxemburg von ihrem gemäßigten Charakter her fern. Für sie sind das »gefährliche Narren«. Immer noch bewahrt sie sich ihre seltsam überhöhte Meinung vom Deutschtum, obwohl der Krieg sie doch etwas Besseres gelehrt haben könnte. Im Revolutionsmonat November hat sie »russische Zustände« befürchtet und Elisabeth Schiemann geschrieben: »Der Deutsche ist von Natur aus ruhig und besonnen und sehr zur Ordnung geneigt, und vorläufig ist auch alles ruhig und ordentlich zugegangen.« Da lebten Liebknecht und Luxemburg noch …
Im Sommer 1919 besiegelt der Versailler Vertrag endgültig das Ende des Kaiserreichs. Lise Meitner begrüßt die neue Republik, sie habe »von jeher stark demokratische Neigungen gehabt«, schreibt sie an ihre Freundin Schiemann. Dass es ihr gutes altes Österreich-Ungarn nicht mehr gibt, betrübt sie trotzdem ein wenig. Wenn sie nun über Böhmen nach Wien reist, muss sie durch ein anderes Land fahren, durch die Tschechoslowakei. Und obwohl Berlin inzwischen längst zu ihrer eigentlichen Heimat geworden ist, obwohl sie inzwischen überzeugte Anhängerin der Demokratie ist — tief im Innern trauert sie vielleicht doch ein bisschen der kaiserlich-königlichen Monarchie nach. Auf jeden Fall hat sie ihre österreichische Staatsbürgerschaft behalten und wird sie auch bis an ihr Lebensende nicht abgeben.
Mit Beginn der Weimarer Republik weht für Wissenschaftlerinnen ein neuer Wind. Auch für Lise Meitner persönlich. Max Planck, Emil Fischer und der Physikochemiker Walter Nernst (der ein Jahr später den Nobelpreis erhalten sollte) beantragen in Würdigung ihrer wissenschaftlichen Leistungen die Ernennung zur Professorin. Dem Antrag wird stattgegeben. Am 31. Juli verleiht der zuständige Minister Lise Meitner