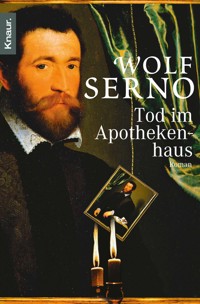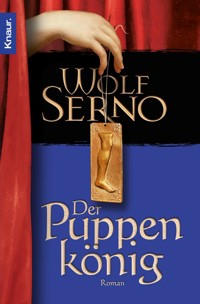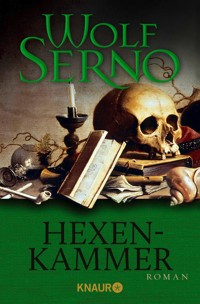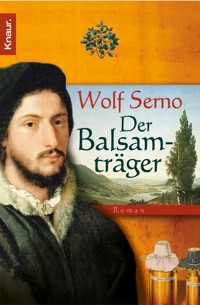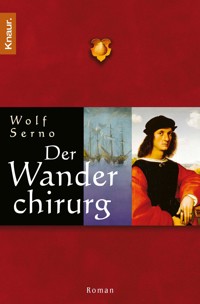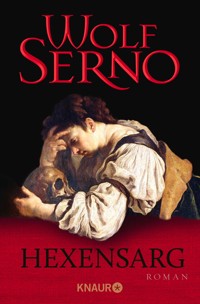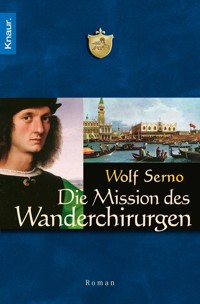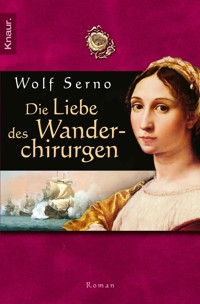6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Puppenspieler-Serie
- Sprache: Deutsch
Berlin, anno 1783: Als der Puppenspieler Julius Klingenthal die Stadt an der Spree betreten will, wird seine gesamte Barschaft beschlagnahmt. In seiner Not wendet er sich an niemand Geringeren als Friedrich den Großen, der in Potsdam residiert. Friedrich zeigt sich gnädig und hilft ihm. Doch beim Verlassen des Schlosses taumelt ihm ein Sterbender in die Arme, und wider Willen wird Julius in einen Kriminalfall hineingezogen … Das Spiel des Puppenkönigs von Wolf Serno: Historischer Roman im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Wolf Serno
Das Spiel des Puppenkönigs
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitatquellen
Motto
Die wichtigsten Personen
Prolog
Da …
Da wird …
Da wird sein …
Da wird sein Heulen …
Da wird sein Heulen und …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind berufen …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind berufen, aber …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind berufen, aber wenige …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind berufen, aber wenige sind …
Da wird sein Heulen und Zähneklappen, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet.
Epilog
Kleines Glossar Friderizianischer Ausdrücke:
Einige Erläuterungen zum historischen Hintergrund
Zu guter Letzt
Für mein Rudel:
Micky, Fiedler († 16), Buschmann, Eddi.
Und diesmal besonders für Sumo,
meinen Co-Autor, der mit mir die Wärmematte
in der fußkalten Dichterklause teilte.
Die religiösen Zitate des Romans stammen aus:
DIE BIBEL
Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
nach der deutschen Uebersetzung
D. Martin Luthers
Siebenundzwanzigster Abdruck
Gedruckt und verlegt von B. G. Teubner in Leipzig, 1877
*
Die jiddischen Schreibungen und Zitate des Romans
stammen aus:
Jiddisch – Eine kleine Enzyklopädie
von
Leo Rosten
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2002
*
Die verwendeten Zeilen aus der
Odyssee
stammen aus einer Übersetzung von
Roland Hampe
Verlag: Philipp Reclam jun. Stuttgart
»… doch das stärkste Giftwohnt einem Gewächs inne,das weder Pilz noch Kraut ist,weder Moos noch Farn:
Es ist ein Baum,ein turmhoher Riese,der auf den malaiischen Inselngedeiht – der Upas-Baum.
Man sagt, jeder Vogel,der durch seinegiftgeschwängerte Krone fliegt,fällt herab, und kein Tier,auch nicht der Mensch,kann sich ihm auf zehn Schrittenähern, ohne sofortden Tod zu erleiden.«
Johann Philipp Harsleben,Apotecarius zu Potsdam
Die wichtigsten Personenin der Reihenfolge ihres Auftritts:
Julius KlingenthalBauchredner und »Puppenkönig«
Friedrich der Große*König von Preußen
Strützky*Kammerhusar bei Hofe
Hans von ReckwitzAssistent von Friedrichs Leibarzt Prof. Selle
Elsa SieboldHebamme in Potsdam
AnniMagd im Palais Chattemont
AlenaKlagefrau; Klingenthals Geliebte
Doktor Korn, genannt »Körnchen«Arzt im Viertel
Madame de ChattemontGründerin des Collegium Artis in Potsdam
GöttscheMadames Kutscher
LudolfDiener im Palais Chattemont
Graf SøderborgSpion; Mitglied des Collegiums
Johann Georg Pfund*Kutscher Friedrichs des Großen
Girolamo Marchese Lucchesini*Vertrauter und Freund Friedrichs des Großen
Fürst KatusowGarde-Obrist, Spion; Mitglied des Collegiums
Hartmut von der EichKammerjunker bei Hofe
Wilhelm von KarstKammerjunker bei Hofe
Professor Doktor Selle*Leibarzt Friedrichs des Großen
Charles Dantal*Vorleser Friedrichs des Großen
Ehrenfried QuantzFlötenspieler; Neffe des Johann J. Quantz*
Generalmajor von Abraham · Geheimrat von Karius · Timothy Harrington · Gerard AdamMitglieder des Collegiums
Johann Philipp Harsleben*Apotheker in Potsdam
Pilâtre de Rozier*Konstrukteur von Luftschiffen
Die mit einem * gekennzeichneten Personen haben tatsächlich gelebt.
Prolog
Glaube Er ja nicht, ich könnte eine Ausnahme machen! Es bleibt dabei, ich muss eine der Puppen aufschneiden«, sagte der preußische Posten am Stadttor von Berlin. »Und zwar von oben bis unten. Vorschrift ist Vorschrift.«
Julius Klingenthal, der Besitzer der Puppen, wurde kreidebleich. »Das könnt Ihr nicht tun! Ihr zerstört damit meinen Broterwerb. Ich habe Euch doch gesagt, dass ich Bauchredner bin und dass jede Puppe für mich unersetzlich ist.«
»Und ich habe gesagt, dass ich keine Ausnahme machen kann.« Der Posten musterte Klingenthal scharf. »Wenn Ihm das nicht passt, kann Er sich ja höherenorts beschweren.«
»Ich will mich nicht beschweren, ich komme in friedlicher Absicht, ich will nichts weiter, als meine Vorstellungen in der Stadt geben. Aber bevor Ihr einer meiner Puppen auch nur ein Haar krümmt, kehre ich lieber um, dann kann Berlin mir gestohlen bleiben.« Klingenthal schickte sich an, den Karren, auf dem seine sechs lebensgroßen Puppen saßen, zu wenden, wurde aber vom Posten daran gehindert.
»Was soll das?«, fragte Klingenthal stirnrunzelnd.
»So einfach, wie Er sich das denkt, ist das nicht! Er hat sich verdächtig gemacht, sehr verdächtig. Sechs Figuren auf einem Karren, zusammengewürfelt wie ein Haufen Zigeuner, wer weiß, was alles in ihren Leibern versteckt ist. Pistolen, Pulver, Bajonette? Mit Waffen zieht man nicht durch preußische Lande, jedenfalls nicht, wenn man von niedriger Geburt ist, und das ist Er ja wohl, oder?«
Klingenthal biss sich auf die Lippen. Er war zwar nicht von Adel, doch er kam aus gutem Haus, einem Haus, in dem angesehene Bürger aus und ein gegangen waren und wo des Abends musiziert und französisch parliert wurde. Sein Vater war Geld- und Pfandleiher in Tangermünde gewesen, aber auch Jude, und das war ihm und der Familie zum Verhängnis geworden. In den Wirren des Siebenjährigen Krieges hatte man ihn und die Seinen denunziert, verfolgt und schließlich hingerichtet. Nur Klingenthal war übrig geblieben; ihn hatte ein launisches Schicksal überleben lassen und später – nach vielen verschlungenen Wegen – dazu ausersehen, Bauchredner zu werden. Nicht dass er etwas gegen die Tätigkeit als Ventriloquist gehabt hätte, im Gegenteil, er übte sie gern aus. Doch als Bauchredner stand er mit Tagelöhnern, Kleinbauern und Handwerkern auf der untersten Stufe der Gesellschaft und musste sich in der erniedrigenden dritten Person anreden lassen.
Klingenthal machte einen letzten Versuch. »In den Puppen befindet sich nur Wolle und Rosshaar«, sagte er und fügte, wenn auch widerstrebend, hinzu: »Bitte, lasst mich jetzt gehen.«
»Da kann Er so lange bitten, bis aus Kommissbrot Kuchen wird, ich habe meine Befehle.« Der Posten zog seinen Degen und begann, um den Karren herumzustolzieren. Drei Puppen saßen auf jeder Seite. Links die blonde Magd, die eine Haube und einen verblassten Kittel trug, daneben das Burgfräulein, eine ältliche Jungfer mit einem Spitzhut auf dem Kopf, blasiertem Blick und einem zerknüllten Taschentuch in der Hand, schließlich der Landmann mit seiner Forke – auf der rechten Seite saßen der Schiffer in Köperhosen, der Söldner im wehrhaften Harnisch und der Schultheiß in seiner Amtstracht mit goldener Amtskette. »Ist die aus echtem Gold?«, fragte der Posten misstrauisch.
Trotz der prekären Situation konnte Klingenthal sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Wenn sie aus Gold wäre, würde ich nicht hier stehen.«
»Aha, so.« Der Posten überlegte kurz, wie Klingenthal das meinte, dann sagte er: »An dieser Puppe werde ich die Probe aufs Exempel machen.« Entschlossen nahm er die Kette hoch, schlitzte den Schultheiß der Länge nach auf und wollte gerade in den Leib schauen, als ihn ein Schmerzensschrei innehalten ließ. Es war der Schrei eines Menschen, kein Zweifel, doch er kam direkt aus dem Mund der Puppe. Nein, das war nicht möglich, oder? Verwirrt wandte der Posten sich Klingenthal zu. »War Er das, der den Schrei ausgestoßen hat?«
Statt einer Antwort hörte er ein Röcheln in seinem Rücken, ein Röcheln, das langsam erstarb, und diesmal musste es von der Puppe kommen, denn der Kerl vor ihm hatte den Mund kein Jota verzogen. Niemand war in der Lage, derartige Laute ohne Lippenbewegungen zu erzeugen, auch nicht der beste Bauchredner. Wie war das möglich? Spuk und Zauberei gab es im aufgeklärten Preußen nicht, alles musste eine natürliche Erklärung haben. Aber welche?
»Mörder!« Der Posten zuckte unwillkürlich zusammen. Der Ausruf war von der Magd gekommen. »Du hast ihn umgebracht!«
»Kanaille!«, schloss sich das Burgfräulein an.
»Hundsfott!«, rief der Landmann.
»Kielholen, den Mann!«, rief der Schiffer.
»Auspeitschen!«, rief der Söldner.
Der Posten rang um Fassung. Das konnte nicht sein! Jedes Schimpfwort kam aus einem anderen Puppenmund. Die Magd hatte eine warme Stimme, das Burgfräulein kreischte, der Landmann sprach träge, Schiffer und Söldner klangen angriffslustig. Es war ganz so, als lebten die Figuren wirklich.
»Meine Puppen leben wirklich«, sagte Klingenthal, als hätte er die Gedanken des Postens erraten, »nur leider vergreifen sie sich manchmal im Ton. Ich bitte in ihrem Namen um Entschuldigung.«
»Äh, ja.« Der Posten überspielte seine Unsicherheit, indem er den Degen wieder in die Scheide stieß. »Jedenfalls scheint Er keine Waffen mit sich zu führen. Da hat Er Glück gehabt. Wie steht es mit Geld?«
»Geld?«
»Ja, Geld! Er will doch wohl nicht behaupten, Er reise ohne Münze?«
»Natürlich nicht«, sagte Klingenthal schnell. Erleichtert registrierte er, dass die Aufmerksamkeit des Postens nicht mehr seinen Lieblingen galt. »Ich habe Nürnberger Batzen dabei.«
»Nürnberger Batzen?«
»So ist es.« Klingenthal fragte sich, warum die Augen des Postens plötzlich aufleuchteten.
»Dann gehe Er schnurstracks zum Packhof. Dort wird man weitersehen.«
»Mit Verlaub, ist das ein Gasthaus?«
Der Posten gestattete sich ein Grinsen. »Ein Haus ist es schon, nur ob es gastlich ist, fragt sich.«
»Tut mir leid, ich werde als Erstes eine Herberge aufsuchen.«
»Das wird Er nicht!« Die Stimme des Postens klang wieder scharf. »Er wird tun, was ich sage. Los, auf zum Packhof, Marsch, Marsch!«
Es blieb Klingenthal nichts anderes übrig, als zu gehorchen, zumal unverhofft ein weiterer Wachsoldat neben ihm stand und ihm einen unsanften Stoß versetzte. »Mitkommen«, befahl der Mann.
»Ich werde mich über Euch beschweren!«, rief Klingenthal wütend.
Der Posten grinste erneut. »Tue Er, was Er nicht lassen kann. Am besten im Packhof.«
Vor dem Packhof, einem großen steinernen Bau, musste Klingenthal auf Geheiß des Wachsoldaten seinen Karren zum Stehen bringen. Es dauerte eine Weile, bis ein pedantisch gekleideter, Perücke tragender Mann heraustrat – der Packhofinspektor. Statt einer Begrüßung stemmte er die Arme in die Hüften und unterzog Klingenthal einer eingehenden Musterung. Was er sah, war ein Mann von mittlerer Größe und gut proportionierter Statur, vielleicht Mitte vierzig, mit einem wettergebräunten Gesicht und einer für die Landstraße ungewöhnlichen Kleidung: Er trug einen Gehrock aus feinem schwarzem Nankinett. Ebenfalls ungewöhnlich war, dass er keinen Gaul vor seinen Karren gespannt hatte. Er schien das Gefährt selbst zu ziehen. War er ein Herr, der zum Spaß einen Wagen zog, oder war er ein Kärrner, der zum Spaß einen Rock trug? Angesichts der ausgetretenen Schuhe und der bunten Puppen auf dem Wagen entschied der Inspektor, es mit einem Mann aus dem fahrenden Volk zu tun zu haben – einem Laienspieler vielleicht oder einem Possenreißer. »Hat Er etwas zu verzollen?«, fragte er laut.
Klingenthal, der sich zunehmend vorkam, als stünde er am Pranger, sagte: »Ich protestiere gegen die Behandlung, die mir am Tor widerfahren ist. Der Posten hat aus nichtigen Gründen eine meiner Puppen aufgeschlitzt!«
»So, hat er das? Dann hat er nur seine Pflicht getan«, erwiderte der Inspektor ungerührt. »Ebenso, wie ich meine Pflicht zu tun gedenke. Ich frage Ihn nochmals: Hat Er etwas zu verzollen?«
»Nein, nichts.«
Der Wachsoldat mischte sich ein. »Er hat Nürnberger Batzen dabei.«
»Was, Nürnberger Batzen?« Die Stimme des Inspektors klang, als führe Klingenthal einen Kübel Fäkalien mit sich.
»Es ist gutes Geld. Ein Batzen entspricht ungefähr vier Kreuzern, so sagte man mir.«
»Es ist ungültiges Geld! Unterstehe Er sich, es in die Stadt einschmuggeln zu wollen!«
Klingenthal erschrak. »Das liegt mir fern. Ich wusste nicht, dass die Batzen hier nicht gelten.«
»Was heißt, hier nicht gelten? Unser König Friedrich hat fremde Währungen schon vor Jahrzehnten verboten.«
»Auch das wusste ich nicht. Ich bin zum ersten Mal in Berlin.«
Der Inspektor zog die Brauen hoch. »Das nützt Ihm nichts. Ich muss die Batzen beschlagnahmen.«
»Kann ich sie nicht in preußische Taler umtauschen? Das muss doch möglich sein?«
»Nein. Fremde Währungen existieren hierzulande nicht, und was nicht existiert, kann auch nicht eingetauscht werden. Nun gebe Er das Geld heraus.«
»Ich denke, es existiert nicht? Wie soll ich es da herausgeben?«
»Will Er infam werden? Händige Er mir das Geld aus, bevor ich Gewalt anwenden lasse!«
Klingenthals Kiefermuskeln mahlten, doch er beherrschte sich. Langsam wurde ihm klar, warum die Augen des Postens am Tor so schadenfroh aufgeleuchtet hatten. Widerstrebend griff er unter seinen Rock und holte seine Geldkatze hervor. »Es ist meine gesamte Barschaft, wovon soll ich leben, wenn Ihr sie mir nehmt?«
»Das ist Sein Problem, das hätte Er sich früher überlegen müssen.«
»Ich möchte eine Quittung für mein Geld. Wenigstens darauf sollte ich Anspruch haben.«
»Er hat hier nichts zu prätendiren! Er braucht keine Quittung, im Übrigen existiert das Geld nicht.«
Klingenthal gab auf. Als einer, der im Altmärkischen aufgewachsen war, wusste er, wie stur die preußischen Beamten sein konnten, doch dass sie so stur waren, hatte er nicht für möglich gehalten. Er übergab das Geld.
Der Inspektor nahm es. »Er soll froh sein, dass ich Ihn nicht wegen Conterbande belange, was glaubt Er wohl, wie viel beschlagnahmte Schmuggelware im Packhof lagert!«
Klingenthal schwieg, er spürte, dass jedes weitere Wort überflüssig sein würde. Auch seine Puppen schwiegen. Nur der Söldner konnte nicht an sich halten und zischte: »Das ist Wegelagerei.« Und der Schiffer ergänzte: »Piraterie.« Allerdings sagten beide es so leise, dass weder der Wachsoldat noch der Inspektor es hören konnten. Für Letzteren schien der Fall erledigt zu sein, denn er schickte den Wachsoldaten fort und wandte sich selbst zum Gehen. In einer Anwandlung von Milde sagte er: »Wenn Er kein Geld hat, muss Er sich welches verdienen, wie jeder industrieuse Mann es tut. Bis dahin mag Er im Weißen Schwan logieren, der Wirt ist kein übler Mann, vielleicht nimmt er Ihn erst einmal so auf.« Sprach’s und verschwand in dem hohen Gemäuer des Packhofs.
Klingenthal blieb allein zurück.
Er war angekommen im quirligen Berlin, doch er fühlte sich wie der einsamste Mensch auf Erden.
Der Wirt vom Weißen Schwan sah aus wie alle seiner Zunft: Er war rotgesichtig und fettleibig und darüber hinaus schlecht zu Fuß. Umso mehr war es ihm anzurechnen, dass er sich bereit erklärt hatte, vor sein Gasthaus zu treten und Klingenthal und seine Puppen in Augenschein zu nehmen. Da zu seinen Charaktereigenschaften auch die Gutmütigkeit zählte, war er einverstanden, Klingenthal für drei Tage aufzunehmen, nachdem dieser ihm sein Leid geklagt hatte.
»Aber nur für drei Tage«, keuchte er kurzatmig, »und nur, weil der Packhofinspektor es gesagt hat. Berlin ist ein teures Pflaster, und es wird mit jedem Tag teurer. Es gibt nichts, was der Alte Fritz nicht mit Steuern belegt hat, nichts! Allein acht Silbergroschen für jedes Pfund Kaffee sackt er ein, und selber rösten ist strengstens verboten! Ein Wunder, dass Pinkeln und Atmen noch steuerfrei sind.«
Klingenthal wollte sich höflich bedanken, wurde aber von einer breithüftigen Frau unterbrochen, die aus dem Gasthaus gelaufen kam und voller Empörung rief: »Carl-Wilhelm, Carl-Wilhelm, wo steckst du bloß wieder, denkst wohl, die Arbeit macht sich von allein, ich sage dir …«
Was sie sagen wollte, sollte ihr Geheimnis bleiben, denn sie hatte Klingenthal mit seinen Puppen auf dem Wagen entdeckt, was eine abrupte Wandlung in ihrem Gesicht auslöste. Eben noch zornentbrannt, glätteten sich ihre Züge, wurden freundlicher, ja, ordneten sich sogar zu einer strahlenden Miene. Der Grund war, und das konnte Klingenthal nicht wissen, dass sie eine Nichte in Steinfurth an der Elbe hatte, mit der sie in regem Briefwechsel stand, und diese Nichte hatte ihr schon häufiger von einem Puppenspieler berichtet, einem Meister seines Fachs, der nicht zuletzt deshalb »der Puppenkönig« genannt wurde. Dieser Puppenkönig verstehe es wie kein Zweiter, mit dem Bauch zu reden und ganze Marktplätze zum Lachen zu bringen. »Ihr müsst Meister Klingenthal sein«, sprudelte sie hervor, »ich bin die Wirtin, willkommen im Weißen Schwan! Ich hoffe, Ihr beehrt uns recht lange.«
Der Wirt brummte: »Er bleibt fürs Erste nur drei Tage.«
»Nur drei Tage? Kommt überhaupt nicht in Frage.«
»Doch.« Der Wirt erklärte die missliche Lage, in die Klingenthal geraten war.
Bevor seine Frau darauf etwas entgegnen konnte, sagte Klingenthal: »Gleich morgen werde ich eine Vorstellung geben, bei der ich etwas Geld zu verdienen hoffe. Ich bin Euch sehr verbunden, Frau Wirtin.«
»Jawoll, gehorsamsten Dank, Gnädigste!«, rief der Söldner.
»Ahoi, schließe mich den Worten der Landratte an!«, rief der Schiffer.
»Auch ich möchte mich bedanken«, sagte die Magd.
»Ebenso wie ich«, sagte das Burgfräulein. »Von Dame zu Dame.«
Der Landmann sagte nichts, denn er weilte im Land der Träume, wie seinen Schnarchgeräuschen deutlich zu entnehmen war.
Wieder ging eine Veränderung im Gesicht der Wirtin vor. Ihre strahlende Miene verblasste und machte einem Ausdruck großer Verblüffung Platz, denn etwas Derartiges hatte sie noch nie erlebt. Zwar hatte die Nichte ihr Klingenthals Ventriloquierkünste in den leuchtendsten Farben beschrieben, doch war das nichts im Vergleich mit der Wirklichkeit. »Ihr seid tatsächlich ein Meister Eures Fachs«, brachte sie schließlich staunend hervor.
Klingenthal, dem es sichtlich guttat, mit Respekt behandelt zu werden, erwiderte: »Leider kann sich der Schultheiß nicht bei Euch bedanken, denn der Posten am Stadttor hat ihm den Bauch aufgeschlitzt. Er ist schwer verletzt und ringt mit dem Tod. Ich hoffe, er kommt durch.«
Die Wirtin wunderte sich ein wenig, wie sehr Klingenthal seine Puppen vermenschlichte, doch sie ließ sich nichts anmerken und sagte: »Ja, ich sehe es. Vielleicht kann ich helfen, ich hab Nadel und Faden. Aber nun kommt erst mal rein, alles Weitere findet sich.«
Klingenthal hatte seine Puppen nacheinander ins Gasthaus getragen und sie in der ihm zugewiesenen Dachkammer abgesetzt. Dann hatte er seine wenige Habe aus dem Karren genommen und ebenfalls in seine neue Bleibe gebracht. Nun blickte er sich um. Der Raum maß vielleicht drei mal drei Schritte im Geviert, wies ein einfaches Lager auf, dazu eine Spiegelscherbe an der Wand und einen Waschtisch mit Schüssel und Wasserkruke in der gegenüberliegenden Ecke. Ein Fenster gab es nicht. Das wenige Licht, das den Raum erhellte, fiel durch ein paar Ritzen in den Dachsparren. Klingenthal hatte schon behaglicher gewohnt, aber er konnte keine Ansprüche stellen. Er bettete den Schultheiß vorsichtig auf das Lager und entzündete eine Kerze.
Es klopfte. Die Wirtin, Nadel und Faden in der Hand, trat ein. »Damit kriege ich die Puppe wieder ganz!«, rief sie eifrig. »Ich sehe, Ihr habt schon ein Licht angemacht, das ist gut, dann kann ich besser arbeiten.«
»Sehr liebenswürdig von Euch, aber ich möchte die Operation selbst durchführen«, sagte Klingenthal.
»Könnt Ihr denn mit Nadel und Faden umgehen?«
»Gewiss. Alle meine Puppen habe ich eigenhändig gefertigt. Die erste war der Schultheiß, deshalb liegt sie mir besonders am Herzen. Oh, Ihr habt nur schwarzen Zwirn mitgebracht, darf ich Euch bitten, auch noch weißen und braunen zu holen?«
»Ja, gern, aber wieso?«
»Der schwarze Zwirn passt zur Farbe der Hose, doch das Leinenhemd ist weiß und der Rock rotbraun. Wenn Ihr so freundlich wärt, könnte ich alles Ton in Ton nähen.«
Während die Wirtin verschwand, legte Klingenthal schon Hand an. Er streifte dem Schultheiß die Hose zurück und knöpfte den beschädigten Rock auf. Gleiches tat er mit dem Leinenhemd darunter. Seine Hände gingen dabei kundig und behutsam vor. »Bald wird es dir wieder besser gehen«, murmelte er. »Ich tue mein Bestes.«
Er betastete das feine Ziegenleder, das der Puppe als Haut diente, und begann das Rosshaar und die Wolle wieder in den Leib zu stopfen.
Der Schultheiß gab knisternde Laute von sich. Im Flackerlicht der Kerze sah es aus, als rolle er dabei mit den gläsernen Augen.
»Ja«, sagte Klingenthal, »ja, ich weiß, dass du Schmerzen hast.« Erleichtert stellte er fest, dass die Schnittkanten der Wunde glatt und sauber waren – der Degen des Postens musste rasiermesserscharf gewesen sein. Die Wirtin erschien wieder, weiteren Zwirn und einen dreiarmigen Kerzenleuchter herbeitragend. »Mehr Licht wird Euch die Arbeit erleichtern, lieber Meister. Ich will nicht, dass Ihr Euch die Augen verderbt.«
Klingenthal dankte. Er hatte sich entschlossen, per Zick-Zack-Stich eine Anstoßnaht herzustellen und so das auseinanderklaffende Ziegenleder wieder zusammenzufügen. Die Operation verlangte einiges Geschick, doch sie gelang. Dann nahm er sich das Hemd vor, für dessen Ausbesserung er den weißen Zwirn wählte.
Die Wirtin verfolgte jede seiner Tätigkeiten mit Argusaugen. »Alles, was recht ist, Ihr setzt die Stiche so, als wärt Ihr bei einem Schneider in die Lehre gegangen!«
»Ein Schneider war es nicht. Ich lernte das Nähen bei einem Meister der Puppenmacherei, sein Name ist Zacharias Neuberger. Er war ein sehr strenger Lehrer. Streng, aber auch gütig und geduldig. Eine lebensgroße Puppe herzustellen erfordert unzählige Arbeitsschritte und vielerlei Materialien, so ist der Leib aus Wolle, Stroh, Wachs oder Rosshaar, der Kopf aus asiatischem Pflanzengummi, das Haar aus echtem Menschenhaar. Wie Ihr seht, hat der Schultheiß unter seiner Perücke schon leicht angegrautes Haupthaar, genau wie ich.«
Die Wirtin, die jedes Wort wie ein Schwamm aufgesogen hatte, nickte.
»Wenn eine Puppe entsteht, ist das immer ein langer Prozess, Körperteil kommt zu Körperteil, Glied zu Glied, der Leib wächst heran wie bei einem Menschen. Während der ganzen Zeit spricht man mit der Puppe, erst wenig, dann mehr, und eines Tages stellt man fest, dass die Puppe antwortet. Das ist der Zeitpunkt, an dem sie zu leben beginnt. Alle meine Puppen leben, und mit ein wenig Glück wird auch der Schultheiß weiterleben.«
»Ich finde, er sieht Euch ähnlich.«
»Das hat schon mancher gesagt.« Klingenthal arbeitete weiter, zog wie ein Uhrwerk den Faden durch den Stoff und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Es lag schon an die zwanzig Jahre zurück, dass er den Schultheiß erschaffen hatte, zwanzig Jahre, in denen unendlich viel geschehen war, in denen er nicht weniger als fünf weitere Puppen gefertigt, eingekleidet und zum Reden gebracht hatte.
Der Söldner verkörperte die Zeit, in der er als Infanterist gedient hatte, der Schiffer stand für die Zeit als Matrose und der Landmann für die Zeit als Knecht. Die Magd erinnerte an eine alte Dänin, die der gute Geist im Hause Klingenthal in Tangermünde gewesen war, und das Burgfräulein an eine adlige Dame, die er als Knabe glühend verehrt hatte. Alle Puppen standen ihm auf ihre Art nahe und waren ein Teil seiner selbst. Am nächsten aber stand ihm der Schultheiß, obwohl Klingenthal niemals das Amt eines Bürgermeisters ausgeübt hatte.
Bevor er den Schultheiß erschaffen hatte, war er Student der Medizin gewesen, ein sehr guter sogar, nur hatte ihm das wenig genützt an jenem Tag, als dem Professor die Operation misslang, der Patient starb und man ihm die Schuld in die Schuhe schob. Klingenthal hatte sich gewehrt, hatte den wahren Sachverhalt vor dem Untersuchungsausschuss geschildert, doch das Wort des Professors stand gegen das seine – und damit das Wort einer anerkannten Kapazität gegen das eines kleinen Studenten und darüber hinaus gegen das eines Juden. Er hatte die Universität verlassen müssen, und seine Hoffnung, einmal Arzt werden zu können, war wie eine Seifenblase zerplatzt.
So hatte er sich der Puppenmacherei zugewandt, das Ventriloquieren erlernt und zunächst eine Arztpuppe herstellen wollen, gleichsam als Ersatz für den entgangenen Lebenstraum. Doch Zacharias Neuberger, der Puppenmacher, hatte ihn überzeugt, dass es besser wäre, eine andere Figur zu erschaffen, denn nur eine Puppe, die ohne Bitterkeit und Rachegefühle entstünde, würde am Ende Freude machen.
Klingenthal hatte sich für einen Schultheiß entschieden, für eine Figur, die sich durch Höflichkeit, Freundlichkeit und vor allem durch Gerechtigkeit auszeichnete.
»Ihr seid gleich fertig«, unterbrach die Wirtin seinen Gedankenfluss, »ich muss zugeben, dass ich es nicht so schnell geschafft hätte. Die Puppe sieht wieder aus, als wär ihr nie was passiert.«
»Ja, es scheint noch einmal gut gegangen zu sein«, sagte Klingenthal und gab dem Schultheiß einen aufmunternden Klaps.
»Ich … ich …«, krächzte der Schultheiß schwach. »Ich glaube, es geht wieder.«
»Hurra!«, brüllte der Söldner.
»Dem Himmel sei Dank!«, rief die Magd.
Der Schiffer, der manchmal zu Derbheiten neigte, rief: »Auf, auf, du müder Leib, an Backbord steht ein nacktes Weib!«
Die Wirtin fasste sich an den Busen. »Großer Gott, mir war eben schon wieder, als würden die Puppen wirklich sprechen!«
Klingenthal erwiderte nicht ohne Stolz: »Ein guter Bauchredner formt die Worte, aber nicht die Lippen, ein sehr guter Bauchredner versteht es darüber hinaus, die Worte zu lenken, als kämen sie aus einem ganz bestimmten Mund, ein Meisterbauchredner aber formt und lenkt die Worte mit ganz individueller Stimme, ebenso wie er in der Lage ist, sämtliche Geräusche dieser Welt täuschend echt nachzumachen.«
»Was Ihr nicht sagt!« Die Wirtin wollte Nadel und Faden wieder an sich nehmen, doch in diesem Augenblick drang von unten aus dem Schankraum lautes Fluchen und Schimpfen herauf, gefolgt von klatschenden Schlägen, dem Krachen von splitterndem Holz und allerlei Wehgeschrei.
Die Wirtin erstarrte, dann ging ein Ruck durch ihre füllige Gestalt, sie stürzte aus der Kammer und brüllte die Treppe hinunter: »Carl-Wilhelm, Carl-Wilhelm, wo steckst du bloß wieder, die Gäste prügeln sich und du …« Weiter kam sie nicht, denn vor ihr breitete sich ein Bild des Friedens aus. Die wenigen Zecher im Raum saßen da, als könnten sie kein Wässerchen trüben, widmeten sich ihren Bierkrügen, aßen Soleier und saure Gurken oder schmauchten ein Pfeifchen.
Der Schwanenwirt, der hinter dem Schanktisch Gläser spülte, blickte fragend auf. »Was hast du gesagt, Frau?«
»Äh, nichts.« Kleinlaut trat die Wirtin den Rückzug an und ging wieder in die Dachkammer, wo Klingenthal sie mit einem Lächeln empfing. »Ich sagte Euch doch: Ein Meister-Ventriloquist ist in der Lage, sämtliche Geräusche dieser Welt täuschend echt nachzumachen, und dazu gehören auch die Laute einer zünftigen Schlägerei.«
Obwohl sie gefoppt worden war, musste die Wirtin lachen. Ihre Bewunderung für Klingenthal stieg ins Unermessliche. »Ihr seid mir ein rechter Tausendsassa, mich so aufs Glatteis zu führen! Aber ich nehm’s Euch nicht übel, nee, das tu ich nicht, wollt Ihr heute noch was essen? Wartet, ich schick Euch was Leckeres rauf. Mögt Ihr gebratene Leber mit Äpfeln, Zwiebeln und Stampfkartoffeln?«
Klingenthal zögerte. Als Jude musste er sich an die jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut, halten, die den Verzehr von Schweinefleisch strikt verbot. War die gebratene Leber vom Schwein? Er hoffte, dass es sich nicht so verhielt, und sagte: »Sehr freundlich von Euch, vielen Dank.«
Der Söldner rief: »Ein Schlückchen Bier zum Runterspülen wär auch nicht zu verachten!«
»Oder ein Schlückchen Rum!«, rief der Schiffer.
Klingenthal entschuldigte sich für die unbescheidenen Forderungen seiner Puppen.
»Das macht doch nichts, lieber Meister.« Die Wirtin strahlte und deutete einen Knicks an. »Dauert nur ’nen Moment!« Dann, ohne ein weiteres Wort, nahm sie Nadel und Faden wieder an sich und eilte die Treppe hinunter. Und während sie hinunterlief, nahm sie sich vor, noch heute einen Brief zu schreiben und ihrer Nichte in Steinfurth die unglaubliche Neuigkeit vom Besuch des Puppenmeisters mitzuteilen.
Die würde blass werden vor Neid.
Am anderen Morgen trug Klingenthal seine Puppen einzeln durch den Schankraum hinaus und setzte sie auf seinen Karren, jede auf ihren angestammten Platz. Die letzte Puppe war der Schultheiß, den er besonders vorsichtig behandelte.
»Na, soll’s losgehen zur ersten Darbietung?«, fragte der Wirt, der sich wie immer hinter dem Schanktisch aufhielt.
»So ist es«, antwortete Klingenthal, »erst wollte ich den Schultheiß zurücklassen, aber er war nicht damit einverstanden, er sagte, er hätte wenig Lust, die ganze Zeit allein zu sein, im Übrigen fühle er sich wieder ganz gesund.«
Der Wirt steckte sich das Tuch, mit dem er die Tischfläche abgewischt hatte, umständlich in den Gürtel. »Ich an Eurer Stelle würde mir das mit der Darbietung noch mal überlegen, es wird Regen geben, das spüre ich in allen Knochen, und Regen wäre für Eure Vorstellung doch Gift, oder?«
»Das wäre er in der Tat«, bestätigte Klingenthal, der sich fragte, worauf der Dicke hinauswollte.
»Ich an Eurer Stelle würde mal zum König gehen, ein Versuch kann nicht schaden.«
»König, Versuch?« Klingenthal verstand nicht. »Was wollt Ihr damit sagen?«
Der Wirt wischte nochmals den Schanktisch ab, obwohl das gar nicht nötig war. »Der König ist seit ein paar Tagen wieder in Potsdam, und wie es heißt, zwickt ihn die Gicht neuerdings etwas weniger, wodurch seine Laune sich gebessert haben dürfte. Ich würde also nach Sanssouci gehen und ihm die Geschichte mit den Nürnberger Batzen erzählen, vielleicht habt Ihr Glück.«
»Ihr meint …?«
»Das meine ich. Der Alte Fritz ist zwar ein Bärbeiß, wie er im Buche steht, einer, der Taugenichtse, Drückeberger und Faulpelze nicht ausstehen kann, aber wenn einer seine Arbeit ordentlich tut und auch sonst einen manierlichen Eindruck macht, kann er ganz umgänglich sein.«
»An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht.«
»Deshalb sage ich es Euch. Versucht Euer Glück, nehmt Euren Reisepass mit und, wenn Ihr habt, auch die eine oder andere Referenz, und lasst Euch überraschen. Aber denkt daran: kein langes Geschwafel, kein Drumherumgerede, keine Fickfackereien.«
Wenig später, nachdem er seine Puppen wieder in die Stube gebracht hatte, war Klingenthal auf dem Weg nach Potsdam. Es war ungewohnt für ihn, allein zu marschieren, ohne Karren und ohne seine Lieblinge, doch hatte das auch sein Gutes, denn es war heiß an diesem Tag, die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel herab, und er geriet gehörig ins Schwitzen. Der Schwanenwirt mit seiner Regenprophezeiung hatte sich gründlich geirrt. Klingenthal musste lächeln. Noch immer hatte er den Brustton der Überzeugung im Ohr, mit dem der Wirt seine Voraussage gemacht hatte. Nun ja, jeder irrte sich früher oder später einmal, das war nur menschlich. Allerdings kam es darauf an, wie entscheidend der Irrtum war – das wusste niemand besser als Klingenthal selbst, denn im letzten November war er einem katastrophalen Irrglauben aufgesessen. Er hatte geglaubt, nein, er war sicher gewesen, dass er und Alena keine Zukunft haben würden. Alena … Er sah sie genau vor sich, besonders ihre Augen. Es waren schwarze Augen von ganz eigener Faszination, denn wer in sie hineinsah, hatte das Gefühl, sie wären in der Lage, alles auszudrücken, was ein Gemüt bewegt: Sie konnten jubeln und trauern, lieben und hassen, streiten und schlichten, loben und tadeln, schwatzen und schweigen – das alles und noch viel mehr konnten sie, je nachdem, wie ihrer Besitzerin zumute war. Ja, Alenas Augen waren so außergewöhnlich, dass man ihr übriges Gesicht erst auf den zweiten Blick beachtete, obwohl auch dieses von besonderem Reiz war: die Nase fein und gerade, der Mund weich und geschwungen, wobei Letzterer durchaus imstande war, die Sprache der Augen tatkräftig zu unterstützen.
Alena hatte die Sprache ihrer Augen zu ihrem Beruf gemacht, denn sie schlug sich als Klagefrau durchs Leben. Sie spendete den Hinterbliebenen Trost, sprach mit ihnen, sang mit ihnen, betete mit ihnen – und weinte mit ihnen in einer so herzzerreißenden, anrührenden Art, dass jeder sich am Ende gestärkt fühlte. Wie auf Bestellung war sie zu jeder Art von Gefühlsausbruch fähig.
Und genau das hatte Klingenthal gestört. Er war sich nie sicher gewesen, welche Alena er gerade vor sich hatte: die leidenschaftlich Liebende oder die Klagefrau. Dabei hätte er nur auf sein Herz hören müssen. Wie töricht war er gewesen, wie tör …!
Er schrak zusammen, ein Reiter preschte an ihm vorbei, Knechte und Landfrauen kamen ihm entgegen, die Straße belebte sich. Er zwang seine Gedanken wieder in die Gegenwart und spähte nach vorn. Eine Brücke rückte in sein Gesichtsfeld. Ob das die Glienicker Brücke war? In jedem Fall handelte es sich um eine Holzkonstruktion, die über den Havelstrom führte und die, er sah es mit Schrecken, nicht ohne weiteres zu passieren war, denn ein Schlagbaum mit Wachtposten versperrte den Übergang.
»Wohin des Wegs?«, fragte der Posten militärisch knapp.
Klingenthal zögerte kurz, ob er sein Ziel angeben sollte, entschloss sich aber dann, es mit der Wahrheit zu versuchen. Er entbot die Tageszeit und sagte, er wolle nach Sanssouci, um wegen eines privaten Anliegens vor den König zu treten.
Der Posten schien nicht weiter erstaunt. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendwelche Bittgesuche an den König gerichtet wurden, auch wenn dies meistens schriftlich und nicht persönlich geschah. »Soviel ich weiß, ist der König heute nicht in Sanssouci«, sagte er. »Er weilt im Potsdamer Schloss.«
»Vielen Dank für die Auskunft«, sagte Klingenthal angenehm berührt. Es schien auf dieser Welt auch Posten zu geben, die freundlich waren. »Welchen Weg nehme ich da am besten?«
Der Posten öffnete den Schlagbaum. »Am besten, Er geht die Straße einfach weiter geradeaus, immer nach Südosten, bis zum Berliner Tor, dann nach Potsdam hinein und direkt zum Alten Markt, da ist das Stadtschloss.«
Klingenthal bedankte sich nochmals und machte sich auf den Weg. Linker Hand floss die Havel, glitzernd und blau, begrenzt von sattgrünen Uferböschungen, befahren von rahgetakelten Kähnen, die emsig Lasten transportierten. Er genoss den friedvollen Anblick und musste an den Schiffer denken, der mit den anderen Puppen im Weißen Schwan geblieben war. Wie es ihnen wohl erging ohne ihren Meister?
Auch der Posten am Berliner Tor ließ ihn anstandslos passieren, was Klingenthal zum Anlass nahm, rasch auszuschreiten, ehe der Mann es sich anders überlegte. Kurz darauf tauchten links und rechts mehrstöckige Bauten auf, Bürgerhäuser, aber auch Kasernen – steinerne Zeugnisse dafür, dass Potsdam eine Garnisonsstadt war. Klingenthal ließ den Blick schweifen und konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken, zu seltsam war der Anblick, der sich ihm bot: Die meisten Häuser waren mit Figuren, Putten und Tieren geschmückt, von denen es mehr auf den Dächern zu geben schien als Spaziergänger auf den Straßen. Noch amüsanter kam ihm die traute Eintracht vor, in der die unterschiedlichsten Dinge an den Fassaden auftauchten: Da gab es Soldatenhosen, die an korinthischen Wandpfeilern zum Trocknen aushingen, Dreispitze, die zum Lüften über Marmorvasen gestülpt waren, oder auch mal, der Abwechslung wegen, einen einsamen Stiefel, der in blankgewichster Schwärze auf einem Fenstersims stand. Damit nicht genug, begegneten ihm mehrere Bierschilder, die von einer mit Halbgöttern beladenen Mauer herübergrüßten, gefolgt von einem windschiefen Tabakschild, das zum Schnupfen von echtem Mascarol aus Sevilla aufforderte. Die Potsdamer, ob Soldaten oder Bürger, schienen ein unbekümmertes Verhältnis zur Baukunst zu haben.
Klingenthal ging weiter und gelangte wie von selbst zum Alten Markt, der umrahmt war von prächtigen Bauten, darunter der Nikolai-Kirche, dem Rathaus und dem Barini-Palast. In der Mitte befand sich der große Obelisk und an der Südseite das Tor zu Friedrichs Stadtschloss. Es war ein schönes Tor – aber ebenfalls von Posten bewacht.
Da Klingenthal sein Glück nicht überstrapazieren wollte, dachte er, es gäbe vielleicht einen Einlass ohne Bewachung, wanderte die Schlossstraße hinunter, umrundete die gesamte Anlage und gelangte zum Paradeplatz, wo in diesem Augenblick die Leibgarde des Königs exerzierte. Die Männer des Regiments Garde du Corps verstanden ihr Handwerk, das sah ein Blinder mit dem Krückstock, und auch Klingenthal, der seit seiner Soldatenzeit nichts mehr mit dem Militär zu tun gehabt hatte, entging es nicht. Er war so vertieft in den Anblick von präzisem Gleichschritt, exakten Schwenks und präsentierten Gewehren, dass er zwei Offiziere, die hinter ihn getreten waren, gar nicht bemerkte.
»Na, juckt’s Ihn in den Hacken?«, fragte der eine Leutnant.
Klingenthal fuhr herum.
»Oder juckt’s Ihn in den Händen?«, fragte der andere Leutnant.
»Um Gottes willen, nein«, rief Klingenthal erschrocken. »Meine Herren, ich … ich …«
»Wo juckt’s Ihn denn?«, fragte der eine Leutnant.
»Wenn’s Ihn nicht in den Hacken und Händen juckt?«, fragte der andere Leutnant.
Beide Offiziere grinsten und schienen bester Laune zu sein. Klingenthal merkte allmählich, dass sie nichts Böses im Schilde führten und sich nur einen Spaß daraus machten, ihn auf den Arm zu nehmen. Er fasste sich ein Herz und sagte: »Ich möchte zum König.«
»Das möchten viele«, sagte der eine Leutnant.
»Aber den wenigsten gelingt es«, sagte der andere Leutnant.
»Das ist mir klar. Aber bei mir liegt ein besonderer Notfall vor.«
»Das höre ich nicht zum ersten Mal«, sagte der eine Leutnant.
»Und sicher auch nicht zum letzten Mal«, sagte der andere Leutnant.
»Es ist wirklich dringend. Es heißt, dass König Friedrich ein vielbeschäftigter Mann ist, es heißt aber auch, dass er der erste Diener seines Staates ist. Als unbescholtener Mann aus dem Volk bitte ich um eine kurze Audienz. Wenn Ihr, meine Herren, mir dazu verhelfen könntet, wäre ich Euch sehr verbunden.«
»Er hat Glück«, sagte der eine Leutnant, ernst werdend.
»Um nicht zu sagen, unglaublichen Dusel«, sagte der andere Leutnant, ebenfalls ernst werdend. »Der König weilt zurzeit im Lustgarten, nur hundert Schritte von hier entfernt. Er spricht mit einem seiner Gärtner, und wie es scheint, hat er einen extra-gnädigen Tag.«
»Weshalb auch wir heute extra-gnädig sind«, sagte der andere Leutnant. »Hat Er Papiere dabei, mit denen Er sich legitimieren kann?«
Klingenthal zog seinen Pass und einige Referenzen hervor.
Die Offiziere studierten alle Unterlagen sorgfältig und schienen es lustig zu finden, dass jemand sein Geld mit der Bauchrednerei verdiente. »Es gibt nichts zu beanstanden«, sagte der eine Leutnant.
»Um nicht zu sagen, es ist alles in Ordnung«, sagte der andere Leutnant. »Immer geradeaus, dann kann Er den König nicht verfehlen.«
Klingenthal sträubte sich. Sosehr er sich wünschte, sein Geld zurückzubekommen, so sehr fühlte er plötzlich Unsicherheit in sich aufsteigen. Der König hatte bestimmt andere Sorgen, als sich mit den Problemen eines Puppenspielers zu befassen. »Verzeihung, ich glaube nicht, dass Seine Majestät mich anhören will«, sagte er.
Statt einer Antwort traten die beiden Offiziere neben ihn. Der eine Leutnant nahm ihn beim linken Arm, der andere Leutnant nahm ihn beim rechten Arm. Es blieb Klingenthal nichts anderes übrig, als mit ihnen zu gehen. Sie führten ihn auf einen von Eibenhecken gesäumten Weg, dessen Ende von einem Tulpenbaum markiert wurde. Vor dem Baum stand ein Gärtner, und neben ihm stand, kein Zweifel, Friedrich der Große. Beide drehten den Ankömmlingen den Rücken zu, angeregt in ein Gespräch vertieft.
Die beiden Offiziere blieben in einigem Abstand mit Klingenthal stehen. Sie ließen ihn los. »Stillgestanden!«, befahl der eine Leutnant.
Klingenthal verharrte wie ein Ölgötze.
»Rechten Fuß vor«, befahl der andere Leutnant.
»Brust heraus, Kopf in die Höhe«, befahl der eine Leutnant.
»Briefe mit der rechten Hand hochhalten«, befahl der andere Leutnant.
»So stehen bleiben«, befahl der eine Leutnant.
»Und warten«, befahl der andere Leutnant.
Kaum hatten die Offiziere das gesagt, gingen sie fort, doch sie sahen sich noch ein paar Mal um, ob Klingenthal auch weiterhin regungslos dastand. Als sie endlich außer Sichtweite waren und Klingenthal schon einen Krampf im Fuß verspürte, wandte der König sich ihm zu. Er war klein von Gestalt, wirkte gebrechlich und stützte sich auf das, was man in feinen Kreisen ein »spanisches Röhrchen« nannte, einen schmalen Gehstock. Der Gärtner bekam einen Befehl und trabte los, um Klingenthals hochgehaltene Papiere zu holen. Als er sie hatte, gab der König dem Gärtner sein Röhrchen, damit er es halte, und begann Klingenthals Pass und Referenzen zu lesen.
Klingenthal stand weiterhin da wie eine Vogelscheuche und wagte nicht, sich zu rühren.
Endlich schien der König sein Studium beendet zu haben, er blickte auf und bedeutete Klingenthal, er möge näher treten. Klingenthal gehorchte. Langsam, um einen gemessenen Schritt bemüht, ging er auf den König zu, blieb in gebührendem Abstand stehen und verbeugte sich tief.
»Er ist gestern am 25. August 1783 nach Berlin gekommen«, sagte der König. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. »Er hat Referenzen als Puppenspieler. Wo sind die Puppen?«
»Die Puppen sind in Berlin, Eure Majestät.«
»Was will Er von mir, wenn Seine Puppen in Berlin sind?« Friedrichs Stimme klang leicht ungeduldig.
Klingenthal musste an den Schwanenwirt denken, der ihn vor langem Geschwafel, Drumherumgerede und Fickfackereien gewarnt hatte. Deshalb ging er nicht auf die Frage ein, sondern sagte ohne Umschweife: »Man hat mir im Packhof von Berlin mein Geld genommen, weil ich keine preußische Münze mit mir führte.« Dann erklärte er nach bestem Wissen und Gewissen den ganzen Vorgang und endete mit dem Satz: »Ich bitte Eure Majestät um Gerechtigkeit.«
»So, tut Er das«, sagte Friedrich, griff in die Tasche seines abgetragenen Uniformrocks, holte umständlich eine Portion losen Schnupftabaks hervor, nahm noch umständlicher eine Prise und nieste krachend. »Das ist gut für den Schlagfluss und gut fürs Gedächtnis«, sagte er wie zu sich selbst. Der Vorgang wiederholte sich. Abermals ein krachendes Niesen. Klingenthal sah mit Erstaunen, dass des Königs Rock schon zahllose Spuren dieser Entladungen aufwies, wie überhaupt festzustellen war, dass der Herrscher Preußens nicht gerade aussah, als käme er frisch aus der Kleiderkammer. Sein Dreispitz war an den Ecken abgestoßen, und die Stiefel waren staubig und verschmutzt. Das Einzige, was strahlend glänzte, waren der Schwarze-Adler-Orden auf der Brust und die Augen im Gesicht. Es waren blaue Augen, klar und hervorstehend, so hervorstehend, als wollten sie jedermann durchdringen und die Wahrheit erforschen. »Wie alt ist Er?«, fragte Friedrich.
»Siebenundvierzig, Majestät.«
»Er sieht jünger aus.«
»Jawohl, Eure Majestät, danke!«
»Hat Er gedient?«
Auf diese Frage war Klingenthal vorbereitet. »Jawohl, Eure Majestät, ich kämpfte als Infanterist in der Schlacht von Freiberg.«
»Aha.« Die großen blauen Augen fixierten Klingenthal. »Wann war die Schlacht, wo war die Schlacht, und wer gewann die Schlacht?«
Klingenthal antwortete in strammem Ton: »Am 29. Oktober 1762, Eure Majestät, es war ein Freitag, ich weiß es noch wie heute. Freiberg liegt in Sachsen, und wir feierten den endgültigen Sieg über die Österreicher.«
»So, so, und in welchem Regiment war Er?«
»In einem Freikorps, Majestät. Die Freikorps wurden von Eurem Bruder Heinrich, Seiner Hoheit dem Prinzen von Preußen, geführt.«
»In welchem Freikorps war Er?«
»Im Freikorps von Kleist, Majestät.«
»Hm, hm.« Friedrich schien mit den Antworten zufrieden zu sein. Dennoch musste ihn ein Restzweifel plagen, denn er stellte eine letzte Frage: »Welche seltsame Angewohnheit hatte der Kommandeur von Kleist, bevor er in die Schlacht zog?«
Klingenthal gestattete sich ein Lächeln. »Er ließ das gesamte Korps in Reih und Glied antreten, ritt vor die Front, stieg ab und begann in aller Ruhe, sich zu rasieren. Danach nahm er die Barbierschüssel mit dem Schaumwasser und den Bartstoppeln und kippte sie aus. Dazu rief er: ›Möge der Feind darin ersaufen, und nun: auf, auf, meine Kinder!‹«
Friedrich nickte. »Er hat gedient, ich glaube es. Und ich glaube Ihm auch, dass man Ihm in Berlin seine Münze genommen hat.«
»Jawohl, Sire«, sagte Klingenthal froh.
Friedrich stutzte und runzelte die Stirn. »Hat Er mich eben ›Sire‹ genannt? Spricht Er am Ende französisch? Tu parles français?«
»Oui, Sire, certainement, mais je ne le parle pas depuis longtemps.«
»Dann wollen wir weiter so sprechen«, sagte Friedrich auf Französisch. »Deutsch ist die Sprache der Knechte und Bauern, daran ändern auch Schmierer und Tintenkleckser wie dieser Geheimrat Goethe nichts. Wohlan, es ist wahr, dass die Batzen in meinem Lande nicht gelten, aber im Packhof hätte man Ihm die Batzen versiegeln müssen, damit Er sie nach Thüringen schicken und sich dafür andere Sorten geben lassen konnte. Das wäre korrekt gewesen. Nun, gebe Er sich zufrieden, Er wird sein Geld zurückerhalten.«
»Merci bien, Sire«, sagte Klingenthal glücklich und wollte fragen, wie das geschehen solle, doch in diesem Augenblick schlug die Turmuhr der Garnisonkirche ein Mal, und Friedrich wandte sich zum Gehen. »Ich muss fort«, sagte er, »sie warten mit der Suppe auf mich.«
Klingenthal blieb zurück und hatte den Eindruck, das Ganze wäre nur ein Spuk gewesen. Wo eben noch der Alte Fritz gestanden hatte, war jetzt Leere. Leere überall, kein Mensch war mehr zu sehen im Lustgarten. Klingenthal setzte sich auf eine Bank und wartete. Nichts geschah. Konnte es sein, dass der König ihn vergessen hatte? Klingenthal wartete weiter – und blieb weiter mit seinen Fragen allein. Gerade wollte er sich wieder erheben, da kam ein Uniformierter aus dem Schloss gelaufen, blickte sich um und herrschte ihn an: »Ist Er der Mann, der mit meinem König im Garten war?«
»Jawohl, der bin ich.«
»Ich bin der Kammerhusar Strützky. Komme Er mit.« Der Husar stürmte voran ins Schloss, so dass Klingenthal Mühe hatte, ihm zu folgen. Eiligen Schrittes ging es durch verschiedene Säle und Gänge und endete in einem Gemach, in dem sich Pagen, Lakaien und weitere Husaren aufhielten. Ein gedeckter Tisch stand in der Mitte, darauf eine Terrine mit Suppe, ein Rindfleischgericht, eine Portion Peitzer Karpfen mit Gartensalat, eine Portion Wildbret mit Gurkensalat, Brot, Butter, Käse, Früchte, dazu Messer, Gabel, Löffel und blütenweiße Servietten. Alles, was das Herz eines Hungrigen höher schlagen lässt, war vorhanden.
Strützky drängte Klingenthal an den Tisch und zog einen Stuhl heran. »Die Speise, die hier steht, hat Ihm der König auftragen lassen und befohlen, Er soll sich satt essen, und ich soll servieren. Nun also, frisch dran!«
Klingenthal setzte sich langsam, den Kopf voller Gedanken. Erst jetzt merkte er, wie erschöpft und hungrig er war. »Ich denke, es ziemt sich nicht, wenn Ihr mich bedient«, sagte er. »Ich komme auch allein zurecht.«
»Guten Appetit«, sagte Strützky unbeirrt und schöpfte Klingenthal einen Teller mit Gemüsesuppe voll.
Klingenthal begann zu essen. Die Suppe war frisch und nahrhaft. Er spürte, wie seine Lebensgeister zurückkehrten.
»Wein oder Bier?«, fragte Strützky. »Zum Fisch würde ich ein gutes Potsdamer Bier empfehlen, zu Rindfleisch und Wildbret eine Bouteille roten Muskatellers.«
Klingenthal winkte höflich ab. Er wollte weder Bier noch Wein trinken, und den Karpfen würde er sowieso nicht essen, obwohl es ihm erlaubt war, Fische, die Schuppen hatten, zu verzehren. Ebenso durfte er Wildbret verspeisen, soweit es sich um Reh oder Hirsch handelte, anders sah es mit Wildschwein aus, denn Schweine, ob wild oder domestiziert, waren in jedem Fall nicht koscher. Selbst Rindfleisch, obwohl von Wiederkäuern mit gespaltenen Hufen stammend, war abzulehnen, wenn es nicht nach ritueller Vorschrift geschlachtet worden war. So gesehen, konnte er eigentlich gar nichts essen, aber das wiederum wollte er auch nicht. »Bitte nur Wasser und, wenn es geht, etwas von dem Rindfleisch.«
Strützky zuckte mit den Schultern, brachte einen Krug Wasser und legte von dem Rindfleisch vor. Dann stellte er den Karpfen und das Wildbret auf eine Kohlenpfanne und fragte, was er sonst noch für Klingenthal tun könne.
»Nichts, danke.« Klingenthal genoss das zarte Fleisch, die Soße und die dampfenden Kartoffeln dazu und dachte an seinen Gönner, Friedrich den Großen, der so plötzlich verschwunden war und der in diesem Augenblick gewiss dasselbe aß. Der Alte Fritz, das musste er zugeben, war ein großzügiger Gastgeber. Doch würde er in der leidigen Batzen-Angelegenheit ebenso großzügig sein?
»Ist Er derjenige, der mit dem König im Lustgarten war?« In der Tür stand ein kleiner, akkurat gekleideter Mann, dem man schon von weitem den Schreiberling ansah.
Klingenthal bejahte.
»Er soll mit mir zum König kommen.« Der Schreiberling hatte eine näselnde Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
Strützky protestierte: »Aber der Puppenspieler hat ja noch gar nichts gegessen!«
»Na und? Intendirt Ihr etwa, Seine Majestät warten zu lassen? Ich darf doch sehr bitten.«
Strützky gab sich geschlagen und musste mit ansehen, wie Klingenthal, im Schlepptau des Schreiberlings, den Raum verließ. Wieder ging es durch Säle und Gänge, bis der Schreiberling schließlich vor einer großen zweiflügeligen Tür stehen blieb, ein andächtiges Gesicht zog und klopfte.
»Entrez!«
Gemeinsam betraten sie einen hohen Raum, offenbar ein Arbeitszimmer, denn ein Schreibtisch stand darin, und dahinter saß – der König. Zu seinen Füßen zwei seiner geliebten Windspiele. »Komme Er näher, Puppenspieler«, befahl Friedrich.
Klingenthal verbeugte sich klopfenden Herzens und tat, wie ihm geheißen.
»Hier hat Er seine Papiere wieder.« Friedrich winkte dem Schreiberling, damit dieser Klingenthal seinen Pass und seine Referenzen zurückgebe. Als das geschehen war, winkte Friedrich abermals, und der Schreiberling übergab ein weiteres Schriftstück.
»Es ist ein Reskript an den Packhof, darin ist angewiesen, dass man Ihm seine Batzen in Taler umtausche. Und hier« – Friedrich winkte zum dritten Mal – »ist ein Handgeld für das erlittene Ungemach.«
Der Schreiberling zählte Klingenthal fünf Dukaten und einen Friedrichsdor auf den Tisch, und der König fügte mit unmerklichem Lächeln hinzu: »Der Betrag wird dem Packhofinspektor vom Salär subtrahirt.«
Klingenthal wusste kaum, wie ihm geschah, er musste an sich halten, um nicht lauthals loszujubeln. Schließlich stammelte er einen Dank, doch Friedrich schüttelte den Kopf. »Er hat nichts zu danken. Er hat seine Schuldigkeit an Preußen getan, so hat Preußen auch seine Schuldigkeit an Ihm getan. Ich wünsche Ihm alles Gute. Er darf gehen.«
Sich rückwärts bewegend, verließ Klingenthal des Königs Zimmer, verbeugte sich nochmals tief und gelangte auf den Gang. Er ging wie im Traum, vielleicht dreißig Schritte weit, bis er zu einer Abzweigung kam. Sollte er sich nach links oder nach rechts wenden? Von wo war er gekommen? Er hatte nicht darauf geachtet. Ich muss mich konzentrieren, dachte er, es wäre doch gelacht, wenn ich nicht zurückfände. Wo war eigentlich der Schreiberling? Wahrscheinlich noch beim König. Der König. Ein warmes Gefühl durchströmte Klingenthal. Mochte Friedrich auch knorrig, geizig und bösartig sein, wie viele behaupteten, ungerecht war er nicht!
Klingenthal hielt sich rechts und schaute sich immer wieder um. Marmor, Säulen und Bilder – Bilder, Säulen und Marmor, irgendwie sah alles gleich aus. Egal, er musste nur vorwärtsgehen, dann würde er wie von selbst aus dem Schloss gelangen. Seltsam, dass es hier drinnen genauso menschenleer war wie draußen im Garten. Keine Wachen, keine Diener, nichts.
Sollte er nicht besser zurückgehen und nachfragen? Nein, das wäre zu peinlich. Doch halt, da kam jemand aus einer Seitentür! Klingenthal strebte dem Unbekannten entgegen – und blieb abrupt stehen. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Mann. Zwar war er ähnlich gut gekleidet wie der Kammerhusar Strützky, trug Perücke mit Zopf, Rock und Kniehosen, doch glich sein Gebaren eher einem, der die Nacht in der Gosse verbracht hatte. Er schwankte wie ein Rohr im Wind, taumelte, fasste sich an den Leib, krümmte sich, stieß unverständliche Laute aus und sank schlussendlich auf die Knie. Klingenthal war aufs höchste erschrocken. »Wie kann ich Euch helfen?«, rief er.
Die Antwort war ein Keuchen und Röcheln.
Klingenthal dämmerte es langsam, dass der Mann keine Schnapsleiche war, sondern an etwas Ernsterem litt. »Hört Ihr mich? Seht mich an!«
Der Oberkörper des Mannes sackte nach vorn, Klingenthal gelang es gerade noch, selbst auf die Knie zu sinken und die Gestalt aufzufangen. »Ihr müsst versuchen, tief und gleichmäßig zu atmen, tief und gleichmäßig atmen, hört Ihr?«
Der Mann stöhnte.
Klingenthal griff ihm in die Rockaufschläge, umklammerte ihn, damit er nicht umfalle, doch nun begann der Unbekannte zu zucken, am ganzen Körper zu zucken, und Klingenthal musste, ob er wollte oder nicht, mitzucken. Er kam sich hilflos vor, ratlos, lächerlich wie ein galvanisierter Froschschenkel, und bemühte sich trotzdem, den Leidenden ruhig zu halten. Aber es wollte ihm nicht gelingen, es schien, als entwickle der Mann übermenschliche Kräfte, Kräfte, die ein letztes Mal aufflackerten, bevor sie für immer erloschen.
Und sie erloschen.
Die Muskeln des Mannes erschlafften, der Körper sank in sich zusammen und wurde schwer. Klingenthal konnte ihn nicht mehr halten, er musste ihn zu Boden gleiten lassen.
Da lag der Unbekannte nun.
Klingenthal schloss ihm die Augen und richtete sich, nach Luft ringend, auf. Ein Karussell von Gedanken kreiste in seinem Hirn. Wer war der Tote? Und wie war er zu Tode gekommen? Durch eine infarzierte Ader, ein geplatztes Aneurysma, eine Attacke der Fallsucht? Er wusste es nicht. Um das zu klären, wären eingehende Untersuchungen nötig. Medizinische Untersuchungen, möglichst an einer Universität.
Als Klingenthal so weit mit seinen Überlegungen gediehen war, schoss ihm ein zweiter Schrecken in die Glieder. Er dachte daran, dass er sein Studium hatte abbrechen müssen, weil ihm die Schuld am Tode eines Menschen in die Schuhe geschoben worden war. Auch hier war ein Mensch zu Tode gekommen, und er, Klingenthal, stand direkt neben der Leiche!
Es würde besser sein, zu gehen, und das möglichst schnell. Nicht auszudenken, wenn man ihn für das Dahinscheiden des Unbekannten verantwortlich machte! Er blickte nach oben und murmelte: »Gott, Dein Name sei gepriesen, Du hast bisher dafür gesorgt, dass außer mir niemand Zeugnis über dieses Geschehnis ablegen kann, bitte sorge auch dafür, dass es weiterhin so bleibt!« Dann wollte er sich rasch davonmachen, aber irgendetwas war da noch, das ihn daran hinderte, irgendetwas, das ihm seltsam vorkam. Was war es nur? Dann wusste er es.
Der Tote trug Lederhandschuhe.
Daran war eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch mindestens zwei Dinge sprachen dagegen: Erstens der heiße Tag und zweitens die Beschaffenheit der Fingerlinge. Es waren einfach gefertigte gelbe Stücke, die nicht zur übrigen Kleidung des Toten passten. Was hatte das zu bedeuten? Klingenthal wusste es nicht, und wenn er es recht bedachte, wollte er es auch nicht wissen. Er wollte endlich hinaus aus dem Schloss, alles andere ging ihn nichts an.
Schnell lief er weiter.
Klingenthal fand kurz danach tatsächlich hinaus, aufatmend und fest entschlossen, niemals an diesen Ort zurückzukehren – sosehr der Alte Fritz ihn auch beeindruckt hatte. Er fuhr mit einem der königlichen Proviantwagen nach Berlin, ging in den Packhof und ließ sich sein Geld in Talern auszahlen, danach entlohnte er den Wirt vom Weißen Schwan und spannte sich vor seinen Karren, um noch am selben Tag die Stadt zu verlassen.
Er wandte sich nach Süden, wollte Entfernung und Zeit zwischen sich und die bösen Geschehnisse bringen. Er gab Vorstellungen auf dem Land, heimste viel Lob mit seinen Puppen ein und hatte ein gutes Auskommen. Und mit jeder Woche, die verging, dachte er weniger an das Erlebte. Er hätte zufrieden sein können, zufrieden und sorglos, wenn da nicht eine ganz bestimmte Erinnerung gewesen wäre, die ihn nicht losließ:
die Erinnerung an den Toten mit den Lederhandschuhen.
Da …
Elsa Siebold war eine altgediente Hebamme, die so schnell durch nichts zu erschüttern war, doch das, was sich in den letzten Tagen und Nächten vor ihren Augen zugetragen hatte, war selbst ihr fast zu viel geworden. Niemals zuvor hatte eine Gebärende so leiden müssen wie Anni. Gegen Anni, die Küchenmagd, schien sich alles verschworen zu haben. Es fing damit an, dass sie in ihrer Jugend unter der Englischen Krankheit gelitten hatte, wodurch ihr Körper nicht nur plumpe, kurze Glieder und verdickte Knöchel aufwies, sondern auch, und das war weitaus schlimmer, ein rachitisches Becken.
Es ging weiter damit, dass die Leibesfrucht ungewöhnlich groß war. Der bloße Anblick hatte Elsa Siebold diesen Umstand schon vermuten lassen, und die kundigen Handgriffe, mit denen sie den geschwollenen Leib abtastete, gaben ihr Gewissheit. Anschließend hatte sie eine innere Untersuchung vorgenommen und festgestellt, dass die Beckenwände nicht mit derselben Leichtigkeit zu erfühlen waren wie bei einem allgemein verengten Becken und dass die Wölbung des Kreuzbeins abgeflacht war. Das hatte den Ausschlag gegeben.
Nichts Gutes ahnend, hatte sie Doktor Quest holen lassen, einen jungen Arzt aus der Nachbarschaft, der mit wichtiger Miene in den kargen Raum getreten war und, des Anstands wegen, den Leib der Gebärenden unter der Bettdecke exploriert hatte. Nach einigen Minuten hatte er nichts anderes sagen können als das, was Elsa schon wusste. »Das Kind ist zu groß, und das Becken ist zu eng. Um es mit meinem französischen Kollegen François Rousset zu sagen: Bei abnorm großen Kindern, bei Zwillingsgeburten, bei Monstren, bei schwierigen Geburtslagen, intrauterinem Fruchttod und bei Enge der Geburtswege ist ein Kaiserschnitt das probate Mittel.«
Elsa hatte gefasst dreingeblickt und sich gefragt, ob der Herr Doktor denn auch alle notwendigen Instrumente mit sich führe, denn ihre eigenen reichten für den Eingriff nicht aus, doch Quest hatte weiter doziert: »Andererseits beträgt die mütterliche Mortalitätsrate bei dieser Operation mindestens achtzig Prozent, liebe Frau Siebold, weshalb ich kein Verfechter einer solchen Maßnahme bin. Lassen wir also Rousset mit seinen Propositionen beiseite. Das Kind wird schon kommen, eine bessere Wehmutter als Euch kann es sich nicht wünschen.«
Dann war er gegangen, und Elsa hatte den Kopf geschüttelt und sich gefragt, warum Quest einen Rückzieher gemacht hatte. Vielleicht hatte er Bedenken gehabt, die Operation in einer so ärmlichen Umgebung durchzuführen, vielleicht war es auch die Befürchtung gewesen, Anni könne ihn für seine Bemühungen nicht ausreichend entlohnen, vielleicht war es auch beides zusammen.
Das alles lag inzwischen dreißig oder mehr Stunden zurück, und Annis Leidensweg hatte von da an erst richtig begonnen. Elsa hatte sich nichts anmerken lassen, wie es sich für eine gute Hebamme gehört, und weitergemacht. Unermüdlich war sie für die Kreißende da gewesen, hatte neben ihr am Bettrand gesessen, ihr die Hand gehalten und ihr eine Abkochung von Mutterkorn verabreicht, um die Kontraktion der Gebärmutter zu unterstützen. Sie hatte ihr unzählige Male die Stirn abgewischt, hatte ihr Mut zugesprochen und ihr versichert, dass Kreuzschmerzen etwas ganz Normales bei einer Geburt seien, hatte ihr Weidenrindentee gekocht, mit ihr gebetet, wieder und wieder die Herztöne des Kindes mit dem Hörrohr abgehorcht und hatte immer aufs Neue die doppelt gefaltete Strohmatratze, die Annis Rücken abstützte, zurechtgerückt.
Oftmals hatte sie sich gewünscht, Anni wäre keine einfache Magd, sondern eine reiche Dame wie ihre Herrin, die vornehme Madame de Chattemont, die im gleichen Anwesen wohnte, selbstverständlich nicht in der untersten Kammer des Gesindeteils, sondern in der Belle Etage des mehrgeschossigen Palais. Als reiche Dame hätte Anni sich der besten Behandlung und Pflege sicher sein können, aber sie war nicht reich, sie war nicht einmal verheiratet, und das Kind würde ein Kind der Sünde sein. So musste sie gebären wie alle armen Frauen: entweder in einer Accouchiranstalt oder daheim mit Hilfe einer Hebamme, wobei sie sich noch glücklich schätzen konnte, dass Elsa ihr, weil sie befreundet waren, umsonst Beistand leistete.
Und Beistand hatte Anni wahrhaftig nötig, sie hatte Anwandlungen von Erbrechen und unlöschbarem Durst gehabt, Zeichen der Schwäche, und Elsa war nichts anderes übrig geblieben, als ihr ein ums andere Mal die Speischüssel unter das Kinn zu halten und frisches Brunnenwasser zu holen. Mehr hatte sie nicht tun können. Geschick, Geduld und Zuspruch, das waren die wichtigsten Tugenden einer guten Wehmutter.
Irgendwann war das Fruchtwasser abgegangen, Elsa wusste nicht genau, wann, denn sie war zwischendurch eingeschlafen, aber danach schien der Geburtsvorgang endlich voranzugehen, denn auch der Muttermund hatte sich zwei Zoll weit geöffnet.
Anni hatte die letzten Kräfte in ihrem gemarterten Körper angesammelt, und Elsa hatte sie angefeuert, hatte ihr zum hundertsten Mal vorgemacht, wie sie atmen sollte, hatte ihr zugerufen: »Du musst pressen, pressen, pressen, hörst du!«, aber dann, übergangslos, hatte Anni sich mit einem Seufzer in die Matratze zurücksinken lassen. Ihre Kraft war aufgebraucht, kein Fünkchen Wille hatte mehr in ihr gesteckt, dabei war ihr Leib noch immer so prall wie ein Kürbis gewesen und zu einem bedrohlichen Gefängnis für das Kind geworden.
Wieder hatte Elsa das Hörrohr angesetzt – und diesmal nichts vernommen. Sie hatte den Atem angehalten und das Hörrohr woanders angesetzt, hier, da und dort, doch es war dabei geblieben: nichts. Die Herztöne waren verstummt.
Das Kind war tot.
Alle Bemühungen waren umsonst gewesen. Das Kind war tot, und Elsa hatte nun, nach so vielen Stunden, die traurige Pflicht, es Anni zu sagen. »Du wirst bald erlöst sein«, sagte sie, »dann hat die Quälerei ein Ende.«
Anni nickte kaum merklich.
»Für das Kleine ist die Quälerei schon jetzt vorbei«, fuhr Elsa behutsam fort.
»Wie … wie meinst du das?«, murmelte Anni.
»So, wie du es verstanden hast. Aber bedenke«, fuhr Elsa schnell fort, »dass dein Kind wahrscheinlich sowieso tot herausgekommen wäre.«
Anni sagte nichts. Dann füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Muss ich jetzt sterben?«, flüsterte sie.
»Natürlich nicht«, erwiderte Elsa zuversichtlich. »Das Kind ist tot, aber du wirst leben. Ich muss das Kleine nur so perforieren, dass es herausgeht. Mach dir keine Sorgen, es ist nicht das erste Mal, dass ich so was tue. Verlass dich auf Elsa Siebold. Wenn das Kind aus dem Leib ist, wirst du dich gleich viel besser fühlen. Bestimmt war es Gottes Wille, dass dein Kind gestorben ist. Bedenke nur, welch ein Leben es gehabt hätte. Du hättest es fortgeben müssen, denn ich glaube nicht, dass Madame de Chattemont ein Bankert unter ihrem Dach geduldet hätte. Du wärst gezwungen gewesen, das Kleine ins Militärwaisenhaus zu stecken, nur ein paar Schritte von hier, wo es tagein, tagaus außer Dresche nur Mehlsuppe und Ochsengeschlinge gekriegt hätte. An hohen Feiertagen vielleicht auch mal Erbsen mit Speck oder eine Butterstulle. Ich habe eine Bekannte, die hatte eine Nachbarin, und die Nachbarin hatte ein Kind, das unter tragischen Umständen ins Militärwaisenhaus musste, ich glaube, es war im letzten Jahr, richtig, im letzten Jahr war es, wir haben ja schon 1784 …«
So sprach Elsa, um Anni abzulenken und vielleicht auch, um sich selbst auf andere Gedanken zu bringen, denn das, was sie tun musste, war keineswegs angenehm. Sie legte die notwendigen Instrumente zurecht: das Perforatorium, die speziellen Schädelzangen, die Kopfzieher und die Haken. Dann tastete sie mit den Händen noch einmal den Unterleib ab. Ja, an der Lage des Kindes war nichts auszusetzen, nur der Kopf stand fest im Beckeneingang, zu fest. Elsa fragte sich, woran das Kind gestorben sein mochte, doch sie schob den Gedanken beiseite. Um der Mutter willen durfte sie nicht länger warten.
Sie kniete sich vor das Lager und drückte Annis Schenkel noch ein wenig weiter auseinander. Anni sagte nichts, offenbar befand sie sich in einer Art Dämmerzustand. Elsa fuhr fort, die Geschichte von dem Nachbarkind im Militärwaisenhaus zu erzählen, sie erzählte irgendetwas, nur um den Fluss ihrer Rede aufrechtzuerhalten und Anni abzulenken. Sie griff zum Perforatorium mit dem scharfen metallenen Stern an der Spitze und führte es behutsam ein, damit es anschließend durch die Fontanelle im Kindeskopf gedrückt werden konnte. Nur gut, dass die Frucht tot ist, dachte sie und arbeitete weiter. Nach dem Perforatorium würden die anderen Instrumente zum Einsatz kommen, die Werkzeuge, mit deren Hilfe der Schädel zerkleinert und das Ungeborene herausgezogen werden konnte.