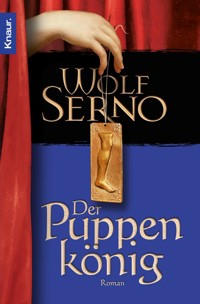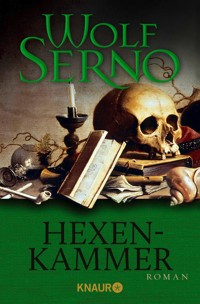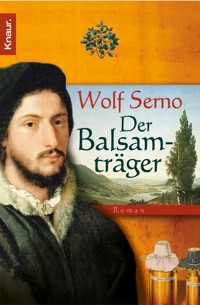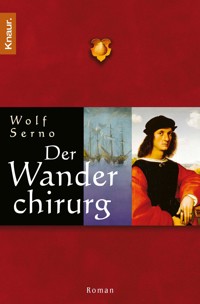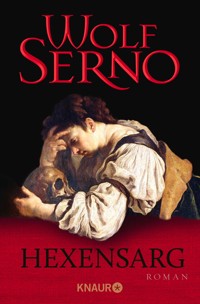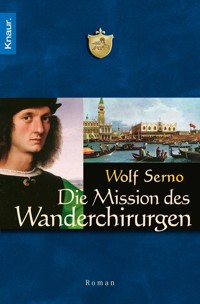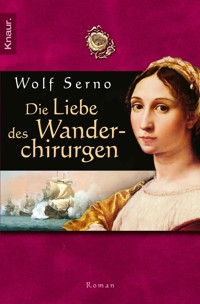Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hamburg im 18. Jahrhundert: Eines Nachts wird der Apotheker Teodorus Rapp hinterrücks überfallen und bewusstlos geschlagen. Als er wieder erwacht, sind seine Kleider blutüberströmt. Er eilt in seine Apotheke und entdeckt dort - sich selbst! Wer ist der geheimnisvolle Doppelgänger? Hat er es etwa auf Teodorus' wertvolle Naturaliensammlung abgesehen, oder stecken andere Motive hinter den rätselhaften Vorgängen? Bestsellerautor Wolf Serno beweist in diesem Roman, dass er auch das Genre der historischen Spannung mit traumwandlerischer Sicherheit beherrscht. Tod im Apothekenhaus von Wolf Serno im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf Serno
Tod im Apothekenhaus
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Prolog
Kapitel eins,
Kapitel zwei,
Kapitel drei,
Kapitel vier,
Kapitel fünf,
Kapitel sechs,
Kapitel sieben,
Kapitel acht,
Kapitel neun,
Kapitel zehn,
Kapitel elf,
Kapitel zwölf,
Kapitel dreizehn,
Kapitel vierzehn,
Kapitel fünfzehn,
Kapitel sechzehn,
Kapitel siebzehn,
Kapitel achtzehn,
Kapitel neunzehn,
Kapitel zwanzig,
Epilog
Ein criminales Geschehniss zu Hamburg, A. D. 1716
»Apoteca fons vitae mortisque est«
Die Apotheke ist eine Quelle des Lebens und des Todes
Für mein Rudel:Micky, Sumo, Buschmann und Fiedler († 16)
Prolog
Der Tag verspricht, schön zu werden, so schön, wie der Herrgott sich den Sonntag bei seiner Erschaffung gedacht haben mag. Gedankt sei ihm, denn das Regenwetter der letzten Wochen glich einer Sintflut und war eine Prüfung für jedermann …
Doktor Christof Gottwald, weithin bekannt als Gelehrter und Sammler, seufzte vernehmlich und tauchte die Feder erneut in das große Tintenfass, das vor ihm auf dem Schreibpult stand. Dann setzte er die Eintragung in sein Tagebuch fort:
Der erste Hahnenschrei ist eben verklungen. Mögen die Sonnenstrahlen, die so golden über den Dächern von Danzig aufsteigen, ein gutes Omen sein für das, was der Tag mir bringt. Wenn alles so eintrifft, wie ich es erhoffe, dann …
Er brach erneut ab, aus Sorge, der Gedanke würde nicht Wirklichkeit werden, wenn er ihn einfach so niederschriebe. Stattdessen endete er:
Gott verzeih mir meinen Aberglauben, aber seit der vierten Morgenstunde flieht mich der Schlaf, und ich kann an nichts anderes mehr denken als an den bevorstehenden Besuch. Er hat mein Leben die letzten Tage, gelinde gesagt, auf den Kopf gestellt, wie sehr, mag allein daran zu erkennen sein, dass ich Tagebuch führe, bevor der Tag begonnen hat. Wir schreiben heute den 6. Maius, A. D. 1716, und ich gäbe viel darum, meine nächste Eintragung bereits jetzt zu kennen.
Gottwald streute Löschsand auf das Geschriebene und rief nach der Hausmagd. »Lotte! Wie viel Uhr ist es?«
Einige Zeit verging, bevor die Magd in der Tür zu seinem Studierzimmer erschien. Sie hatte gerade das Herdfeuer in der Küche angefacht und wischte sich die rußigen Hände an der Schürze ab. »Is noch früh, Herr.«
»Das ist mir bekannt. Ich fragte nach der Uhrzeit.«
»Weiß nich genau. Wieso, Herr?«
»Darüber mach dir keine Gedanken. Geh wieder an deine Arbeit. Nein, warte, wie ist das Befinden der gnädigen Frau heute Morgen? Hast du nach ihr gesehen? Ist sie schon wach?«
»Hm ja, Herr.«
»Und? Ist sie noch immer unpässlich? Was macht ihr Fieber? Lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!«
Lotte knetete die Hände. Sie war eine brave Magd, aber das Pulver hatte sie nicht erfunden. Ebenso wenig wie die freie Rede. »Hm ja, Herr. Das Fieber is nich runter, un die Gnädige sacht, es geht ihr schlecht. Hm ja, vielleicht nich ganz so schlecht wie gestern, aber noch schlecht, ja, das hat sie gesacht.«
Gottwald fühlte sich einigermaßen beruhigt. In gewisser Weise war er sogar froh, dass seine Frau das Bett weiterhin hüten musste, denn das Gespräch mit dem Besuch würde sich ohne sie besser führen lassen. »Schön, geh wieder in deine Küche.«
»Ja, Herr.«
»Halt, bleib! Ist drüben alles zu meiner Zufriedenheit? Geputzt, gewischt, entstaubt? Du weißt, dass ich einen hohen Gast erwarte.«
»Ja, Herr, ja doch. Habt mich wohl hunnertmal dran erinnert.« Lotte verschwand.
Gottwald sah ihr stirnrunzelnd nach, klappte das Tagebuch zu und verstaute es in einer Schublade unter dem Schreibpult. Er tat dies, ohne recht zu wissen, was er machte. Dann schritt er hinüber in sein Kabinett, um selbst nach der Uhrzeit zu sehen. »Allmächtiger, schon fast halb sieben!«, entfuhr es ihm. »Aber vorhin war es doch erst …«
Er spürte, wie ihm das Herz bis zum Hals schlug und versuchte, ruhig durchzuatmen. Er durfte sich nicht so aufregen! Noch einmal ließ er den Blick über die Schränke, die Schatullen, die Schubladen und die Regale schweifen, in denen seine Kostbarkeiten ruhten. Alles war aufs Trefflichste vorbereitet. Natürlich war es das. Seit Wochen schon, genau genommen seit dem Zeitpunkt, als der mächtige Herrscher erstmals Interesse an seiner Sammlung bekundet hatte.
Er hatte sich für sechseinhalb Uhr ansagen lassen, und es war bekannt, dass er Pünktlichkeit liebte. Wenn dem so war, musste er jede Sekunde eintreffen. Gottwald lief, die Hände auf dem Rücken, auf und ab und wurde trotz seiner guten Vorsätze immer unruhiger. Dann zuckte er jäh zusammen.
Es hatte kräftig an der Haustür geklopft.
Er stieß ein krächzendes »Ja, jaaa! Ich komme!« aus und hastete los, um zu öffnen. Fast hätte er dabei Lotte umgerannt, die ebenfalls auf dem Weg zur Tür war. »Aus dem Weg, los, los«, zischte er, »mach dich fort in deine Küche, und wehe, du lässt dich blicken!«
»Huch, Herr, ja, aua …«
Gottwald stürzte weiter zur Tür, blieb kurz vor dem Garderobenspiegel stehen, aus dem ihm ein zierlicher Mann mit fransigem Schnäuzer entgegenblickte, und überprüfte in fliegender Hast den Sitz seiner Kleidung. So weit er es beurteilen konnte, saß alles ohne Fehl und Falten.
»Wohlan denn«, murmelte er, drückte die schwere Klinke hinunter – und riss erstaunt die Augen auf. Vor ihm stand nicht der erwartete Hofstaat, sondern ein einzelner Mann. Ein Herr immerhin, der Haltung und der Kleidung nach, gewandet in untadeliges Tuch und gekrönt von einem Dreispitz mit goldener Kokarde, in der ein Doppeladler blitzte.
Gottwald stammelte: »Willkommen … willkommen in meinem bescheidenen Heim.«
»Guten Morgen. Ihr seid vermutlich Doktor Gottwald.« Ohne eine Antwort abzuwarten, lüftete der Fremde seine Kopfbedeckung und trat einen Schritt näher. Da er niemanden sah, der ihm den Dreispitz abnehmen konnte, klemmte er ihn sich unter den Arm. »Mein Name ist Areskin, Robert Areskin. Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, einander persönlich kennen zu lernen. Bisher hatten wir ja nur schriftlich das Vergnügen.«
»Ja, äh … bedauerlicherweise«, sagte Gottwald, und da ihm sonst nichts einfiel, verbeugte er sich.
Der Ankömmling gestattete sich ein Lächeln. »Ich nehme an, Ihr habt jemand anderen erwartet, in diesem Fall bitte ich Euch um etwas Geduld. Es gilt, zuvor einige Dinge klarzustellen.«
Gottwald beeilte sich, zu versichern, dass er dafür vollstes Verständnis habe.
»Umso besser.« Areskin begann an den Fingerlingen seiner Handschuhe zu zupfen. Als er sich ihrer entledigt hatte, spähte er wie zuvor vergebens nach einem dienstbaren Geist und stopfte sie dann in den Dreispitz, den er sich abermals unter die Achsel schob. »Es handelt sich um den möglichen Käufer Eurer Sammlung. Wie Ihr wisst, ist er eine der am höchsten gestellten Persönlichkeiten dieser Welt – mit allen Eigenarten, die sein außergewöhnlicher Stand mit sich bringt. Eine dieser Eigenarten ist es, gerne anonym aufzutreten, um so die Lebens- und die Denkweise des einfachen Bürgers besser zu verstehen. Er hat dies schon mehrfach getan und will es auch heute wieder tun. Er weiß nicht, dass Euch bekannt ist, wer er ist. Erstarrt also nicht in Ehrfurcht, wenn er vor Euch steht, sondern benehmt Euch höflich wie zu jedermann. Fallt nicht auf die Knie, sondern verbeugt Euch nur. Tut so, als wäre er mein Begleiter.«
»Jawohl, ganz wie Ihr wünscht«, versprach Gottwald. Was Areskin da erzählte, war ihm nicht neu. Er wusste um die Marotte des Herrschers, denn er hatte so viel wie möglich über ihn in Erfahrung gebracht. Darunter auch, dass der mächtige Mann eine Zeit lang unerkannt in England auf einer Werft gearbeitet hatte – als einfacher Zimmerer, um Land, Leute und die Schiffsbaukunst zu studieren. Vielleicht hatte er bei dieser Gelegenheit auch Robert Areskin getroffen und schätzte seitdem dessen Rat. »Ganz wie Ihr wünscht«, wiederholte Gottwald.
»Dann wäre das geklärt. Da mein, äh, Begleiter befürchtet, man könne ihn an seiner Sprache erkennen, wird er die ganze Zeit über schweigen oder, falls nötig, sich flüsternd mit mir austauschen. Ansonsten findet die Unterredung ausschließlich zwischen Euch und mir statt. Jede Antwort, die Ihr gebt, richtet Ihr an mich, jede Frage, die Ihr stellt, ebenso; das gilt selbstverständlich auch für alle sonstigen Äußerungen von Euch. Habt Ihr das verstanden?«
»Ich denke, ja.«
»Erst wollte mein Begleiter heute nicht erscheinen, aber dann fesselte ihn der Gedanke, wieder einmal inkognito ausfahren zu können. Und überdies: Wer kauft schon gern die Katze im Sack.«
»Natürlich«, erwiderte Gottwald höflich lächelnd und bemühte sich um einen Bückling, der seine Bandscheiben knacken ließ. Als er sich langsam wieder aufrichtete, blickte er auf eine Reihe goldener Knöpfe. Jeder Einzelne trug einen Doppeladler von jener Form, wie Gottwald ihn schon an Areskins Dreispitz bemerkt hatte. Sie gehörten zu einem einfachen nachtblauen Gehrock, welcher wiederum einen riesenhaften Mann kleidete. Der Herrscher! Das musste er sein!
Gottwald konnte sich gerade noch zurückhalten, nicht doch auf die Knie zu fallen. Stattdessen verbeugte er sich zum dritten Mal. Er hatte gewusst, dass sein Besucher von hohem Wuchs war, aber mit derart gigantischen Ausmaßen hatte er nicht gerechnet. Er schätzte die Größe auf fast sieben Fuß. Flüchtig dachte er, dass der Eintretende mit seiner Körperlänge auf jedem Jahrmarkt eine Sensation abgeben würde, schalt sich aber sofort ob des despektierlichen Gedankens. Er machte eine Geste, von der er hoffte, dass sie ebenso elegant wie einladend wirkte, und sagte: »Wenn die Herren vorangehen möchten …«
»Danke. Wir sind Euch sehr verbunden«, sagte Areskin. Ohne ein weiteres Wort traten er und seine Begleitung ins Haus, wobei der Riese den Kopf tief einziehen musste.
»Immer gerade durch«, rief Gottwald, »dann kommt Ihr automatisch in den letzten Raum. Das ist er!«
Im Kabinett angelangt, sahen sich die beiden Besucher um und blieben vor dem Vitrinentisch stehen. Der Hausherr beeilte sich, ihnen Plätze anzubieten.
Areskin winkte ab. »Wir stehen lieber, beginnt nur unverzüglich mit Euren Ausführungen.«
»Gewiss, gewiss …« Gottwald glaubte ein Glitzern in den Augen des Goliath erkannt zu haben, und eine stille Befriedigung bemächtigte sich seiner. Vor seinen Steinen reagierten noch immer alle gleich. Egal, ob sie niedrigen Standes oder hochwohlgeboren waren. So mancher hatte die Kostbarkeiten erwerben wollen, aber niemand hatte sie sich leisten können. Nach wie vor gehörten sie ihm, Christof Gottwald, und für den Fall, dass sich das ändern sollte, musste ihm ein erkleckliches Sümmchen geboten werden. Nun ja, jedenfalls so viel, wie er brauchte. »… ganz wie Ihr wünscht.«
Auf das, was er nun vortragen wollte, hatte er sich penibel vorbereitet: »Zunächst gestattet mir den Hinweis, dass der vor Euch stehende Tisch nur eine kleine Auswahl meiner Sammlung präsentiert. Ich habe ihn aufbauen lassen, damit er dem Auge des Betrachters einen Überblick vermittelt, in welch unendlicher Vielfalt der Stoff, den wir den ›magischen Sonnenstein‹ oder Bernstein nennen, vorkommt.«
Die Herren wechselten einen Blick. Ihr Interesse an den ausgestellten Exponaten schien sich zu steigern. Gottwald sah es mit Freude und fuhr rasch fort: »Meine eigentliche Sammlung umfasst mehr als achttausend Einzelstücke, die alle hier im Raum gelagert werden, doch dazu komme ich später. Wie Ihr seht, ist Bernstein von höchst unterschiedlicher Farbigkeit, von hellgelb über gelbgold, gold, goldbraun bis hin zu einem tiefen Braunschwarz.« Sein Zeigefinger wies auf entsprechende Stücke. »Darunter gibt es völlig undurchsichtige Exemplare und dann wiederum absolut transparente. Man mag es kaum glauben, dass am Anfang dieser Fülle stets nur ein paar Tropfen austretendes Baumharz standen. Und doch ist es so. Bernstein begegnet uns, wie Ihr sicher wisst, als maritimer Stein am Meeresboden und an den Ufern der Ostsee, ferner als Erdbernstein an Land. Die größten Vorkommen verzeichnen wir in Samland; die Hochburgen seiner Bearbeitung befinden sich in Königsberg und hier in Danzig.«
Gottwald nahm zwei besonders schön geschliffene Stücke und gab sie seinen Besuchern in die Hand, damit diese sie näher in Augenschein nehmen konnten. »Überhaupt muss festgestellt werden, dass es kaum ein schöneres Material für den Künstler und seine Entfaltung gibt. Denkt nur daran, wie herrlich Bernstein sich für ornamentierte Wandverkleidungen ganzer Zimmer eignet und …«
»Schon recht, schon recht«, unterbrach Areskin den Redefluss des Hausherrn und legte seinen Stein zurück. »Das ist meinem Begleiter sehr wohl bekannt. Bedenkt, dass seine Zeit begrenzt ist.«
Gottwald schlug die Augen nieder und dachte flüchtig: Das habt Ihr, Robert Areskin, mir im Vorhinein bereits mehr als deutlich gemacht. Ihr teiltet mir mit, dass unser heutiges Treffen zu ungewöhnlich früher Stunde stattfinden müsse, da der Tagesablauf Eures Herrschers es so verlange: Schon um zehn Uhr würde er eine Mittagsspeise zu sich nehmen und im Anschluss daran, gegen zwölf Uhr, schlafen. Am Nachmittag pflege er Hof zu halten und Befehle zu erteilen, um sich dann gegen sieben Uhr am Abend zur Nachtruhe zu begeben, welche am nächsten Morgen bereits um dreieinhalb Uhr beendet sei. Diesen Rhythmus wolle er stets und unter allen Umständen einhalten, selbst dann, wenn er sich auf Reisen befände. »Wie könnte ich das vergessen«, sagte Gottwald laut und musterte verstohlen den mächtigen Mann, in dessen Hand sich das Ansichtsexemplar verlor. Seine dunklen, stechenden Augen lagen unverwandt auf dem Stück und schienen es zu durchleuchten. Sie waren das beherrschende Element in einem Gesicht mit kräftiger Nase und kohlschwarzem Bart, einem Gesicht, das im Verhältnis zu dem riesigen Körper klein wirkte.
Eilig trat der Hausherr an den ersten Schrank und zog mehrere Schubladen auf. Anschließend entzündete er eine Petroleumlampe, da er sich nicht nur auf das frühe Tageslicht verlassen wollte. Das Ergebnis war ein Glänzen und Glitzern, ein Schillern und Funkeln, das einer Diamantensammlung würdig gewesen wäre. Jedes Stück in dem Laden war makellos in Reinheit und Schliff. Es gab Exponate in den Formen der Sternzeichen und in denen der Geometrie, es gab Tiere und Pflanzen, Fische und Vögel und vielerlei mehr. Es gab sogar eine Herde aus zwölf hintereinander hertrottenden Elefanten, bei der jedes Tier ein wenig kleiner als das vor ihm Gehende war.
Gottwald sah, wie der hohe Gast sich zu Areskin hinabbeugte und ihm etwas zuflüsterte. Der Engländer nickte, räusperte sich und sprach dann.
»Mein Begleiter wünscht zu wissen, ob es mit den Elefanten eine besondere Bewandtnis hat.«
»Welch scharfsinnige Frage!«, gab Gottwald sich begeistert und hoffte, dass sein Ausruf echt klang. »In der Tat ist es so! Die zwölf Rüsseltiere stellen einen Jahreskalender dar, wobei jedes Tier für einen Monat steht. Das Ganze funktioniert so: Nach Ablauf des Januar dreht man den ersten Elefanten um, nach dem Februar den zweiten, dann den dritten und so fort. Am Ende des Jahres marschiert die gesamte Herde in die entgegengesetzte Richtung. Interessanterweise hat dann der kleinste Elefant die Spitze übernommen, was sicher auch ein Sinnbild dafür ist, wie vergänglich Macht und Führerschaft sein können.«
Im selben Moment, als Gottwald das sagte, merkte er, dass er gehörig ins Fettnäpfchen getreten war, denn der Blick des hochgestellten Besuchers verdüsterte sich. Offenbar hatte er die Analogie verstanden oder erahnt und bezog sie auf sich selbst.
Gottwald lachte unsicher. »Äh … nun, ein Jahr später ist dann ja wieder alles beim Alten! Haha!«
Der Herrscher verzog keine Miene. Vielleicht, weil er des Deutschen doch nicht so mächtig war. Nun sprach er abermals mit Areskin, und dieser sagte: »Mein Begleiter weist Euch darauf hin, dass die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten bei Bernstein ihn weniger fesseln. Er ist, nun, sagen wir, mehr an den Launen der Natur interessiert.«
Der Hausherr verstand. »Ihr meint gewiss die Einschlüsse, die sich mit Glück im Bernstein finden lassen. Ihr werdet staunen, was meine Sammlung diesbezüglich zu bieten hat.« Er hoffte inbrünstig, die Scharte von eben auswetzen zu können, weil er darauf angewiesen war, seine Sammlung, oder wenigstens Teile derselben, gut zu verkaufen. Danzig war ein teures Pflaster, und das prächtige Bürgerhaus, das er seiner Frau zuliebe vor einiger Zeit erworben hatte, verschlang Unsummen an Unterhalt. Dazu die Arztkosten, die ihr Leiden verursachte … »Geduldet Euch nur einen Augenblick.«
Er schritt zum nächsten Schrein, einem kleineren mit Holzintarsien geschmückten Kasten, und öffnete ihn vorsichtig. »Nun, was sagt Ihr dazu?«
Die Herren schwiegen. Das, was sich ihren Augen darbot, schien unspektakulär. Einige Dutzend Bernsteinstücke waren es, mehr nicht. Sie lagen auf grünem Samt, unbearbeitet und ungeschliffen, so wie der Finder sie am Ostseestrand aufgelesen haben mochte.
Gottwald nahm einen Stein zur Hand und hielt ihn ins Licht der Petroleumlampe. »Seht, was dieses Stück in sich birgt.«
Areskin und der Riese kniffen die Augen zusammen. »Sieht aus wie eine Fliege«, sagte der Engländer. Seine Stimme klang nicht sonderlich begeistert.
»Richtig. Nur eine Fliege.« Gottwald hielt eine Lupe über den Stein. »Aber sie ist vollständig erhalten, die Beine, die Augen, die Flügel, alles. Das Harz hat sie sanft, aber unentrinnbar umschlossen, und wenn Ihr ganz genau hinschaut, seht Ihr, dass sie die hinteren zwei ihrer sechs Beine aneinander reibt. Was sagt uns das? Nun, dass dieses Insekt sich gerade putzte, als der Tod es ereilte. Es war sich keiner Gefahr bewusst. Fliegen sind flink. Einem schnellen Jäger entkommen sie durch noch schnellere Reaktion. Das Baumharz hingegen ist langsam und scheinbar harmlos. Doch es klebt stärker als der beste Knochenleim, und wenn ein Bein oder ein Flügel erst daran haftet, dann gibt es kein Entrinnen.«
Gottwald gab Areskin die Lupe, damit dieser sie hielte, und vermerkte mit Befriedigung, dass seine Besucher das Insekt jetzt mit anderen Augen ansahen. Er nutzte die Gunst des Augenblicks und gab ihnen nacheinander weitere Exponate mit Einschlüssen. Darunter eine Schwebfliege, eine Wespe, mehrere Schnaken, einen Grashüpfer, Ameisen von verschiedener Größe und Farbe, einen kleinen, aber schwer gepanzerten Käfer, eine daumennagelgroße Spinne, einen kleinen Frosch, ein asselähnliches Krabbeltier, zwei ineinander verschlungene Würmer und eine haarige Raupe. Und zu jeder der seltenen Kostbarkeiten erzählte er eine Geschichte. Das Interesse seiner Besucher steigerte sich von Mal zu Mal.
Gottwald zeigte noch mehr Steine. Darin Blüten, die der Beschaffenheit nach an Löwenmaul erinnerten, dazu gezahnte und gefiederte Blätter, Bucheckern und Eicheln, Gräser, Rispen und Ähren.
»Mein Begleiter möchte wissen, wie alt die Stücke sind«, sagte Areskin. »Wann beispielsweise ereilte diese Ameise ihr Schicksal?«
Der Hausherr holte tief Luft. Die Frage hatte er kommen sehen. Es war eine der wenigen, auf die er keine Antwort wusste. Er hätte es sich leicht machen und mit der Kirchenlehre antworten können, nach der die Erde in sechs Tagen erschaffen worden war und nur wenige tausend Jahre zählte. Er hätte daraus ableiten können, dass demzufolge auch seine Exponate nicht älter sein konnten, aber das wäre unwissenschaftlich gewesen, und er war ziemlich sicher, dass die Herren sich mit einer solchen Erwiderung nicht begnügen würden. »Es muss zu einer Zeit geschehen sein, als es an den Gestaden der Ostsee ganz anders aussah als heute«, sagte er. »Dichte Wälder standen damals hier, Nadelbäume, Bäume mit einer Rinde, aus der in dicken Tropfen ständig Harz austrat. Mal krochen sie langsam über das Geäst, mal fielen sie zu Boden – auf eine Flora und Fauna, die der unseren heute nicht unähnlich ist. Es mag zehn mal zehntausend Jahre her sein, als das passierte, vielleicht auch zehntausend mal zehntausend Jahre, wer will das wissen außer Gott.
Richtet Euer Augenmerk noch einmal auf die von Euch bezeichnete Ameise: Sie ist zweifelsohne eine Vertreterin ihrer Art, und doch weicht einiges an ihrem Körper von den bekannten Spezies ab. Ich bin sicher, dass es auf der ganzen Welt kein lebendes Tier wie dieses gibt, einfach deshalb, weil es uralt ist.«
Areskin und sein Begleiter schwiegen beeindruckt.
»Gestattet mir, das Exponat zurückzulegen. Bernstein ist lichtempfindlich, müsst Ihr wissen, zu viel Helligkeit trübt das Material. Mit dem Licht ist es überhaupt so eine Sache: Einerseits braucht man genügend davon, um seine Schätze untersuchen zu können, andererseits muss man damit geizen. Alle meine Exponate ruhen im Dunklen und unter Verschluss, und zwar nach einem bestimmten Ordnungsprinzip, das ich Euch gern erläutern will …«
»Das wird nicht nötig sein«, fiel Areskin dem Hausherrn ins Wort. »Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sagt, was steckt in jenem Stein dort?« Er wies auf ein besonders großes, längliches, sehr transparentes Stück.
Gottwald zögerte. »Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Ich weiß es nicht genau, weshalb ich Euch auch nicht besonders darauf aufmerksam machte. Der Inhalt sieht aus wie ein silbriger, ebenmäßig gebogener Zweig, der an einem Ende nadelspitz zuläuft; vielleicht ist es aber auch nur eine ungewöhnlich lange Tannen- oder Kiefernadel.«
»Meinen Begleiter erinnert der Einschluss eher an die Miniatur eines Samuraischwerts.«
»Eines Samuraischwerts? Oh, welch ein treffender Vergleich! Darauf bin ich in der Tat noch nicht gekommen«, gab der Hausherr sich erneut begeistert. Doch insgeheim gratulierte er sich. Der mächtige Herr hatte erstmals eine Meinung geäußert! Das musste ein gutes Zeichen sein. Gottwald beschloss, näher auf die Assoziation einzugehen, auch auf die Gefahr hin, von seinen Verkaufsobjekten abzulenken. »Nun, Herr Areskin, sollte Euer Begleiter sich zu fernöstlicher Kultur hingezogen fühlen, darf ich auf das hiesige Museum des Doktor Johann Breyn verweisen, das für seine ›japanische Flora‹ berühmt ist. Auf Wunsch werde ich die Herren gern mit ihm bekannt machen. Es wird ihm sicherlich eine Ehre sein, eine gesonderte Führung zu arrangieren.«
Während er das sagte, wagte Gottwald zum ersten Mal, dem Riesen direkt ins Gesicht zu sehen. Er las darin kein nennenswertes Interesse, was ihn verwunderte, denn der Herrscher galt als ein Mann, dessen beweglicher Geist sich von vielem fesseln ließ, unter anderem von Artilleriewesen, Festungsbau, Schmiedekunst, Schiffbau, Navigation, Astronomie und technischen Apparaten aller Art. Ja, es hieß sogar, er habe als Chirurg und Zahnarzt gearbeitet, und als Überbleibsel letzterer Tätigkeit verwahre er ein Säckchen voller Zähne, die er selbst gezogen hatte.
Gottwald räusperte sich und brachte die Sprache wieder auf seine Sammlung: »Wenn es gewünscht wird, kann ich zu meinen schönsten Stücken jederzeit Zertifikate der entsprechenden Künstler beibringen.«
»Nicht nötig, die Exponate sprechen für sich«, entgegnete Areskin höflich, nachdem er sich mit seinem Gebieter abgestimmt hatte. Der jedoch schien mit seinen Gedanken bereits wieder woanders zu sein, denn er starrte angelegentlich auf einen Punkt hinter Gottwalds Schulter.
Natürlich, die Standuhr!, schoss es dem Hausherrn durch den Kopf. Der Herrscher bekundet Interesse an dem Zeitmesser! Gottwald sprang einen Schritt zur Seite, um den Blick auf die Uhr freizugeben, und setzte sogleich zu einer Erklärung an: »Ein Meisterwerk, nicht wahr? Es handelt sich um eine Bodenstanduhr, die aus England stammt. Sie ist, wie ich in aller Bescheidenheit hinzufügen darf, die schönste Uhr, die ich jemals sah. Seht nur die Form! Seht nur das schwarze Lackgehäuse! Und das Gehwerk ist von Martineau in London. Es arbeitet absolut präzise.«
»Und es zeigt drei Minuten nach neun Uhr an«, ergänzte Areskin trocken. »Zeit für uns, zu gehen.«
»Ja, aber …«, stotterte Gottwald.
»Ich danke Euch, auch im Namen meines Begleiters, für Eure umfassenden Ausführungen, Doktor Gottwald.«
Dem Hausherrn lagen tausend Fragen auf der Zunge, vor allem die, was nun aus seiner Sammlung würde. Wollte der Herrscher sie etwa nicht kaufen? Kaum auszudenken, wenn dem so war. Niemand würde einen so guten Preis zahlen können wie er. Und das Geld, es war dringend vonnöten …
»Mein Begleiter kauft die komplette Sammlung.« Areskin begann sich die Handschuhe überzustreifen.
»Ja? … Ja! Gern!« Gottwald fühlte unendliche Erleichterung. Er sah zu dem Mächtigen hinüber, der, wohl zum Gruß, den Blick kurz senkte und dann das Kabinett verließ. Es geschah so unerwartet, dass der Hausherr nicht einmal Zeit für eine Verbeugung fand.
Areskin hatte unterdessen die Handschuhe angezogen und machte ein paar Fingerübungen, um deren Sitz zu überprüfen. »Wenn Ihr einverstanden seid, suche ich Euch morgen ein zweites Mal auf, damit wir über die Kaufsumme sprechen können. Es wäre unschicklich gewesen, dies im Beisein meines Gebieters zu tun.« Er gestattete sich ein Lächeln. »Es muss ja nicht zu so früher Stunde sein wie heute. Wäre Euch elf Uhr recht?«
»Gewiss, natürlich!« Gottwald wäre jeder Zeitpunkt recht gewesen.
»Über den Preis werden wir uns einigen. Und über Details wie Zahlungsweise und Abholung auch.«
»Ja, ja, gewiss.«
»Wenn mein Gebieter etwas will, dann bekommt er es auch. Das war schon immer so.« Areskin wandte sich zum Gehen. »Bemüht Euch nicht, ich finde den Weg allein. Bis morgen also.«
Gottwald verbeugte sich tief. »Ich wünsche Euch einen guten Tag, Herr Areskin, und werde mir erlauben, schon einiges für den Transport vorzubereiten. Etliche Stücke bedürfen der besonderen Verpackung.«
»Gut, dass Ihr es erwähnt.« Der Engländer blieb noch einmal stehen. »Es gibt da etwas, das Ihr getrost behalten solltet.«
»Äh … ach ja?«
»Den Elefantenkalender.«
Die schlichte schwarze Mietkutsche, die sich kurze Zeit später dem Hohen Tor näherte, war ein Gefährt, wie es zu Dutzenden in den Straßen von Danzig vorkam. Niemand konnte ahnen, dass darin einer der mächtigsten weltlichen Herren mit seinem Berater saß. Die zwei Braunen zogen in gemächlichem Trab die Kutsche. Sie passierte das Tor, erreichte den Königsweg und näherte sich alsbald der Langgasse.
Je länger die Fahrt dauerte, desto mehr verfinsterte sich die Miene des Herrschers, da er ständig versuchte, seine überlangen Gliedmaßen in eine angenehme Sitzposition zu falten – vergeblich. Als die Langgasse ins Blickfeld kam und das alte Rechtstädtische Rathaus in einiger Entfernung auftauchte, brach der Mächtige sein Schweigen.
»Der Mann hatte Angst«, sagte er.
Areskin, der sich so klein wie möglich machte, zog verwundert eine Augenbraue hoch. »Angst? Wie meint Ihr das?« Er konnte sich die offizielle Anrede sparen, denn er hatte ein sehr vertrautes, fast freundschaftliches Verhältnis zu seinem Gebieter. Zudem war dieser noch immer inkognito. Der Kutscher vorne auf dem Bock hatte keine Ahnung, wen er beförderte. Das Einzige, was er kannte, war das Fahrziel, und das lag gut dreihundert Schritte vom Quartier des Herrschers entfernt.
»Er hatte Angst, ich würde ihm seine Sammlung nicht abkaufen. Ich las es in seinem Gesicht. Und ich hörte es an seiner Stimme. Wahrscheinlich ist er auf das Geld angewiesen. Ihr solltet das berücksichtigen, Robert, wenn Ihr morgen mit ihm verhandelt.«
Der Engländer nickte. Die Erkenntnis seines Herrschers überraschte ihn nicht. Es kam selten vor, dass dessen scharfen Augen etwas entging. »Das werde ich. Im Übrigen bitte ich um Pardon für den begrenzten Platz, aber Euer Wunsch, heute wieder einmal unerkannt …«
»Schon gut, mein lieber Robert, schon gut.« Der Herrscher steckte den Kopf zum Fenster hinaus. Die Kutsche bewegte sich nun langsamer, da immer mehr Gegenverkehr herrschte. Das Grüne Tor am Ende des Königswegs kam in Sicht. »Gott der Allmächtige hat mich mit einem riesigen Körper ausgestattet, aber gleichzeitig vergessen, die Mietkutschen dieser Welt etwas größer ausfallen zu lassen.« Er lachte freudlos, zog den Kopf wieder ein und presste die Lippen zusammen. Wiederholt bemühte er sich, ein Bein über das andere zu schlagen. Die Versuche misslangen, weil sein Schuh unter Areskins Sitzbank eingeklemmt war.
»Darf ich? Wenn Ihr Euch etwas vorbeugt … ja, so wird es vielleicht gehen.« Der Engländer befreite den Schuh, indem er ihn seitwärts nach unten drückte. Sein Gebieter dankte es ihm mit einem kurzen Nicken.
Dann sagte er: »Die Sammlung dieses Doktor Gottwald ist recht ansprechend.«
Areskin kannte sein Gegenüber gut genug, um zu wissen, das die Bemerkung erst der Beginn einer Erklärung war, deshalb fragte er vorsichtig: »Aber?«
»Sie ist in der Tat sehr umfangreich.«
»Ja, das ist sie.«
»Aber sie ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Zwar zeigt sie, wie unterschiedlich Bernstein ausfällt und was alles daraus geschnitzt werden kann, aber wie Ihr wisst, nenne ich schon eine große Zahl an Lapides mein Eigen. Es kommt mir, von den Exponaten mit den Einschlüssen einmal abgesehen, nicht darauf an, Bernsteinfiguren in Pflanzen- oder Tierform zu besitzen. Ich will die Natur in realitas.«
»Jawohl.«
»Ich will keine Bernsteinsammlung, sondern einen echten Thesaurus. Ich will Conchilien, Amphibien, Serpentes und Lepidopteren.«
»Ein Thesaurus, der sich halbwegs komplett nennen darf, ist heutzutage außerordentlich kostspielig.«
»Das ist mir gleichgültig.« Der Herrscher veränderte mit beträchtlichem Aufwand die Beinstellung. Seine Laune wurde dadurch nicht besser.
Der Engländer seufzte im Stillen. Hohe Kosten waren für seinen Gebieter noch nie ein Argument gewesen. Dank seiner gnadenlosen Steuereintreiber konnte er sich nahezu jeden Wunsch erfüllen. Dennoch war der Einwand einen Versuch wert gewesen. »Bitte, glaubt mir, es ist sehr schwierig, wahrscheinlich sogar unmöglich, an einen Thesaurus dieser Art heranzukommen.«
»Ich will Lacertidae, Scorpiones, Chelicerata und natürlich Aves aus tropischen Ländern, und Ihr, Areskin, werdet mir all das beschaffen.«
Der Engländer wusste, wenn sein Gebieter ihn mit dem Nachnamen ansprach, wurde es ernst. Dennoch machte er einen letzten Versuch. »Ich versichere Euch, es ist unmöglich, derzeit einen Thesaurus zu kaufen. Ich habe meine Fühler diesbezüglich schon viele Male ausgestreckt, da ich Euren Wunsch kenne. Aber, mit allem Respekt: Die Wissenschaftler und Gelehrten, die solche Thesauren besitzen, sind ein eigener Menschenschlag. Sie sind an materiellen Werten nicht interessiert, sondern gehen nur ihrer Sammelleidenschaft nach, versteht Ihr? Die Exponate haben für sie ideellen Wert, einen Wert, der nicht mit Geld oder Gold aufgewogen werden kann. Es ist schon ein einmaliges Glück, dass Doktor Gottwald sich zum Verkauf seiner Bernsteinsammlung entschließen musste.«
Der Herrscher schwieg. Eine steile Falte bildete zwischen seinen Augenbrauen.
»Soll ich die Kaufzusage rückgängig machen?« Areskin versuchte zu retten, was zu retten war. Er wusste: Ab einem gewissen Punkt wurde es höchst gefährlich, seinem Herrscher zu widersprechen. Selbst für ihn.
»Nein! Die Gelegenheit ist viel zu günstig. Sie wird genutzt. Gleichzeitig besorgt Ihr mir einen Thesaurus, einen, der diesen Namen verdient. Stück für Stück wohl präpariert und in sich komplett!«
»Jawohl … Sire.«
»Wie Ihr das macht, ist mir gleichgültig.«
Kapitel eins,
in welchem sich erweist, dass der Schädel eines Apothekers ebenso brummen kann wie der eines jeden anderen Bürgers.
Wie ausgerechnet er zu der Ehre gekommen war, wusste Teodorus Rapp beim besten Willen nicht, aber er war der Einladung gefolgt und stand nun Auge in Auge der Gastgeberin gegenüber, einer dicklichen, ältlichen Person, die ihrem erhitzten Gesicht mit einem Fächer Kühlung zu verschaffen suchte.
»Ich bin entzückt, dass Ihr es einrichten konntet, Monsieur«, quäkte Elsa Lüttkopp, die Frau von Berendt Lüttkopp, seines Zeichens Mitglied der Erbgesessenen Bürgerschaft zu Hamburg. »Quel plaisier, quel plaisier!«
»Äh … jawohl.«
»Ich weiß gar nicht, wie viele Herrschaften kommen, mon cher, aber wenn wirklich alle kommen würden, pour l’amour de Dieu …!«
Rapp spürte, wie ihn ein Wirbel aus Unbehagen und Unsicherheit fortzureißen drohte. Er war Einzelgänger, lebte zurückgezogen und fühlte sich nur seiner Profession verbunden. Empfänge, auf denen Menschenmengen herumstanden und unwichtiges Zeug daherschwatzten, mied er gewöhnlich wie der Teufel das Weihwasser. Aber nun hatte er sich darauf eingelassen und musste die drangvolle Enge, die dünstenden Leiber und die französischen Wortfetzen um sich herum ertragen. Es widerstrebte ihm zutiefst, die Dicke mit »Madame Lüttkopp« anzureden, ja, ihr womöglich noch einen Kuss auf die Patschhand hauchen zu müssen.
»Ähm …«, setzte er an und stellte fest, dass sie schon weitergeeilt war, um sich auf das Angeregteste mit einem soeben eingetretenen Paar zu unterhalten.
Rapp atmete auf und fühlte gleichzeitig einen Stoß im Rücken, der von einem Tablett herrührte.
»Coffee, Thee, Konfekt, Monsieur?«, näselte ein Bediensteter.
»Ähm …«, machte Rapp abermals. Er nahm, wenn überhaupt, lieber Chocolate, aber von diesem Getränk war weit und breit nichts zu sehen, vielleicht, weil zu seiner Aufbereitung Honig, Vanille, Anis, Muskat, Zimt und anderes benötigt wurde.
Wie selbstverständlich drückte der Diener ihm eine Coffeetasse in die Hand. »Zucker zum Süßen, Monsieur?«
»Äh … nein.«
»Kardamom?«
»Nein, nein!«
Der Mann verschwand.
Obwohl es mittlerweile noch voller geworden war, kam Rapp sich sehr verloren vor. Jeder redete mit jedem – nur nicht mit ihm. Allongeperücken und lange Gehröcke bestimmten bei den Herren das Bild; beim schönen Geschlecht herrschten die neuen Puderfrisuren vor, dazu tiefe Dekolletés und die wieder in Mode gekommenen ausladenden Reifröcke. Ein guter Teil des Hamburger Bürgeradels schien sich hier ein Stelldichein zu geben.
Rapp selbst trug ebenfalls Perücke, allerdings eine, die ihm geringfügig zu groß war, dazu einen Gehrock aus weinrotem Tuch mit schwarzen Knöpfen. Es war ein Stück, das schon einen Vorbesitzer gehabt hatte und demzufolge – wie seine künstliche Lockenpracht – im Sitz etwas zu wünschen übrig ließ. Doch Rapp focht das nicht weiter an; er gab sein Geld lieber für Wichtigeres aus.
Die Coffeetasse in der Hand, ließ er, so weit dies überhaupt möglich war, seinen Blick schweifen. Er befand sich in einem Raum, dessen hohe Wände mit feinster lindgrüner Seidentapete bespannt waren, eine Ausstattung, die sicher ein Vermögen gekostet hatte. Aber Berendt Lüttkopp zählte beileibe nicht zu den Armen der Stadt, im Gegenteil, seine Tätigkeit in der Bürgerschaft ließ ihm noch genügend Zeit, ein überaus erfolgreicher Reeder und Kaufherr zu sein.
Wo ist der Mann überhaupt?, fragte sich Rapp. Auf der Karte, die ihm am Morgen durch einen Boten überbracht worden war, hatte gestanden:
InvitationMonsieur und Madame Lüttkoppwären entzückt über die Ehre Eures Besuchsam Sonnabend, den 24sten October 1716,¼ auf 8 Uhr am Abend,Palais Lüttkopp, Große Johannisstraße
Also musste der Hausherr irgendwo sein. Doch Rapp konnte niemanden, der dafür in Frage kam, erspähen. Wahrscheinlich plauderte der Gastgeber mit irgendwelchen Honoratioren. Stattdessen fielen ihm drei in schlichtes Schwarz gekleidete Männer auf, deren olivfarbene Haut sie als Südländer auswies. Sie wirkten unsicher und nervös, und Rapp fragte sich gerade, woran das liegen mochte, als sich einer von ihnen – heftig an seiner Tonpfeife ziehend – an ihn wandte.
»Scusi, Signore!«, rief er mit lebhafter Stimme, »habt Ihr, äh, vielleicht Zeit für mich?«
Rapp stutzte und fühlte sich unangenehm berührt. Wieso sollte er Zeit für einen Menschen haben, der ihm wildfremd war und dessen Figur ihn an eine Kaulquappe aus der Familie der Bufonidae erinnerte, an eine stattliche zwar, aber trotzdem … »Ähm, ich fürchte, ich kann Euch nicht ganz folgen.«
»Zeit von Uhr, Signore! Uhrzeit! Habt Ihr?«
»Ach so.« Rapp spürte so etwas wie Erleichterung. Er tastete mit der freien Hand nach der Taschenuhr, holte sie hervor und studierte das Zifferblatt. »Es sind noch genau neun Minuten bis acht Uhr«, verkündete er dann, nun schon etwas verbindlicher.
Der Schwarzberockte stöhnte auf. »Mamma mia, so spät, so spät! Gleich es geht los. Könnt Ihr vielleicht halten einen Moment meine, äh, Pfeife, per favore?«
Rapp blieb nichts anderes übrig, als seine Uhr zurückzustopfen und das Rauchinstrument entgegenzunehmen, wobei er sich fast die Finger am Tonkopf verbrannte. Es war ein Tonkopf, wie ihn wohl nur ein Musiker auswählte, denn er hatte die Proportionen einer Wirbeltrommel und war ebenso bemalt.
»Grazie, Signore, Ihr seid ein guter Mensch!« Die Kaulquappe nahm ein riesiges Taschentuch in beide Hände und presste es sich gegen die feuchte Stirn. Dann wischte sie sich den schweißnassen Nacken aus. »Ihr müsst wünschen mir Glück, viel Glück, per favore …!«
Rapp, die Tonpfeife in der einen, die Coffeetasse in der anderen Hand, kam sich etwas lächerlich vor. »Glück? Ich verstehe nicht, mein Herr, ich …«
»Scusi! Scusi tanto! Ich vergaß vorstellen mich. Mein Name ist Giovanni Agosta!« Der Mann, offenbar ein Italiener, wedelte mit dem Tuch in Richtung seiner zwei Begleiter. »Meine Brüder! Luigi und Pietro. Wir sind aus Firenze, sind Musici, verstehen? Wir machen Musik. Wir gleich haben unsere Auftritt.«
»Aha, ja.« Rapp dämmerte es, dass er zu einem Kammermusikabend eingeladen war. Das hatte er nicht wissen können. Davon hatte auf der Einladung der Lüttkopps kein Wort gestanden. Seine Laune, eben im Begriff, sich zu bessern, sank wieder.
Eifrig sprach Giovanni Agosti weiter: »Ihr kennt Corelli, Signore?«
»Nun …«
»Arcangelo Corelli?«
Rapps Welt war nicht die der Töne. Niemals zuvor hatte er von einem Mann namens Corelli gehört und das, obwohl die Kaulquappe den Namen so ausgesprochen hatte, als müsse ihn jedermann kennen. Rapp vermutete, dass es sich bei dem Genannten ebenfalls um einen Musiker handelte, vielleicht um einen Komponisten, und beschloss, sich keine Blöße zu geben. »Warum seid Ihr eigentlich so aufgeregt?«, stellte er eine Gegenfrage. »Dies ist doch gewiss nicht Euer erster Auftritt?«
Damit hatte Rapp die Schwierigkeit umschifft, denn Agosta nahm sogleich den Faden auf und sprach gestenreich über die große Bedeutung, die dieser Auftritt für ihn und seine Brüder habe; es sei das erste Mal, dass sie in »Amburgo« gastierten und die Chance, einige Bekanntheit bei den einflussreichen Bürgern zu erlangen, einmalig. Alles, wirklich alles, hinge davon ab, wie ruhig ihre Hände die Bögen führen würden.
Wenn Rapp sich auch nichts aus Musik machte, so tat ihm sein Gegenüber dennoch Leid. Die Kaulquappe war nicht unsympathisch, im Gegenteil, sie sah sogar recht passabel aus. Der Mund erinnerte an den eines lebensfrohen römischen Fauns, dazu kamen eine starke Nase und jene Fältchen um die Augen, wie sie Menschen besitzen, die gern und häufig lachen. Rapp, der im Grunde seines Herzens von hilfsbereiter Natur war, hoffte, Agosta würde nach der Vorstellung Grund zum Lachen haben. Ohne sich dessen bewusst zu werden, steckte er die Pfeife des anderen in die Rocktasche und holte im Gegenzug ein kleines Fläschchen hervor. Er überreichte es dem Musiker.
»Was ist das, Signore?«
»Lest, was darauf steht.«
»Sì, sì.« Mit einiger Mühe buchstabierte der Italiener die Aufschrift: »Rapp’sche Beruhigungstropfen … grazie, Signore, Ihr meint …?«
»Genau das. Trinkt nur das ganze Fläschchen leer. Ich verbürge mich für die Wirksamkeit seines Inhalts, weil ich ihn selbst hergestellt habe. Mein Name ist Rapp, Teodorus Rapp. Ich besitze das Apothekenhaus Rapp in der Deichstraße.«
Agosta öffnete das Fläschchen und zögerte.
»Ihr könnt die Arznei getrost einnehmen. Die Tropfen sind ausgezeichnet, ich habe sie immer dabei. Sie enthalten die Extrakte vieler segensreicher Pflanzen.«
»Sì, äh, sì, sì.« Agosta setzte das Fläschchen an die Lippen und kippte entschlossen einen Großteil der Flüssigkeit hinunter.
Rapp sah es mit Genugtuung. Er wusste, dass sein Tranquilium in den wenigen Minuten bis zur Aufführung kaum zur Wirkung kommen würde – er wusste aber auch, dass der Glaube an ein Medikament Berge versetzen kann. »Die Tropfen sind nach einer bestimmten Theorie aufbereitet: der des Goldenen Schnitts, wenn Ihr versteht, was ich meine«, sagte er, und ohne die Antwort des Musenjüngers abzuwarten, fuhr er fort: »Es handelt sich dabei um eine geometrische Verhältnismäßigkeit, die ich in den Pflanzenbereich übertragen habe. Mit anderen Worten: ein Teil Melisse, ein Teil Kampfer, zwei Teile Passiflora, drei Teile Hopfen und fünf Teile Baldrian. Eine Reihung, bei der sich jede Zahl durch die Summe der beiden vorhergehenden bildet.«
Der Italiener schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Das Fläschchen, das er gerade zur Gänze leeren wollte, sank wieder herab, doch Rapp war bei einem seiner Lieblingsthemen angekommen und setzte bereits seine Ausführungen fort:
»Diese Reihung, mein Herr, die beliebig erweitert werden kann, nennt man auch Fibonacci-Folge, nach einem Mathematiker namens Fibonacci, welcher ein Landsmann von Euch war. Das Interessante dabei ist: Wenn man jede Zahl durch die nächstfolgende teilt, nähert man sich dem Wert von Null Komma sechshundertachtzehn und damit der magischen Zahl des Goldenen Schnitts. Es ist Euch ja sicher bekannt, welche Bedeutung dieses geometrische Verhältnis für die alten italienischen Meister hatte. Ich bin ganz sicher, dass die Harmonie der Teile, die dem Auge gut tut, gleichermaßen wirksam im Bereich der Drogen ist.«
Vielleicht lag es an den ablenkenden Worten, vielleicht auch daran, dass der Beruhigungssaft tatsächlich seine Wirkung tat, in jedem Fall schien Agosta nun etwas gefasster zu sein.
»Ich bin ganz sicher, dass die Harmonie der Teile, die dem Auge gut tut, gleichermaßen wirksam im Bereich der Drogen ist«, wiederholte Rapp, und während er das sagte, fiel ihm ein, dass er den Tropfen womöglich auch seine Einladung verdankte. Er erinnerte sich, sie vor nicht allzu langer Zeit einer der Hausmägde von Elsa Lüttkopp gegeben zu haben. Ja, ja, die Tropfen. Sie erfreuten sich bei den Hanseaten großer Beliebtheit, und er hatte schon so manche Hamburgische Mark mit ihnen verdient. Mittlerweile waren sie in der Stadt bekannter als ihr Erzeuger, aber das war ihm nur recht. Er hatte schon immer wenig Aufhebens um seine Person gemacht – und sich stattdessen lieber seinen Professionen gewidmet.
Ein hell klingender Gong holte Rapp in die Wirklichkeit zurück. Agosta fuhr zusammen und stürzte mit den Worten »Mamma mia, es ist so weit! Grazie, signore, grazie und arrivederci!« in den Nebenraum.
Mit ihm machten sich unverzüglich alle Anwesenden auf, und der Strom der Hinüberstrebenden und dabei ohne Unterlass Schwätzenden riss Rapp mit sich und sog ihn durch die Flügeltür hinein in den gegenüberliegenden Salon. Jedermann schien zu wissen, in welcher Stuhlreihe er sich niederzulassen hatte, nur Rapp war völlig ahnungslos. Gab es eine bestimmte Sitzordnung? Wo sollte, wo durfte er Platz nehmen? Schließlich, als einer der Letzten, setzte er sich in die hinterste Reihe, dorthin, wo noch einige Stühle frei waren. Noch immer balancierte er die Coffeetasse in der Hand und fragte sich verzweifelt, wohin die vielen anderen Gäste, die ebenfalls den Türkentrank zu sich genommen hatten, diese abgestellt hatten.
Wieder meldete sich der Gong. Obwohl er ganz hinten saß, kam Rapp sich vor wie in einer Zwangsjacke – abgegrenzt von Stuhllehnen und Köpfen, von streng gescheitelten wallenden Locken, von Rüschen und Spitzenborten, Bändern und Schleifchen, von Schweiß und schweren Parfümschwaden. Ein Sprachengemisch aus Französisch, Englisch und Deutsch schwirrte in seinen Ohren. Die Stühle links und rechts neben ihm waren frei geblieben, und Rapp fragte sich gerade, ob er auf einem der beiden seine Coffeetasse absetzen durfte, als plötzlich zwei Nachzügler herbeistürzten. Es waren kräftige, gut gekleidete Herren, die ohne zu zaudern neben ihm Platz nahmen, wobei der eine Rapp einen heftigen Rempler versetzte.
»Au!«, machte Rapp und blickte vorwurfsvoll auf. Er hatte seine liebe Not, den überschwappenden Coffee zu bändigen.
Der Verursacher des Fast-Malheurs lächelte breit. Dann sagte er: »Смотри, вот наш друг!! Serr gut, uns Freund da sein!«
Rapp verstand den Sinn des Satzes nicht, nahm aber an, der Herr habe sich entschuldigt, und war um Freundlichkeit bemüht. »Schon gut, es ist ja nichts passiert.«
Daraufhin beugte sich der andere Fremde vor und meinte: »Давайте, начнём! Endlich kann lossgehen!« Rapp, zwischen beiden sitzend, fühlte sich zunehmend unwohl.
Der erste Mann nickte.
Das schien ein Zeichen für den anderen Mann zu sein, denn er erhob sich und verschwand mit den Worten: »Ну им там скажу. Ich sagen Bescheid.«
Einen Atemzug später ging auch der erste Unbekannte.
Der Gong rief zum dritten Mal. Rapp, noch einigermaßen verwirrt durch die fremden Männer, fuhr aus seinen Gedanken hoch und vernahm von vorn eine ihm nur zu gut bekannte quäkende Stimme. Verzweifelt murmelte er: »Bei allen Mörsern und Pistillen, mir bleibt wahrhaftig nichts erspart! Kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen?«
Sein Wunsch wurde nicht erhört. In der Folgezeit ließ sich Madame Lüttkopp des Langen und Breiten über die Ehre und Freude aus, die ihrem Gemahl und ihr durch den Besuch der Anwesenden zuteil würde, zählte die vielen Male auf, die das Palais Lüttkopp in diesem Jahr schon Schauplatz kultureller Ereignisse gewesen sei, erlaubte sich, in aller Bescheidenheit darauf hinzuweisen, dass ihr lieber Mann und sie dies alles aus Freude an der Kunst und mithin völlig uneigennützig möglich gemacht hätten, und leitete endlich über zu dem eigentlichen Grund der abendlichen Zusammenkunft: »Mesdames et Monsieurs«, quäkte sie, sich ununterbrochen befächernd, »je suis très heureuse … Ich kündige Euch nun die phantastischen Agosta-Brüder aus Florenz an, Virtuose ein jeder, und jeder Einzelne ein Meister seines Fachs …«
Die Lobeshymne auf die drei Musiker ging noch eine Weile weiter, gerade so, als habe Elsa Lüttkopp dieselben persönlich an ihrem Busen groß gezogen und ausgebildet, wieder und wieder unterbrochen von französischen Brocken, wie formidable … très magnifique … phantastique …
Höflicher Applaus setzte ein, erstarb aber sogleich wieder wegen der energischen Abwehrbewegungen der Hausherrin. »Mesdames et Monsieurs, un moment s’il vous plait … große Ehre … einmalige Darbietung … das erste Mal in Hamburg … Italien, die Mutter aller Künste … Palais Lüttkopp … unvergleichlicher Genuss …«
Rapp wurde die Coffeetasse schwer. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, und das gleichförmige Gefasel machte ihn schläfrig. Er überlegte, ob er die Tasse neben sich absetzen durfte, nachdem die seltsamen Fremden gegangen waren und offenbar nicht wiederkamen, doch nun ergriff einer der Agosta-Brüder das Wort. Rapp erkannte, dass es sich nicht um Giovanni handelte, sondern um einen der beiden anderen. Auch dieser ähnelte im Äußeren einer Quappe der Bufonidae, schien allerdings ein paar Jahre älter zu sein. Luigi – oder Pietro – war zunächst mächtig aufgeregt, wie sein in raschem Wechsel auf und nieder hüpfender Adamsapfel verriet, wurde dann aber zusehends sicherer und sprudelte schließlich in einem Mischmach aus Italienisch und Deutsch hervor, dass die heutige Darbietung einzig und allein eine Huldigung des Maestros Corelli sei, jenes vor drei Jahren verstorbenen Genies, dessen Werke unsterblich wären. Der Abend sei den Triosonaten des Meisters vorbehalten; sein Bruder Pietro würde die erste Violine spielen, sein Bruder Giovanni die zweite und er selbst – Luigi – schließlich den Basso continuo auf dem Violoncello.
Ein paar Hände klatschten erwartungsvoll.
Rapp dachte, nun ginge es endlich los, irrte sich aber, denn als Nächstes hielt Luigi ein gitarrenähnliches, mit Elfenbein-Intarsien reich verziertes Instrument empor und erklärte mit starkem Akzent, dies sei ein Hamburger Cithrinchen, wie jedermann wohl wisse. Natürlich käme es nicht für die Triosonaten Corellis in Frage, dennoch wolle er die Melodie des ersten Satzes darauf zu spielen versuchen, sozusagen als Verbeugung vor der Hansestadt und dem heimischen Publikum.
Starker Applaus setzte ein, denn so etwas hörten die Hamburger gern. Manche von ihnen schlossen die Augen und lehnten sich zurück, in Erwartung der ersten Töne.
Doch noch immer war es nicht so weit. Luigi erläuterte jetzt den Unterschied von Kirchensonaten und Kammersonaten; Erstere seien viersätzig, die anderen dreisätzig, bestehend aus dem Eingangsatz und zwei Tanzsätzen, alle drei in der Folge schnell – langsam – schnell angelegt …
Rapp zog die Taschenuhr hervor und stellte grimmig fest, dass es schon ein Viertel auf neun Uhr war. Wie lange würde man ihn noch gefangen halten? Eine halbe Ewigkeit saß er nun schon hier. Aber was war das? Musik drang plötzlich an sein Ohr! Die Darbietung hatte begonnen. Für einige Minuten konzentrierte er sich auf den unterschiedlichen Klang der Instrumente, bemühte sich vergebens, die Melodie, welche munter die Tonleiter hinauf- und hinabkletterte, zu erkennen, und versuchte, dem Ganzen einen Hörgenuss abzugewinnen. Es gelang ihm nicht. Er war und blieb unmusikalisch. Schon als Kind hatte er die einfachsten Melodien falsch gesungen, für jedermann falsch und unerkennbar …
Rapp schreckte hoch. Da war er doch glatt eingenickt! Das durfte ihm nicht noch einmal passieren. Abermals lauschte er den Tönen, die ihn so stetig berieselten, und abermals glitt er hinab in Morpheus’ Arme. Hoppla! Er blinzelte und kniff sich in den Arm. Der Schmerz hielt ihn für ein paar Minuten wach. Welcher Satz wohl gerade gespielt wurde? Die Musik hörte sich schnell an. Wie war das noch? Schnell – langsam – schnell, hatte Luigi Agosta gesagt. Demnach konnte es schon der letzte Satz sein. Aber – oh Graus – auch noch immer der erste!
Erneut lullten die Klänge ihn ein. Eigentlich hatte er spätestens um neuneinhalb Uhr wieder in der Apotheke sein wollen, ein paar wichtige Arbeiten harrten dort der Erledigung. Auch musste er noch auf den Kräuterboden steigen und den Trocknungsgrad einiger Pflanzen überprüfen. Er seufzte halb im Schlaf. Die Tätigkeit eines Pharmazeuten glich einem Fass ohne Boden und ließ für andere Professionen kaum Spielraum. Und nun hatte auch noch die kalte Jahreszeit eingesetzt, mit Niesel und Nässe und dem typischen Hamburger Nordwest, einem Wind, der durch Mark und Bein blies und so manches Zipperlein hervorrief. Die Zeit der lindernden Thees war gekommen. Es gab Dutzende Rezepturen und noch mehr Drogen, und alle wollten mit der gebotenen Sorgfalt aufbereitet sein. Rapp war stolz auf seine Febris-Thees gegen die übermäßige Körperhitze. Je heißer sie aufgebrüht wurden, desto besser wirkten sie …
»Herrje!« Was war das? Ihm selbst war unerwartet heiß geworden. Ein dunkler Fleck breitete sich auf seinem schönen roten Rock aus – der Coffee!
Zähneknirschend und zur Untätigkeit verdammt, musterte Rapp das Ärgernis, bevor er endlich die Tasse auf einem der freien Stühle absetzte. Warum nur hatte er das nicht gleich gemacht? Wie lange er wohl geschlafen hatte? Die Musik jedenfalls war noch zu hören. Spielten die Agosta-Brüder nun schnell oder langsam, welcher Satz war dran? Über diesen Gedanken nickte er zum wiederholten Male ein.
Doch alles auf dieser Welt hat einmal ein Ende, und so war es auch mit diesem, von Madame Lüttkopp als Soirée bezeichneten Abend. Rapp merkte es an dem Applaus, der ihn aus seinen Träumen riss. Pflichtschuldigst klatschte er ebenfalls. Es war geschafft! Licht am Ende des Tunnels! Er zog die Uhr hervor und schielte heimlich aufs Zifferblatt. »Donnerwetter, schon bald elf Uhr!«, entfuhr es ihm. Es wurde höchste Zeit, nach Hause zu kommen. Da die anderen Gäste sich erhoben, tat er es ihnen gleich und schob sich aus dem Raum – nicht ohne die Coffeetasse vorher mit einem wütenden Blick gestreift zu haben.
Wo war nur die Gastgeberin? Rapp reckte den Hals. Aha, da vorn stand sie ja. Sie parlierte mit den Agosta-Brüdern – umringt von einer Gruppe jener Spezies von Zuhörern, die am Ende jeder Veranstaltung glauben, sich wichtig machen zu müssen, indem sie überflüssige Fragen stellen oder Schmeicheleien von sich geben. Rapp schnaubte. Dann musste die Dame eben auf seinen Abschiedsgruß verzichten. Wenn er es recht bedachte, war er darum auch keineswegs traurig. Wo war nur der verdammte Ausgang? Ach, natürlich, dort, wo alle anderen hindrängten. Wenn er nur nicht vergaß, sich seinen Stock und seinen Dreispitz wiedergeben zu lassen. Er erinnerte sich, beides beim Eintreten einem Bediensteten überantwortet zu haben, konnte sich aber nicht an das Gesicht des Burschen erinnern.
»Euer Hut, Euer Stock, Monsieur«, schnarrte eine Stimme hinter ihm.
»Ah-hm … ja!«, fuhr Rapp herum. »Ich hatte schon befürchtet, dass ich meine Sachen nicht … nun ja …« Er ließ offen, was er befürchtet hatte, denn das ging den Diener einen feuchten Kehricht an, und rammte sich den Dreispitz auf die Perücke. Den Stock in der Hand, betrat er kurz darauf die Straße. Vor ihm und neben ihm herrschte rege Aufbruchstimmung. Die Zweispänner der reichen Herrschaften setzten sich holpernd in Bewegung. Kutscher schnalzten mit der Zunge, Peitschen knallten und Pferde wieherten nervös. Die weniger Begüterten unter den Gästen standen am Straßenrand und feilschten um die Gunst der fünf oder sechs Laternengänger, die das Haus Lüttkopp für den Heimweg zur Verfügung gestellt hatte. Auch Rapp hätte gern einen dieser hilfreichen Begleiter in Anspruch genommen, aber selbstverständlich schnappte man ihm den Letzten vor der Nase weg. Nun gut. Er hatte es ohnehin nicht weit. Er würde nicht über den Burstah gehen, sondern den Weg über den Hopfenmarkt nehmen, vorbei an St. Nikolai. Dort standen mehrere Laternen, die den Platz erleuchteten.
Rapp steckte die Nase in den Wind und sog tief die frische Nachtluft ein. Dann setzte er sich in Bewegung. Die Große Johannisstraße lag in unmittelbarer Nähe des Rathauses, was Berendt Lüttkopp vor Jahren bewogen haben mochte, seinen Wohnsitz eben hier erbauen zu lassen. Rapp wandte sich nach Süden. Es pressierte ihm nun mächtig, in seine Apotheke zu kommen. Allein der Gedanke, dass am heutigen Tage einige Salben zur Neige gegangen waren und umgehend neu zubereitet werden mussten, ließ ihn seinen Schritt beschleunigen. Auch der Vorrat an Oleum camphorat, dem Öl des indischen Kampferbaums, wollte endlich in kleine Gefäße umgefüllt werden, ebenso der venezianische Theriak und einige andere Liquores. Dann war da noch das Schneidebrett zum Zerkleinern von Kräutern: Es hakte seit einigen Tagen und wartete darauf, gängig gemacht zu werden. Nicht zuletzt das große Wiegemesser konnte mal wieder eine Schärfung vertragen. Und über alledem die Kräuterbüschel auf dem Trockenboden: Es waren genau zweihundertsiebenundfünfzig, die dort hingen, und alle mussten überprüft und nötigenfalls umgehängt oder mehr ans Licht gebracht werden.
Rapp schnaubte und bedauerte, nicht drei oder mehr Hände zu haben. Mittlerweile war er auf dem Hopfenmarkt angelangt, wo St. Nikolai von rechts herübergrüßte. Die Tranlaternen spendeten schummriges Licht. Niemand war zu sehen. Die Tür des Gotteshauses war geschlossen, was Rapp allerdings nicht verwunderte. Nach seiner Erfahrung war der Hamburger Bürger ein regelmäßiger, aber nicht allzu fleißiger Kirchgänger. Er hatte dafür durchaus Verständnis, denn er selbst ließ sich selten in St. Nikolai sehen. Stattdessen stand er lieber hinter dem Rezepturtisch in seiner Offizin oder saß – wenn seine knappe Zeit es erlaubte – vor seiner geliebten Sammlung überseeischer Kuriosa.
Die Kirchenglocke hoch oben im Turm begann zu dröhnen. Elf Uhr!, schoss es ihm durch den Kopf, und unwillkürlich zählte er die Schläge mit, während er weiter in Richtung Deichstraße eilte. Nach dem zehnten Schlag glaubte er linker Hand einen anderen, viel leiseren Laut wahrzunehmen. Das Geräusch klang seltsam, irgendwie verzweifelt. Was hatte das zu bedeuten? In seine Überlegungen hinein hämmerte der elfte Glockenschlag. Rapp schüttelte sich unwillkürlich, als könne er dadurch seine Ohren vom Nachhall befreien, und lauschte abermals.
Nichts.
Und doch hatte er etwas gehört. Ja, er war jetzt ganz sicher, dass es sich um einen Ruf gehandelt hatte, einen Notschrei womöglich, ausgestoßen irgendwo in einer der verwinkelten Gassen, die sich wie brüchige Adern durch die alten, baufälligen Häuser nach Osten zum Nikolaifleet hinzogen. Eine Gegend, die nicht allzu einladend war.
»Hilfe! Zu Hilfe! Oooh, oooh …«
Rapp spürte Genugtuung. Auf sein Gehör war immer noch Verlass. Und auch wenn die Häuserfront sich dunkel und drohend vor ihm aufbaute, so zögerte er keineswegs, dem Hilferuf auf den Grund zu gehen. Vielleicht konnte eine seiner stets mitgeführten Arzneien Linderung verschaffen, oder jemand benötigte einen ärztlichen Rat, den zu geben er als Apotheker ebenfalls in der Lage war.
Nein, er fürchtete sich nicht. Wozu auch? Hamburg war zwar eine Hafenstadt und demzufolge ein Ort, an dem sich viele faule, freche, geile, gottlose, versoffene Trunkenbolde, Bierbalge und Bettler herumtrieben, aber ihm war noch nie etwas passiert, und er sah keinen Grund, warum das ausgerechnet in dieser Nacht anders sein sollte. Obwohl er kaum die Hand vor Augen sah, betrat er das sich vor ihm auftuende Gässchen – die Hände weit ausgestreckt und sich auf diese Weise vorantastend. Als seine Pupillen sich besser an das Dunkel gewöhnt hatten und er etwas schneller ausschreiten konnte, rief er: »Wartet, ich komme! Wo seid Ihr?«
Wieder erklang der Hilferuf. Rapp erkannte, dass er sich schon in unmittelbarer Nähe des Verzweifelten befinden musste. Er stolperte über mehrere herumliegende Säcke, fing sich gerade noch und rief abermals: »Ich komme! Nur keine Sorge!«
Er beschleunigte seinen Schritt. Vor ihm tauchte ein schwacher Lichtschein auf. Ein trübes Fenster wurde sichtbar, dahinter schemenhafte Köpfe und betrunkene Stimmen. Fetzen von Musik erklangen. Jemand quälte die Saiten einer Fidel. Über einer windschiefen Tür erkannte er Buchstaben, von ungelenker Hand geschrieben:
Zum Hammerhai
Eine Schänke also, dachte Rapp. Gerade war er im Begriff, sie zu betreten, als abermals der Hilferuf erscholl, viel lauter diesmal und ganz gewiss nicht aus dem Schankraum kommend. Rapp machte auf dem Absatz kehrt und drang weiter in das Labyrinth aus dunklen Gassen vor. Wo war der arme Mensch nur, der seinen Beistand brauchte? Er hielt für einen Augenblick inne. »Wo seid Ihr? Meldet Euch nochm …«
Weiter kam er nicht. Ein derber Schlag hatte ihn am Kopf getroffen. Rapp fiel der Länge nach hin und blieb wie ohnmächtig liegen. Doch sei es, dass der Dreispitz die Hauptwucht des Schlages abgefangen hatte, sei es, dass der Spitzbube nicht richtig Maß genommen hatte, Rapp jedenfalls war nicht bewusstlos, im Gegenteil, helle Wut ob des feigen Überfalls loderte in ihm hoch. Er wartete einige Atemzüge, und richtig: Da näherten sich vorsichtig Schritte. Rapp spürte, wie jemand sich über ihn beugte, holte tief Luft und ließ den Spazierstock mit aller Kraft durch die Luft sausen. Ein Aufheulen über ihm bestätigte, dass er sein Ziel gefunden hatte. Er sprang auf die Füße und erkannte eine dunkle Gestalt, die sich vor Schmerzen krümmte. »Wer bist du, dass du es wagst …?«, donnerte er – und machte neuerlich mit dem Boden Bekanntschaft. Ein weiterer Schlag hatte ihn getroffen. Es musste einen zweiten Angreifer geben! Rapp biss die Zähne zusammen. Wer auch immer ihn da erwischt hatte, er hatte ihm einen äußerst schmerzhaften Hieb versetzt. Seine linke Schulter über dem Schlüsselbein tat höllisch weh. Doch er hatte keine Zeit für Selbstmitleid. Man wollte ihm ans Geld, womöglich sogar ans Leben. Hastig rollte er sich zur Seite, um hinter einer Kohlenkiste Deckung zu suchen. Keine Sekunde zu früh, denn schon bohrte sich die Waffe des neuen Angreifers knirschend ins Holz. Ein Fluch erklang. Oder jedenfalls das, was Rapp für einen Fluch hielt.
Halb hinter der Kiste kauernd, konnte er eine Gestalt erkennen, hoch aufgerichtet und einen Knüppel schwingend. Jetzt gilt’s!, dachte Rapp. Er schlug dem Unhold den Spazierstock zwischen die Beine und hörte mehr, als dass er sah, wie der Mann strauchelte. Rapp sprang auf die Füße und ließ seinen Stock kräftig auf dem Körper des Burschen tanzen. Normalerweise tat er keiner Fliege etwas zu Leide, aber wenn ihm jemand so feige und hinterrücks ans Leder wollte, konnte er sich vergessen.
Rapp schlug noch einmal zu. Sein Zorn begann zu verrauchen. Da hörte er hinter sich ein Scharren. Er fuhr herum und riss den Stock hoch. Das war sein Glück. Denn so konnte er den Schlag des ersten Angreifers abwehren. Der Hundsfott hatte sich erholt und griff nun neuerlich an! Rapps Wut flammte wieder auf. Er rammte dem Burschen sein Knie in den Unterleib und stieß mit dem Spazierstock zu. Die Antwort war ein Aufschrei. Rapp hörte ihn kaum, denn er war schon dabei, weitere Streiche auszuteilen. Endlich sank sein Gegner zu Boden. Schwer atmend richtete Rapp sich auf. Die beiden Halunken lagen zu seinen Füßen und rührten sich nicht mehr.
»Gott sei gelobt und gedankt!«, japste er. »Steht auf, ihr Galgenvögel, und trollt euch.« Er betastete die schmerzende Schulter und begann sich den Rock abzuklopfen. »So etwas Abgefeimtes! Die Hilfsbereitschaft braver Bürger auf diese Weise auszunutzen!«
Die Angreifer lagen da und rückten und rührten sich nicht.
»Los, los, hoch mit euch! Seid froh, dass die Nachtwache nicht in der Nähe war, aber wenn euch nach ihr gelüstet, will ich sie gerne holen. Und dann geht’s ab hinter die schwedischen Gardinen.«
Wieder blieb eine Antwort aus. Rapp wurde unruhig. Er beugte sich zu einem der beiden Leiber hinunter. »He, Bursche, aufwachen! Tu nicht so, als hörtest du mich nicht.« Während er sprach, hielt er den Stock halb erhoben, bereit zum Schlag. Er wusste, dass dieses Gelichter zäh war – kampferprobt in unzähligen Prügeleien.
Oder sollte er doch zu fest zugeschlagen haben? Für einen Augenblick, das musste er zugeben, hatte er Rot gesehen. Da hatte er nicht gewusst, was er tat.
Rapp kniete sich neben die Körper nieder und legte den Stock ab. Es war ein schönes Exemplar aus Ebenholz mit silbernem Knauf, weshalb er es behutsam tat. Dabei spürte seine Hand plötzlich etwas Feuchtes. Eine Pfütze!, war das Erste, was er dachte. Doch das konnte nicht sein. Es hatte seit mehreren Tagen nicht geregnet, und die Flüssigkeit war sehr dunkel, fast schwarz. Er prüfte mit den Fingern ihre Konsistenz. Sie war dicker als Wasser. Und klebriger. Sie war – Blut? Ein Schauer lief Rapp den Rücken hinunter. Seine Gedanken rasten. Er versuchte, sich den Kampf nochmals vor Augen zu führen. Sollte er wirklich so stark …? Aber er hatte doch gar nicht so fest …!
Mit fahrigen Bewegungen tastete er den Boden neben dem Kopf ab. Dann hatte er die entsetzliche Gewissheit: Der Mann lag in einer großen Blutlache. Damit nicht genug – auch der Kopf des zweiten Strolchs war voller Blut. Rapp sah sich um. In der Kneipe schien man von den Geschehnissen nichts mitbekommen zu haben. Der Geräuschpegel war unverändert hoch. Jemand hatte begonnen zu dem Gekratze der Fidel ein Lied anzustimmen, und ein anderer schien eine Zote zu reißen, denn seine Worte wurden immer wieder von Lachen und Gegröle unterbrochen.
Rapp tastete nach dem linken Handgelenk des vor ihm Liegenden, um den Puls zu fühlen, konnte aber keinen Herzschlag feststellen, weil der Bursche eine Jacke mit langen, eng anliegenden Ärmeln trug. Er war mittlerweile so aufgeregt, dass er sich nicht in der Lage sah, den Stoff hochzukrempeln. Und der andere Bursche? Er war ganz ähnlich gekleidet.
»Großer Gott!«, stieß Rapp wieder und wieder hervor, »was habe ich nur angerichtet! Gib, dass die Männer nicht tot sind, ich habe mich doch nur gewehrt. Gib, dass sie nicht tot sind. Bitte …«
Er fing an, die beiden zu schütteln, schrie ihnen ins Ohr, stammelte irgendwelche Wortfetzen, schüttelte sie erneut mit der Kraft der Verzweiflung – allein, es war alles umsonst. Die Glieder der Angreifer waren kraft- und leblos wie die einer Stoffpuppe. Rapp konnte es noch immer nicht fassen, zwei Menschen getötet zu haben. Er, dessen ganzes Streben es von jeher gewesen war, Gesundheit und Leben seiner Mitbürger zu erhalten!
Durch den Sturm seiner Gefühle drang neuer Lärm aus dem Hammerhai. Was war da los? Über die Türschwelle torkelten mehrere Gestalten. Sie waren stockbetrunken, und einer von ihnen warf seinen leeren Becher hoch in die Luft. Rapp sah das Trinkgefäß und gleichzeitig Sterne am Himmel aufgehen. Für den Bruchteil eines Augenblicks wunderte er sich, wieso an einem wolkenverhangenen Himmel Sterne aufblitzen konnten, dann sah er gar nichts mehr.
Er stürzte um wie ein gefällter Baum.