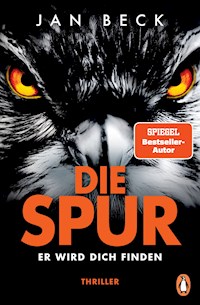10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Björk und Brand Reihe
- Sprache: Deutsch
Es ist nur ein Spiel. Doch es geht um dein Leben.
Als Mavie während einer Party auf ihr cooles, im Dunkeln leuchtendes Tattoo angesprochen wird, hält sie das für einen Scherz. Doch dann sieht sie es im Lichtstrahl der Tanzfläche mit eigenen Augen und gerät in Panik: Woher kommt der Skorpion auf ihrer Haut? Mavie ahnt nicht, dass das Zeichen sie zur Zielscheibe eines perfiden Spiels macht.
Zur gleichen Zeit übernehmen die Ermittler Inga Björk und Christian Brand den Fall einer brutal im Wald ermordeten Joggerin. Noch wissen sie nicht, dass dies erst der Anfang einer grausamen Mordserie ist. Und dass sie nur eine Chance haben, diese zu stoppen: Sie müssen die Seiten wechseln – und das tödliche Spiel mitspielen …
»In diesem Fall geht’s gleich richtig zur Sache – da lässt Herr Fitzek grüßen. Ein Buch, das fesselt!« – Sonntag Express
Entdecken Sie den ultimativen Nervenkitzel! Eine fulminante Thrillerreihe, deren Bände Sie alle unabhängig voneinander lesen können:
Das Spiel – Es geht um dein Leben
Die Nacht – Wirst du morgen noch leben?
Die Spur – Er wird dich finden
Das Ende – Dein letzter Tag ist gekommen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
JAN BECK, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen deutschsprachigen Autors. Bevor er sich dem Schreiben widmete, arbeitete Jan Beck als Jurist. In seinem rasanten Thrillerdebüt Das Spiel lässt Beck seine Leser tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Jan Beck
Das Spiel
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 by Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Cover: Favoritbüro
Covermotiv: Gettyimages/Mike Kuipers
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25190-1V006
www.penguin-verlag.de
Freitag, 21. August
1Im Wald
Sie lief und wollte ihr Glück in alle Welt hinausschreien. Sie hatte es geschafft. Endlich war es vorbei.
Endlich war sie frei.
Nie wieder würde sie den Menschen gegenübertreten müssen, die ihr die letzten Jahre zur Hölle gemacht hatten. Diese Scheusale. Aber am Ende hatten sie bezahlen müssen. Und zwar teuer.
Man erntet, was man sät.
Sie lief schneller.
Die Genugtuung, die sie empfand, brannte stark wie ein Feuer in ihr. Vor wenigen Stunden erst war das Urteil im Prozess gegen ihren Arbeitgeber verkündet worden. Aufhebung der Kündigung und volle Wiedergutmachung des ihr entstandenen Schadens. Ersatz aller Behandlungskosten und Nachzahlung des Gehalts seit ihrem Rauswurf. Und: Strafanzeige gegen unbekannt.
Sie würde das Gesicht ihres Chefs niemals vergessen.
Ich habe gewonnen.
Sie bog in die große Waldschleife ab.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Klägerin an ihrem Arbeitsplatz erheblichem, systematischem Druck ausgesetzt war. Als dies nicht zu ihrem freiwilligen Ausscheiden führte, wurde ihre Arbeit nachweislich manipuliert, um eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Gründen zu rechtfertigen. Da diese Gründe nicht vorlagen, war der Klage stattzugeben.
Sie lief und lief. Wie jeden Abend würde sie erst anhalten, wenn sie keine Kraft mehr hatte. Aber gerade fühlte sie sich, als könnte sie die ganze Welt umrunden.
Sie wollen Krieg? Den können Sie haben!
Und wie sie Krieg bekommen hatte. Nach allen Regeln hatte die Firma Krieg gegen sie geführt. Tarnen und Täuschen inklusive. Man wusste erst, was systematisches Mobbing hieß, wenn man es am eigenen Leib erlebte. Wenn sich jeder distanzierte, wenn das Opfer zum Täter gemacht wurde, zum Störfaktor, zum Spinner, der sich das alles nur einbildete, bis sogar die eigene Familie sich abwandte. Aber sie hatte durchgehalten. Hatte sich von niemandem unterkriegen lassen. Und hatte diesen Krieg, den sie nie wollte, am Ende gewonnen.
Ohne Mark hätte ich das nie geschafft.
Mark hatte vor Glück geweint, als sie ihn vorhin am Telefon erreicht und ihm alles erzählt hatte. Er kam erst am nächsten Tag aus London zurück. Sie hätte ihn so gerne bei der Urteilsverkündung an ihrer Seite gehabt. Damit er höchstpersönlich mitbekam, dass sein Vertrauen in sie gerechtfertigt war.
Ich war nicht verrückt. Die waren es. Und du hast immer an mich geglaubt. Ich liebe dich, Mark!
Tränen stiegen ihr in die Augen, als ihr klar wurde, dass für sie nun ein neues Leben begann. Mit der Entschädigung konnten sie eine Weltreise machen, wenn sie wollten. Oder eine riesige Hochzeit feiern. Vorausgesetzt, Mark fragte sie endlich. Sogar Kinder konnte sie sich jetzt vorstellen, ein Gedanke, der in den letzten Wochen und Monaten ganz weit in die Ferne gerückt war.
Warmer Sommerwind umstrich ihre Beine. Wie lange hatte sie nicht mehr so befreit laufen können? Wie lange hatte sie sich selbst jede Freude verboten, hatte das Ritual der täglichen Joggingrunde mit verbissener Disziplin durchgezogen, den Blick starr nach vorne gerichtet, aus der irrationalen Überlegung heraus, jeder Genuss vor der Urteilsverkündung könnte böses Karma geben? Wie lange hatte sie sich tief im Innern schuldig gefühlt und fast schon selbst zu glauben begonnen, was die anderen behaupteten? Der eigene Kopf spielte einem die schlimmsten Streiche.
Vorbei, vorbei.
Sie erreichte die Lichtung mit dem kleinen Waldsee. Über ihr leuchteten die Sterne. Die Vorhersage behielt recht: Es würde eine klare Nacht werden. Das war auch nicht schwer zu erraten. Seit Wochen brachte ein riesiges Hochdruckgebiet ganz Europa zum Schwitzen, nur die Nachtstunden waren halbwegs erträglich. Aber sie würde sich niemals darüber beklagen. Kalt wurde es noch früh genug.
In ein paar Tagen war Vollmond. Schon jetzt leuchtete er hell, spiegelte sich im Wasser und tauchte die ganze Umgebung in weißbläuliches Licht. Sie schaltete ihre Stirnlampe aus und konnte trotzdem jede Unebenheit des Weges erkennen. Sie fühlte sich, als würde sie schweben.
Dann blieb sie stehen. Einfach so. Weil sie konnte. Weil sie durfte. Sie war frei. Nichts hielt sie mehr davon ab, ihr Leben zu genießen. Ihr Kopf war leer. Sie atmete ein, sie atmete aus. Was jetzt folgte, war ihre Entscheidung, nicht mehr die eines Anwalts oder eines Richters. Sie bestimmte wieder selbst über sich und ihre Zukunft.
Da kam ihr ein Gedanke.
Soll ich es wagen? Einfach … reinspringen? Nackt?
Es war zu verrückt. Und gerade deshalb perfekt. Perfekt wie dieser ganze Tag. Sie lächelte, zog sich das Top über den Kopf und spürte, wie sie dabei die Stirnlampe abstreifte. Achtlos ließ sie beides ins hohe Gras fallen und schlüpfte aus den Joggingschuhen.
Plötzlich hörte sie etwas und hielt inne. Ein kurzes Rascheln nur, aus der Richtung, aus der sie gekommen war. Sie horchte. Angst hatte sie keine. Im Wald gab es die verschiedensten Geräusche, und sie kannte sie alle. War es ein Vogel, der durchs Unterholz streifte? Zu leise. Außerdem zu dunkel. Ein Reh? Zu laut für das, was sie gehört hatte. Vermutlich war ein Eichhörnchen von einem Baum zum anderen gesprungen.
Sie kannte diesen Wald wie ihre Westentasche. Sie war hier aufgewachsen und hatte einen guten Teil ihrer Kindheit unter den Bäumen verbracht. »Eine Halbwilde« hatten ihre Eltern sie scherzhaft genannt, wenn Leute zu Besuch waren. Es hatte ihr stets ein tierisches Vergnügen bereitet, Kindern aus der Stadt den »dunklen, bösen« Wald zu zeigen.
Der Wald ist mein Freund.
Eine Weile blieb sie ganz ruhig stehen und lauschte, aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Schließlich zog sie sich aus, zögerte noch einmal kurz, dann gab sie sich einen Ruck und rannte nackt ins Wasser hinein. Der Kies am Ufer bohrte sich schmerzhaft in ihre Fußsohlen. Das Wasser war kalt, aber angenehm, und wurde schnell tiefer. Eine Sekunde später stürzte sie sich vornüber ins kühle Nass.
Als sie wieder auftauchte, musste sie lachen vor Glück. Was für ein tolles Geschenk, das die Natur ihr da machte! Alles war Sommer, alles war Leben.
Mit ein paar Zügen gelangte sie in die Mitte des Sees, ließ die Füße sinken und bewegte ihre Arme gerade genug, um ihren Kopf über Wasser zu halten. Sie staunte über das Konzert der Grillen um sie herum. Die Vögel waren schon seit Einbruch der Dunkelheit still, aber die Klangwolke, die über der Lichtung aufstieg, aus allen Richtungen zugleich, suchte ihresgleichen. Außer dem Zirpen hörte sie nur ihren Atem und die Geräusche, die ihre Schwimmbewegungen auslösten: weiches, sanftes Wasserplätschern.
Sie atmete tief ein, brachte ihre Beine an die Wasseroberfläche und streckte sich. Ließ sich mit offenen Augen auf dem Rücken treiben. Wieder sah sie Sterne, Sterne, Sterne. Der Mond war zu hell, als dass sie die Milchstraße hätte erkennen können, und doch waren da oben mehr Lichtpunkte, als sie zählen konnte.
Nach einer Minute völliger Harmonie zwischen sich und dem Universum beschloss sie, dass sie Frieden schließen wollte mit der Welt und allem, was war.
»Ich vergebe euch«, sagte sie laut. »Alles ist wieder gut.«
Dann drehte sie sich auf den Bauch zurück und schwamm ans andere Ufer. Dort setzte sie sich auf, vom Bauchnabel abwärts im Wasser, mit den Händen im Kies abgestützt. Immer noch war ihr nicht kalt.
Plötzlich sah sie aus dem Augenwinkel ein Licht aufblitzen. Ganz kurz nur, in etwa dort, wo sie in den See gelaufen war. Vielleicht ein Glühwürmchen.
Zu hell für ein Glühwürmchen.
Sie kniff die Augenlider zusammen. Ihre leichte Kurzsichtigkeit war bei dem schlechten Licht doch hinderlich. Nein, da war nichts. Bestimmt hatte sie sich getäuscht. Vielleicht hatte eine Welle den Mond im Wasser reflektiert.
Welche Welle? Der See war spiegelglatt.
Sie ging in die Hocke, stieß sich vom Ufer ab und schwamm zurück, schneller, als sie ursprünglich wollte. Auch wenn sie es sich niemals eingestanden hätte, war da jetzt noch etwas anderes als Glück und Harmonie in ihr.
Angsthase.
Das mit dem Schwimmen war wohl doch zu verrückt gewesen. Selbst als Kind – als Halbwilde – hätte sie sich das nie getraut. Ihre Mutter hatte sie immer vor dem See gewarnt. Und nun war sie mittendrin, und ihre Sinne spielten ihr Streiche. Zum Beispiel, dass da eine Gestalt im Gras kauerte, keine fünf Meter von ihr entfernt.
Sie spürte den Uferkies an ihren Fingerspitzen. Kniete sich hinein. Kniff die Lider noch schmaler zusammen.
Doch, da war etwas. Aber was? Ein Reh? Ein Hund? Jedenfalls etwas, das vorhin nicht dort gewesen war. Etwas Lebendiges. Sie kannte jeden Wurzelstock und jeden größeren Stein in der Gegend. Das da kannte sie nicht.
»Hey!«, rief sie.
Nichts passierte. Sie griff sich eine Handvoll Kies und warf ihn ans Ufer. Die Gestalt wuchs in die Höhe.
Die Silhouette eines Menschen.
Ihr Herz fing an zu rasen, adrenalinbefeuert. »Hau ab, du verdammter Spanner!«, schrie sie mit sich überschlagender Stimme, nahm eine neue Ladung Kies vom Grund und schleuderte ihn der Gestalt mit aller Kraft entgegen. Dann zog sie sich rückwärts ins Wasser zurück, den Blick starr nach vorn gerichtet.
Die Gestalt ließ sich weder von ihrem Geschrei noch dem Kies aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, jetzt kam sie auf sie zu, ganz langsam.
»Hau ab! Hau ab!«
Konnte das ein Scherz sein? Nichts hätte sie lieber geglaubt. Aber sie kannte niemanden, der sich Späße dieser Art erlaubte. Und wenn doch, dann konnte er was erleben. Sie mochte keine unheimlichen Scherze.
Sie glitt ins tiefere Wasser zurück, schwamm vom Ufer weg und überlegte panisch, was sie tun konnte. Rundum lag dichter Wald. Nur vorne gab es diesen einen Trampelpfad, überall sonst wuchsen dichtes Gras und stacheliges Strauchwerk, auch am anderen Ufer gab es viele Pflanzen, denen man besser nicht mit nackten Beinen begegnete.
Sie paddelte im tiefen Wasser auf der Stelle, drehte sich um sich selbst und suchte einen Ausweg, fand aber keinen. Wollte sie entkommen, musste sie direkt an der Gestalt vorbei.
Wie lange kann ich hier durchhalten?
Langsam wurde ihr nun doch kalt. Sie überlegte, laut um Hilfe zu rufen, aber es wäre reines Glück gewesen, hätte sie jemand gehört. Hier war schon tagsüber kaum etwas los und um diese Uhrzeit gar nichts mehr. Das Zirpen rundum klang jetzt fast spöttisch.
Stark sein, erinnerte sie sich an die Empfehlung im Selbstverteidigungskurs. Die meisten Vergewaltiger wurden von Frauen, die in die Opferrolle verfielen, nur noch angespornt. Man sollte sich stattdessen so ordinär wie möglich verhalten. Nichts törnte einen Vergewaltiger mehr ab als eine Frau, die so tat, als wollte sie es.
Das sagt sich so leicht.
Die Gestalt stand da, am Ufer des Sees, und konnte noch stundenlang durchhalten. Sie selbst würde definitiv früher aufgeben müssen. Und was dann?
Sie zitterte, hatte Gänsehaut am ganzen Körper, klapperte mit den Zähnen. Aber innerlich loderte die nackte Angst.
Eine weitere Minute verging. Dann, von einem Moment auf den anderen, drehte sich die Gestalt um und entfernte sich in aller Seelenruhe, bog links ab und nahm den Weg, der weiter in den Wald hineinführte.
Der Rückweg war frei. Aber wie lange? Jetzt musste sie schnell sein. Mit wenigen kräftigen Zügen schwamm sie ans Ufer und eilte mit großen Schritten aus dem Wasser. Zweimal verlor sie fast die Balance im feinen Kies, aber dann hatte sie Gras unter den Füßen und lief zu der Stelle, an der sie sich ausgezogen hatte. Ihr Blick schweifte über den Boden auf der Suche nach ihren Sachen, sie überlegte, suchte weiter – aber ihr Zeug war weg. Ihre Kleidung, die Stirnlampe, das Täschchen mit dem Handy …
Nichts, was sich nicht ersetzen ließ.
Der Schlüsselbund. Verdammt!
Wenn der Dieb wusste, wo sie wohnte, hatte er jetzt freien Zutritt zu ihrem Haus. Sie musste sofort einen Schlosser rufen, wenn sie zu Hause war.
Und wie komm ich ohne Schlüssel rein? Sie hatte keine Ersatzschlüssel deponiert, da sie das für ein Sicherheitsrisiko hielt.
Zu den Nachbarn. Notfalls nackt.
Sie lief los. Ohne ihre Joggingschuhe wurde jeder Schritt zur Qual. Aber sie konnte, sie durfte nicht zögern. Tempo war das Einzige, was jetzt zählte. Sie lief zum Weg und rechts weiter auf den Joggingpfad, der aus dem Wald herausführte.
Da raschelte etwas hinter ihr. Ein winziges Ästchen brach. Rhythmische Schritte ertönten. Die andere Person folgte ihr. Sie war getäuscht worden!
Sie öffnete den Mund zu einem Schrei, doch sie brachte keinen Ton heraus. Schneller, lauf schneller! Sie ignorierte alles – Steine, Wurzeln, Dornen, Brennnesseln –, nichts war wichtig, außer dass sie rannte. Noch konnte sie entkommen. Sie war gut im Laufen. Wochen- und monatelang war sie wie eine Besessene gelaufen. Ihre Kondition war besser denn je, ihre Muskulatur gestählt.
Wenn ich nur meine Schuhe hätte …
Sie streckte die Hand aus, als sie den dicken Zweig eines Strauchs erkannte, der in den Pfad hereinragte. Sie kannte ihn, wie so viele Details dieser Strecke. Wieso machte sich eigentlich niemand die Mühe, ihn abzuschneiden? Sie bog ihn von sich weg und ließ ihn zurückpeitschen, lief weiter, so schnell sie konnte.
Gleich darauf hörte sie, wie der Zweig ihren Verfolger traf, der einen erstickten Fluch ausstieß. Die Schritte wurden langsamer, aber höchstens für eine Sekunde. Von einem Zweig würde er sich nicht aufhalten lassen.
Sie erreichte dichter bewachsenes Gelände. Hinter ihr leuchtete etwas auf. Eine Taschenlampe. Ihr Verfolger gab sich also keine Mühe mehr, unentdeckt zu bleiben. Der Lichtkegel zitterte aufgeregt. Sie sah, wie sich ihre Silhouette auf dem Waldboden vor ihr abzeichnete. Die Schritte hinter ihr wurden lauter.
Er holt auf.
Aber noch konnte sie entkommen. Gleich gelangte sie an einen ihrer vielen Geheimplätze. Wenn sie nur schnell genug hinter der nächsten Biegung verschwand, sich fallen ließ und dann gleich links im Dickicht verkroch, würde er sie niemals finden. In der Kindheit war das ihr bestes Versteck gewesen.
Ob ich überhaupt noch reinpasse? Vielleicht ist es längst zugewachsen!
Sie verbot sich jeden Zweifel und lief, so schnell sie konnte. Noch zehn Meter … noch fünf …
Geschafft!, dachte sie noch.
Und dann ging alles ganz schnell. Sie wusste, dass sie eben noch gerannt war und jetzt ausgestreckt dalag, dass sie mit dem Gesicht voran auf dem Waldboden aufgeschlagen war, ohne sich mit den Händen schützen zu können. Nur das Dazwischen fehlte. War sie gestolpert? Aber worüber? Hier gab es keine hohen Wurzeln. Was konnte sonst noch so scharf, so unnachgiebig, so unvorhersehbar gemein sein?
Ein gespannter Draht?
Was immer es gewesen war, es hatte sie ihrem Verfolger ausgeliefert. Sie wurde gepackt und brutal in die Höhe gerissen, schmeckte das Blut, das warm über ihr Gesicht lief. Sie wollte es mit der Hand abwischen, aber ihre Hände gehorchten ihr nicht. Völlig benommen spürte sie, wie sie ins Unterholz gezerrt wurde, weiter und weiter. Gestrüpp streifte an ihrem nackten Körper entlang. Der Wald war hier so dicht, dass man selbst bei Tageslicht kaum zwei Meter weit sehen konnte, das wusste sie. Ein Dornenzweig verhakte sich in ihrer Seite und riss ihr die Haut auf. Sie stöhnte.
»Hier!«, zischte jemand.
Sie spürte die spröde Rinde eines Baums an ihrem Rücken. Ihre Arme wurden nach hinten gezogen und mit schnellen, kräftigen Bewegungen zusammengebunden.
»Bitte nicht«, flehte sie. Die eigenen Worte klangen merkwürdig verwaschen. Da war Blut in ihrem Mund. Etwas stimmte nicht mit ihren Zähnen. Sie fuhr mit der Zunge darüber. Mehrere Schneidezähne waren ausgeschlagen. Sie hatte es gar nicht gespürt.
»Bitte nicht«, wiederholte sie, schloss die Augen und fing an zu weinen. Was mochte ihr Verfolger wollen? War er ein Sexualstraftäter, ein Perverser, der sie beim Nacktbaden beobachtet hatte? Und warum war da noch jemand? Wollten sie etwa gemeinsam über sie herfallen? Aber so zugerichtet, wie sie war, musste ihnen doch jede Lust vergehen.
Als sie eine Hand an ihrer Schulter fühlte, beschloss sie, dass sie sich nicht wehren würde. Sollten sie ihren Körper nehmen. Ihren Geist bekämen sie nicht. Sie würde das hier überleben, so schlimm es auch werden mochte. Und eines Tages würde sie die Gelegenheit haben, sich an ihnen zu rächen. Ja, das würde sie. Sie würde sie finden und sich rächen. Der Gedanke gab ihr Kraft.
»Da ist es«, hörte sie eine Männerstimme mit italienischem Akzent sagen. »Das Mal. Siehst du?«
Das Mal?
»Ja!«, antwortete eine Frau.
Die beiden gaben sich keine Mühe, ihre Stimmen zu verstellen. Sie ahnte, dass das kein gutes Zeichen war.
Sie zwang sich, die Augen zu öffnen. Blut und Tränen machten es ihr fast unmöglich, etwas zu erkennen. Dennoch sah sie die Umrisse zweier Gestalten, direkt vor ihr, in bläuliches Licht getaucht, anders als das der Taschenlampe, beinahe violett. Oder spielten ihr die Sinne einen Streich?
»Also, was sollen wir tun?«, fragte die Frau nahezu gleichgültig.
»Warte …«
Sie fühlte eine Hand an ihrem Bauch. Die Finger drückten und zogen, fuhren über die Haut rund um ihren Nabel.
»In der Mitte durch.«
»Quer durch? Lass sehen … Mist, du hast recht.«
Sie verstand nicht, wovon die zwei sprachen. Als sie den Kopf senkte, sah sie nichts als das seltsame blaue Licht. Und dann noch etwas: ein Leuchten. An ihrem Bauch. Sie erkannte nicht, was es darstellen sollte.
Malen die mich gerade an? Ist das vielleicht doch alles nur ein … ein verdammt schlechter Scherz?
Sie durfte sich nicht wehren. Musste das, was auch immer da passierte, über sich ergehen lassen. Konnte sich später rächen.
»Los jetzt!«
Eine rasiermesserscharfe Klinge drang in ihren Bauch ein. Der Schmerz raubte ihr den Atem. Sofort rann warmes Blut aus der Wunde, über den Unterbauch, über ihre Scham, die Beine hinunter.
Die wollen mich schlachten.
Die Erkenntnis traf sie wie ein Hammerschlag. Sich nicht zu wehren, würde ihren sicheren Tod bedeuten. Sie riss an ihren Fesseln, scheuerte daran, wehrte sich, zog ein Bein in die Höhe und trat aus, traf jemanden, wiederholte die Bewegung, aber dieses Mal fuhr ihr Fuß ins Leere.
»Dämliche Bitch!«, hörte sie die Frau schreien.
Jemand riss an ihren Haaren und drückte ihren Kopf mit Gewalt gegen den Baum.
Sie spürte das Messer, links an ihrem Hals, spürte, wie es gegen ihre Haut drückte, bevor es tief durch ihre Kehle schnitt.
Mark, dachte sie noch.
Samstag, 22. August
2Wien, 18.11 Uhr
Christian Brand, Einsatzkommando (EKO) Cobra
Brand kauerte hinter einer halbhohen Sitzbank aus Beton. Neben ihm lag die Tragetasche mit dem Geschenk, das er eben für die Hochzeit seiner Schwester Sylvia besorgt hatte, die in einer Woche stattfinden sollte.
Er hörte Sirenen in den Seitenstraßen. Dazu nervös klingende, von Megafonen verstärkte Durchsagen: Bleiben Sie in den Häusern! Verlassen Sie die Straße! Die Kollegen waren gerade dabei, die Gegend weiträumig abzusperren.
In der Mariahilfer Straße selbst herrschte angespannte Stille, immer wieder von Schüssen unterbrochen, die ein Amokläufer in alle Richtungen abfeuerte. Das Geräusch erinnerte an Peitschenhiebe und schmerzte in den Ohren. Jemand schrie. Eine Frau ächzte.
Brand wusste, dass er eingreifen musste. Er wusste auch, dass er sich damit über sämtliche Dienstvorschriften hinwegsetzte, nach denen er als Mitglied des österreichischen Einsatzkommandos Cobra zu handeln hatte. Doch es war die Lösung mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit. Zugegeben, auch die mit dem höchsten Risiko. Aber es gab keine andere Option. Außerdem hatte er Feierabend. Und in seiner Freizeit konnte er tun, was er wollte.
Ein Beamter ist immer im Dienst.
Brand verzog den Mund, als ihm die Worte seines Ausbilders in den Sinn kamen. Ein Polizeibeamter, ein Elite-Polizist wie er, hatte Vorbild zu sein. Und moderne Vorbilder hielten sich an Regeln.
Regeln retten keinen hier.
Er machte sich bereit. Er wusste, dass der Mann, der hier in der Fußgängerzone auf Höhe der Zollergasse Angst und Schrecken verbreitete, mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Und er wusste, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit des Kerls auch im gegenteiligen Fall unter fünfzig Prozent lag. Entweder erschoss er sich am Ende selbst, oder ein anderer tat ihm den Gefallen. Aber einen Wahnsinnigen mit gezielten Schüssen auszuschalten, war schwerer, als es in der Grundausbildung der österreichischen Polizei aussah. Wenn, dann musste man es so machen, dass der andere garantiert nicht mehr aufstand. Und die Skrupellosigkeit, die man brauchte, um auf den Kopf eines Menschen zu zielen und abzudrücken, besaßen Streifenpolizisten bestimmt nicht.
Brand rannte los, gut zehn Meter, ohne ein Geräusch zu machen, und ließ sich hinter den nächsten großen Blumentrog aus Beton fallen, bevor der andere auch nur die geringste Chance hatte, ihn zu bemerken.
Er spähte am Blumentrog vorbei. Der Amokläufer war schwer bewaffnet: zwei Pistolen, eine Automatikwaffe und jede Menge Magazine. Dazu trug er schusssichere Kleidung an Oberkörper und Beinen sowie einen gepanzerten Helm. Er sah aus, als wäre er auf direktem Weg in den Krieg.
Bestimmt stand er unter Drogen. Brand tippte auf Methamphetamin. Crystal Meth. Das war das Zeug, das Menschen dazu bringen konnte, sich die eigenen Genitalien abzuschneiden, weil sie sie im Rausch für Fremdkörper hielten. Oder – was zum Glück viel öfter vorkam und sozial weitaus verträglicher war – drei Tage und Nächte lang durchzuvögeln. Unter Meth konnte ein Mensch zum Pitbull werden, der im Blutrausch so lange kämpfte, bis gar nichts mehr ging. Eine Kugel würde ihn nicht aufhalten können, es sei denn, sie drang ihm direkt in den Schädel und verquirlte sein Gehirn. Und genau deshalb war die Situation so gefährlich. Es war nur natürlich, dass die Kollegen diesem Pitbull hier lieber in die Beine schossen als in den Kopf. So natürlich wie tödlich.
Vier Menschen lagen im Umkreis von geschätzt dreißig Metern am Boden. Der Mann im Anzug war tot. Eine Kugel hatte seine Halsschlagader erwischt. Ein Taxifahrer hing halb im Gurt seines Mercedes-SUV. Auch er war tödlich verwundet. Der Motor lief, die Fahrertür stand offen, die Füße des Toten hingen raus. Ob er vergessen hatte, sich abzuschnallen, bevor er die Flucht antrat, war schwer zu sagen. So oder so musste der Mann wahnsinniges Pech gehabt haben. Wie alle hier. Falsche Zeit, falscher Ort. Die beiden anderen Opfer – eine Frau mit Stock und eine weitere, wesentlich jüngere, die mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, das jetzt unter ihr lag – waren vielleicht noch zu retten. Brand sah, dass sie atmeten. Aber sie brauchten Hilfe, und zwar so schnell es ging.
Brand war unbewaffnet und würde es auch bleiben. Bis er den Kollegen erklärt hätte, wer er war und was er vorhatte, wäre es vielleicht zu spät. Außerdem würde keiner von ihnen so leichtsinnig sein, ihm seine Glock auszuhändigen. Die eigene Waffe lieh man niemandem.
Brand hörte neue Einsatzwagen kommen. Das Blaulichtmeer, das gegen die Häuserwände der Seitenstraßen brandete, wurde greller. Nichts deutete auf ein schnelles Ende hin. Vielmehr war das hier erst der Anfang. Garantiert warteten alle in sicherem Abstand auf das Eintreffen der Kollegen von der Cobra. Schließlich waren sie für kritische Situationen wie diese ausgebildet und ausgerüstet. Aber selbst unter besten Verhältnissen brauchte die Bereitschaft noch mindestens fünf Minuten. Fünf Minuten zu viel. Und dann musste zuerst ein Überblick gewonnen, der Einsatz abgewogen und koordiniert werden …
Brand hatte diesen Überblick bereits. Und abzuwägen und zu koordinieren hatte er bloß mit sich selbst. Eine Win-win-Situation für alle, ihn vielleicht ausgenommen. Das klang doch rational.
Als sich der Amokläufer umdrehte und mit ausgestreckter Schusshand auf ihn zukam, duckte sich Brand schnell hinter den Blumentrog. Er hörte Schüsse. Kugeln schlugen in Häusermauern ein oder trafen auf Glas. Worauf der Dummkopf gerade zielte, konnte sich Brand nicht erklären. Vielleicht halluzinierte er? Egal. Bestimmt würde er gleich wieder abbiegen und auf ein anderes Ziel zusteuern. Er bewegte sich wie einer dieser Staubsauger-Roboter, die nach dem Zufallsprinzip arbeiteten. War unberechenbar. Irrational. Und genau das war seine Schwäche. Früher oder später lief dieser Roboter in sein Verderben.
Brand wartete fünf Sekunden, dann spähte er wieder über seine Deckung. Wie erwartet, bewegte sich der Attentäter von ihm fort.
Jetzt!, sagte er sich, stand auf und lief die letzten Meter zum Taxi, so schnell und so leise er konnte. Er beugte sich über den toten Fahrer hinweg ins Fahrzeuginnere des Geländewagens, löste den Gurt und zog den Mann heraus. Nur einen Moment später saß er hinterm Steuer und stellte den Wählhebel der Automatik auf Drive.
Der Amokläufer bewegte sich immer noch von Brand weg. Jetzt zielte er auf einen Mann, der sich viel zu auffällig hinter einer Litfaßsäule versteckte. Gleich gab es hier Opfer Nummer fünf.
Jetzt oder nie.
Brand drückte das Gaspedal durch. Der Mercedes beschleunigte. Brand überfuhr den Anzugträger mit der zerfetzten Halsschlagader, der das Pech hatte, genau zwischen dem Wagen und dem Ende dieses Amoklaufs zu liegen. Ein kurzer Hopser, mehr nicht.
Er hätte es bestimmt verstanden.
Viel zu spät bemerkte der Attentäter, dass etwas auf ihn zukam. Er drehte sich um. Legte an und zielte.
Brand duckte sich nicht. Er nahm bloß die Hände vom Lenkrad, um sie vor der Explosion des Airbags zu schützen.
Einen Augenblick darauf erfasste der Geländewagen den Amokläufer und zermalmte ihn an der Litfaßsäule.
Als Christian Brand gegen einundzwanzig Uhr in seiner Wohnung in der Neubaugasse ankam, hatte seine Mutter schon dreimal angerufen. Er wusste, dass sie Angst bekam, wenn sie zu lange nichts von ihm hörte. Beim letzten Besuch in Hallstatt hatte sie – seine Mutter! – ihm eines dieser modernen Handys schenken wollen, damit er sich bei WhatsApp registrieren und ihr texten konnte, wenn er nicht zum Telefonieren kam. Brand hatte Gänsehaut bei der Vorstellung. Nicht, weil er ihr keine elektronischen Nachrichten hätte schreiben wollen, aber wenn er sich die Zombies seiner Generation ansah, die mehr in ihren Smartphones steckten als sonst wo, wusste er, dass er sich dagegen wehren würde, solange es ging. Wenn etwas mitzuteilen war, ging das bestimmt auch über sein altes Nokia.
Brand beschloss, später zurückzurufen, und atmete tief durch. Im Dachgeschoss staute sich die Hitze. Lüften war längst aussichtslos geworden. Auf dem Weg ins Badezimmer zog er sich aus, stellte sich unter die Dusche, stellte den Mischhebel auf ganz kalt, doch das Wasser lief nur lauwarm an ihm hinab. Gar nichts wurde mehr kalt bei dieser Hitzewelle.
Er hatte Nackenschmerzen, aber nicht stark genug für ein Schmerzmittel. Den medizinischen Check nach dem Einsatz hatte er abgelehnt. Er wollte schnellstmöglich nach Hause, doch die Kollegen vom Landeskriminalamt hatten noch tausend Fragen gehabt. Ob er sich ausweisen könne, war noch die harmloseste gewesen. Ob er den Mann absichtlich umgefahren habe, die dümmste. Oberst Hinteregger, sein Vorgesetzter, hatte den Spuk dann beendet – besser gesagt: auf den nächsten Tag verschoben.
Brand stieg aus der Dusche und blieb nass im Bad stehen. Er spürte die Verdunstungskälte auf der Haut. Sonst nichts. Dabei sollte, nein: musste ein Mensch in seiner Situation doch etwas empfinden. Aber es war, als löschten sich die Genugtuung über den gestoppten Amokläufer und der Ärger über das eingegangene Risiko gegenseitig aus. Sein Verhalten würde ein Nachspiel haben. Nicht nur im Dienst, auch in seinem Kopf. Ganz besonders in seinen Träumen. Das war ihm schon klar gewesen, bevor er den Plan mit dem Taxi gefasst hatte.
Schneller als erhofft, war das Wasser verdunstet und die Hitze in seinen Körper zurückgekehrt. Er zog die Boxershorts an, in denen er üblicherweise schlief. Jedes weitere Kleidungsstück wäre eines zu viel gewesen. Im Restlicht der Dämmerung ging er ins Wohnzimmer, das er zu seinem Atelier umfunktioniert hatte. Mehrere Leinwände lagen auf dem Boden oder standen irgendwo angelehnt, Farbtuben, Kohlestifte und eingetrocknete Pinsel waren überall verstreut. Eine halb volle Flasche Jack Daniels stand neben einem benutzten Glas auf dem Couchtisch. Er goss sich etwas Whiskey ein und trank. Dann rief er zu Hause an.
»Mein Gott, Chris, ich hab mir solche Sorgen gemacht! Wo warst du?«, rief seine Mutter aufgeregt.
»Hallo, Mum … ich hatte noch zu tun.«
»Du klingst komisch. Was ist passiert?«
Er schluckte. Wieso merkte sie es immer? »Nein, alles gut.«
»Was war denn los? Was hast du gemacht?«
Die Fragerei nervte ihn. »Ich hab das Hochzeitsgeschenk für Sylvia besorgt.«
Sie atmete schwer. »Chris, hast du denn noch gar nichts von dem Attentäter in der Mariahilfer Straße gehört? In den Nachrichten haben sie vermummte Cobra-Beamte gezeigt. Warst du etwa einer davon?«
»Ach so, das. Nein, das war nach meiner Schicht. Aber jetzt ist es ja eh vorbei.«
»Weil so ein Taxifahrer ihn mit seinem Auto zerquetscht hat. Sie sagen, er sei ein Held.«
»Hm.« Brand nahm einen weiteren Schluck. Der Alkohol brannte in seiner Kehle. Meistens brauchte er den Whiskey nur nach üppigem Essen. Heute würde er ihm helfen müssen, die Bilder in seinem Kopf zu verdauen.
Er hatte das Richtige getan. Manchmal war das Richtige in den Augen der anderen falsch. Brand musste unbedingt verhindern, dass Mum von seiner Aktion erfuhr. Er hatte ihr auch von den anderen Toten nichts erzählt.
»Wie geht’s Sylvia?«, fragte er, um sie abzulenken, und dachte an die Tragetasche mit dem Geschenk, die er nach dem Einsatz nicht mehr hatte finden können. Irgendwer musste sie mitgenommen haben.
»Sie ist aufgeregt. Stell dir vor, die Musikkapelle rückt aus, extra für sie. Ist das nicht großartig?«
»Hm«, machte er wieder. Es war ja wirklich schön, dass seine Schwester ihr Glück gefunden hatte, aber meistens führte das Thema schnell zu ihm und seinem eigenen Beziehungsstatus oder gar zu Enkelkindern, und das gefiel ihm gar nicht.
»Wann kommst du?«
Er war sich sicher, dass er ihr das bereits gesagt hatte, doch bestimmt schwirrte ihr der Kopf vor lauter Hochzeitsvorbereitungen. »Übermorgen, gleich mit dem ersten Zug. Kannst du mich vom Bahnhof abholen?«
»Ruf an, wenn du Verspätung hast.«
»Klar.«
»Ach, warte, das weißt du ja noch gar nicht, hör zu …«
Sie erzählte ihm von seiner Cousine, die ein ziemliches Früchtchen war und angeblich irgendwas Verrücktes für die Hochzeitsfeier plante, was man ihr unbedingt ausreden musste. Brands Gedanken drifteten ab. Vor seinen Augen waren da noch die Betonsäule, der erschlaffte Airbag …
Die zerquetschte Leiche.
Wurde man von einem tonnenschweren SUV an eine Litfaßsäule genagelt, nützte einem der beste Kampfanzug nichts mehr. Lebenswichtige Körperteile wurden auf einen Bruchteil dessen komprimiert, was noch als zu retten eingestuft wurde. »Polytrauma« lautete der sterile medizinische Fachausdruck, der dem Anblick des Toten nicht im Mindesten gerecht wurde. Die neuen Bilder im Kopf gesellten sich zu den alten. Zu Wasserleichen, Bahntoten, halb verwesten Alten und Selbstmördern, die sich das Gehirn rausgeschossen hatten. Brand wusste, dass er sich allen Sinneseindrücken stellen musste. Ekel und Abscheu durften seine Einsatzfähigkeit nicht beeinflussen. Dass ihn die Toten manchmal in seinen Träumen heimsuchten, musste keiner wissen. Auch dass es nach einem Tag wie heute unmöglich war, ohne Alkohol und seine Malerei erholsamen Schlaf zu finden, ging niemanden etwas an.
Brand schloss die Augen und sah den Amokläufer wieder vor sich. Sein Kopf war in Ordnung, der Gesichtsausdruck fast friedlich, aber von der Brust abwärts war da nur noch dieser Brei aus Knochen, Blut, Fleisch und Innereien.
»Wie findest du das?«
Er schreckte auf. Was hatte sie gesagt? »Äh … ich find’s gut!«, versuchte er sein Glück.
»Du findest es gut? Chris, hast du Fieber?«
»Mum, hör zu, ich bin total erledigt.«
»Du hast mir nicht zugehört«, empörte sie sich.
»Tut mir leid. Ich komme übermorgen für zwei Tage nach Hause, und dann reden wir. Gut?«
Wenige Momente später hüllte Brand wieder die Stille seiner Wohnung ein. Er legte das Handy weg, ließ sich auf die Couch fallen und starrte an die dunkle Zimmerdecke.
Seine Mutter meinte es nicht böse, aber sie nervte. Brand wusste, dass es ihr sehnlichster Wunsch war, ihren Sohn als Dorfpolizist in den engen Gassen seines Heimatorts Hallstatt zu sehen, wo er dafür sorgte, dass sich die Horden chinesischer Touristen nicht gegenseitig auf die Füße stiegen. Wenn er dann noch eine Einheimische heiratete und viele Kinder bekam, war er fertig, ihr Traum von seinem Leben. Für ihn dagegen war es keine Option, als einfacher Polizist am Hallstätter See zu arbeiten, tage-, wochen-, monate-, nein jahrelang immer das Gleiche zu erleben, bis sein Körper irgendwann in der Hallstätter Erde verrottete. Brand war glücklich in Wien. Er hatte Freunde hier, hin und wieder eine Kurzzeitfreundin, aber die Richtige war bisher nicht dabei gewesen. Was machte das schon? Er war neunundzwanzig. Kein Grund für irgendwen, in Panik zu geraten.
Er stand auf und suchte eine leere Leinwand, fand aber keine. Also musste ein Bild herhalten, das er ohnehin nicht leiden konnte, von damals, als er sich als Landschaftsmaler versucht hatte, um diese Kiki zu beeindrucken. Ein Motiv aus dem Nationalpark Donau-Auen. Grün in Grün, harmonisch, hoffnungsvoll, beruhigend. Schrecklich. Kiki hatte es gemocht. Doch bevor er es ihr hätte schenken können, hatte sie ihn abserviert. Ein Grund mehr, es aus der Welt zu schaffen.
Er nahm eine Farbwalze und öffnete eine Dose Schwarz. Schwarz war die richtige Grundierung für das Motiv, das er aus seinem Kopf bringen musste. Mit schnellen Bewegungen rollte er die Walze über die Donau-Auen. Es fühlte sich gut an.
3Hamburg, 22.55 Uhr
Mavie Nauenstein, Schülerin
Mavie hatte sich entschieden. Sie würde es tun.
Sie setzte sich auf den Fenstersims in ihrem Zimmer, winkelte die Beine an, duckte sich unter dem Fenstersturz durch und streckte die Beine in den Abgrund. Dann drehte sie sich um und tastete mit den Füßen nach einem Halt, während sie sich mit einer Hand an den Fenstersims klammerte. In der anderen hielt sie das Geschenk. Ihr rechter Fuß fand die Strebe des Blitzableiters.
Geschickt griff sie in die Dunkelheit, packte die Metallleitung und kletterte Strebe für Strebe abwärts, bis sie das kleine Vordach erreichte. Dort ging sie in die Knie und tastete nach dem Fallrohr, das von der Regenrinne senkrecht in die Tiefe führte. Mavie warf das Päckchen ins weiche Gras, umfasste das Rohr mit beiden Händen, ließ sich daran zwei Meter nach unten rutschen und sprang. Fast lautlos landete sie auf dem weichen Rasen vor der Nauenstein’schen Villa am Harvestehuder Weg und kauerte sich hin.
Das kann keiner bemerkt haben.
Sie war im blinden Bereich der Überwachungskameras, leiser als jeder Einbrecher. Sie hatte das schon oft so gemacht. Aber noch nie um diese Uhrzeit.
Das Geschenk war unversehrt geblieben. Mavie hob es auf, schlich in die Deckung der Büsche, die die Einfahrt säumten, und wartete wieder. Wenn Vater sie jetzt erwischte, würde die Strafe vielleicht nicht ganz so hart ausfallen. Sie konnte sich immer noch eine Ausrede einfallen lassen. Zum Beispiel, dass ihr etwas aus dem Fenster gefallen war und sie es schnell wiederholen wollte, ohne Lärm zu machen.
Sie dachte nach. Nein, das nützt gar nichts.
Er hatte ihr ausdrücklich verboten, jemals wieder die Fassade hinabzuklettern. Es reichte schon viel weniger, manchmal gar nichts, damit er seinen Spazierstock holte. Vergangene Woche erst hatte sie beim Abspülen Mist gebaut. Sie hatte eine seiner Lieblingstassen zerbrochen, und er hatte sie dafür geschlagen. Er meine es nur gut, hatte er behauptet. Wie so oft. Aber wenn er sie jetzt beim Ausbüxen erwischte, würde es richtig wehtun. Vielleicht so wie vergangenes Jahr, nach ihrem Weinkrampf, weil sich ihre Eltern auf der Rückfahrt aus Italien so böse gestritten hatten, dass sogar das Wort »Scheidung« gefallen war. Mavie war derart verzweifelt gewesen, dass sie nicht mehr aufhören konnte zu weinen. An einer Tankstelle in Südtirol war eine Polizeistreife auf ihr Schluchzen aufmerksam geworden und hatte sich von Vater die Ausweispapiere zeigen lassen. Weder er noch Mutter hatten bis Hamburg ein einziges Wort mit ihr gesprochen. Als sie zu Hause angekommen waren, hatte sie solche Prügel bekommen, dass sie drei Tage lang nicht mehr …
Nicht daran denken.
Aber sie wollte, nein, sie musste das Risiko eingehen. Heute musste sie tun, was sie für richtig hielt. Egal, was morgen kam.
Sie hatte Schmetterlinge im Bauch.
Sie dachte an Silas, an sein süßes Lächeln, das Kinngrübchen, den selbstsicheren Gang. Und daran, wie er sie vor zwei Wochen zur Geburtstagsparty in seiner Wohnung eingeladen hatte. Einfach so. Sie, die noch auf keiner einzigen richtigen Party gewesen war.
Er mag mich.
Seit der Einladung trug sie ein Gefühl in sich, das jedes andere überstrahlte, das größer war als jede Konsequenz. Ja, er mochte sie. Ganz bestimmt. Und selbst wenn andere sie deshalb für dumm halten würden, wusste sie: Diese Party war ihre große Chance.
Mavie hatte zwei Mitschülerinnen dabei belauscht, wie sie sich über Silas unterhalten hatten. Er lebe bei seiner Mutter, in einer riesigen Wohnung am Rübenkamp, und sei abends oft allein. Sein Vater sei abgehauen, und deshalb müsse seine Mutter die Brötchen nachts auf Pauli verdienen. Mavie konnte nur hoffen, dass es nicht das war, wonach es im ersten Moment klang.
Silas war schon achtzehn und somit der Klassenälteste. Er war einmal sitzen geblieben und seit zwei Jahren in ihrer Klasse. Sein Leben hörte sich unglaublich aufregend an, und der Gedanke, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, von ihm beschützt zu werden, war so verwegen, dass sie ihn kaum zu denken wagte.
Ich brauche ihn.
Er würde ihr aus ihrem bisherigen Leben heraushelfen, das so wenig Freude und so viel Schmerz brachte. Sie malte sich aus, wie es an seiner Seite sein würde. Sogar an eine gemeinsame Familie hatte sie schon gedacht, irgendwann in ferner Zukunft. Er würde ihr nicht wehtun. Ihr nicht und Kindern schon gar nicht.
Sie hatte das Geschenk für ihn mit dem Geld gekauft, das sie sich nicht bloß sprichwörtlich vom Mund abgespart hatte. Ganze zehn Tage lang hatte sie in der Schule aufs Mittagessen verzichtet. Das hatte ihr fünfzig Euro verschafft, von denen ihre Eltern nichts wussten. Sie hatte Silas’ Geschenk in ihr Zimmer geschmuggelt und das Geschenkpapier heimlich aus Mutters Sachen genommen, hatte das Papier so gerade wie möglich vom Bogen abgeschnitten, damit sie nicht merkte, dass etwas fehlte. All das war sehr aufregend gewesen. Aufregend und gefährlich zugleich. Denn Mutter hasste es, wenn man in ihren Sachen stöberte.
Mavie fühlte, dass es richtig war. Es war, als hätte Silas’ Einladung eine kleine Flamme in ihrem Inneren entfacht. Sie ahnte, dass daraus ein Feuer werden konnte. Und sie würde es zulassen.
Zuerst aber musste sie zur Party kommen. Zum Rübenkamp brauchte man zu Fuß über eine Stunde. Dann wäre alles vielleicht schon vorbei. Also hatte sie sich eine viel bessere Möglichkeit ausgedacht.
Sie verharrte in der Deckung der Büsche und konzentrierte sich ganz auf ihre Sinne. Über ihr leuchtete der Vollmond. Sanfter Wind strich um ihren Körper, immer noch warm, obwohl es schon nach elf war. So lange hatte sie warten müssen, bis sie sicher sein konnte, dass ihre Eltern schliefen und kein weiteres Mal nachschauen kamen, ob es ihrer Tochter auch gut ging. Sie machten sich solche Sorgen um sie. Immer schon.
Irgendwann sprang sie auf und lief zum Einfahrtstor. Sie konnte nicht einfach hindurchspazieren, weil hier eine Kamera hing, aber an der Seite ging es. Mit ihrem Talent fürs Klettern fiel es ihr leicht, auf die Mauer zu gelangen und sich an einem Verkehrsschild auf die Straße hinabgleiten zu lassen.
Bei den Nachbarn war alles dunkel. Nicht, dass die von Nauensteins mit ihrer Nachbarschaft verkehrt hätten. Aber wenn jemand sie hier draußen sah, rief er vielleicht die Polizei, und der Effekt wäre derselbe, als würde er sie direkt bei Vater verpetzen.
Sie ging los. Die ersten zehn Meter noch auf Zehenspitzen, bald aber mit jedem Schritt selbstsicherer, bis sie anfing zu laufen, und als sie endgültig außer Hörweite der Nachbarschaft war, schon an der Hochschule für Musik und Theater vorbei, musste sie lachen, laut lachen. Sie rannte schneller, fühlte den warmen Wind im Gesicht und erreichte die Baustelle, an deren Zaun sie ihr Geheimfahrrad festgemacht hatte. Niemand durfte wissen, dass es ihr gehörte. Und niemand konnte es wissen. Sie hatte es gefunden und sich von den zwanzig Euro, die nach dem Kauf von Silas’ Geschenk übrig waren, nicht nur ein Zahlenschloss, sondern auch zerrissene Hotpants und ein schwarzes, enges Spaghettiträger-Top besorgt. Die Klamotten hatte sie anschließend in einer unscheinbaren Plastiktüte beim Fahrrad versteckt. Jetzt zog sie die Sachen heraus, streifte ihre Jogginghose ab und schlüpfte in die Pants. Ihre nackten Beine glänzten im Mondlicht. Dann kam das Top dran. Es war wirklich knapp, verdeckte aber gerade noch die Brandnarbe an ihrem Rücken. Mavie sah stolz an sich hinab. Sie war schlank, ihr Körper wohlproportioniert. In diesem Aufzug, den Vater und Mutter niemals toleriert hätten, würde sie auf der Party garantiert der Hingucker sein. Schon das Anprobieren der Sachen in einer KiK-Filiale in der Baumeisterstraße war ein besonderes Erlebnis gewesen. Als hätte ihr dort aus dem Spiegel ein ganz anderer Mensch entgegengeblickt. Ein Mädchen, das selbst entscheiden konnte, was es wollte. Ein Mädchen, das eine Zukunft hatte.
Der Gedanke, so viele Geheimnisse vor ihren Eltern zu haben, war prickelnd, geradezu erregend. Aber an diesem Abend würde sie, nein: musste sie noch viel weiter gehen.
Sie sprang aufs Rad und trat in die Pedale. Schnell war sie an der großen Hundewiese vorbei. Ihre langen braunen Haare, die sie am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, strichen über ihre Schultern. Rechts von ihr glitzerte die Außenalster. Mavie schaltete in den nächsthöheren Gang. Ein einzelner Fußgänger war auf dem Gehweg unterwegs, aber der hatte nur Augen für seinen Hund. So oder so hätte sie niemand in diesem Aufzug erkannt. An der ägyptischen Botschaft ging es scharf rechts vorbei, über die Alster und gleich links in eine Fahrradstraße hinein.
Mavie kannte die Strecke genau. Das hier war ihr täglicher Schulweg, den sie so oft wie möglich mit dem Fahrrad nahm. Ihrem offiziellen Fahrrad, das jetzt zu Hause in der Garage stand. Mit dem hier war es ungleich schwerer, voranzukommen. Das Hinterrad lief nicht mehr rund, die Kette schleifte, dazu sprang immer wieder der Gang um. Trotzdem war es toll. Vielleicht, weil der schäbige Drahtesel das Erste war, über das sie – und nur sie – bestimmen konnte, wie sie wollte. Sie liebte das Gefühl.
Genau wie sie es liebte, verbotene Sachen zu tun. Schon immer. Egal, wie sehr Vater und Mutter sie bestraften – da war etwas tief in ihr, das sie antrieb, Grenzen zu überschreiten. Fast konnte sie ihre Eltern verstehen, wenn sie langsam an ihr verzweifelten. Aber Mavie konnte nicht anders.
Weil der Teufel in mir steckt.
Zumindest behauptete das ihre Mutter, wenn sie sich gar nicht mehr zu helfen wusste. Aber das war Unsinn. Mavie war überzeugt, dass es den Teufel gar nicht gab. Jedenfalls nicht als gehörntes Wesen mit Bocksfuß, der in einen fahren und dazu verleiten konnte, Böses zu tun, wie Mutter ihr weismachen wollte. Der Teufel – das waren die schlimmen Sachen, die die Menschen anstellten, für die sie ganz allein verantwortlich waren, und nicht irgendein geheimnisvolles Wesen.
Mavie hatte es immer schon schwer gefunden, Mutters Gedanken nachzuvollziehen. Streng genommen glaubte sie nicht einmal an die Kirche, die sie so oft besuchen musste, weil Mutter es wollte. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass auch Vater nicht freiwillig hinging. Aus seinem Mund hörte sie nie etwas, das mit Religiosität zu tun gehabt hätte. Im Gegenteil. Manchmal, wenn Mutter nicht in der Nähe war, konnte er fluchen wie ein Kutscher. Dann fühlte Mavie sich ihm so viel näher als sonst.
»Hey!«, schrie jemand, der ohne zu gucken auf die Straße getreten war. Mavie bremste nicht. Stattdessen wich sie gekonnt aus und strampelte einfach weiter. Der Mann gab ihr noch ein paar Freundlichkeiten mit, aber sie war längst um die nächste Ecke gebogen, schon in der Maria-Louisen-Straße.
Sie überfuhr eine rote Ampel und stellte sich vor, wie es sein würde, in Silas’ Wohnung zu kommen. Wie es dort wohl aussah? Und was würde er zu ihrem Geschenk sagen? Sie hatte sich so viel Mühe gegeben, etwas für ihn zu finden, aber plötzlich fürchtete sie, dass es für einen Achtzehnjährigen zu albern sein könnte. Ob er es vor den anderen Gästen auspackte? Und dann? Würden sie sie auslachen?
Sie wurde oft ausgelacht. Besonders wegen der Kleidung, die sie tragen musste. Oder wegen ihres adeligen Namens – sie hieß offiziell Mavie von Nauenstein –, was sie ja selbst lächerlich fand und was am Johanneum völlig deplatziert war. Vor drei Jahren hatte Vater sie in diese Schule gesteckt. Weil sie nicht folgen wolle, hatte er behauptet. Aber Mavie wusste, dass sich ihr Vater das Geld für die private Brecht-Schule nicht mehr leisten konnte. Sie hatte ein Telefonat mit seinem Bankberater belauscht, als er seine Kreditraten aufschieben wollte. Danach hatte Vater geweint. Sie war zu ihm gegangen, um ihn zu trösten, was ordentlich nach hinten losgegangen war, denn in dem Augenblick, als sie ihm die Hand auf die Schulter gelegt hatte, war seine Traurigkeit in Wut umgeschlagen.
Die Erinnerung an ihre Außenseiterrolle am Johanneum versetzte ihr einen Stich. Auch der Gedanke, die Party könne nur ein Trick sein, um sie vorzuführen, ließ sich nun nicht länger verdrängen. Sollte sie wirklich hingehen? Am Ende warteten alle nur auf das Eintreffen der dummen Pute und lachten sie aus. Oder die Party fand gar nicht statt und sie stand vor verschlossenen Türen. Dabei wollte sie Silas vertrauen. So sehr.
Zu sehr?
Ihre Tritte verloren an Kraft. Jetzt merkte sie, dass sie schwitzte. Würde man es riechen? Daran hatte sie überhaupt nicht gedacht. Bestimmt würden sich alle die Nase zuhalten, wenn sie Silas’ Wohnung betrat.
Sie überlegte, umzudrehen, und verbot es sich einen Moment später. Aber die Zweifel hatten sich längst festgesetzt.
Bei der Schule hielt sie an. Sie hätte sich ohrfeigen können. Da war sie nun, viel zu knapp bekleidet, und schwitzte wie blöd. Etwas nördlich der Schule, direkt vor ihr, lag der Stadtpark, den sie zwar schon oft besucht hatte, aber noch nie alleine und schon gar nicht bei Nacht.
Ziemlich unheimlich im Dunkeln.
Tränen stiegen ihr in die Augen. Jetzt fang bloß nicht an zu heulen, schalt sie sich innerlich, doch schon spürte sie, wie ihre Wangen nass wurden. Sie war froh, nicht geschminkt zu sein, denn dann hätte sie beim Eintreffen am Rübenkamp noch schlimmer ausgesehen. Wenn sie denn jemals dort ankommen würde. Der Gedanke ans Umdrehen war jetzt mindestens genauso verlockend wie der, auf Silas’ Party zu gehen.
Ich fahre zurück, beschloss sie.
Im selben Moment hörte sie eine Männerstimme. »Hallo?«
Mavie drehte den Kopf zur Seite. Da stand ein Polizeiauto. Sie hatte es gar nicht kommen hören.
»Geht’s Ihnen gut?«, fragte der Beamte auf dem Beifahrersitz.
Als sie vor Schreck nicht gleich aus ihrer Starre fand, öffnete er die Tür und stieg aus.
Mavie konnte nur eines denken.
Vater schlägt mich tot.
4Stuttgart, 23.01 Uhr
Werner Krakauer, Journalist
Krakauer saß an seinem PC. Er wusste instinktiv, dass er es gefunden hatte. Das Puzzlestück, das ihm verriet, dass es dieses Puzzle tatsächlich gab.
Während er den Artikel las, spürte er, wie er zu zittern begann.
– Südtirol Online News –
Mann ohne Arme irrte durch Waldstück
Bozen. Es müssen grauenhafte Szenen gewesen sein, die sich Samstag früh im Bergdorf Kohlern oberhalb von Bozen zugetragen haben. Ein Pärchen, das in den Wäldern kampiert hatte, wurde gegen sechs Uhr früh von Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Laut Richard R. (22) dachten er und seine Begleiterin zunächst an ein verwundetes Tier. Sie beschlossen nachzusehen und stießen nach kurzer Suche auf einen geknebelten Mann, der vor ihren Augen zusammenbrach. Es handelt sich um den ortsansässigen Schmied Peter G. (30), dem beide Arme fehlten. Was genau sich zugetragen hat, ist noch völlig unklar. Der Schwerstverletzte wurde im Zentralkrankenhaus Bozen sofort in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die behandelnde Ärztin spricht von großem Glück, dass das Pärchen augenblicklich die Rettungskette in Gang gesetzt und Erste Hilfe geleistet habe. »Dennoch schwebt der Patient in Lebensgefahr«, sagte Dottoressa Elisa Bertagnolli in einer ersten Stellungnahme. Die Polizei habe die abgetrennten Arme zwar finden können, aufgrund des kritischen Zustands des Verletzten sei es aber nicht möglich gewesen, diese wieder anzunähen. Wie der Patient eine derart schwere Verletzung überleben und wie es überhaupt dazu kommen konnte, bleibt rätselhaft. Die Staatspolizei der Quästur Bozen geht von einem Verbrechen aus. Konkretere Ergebnisse werde es aber frühestens im Laufe der nächsten Woche geben.
Krakauer hatte den Beweis, den er brauchte. Es gab kein Zurück mehr. Er würde es tun. Er musste sich fast zwingen, nichts zu überstürzen und systematisch zu arbeiten, einen Schritt nach dem anderen zu machen, genau wie er es sich vorgenommen hatte.
Bevor er ins Darknet einstieg, ergriff er die üblichen Sicherheitsmaßnahmen. Die waren keine Hexerei, auch für jemanden wie ihn nicht, der noch ohne Computer aufgewachsen war. Wenige Mausklicks später konnte ihm niemand mehr nachweisen, was er im anonymen Teil des Internets anstellte. Trotzdem bedeutete das, was er vorhatte, ein enormes Risiko.
Risiko.
Er schnaubte. Das ganze Leben war ein Risiko. Seit seiner Lungenkrebs-Diagnose – seit er wusste, dass ihm trotz Operation und anschließender Chemotherapie nur noch wenige Monate zu leben blieben – war alles anders. Früher hätte er sich das, was er da gerade tat, niemals getraut. Aber jetzt, da ihm die Lebenszeit wie Sand durch die Finger rann, war es höchste Zeit, etwas zu schaffen, was ihn überdauerte. Er wollte sich mit einem Paukenschlag von dieser Welt verabschieden. Vielleicht würde man ihm posthum einen Preis verleihen. In jedem Fall würde er für riesiges Aufsehen sorgen und seinem Arbeitgeber, dem Stuttgarter Blatt, neuen Schwung geben. Egal, wie verbockt sein Leben war, er würde als grandioser Enthüllungsreporter in Erinnerung bleiben und nachfolgenden Journalistengenerationen ein Vorbild sein.
Er schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben. Im Moment hatte er noch nichts, was er hätte enthüllen können. Sein Finger kreiste über der Computermaus. Nur noch ein Klick – ein Hunderttausend-Euro-Klick –, und er wäre im Spiel. Krakauer schwitzte.
Um das Startgeld fürs »Jagdspiel« aufzutreiben, hatte er seine Wohnung verpfänden müssen und die Bank angelogen. Ein großer Sturm habe das Haus seiner Eltern in Marbella abgedeckt, hatte er seinem Bankberater verklickert. Der hatte ihm geglaubt und auf nähere Informationen verzichtet. Krakauer war schließlich immer ein braver, verlässlicher Kunde gewesen, da musste man nicht unbedingt nachforschen oder lästige Fragen stellen.
Er würde die Kreditraten nicht lange bezahlen können. Aber die Bank hatte ja diese Wohnung als Sicherheit. Die würde natürlich versteigert werden. Anwälte, Notare und das Nachlassgericht würden gut verdienen, den Rest bekäme seine Ex-Frau. Niemand würde durch seinen Tod belastet werden. Im Gegenteil.
Mein Tod ist ein gutes Geschäft.
Krakauer lachte auf und musste unweigerlich husten. Er hielt sich die Hand vor den Mund und sah nicht hin, als er sie auf die Maus zurücklegte. Ziemlich sicher war jetzt Blut daran. Aber das war nicht mehr wichtig.
Das Jagdspiel war wichtig. Es war seine letzte große Chance, als Journalist etwas Großes zu enthüllen. Ursprünglich hatte er für eine andere Geschichte recherchieren wollen, die sich um die vielen illegalen Dinge drehen sollte, die im Darknet eine sichere Heimat gefunden hatten. Drogen- und Waffenhandel waren noch die harmloseren davon. Man konnte genauso einfach Auftragsmörder engagieren oder menschlichem Abschaum dabei zusehen, wie er sich an Kindern verging. Aber damit wollte Krakauer nichts zu tun haben. Er hatte sich auf gewöhnliche Drogen konzentrieren und mittels eines kleinen Spesenbudgets den einen oder anderen Testkauf tätigen wollen, den er natürlich den Behörden übergeben hätte, bevor der Artikel erschien. So weit, so harmlos.
Doch dann war er über verschiedene Foreneinträge auf dieses Jagdspiel gestoßen. Bist du bereit, alle Grenzen zu überschreiten? Ein simpler Satz, der unter einer kryptischen, sechzehnstelligen Web-Adresse mit der Endung .onion zu finden war, zusammen mit einem ebenso kryptischen Zahlungsempfänger, an den ein hoher Geldbetrag zu überweisen war, wenn man das Portal betreten wollte. Normalerweise hätte ihm eine solche Webseite ein müdes Lächeln entlockt. An jeder Ecke der vernetzten Welt lauerten Abzocke und Betrug. Kurz darauf hatte Krakauer über einen Insider erfahren, dass es sich um das heißeste Ding drehen sollte, das es derzeit im Darknet gab. Ein regelrechter Hype, der sich in diversen Foren und sozialen Medien nachverfolgen ließ. Natürlich nicht auf Facebook. Das Darknet hatte sein eigenes Facebook und darüber hinaus noch eine Unzahl an Foren jeder Geschmacksrichtung. Alles geschah unter der Oberfläche und war trotzdem da.
Es hieß, dass auf dem Jagdspiel-Portal ein Wettbewerb stattfand, bei dem es darum ging, Menschen aufzuspüren, die irgendwie als Opfer gebrandmarkt waren. Hatte man sie gefunden, musste man Anweisungen befolgen. Angeblich ging es darum, ihnen Körperteile abzutrennen. Und genau deshalb vermutete Krakauer, dass der Mann ohne Arme, den man in Südtirol gefunden hatte, eines der Opfer war.
Und die Polizei tappt im Dunkeln …
Der Jackpot, den der erfolgreichste Jäger gewinnen konnte, sollte riesig sein. Mehr hatte er auf konventionellem Weg nicht herausfinden können. »Steig doch selber ein, wenn du neugierig bist«, hatte ihn einer der Jäger, den er über ein Forum kontaktiert hatte, auf die Idee gebracht.
Ein weiterer Hustenanfall hielt ihn vom allerletzten Klick ab. Er drehte sich zur Seite und krümmte sich zusammen.
Als sich die Anfälle nicht länger verbergen ließen, hatte er seinen Vorgesetzten gebeten, für einige Zeit von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Wieder hatte er zu einer Notlüge gegriffen, bei der seine Eltern die Hauptrolle spielten. Dieses Mal lebten sie bei ihm um die Ecke, und er musste sie pflegen, was auch bedeutete, dass er nur unregelmäßig arbeiten konnte. Die gesamte Kommunikation mit dem Stuttgarter Blatt lief seither über E-Mail.
Als der Husten nachließ, wandte er sich wieder seinem Schreibtisch zu. Er legte die Hand auf die Maus, drückte auf Senden, und das Geld war fort. Hunderttausend Euro, zuvor an einer Internet-Börse in die Kryptowährung Monero getauscht, damit man die Transaktion nicht zurückverfolgen konnte, gehörten jetzt jemand anderem.
Vielen Dank! Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis die Transaktion bestätigt ist.
Krakauer hatte gehofft, dieses Jagdspiel sofort sehen zu können. Seine Zeit war kostbar – und jetzt war er zum Warten verdammt. Er hörte das Ticken der Wanduhr. Starrte auf das Hintergrundbild seines Monitors. Das Bild einer Familie, die es nicht mehr gab. Franziska, Magdalena und er in Lignano, bei einem ihrer ersten gemeinsamen Urlaube. Eine Sandburg im Vordergrund, dahinter das Meer. Sie machten, was alle jungen Familien an den Stränden der Adria machten: Pizza essen, faulenzen und Sandburgen bauen. Lena strahlte übers ganze Gesicht. Wie hätte er bei diesem Selfie ahnen sollen, dass Franziska und er ihre kleine Tochter schon wenige Monate später beerdigen mussten? Der Unfall war zugleich der Beginn vom Ende ihrer Ehe gewesen. Wie bei so vielen Elternpaaren, die plötzlich ohne ihre Kinder dastanden. Nach der Trauerbewältigung schwieg man sich an, weil die Gesprächsthemen fehlten. Man existierte noch eine Zeit lang still nebeneinander und lebte seinen Alltag, so gut es ging. Dann begann einer von beiden ein neues, außereheliches Leben, und am Ende wurde der verbliebene Rest Gemeinsamkeit wie ein Zigarettenstummel ausgedrückt. Es war, wie es war. Krakauer gab Franziska nicht die geringste Schuld dafür, dass sie als Erste einen Neustart gewagt hatte.
Sein Blick streifte über den Schreibtisch und blieb am Tischkalender hängen. Unter dem aktuellen Wochenblatt leuchteten die rot eingekreisten Buchstaben OP hervor. In fünf Tagen war es so weit. Dann würden sie ihm den linken Lungenflügel entfernen und schnellstmöglich mit der Chemotherapie beginnen, um sein Leben für einige Wochen, vielleicht sogar Monate zu verlängern. Krakauer betrachtete diesen Umstand nüchtern. Fast so, als beträfe er jemand anderen. Er hatte schließlich genügend Zeit gehabt, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Jetzt blieben ihm noch fünf Tage, um den wichtigsten Artikel seines Lebens zu schreiben. Er hatte nichts zu verlieren – er konnte nur gewinnen.
Er stand auf, nahm seine Medikamente, goss die Pflanzen, schaute hinaus. Unten auf der Straße pulsierte das Leben. Nachts, wenn die Temperaturen erträglich wurden, kamen die Menschen hinaus, besonders in die Theodor-Heuss-Straße, auf die er hinuntersah. Krakauer ärgerte sich nicht mehr über die lärmenden Massen, im Gegenteil: Er freute sich über die Illusion, unter Leuten zu sein. Er selbst verließ die eigenen vier Wände nur noch, wenn es gar nicht mehr anders ging. Das wenige Essen, das er noch brauchte, bestellte er über Online-Lieferservices. Hunger hatte er kaum noch. Seit der Diagnose konnte er den Kilos förmlich beim Purzeln zusehen. Er war immer übergewichtig gewesen, weshalb die Sprünge umso größer ausfielen. Letzte Woche alleine drei Kilo. Früher hätte er sich darüber gefreut. Jetzt aber war die Digitalanzeige, die bald nur noch zweistellig sein würde, wie ein Countdown zum Tod, auch wenn er im Moment, verglichen mit einem Durchschnittsmenschen, immer noch ziemlich dick war.
The Final Countdown, dachte Krakauer und verzog den Mund.
Unten lachte eine Gruppe junger Leute und feierte das Leben. Was wohl der Anlass war? Ein Geburtstag? Ein Junggesellenabschied? Oder wurde jemand bald Vater? Obwohl Krakauer nie ein neidischer Mensch gewesen war, wünschte er sich jetzt, einer von denen dort unten sein und sich mit ihnen über Belanglosigkeiten freuen zu können – ausgestattet mit einem Leben, dessen Verfallsdatum sich noch nicht einkreisen ließ.
Er ging zum Schreibtisch zurück und lud die Webseite neu, doch der Stand blieb derselbe wie vorhin. Es waren auch kaum zehn Minuten seit der Überweisung vergangen. Er musste geduldig sein.
Krakauer machte ein Handtuch nass, legte es über seinen Kopf und genoss das Gefühl, wie sich einzelne Wassertropfen lösten und über seinen Nacken den Rücken hinunterrannen. Jede Abkühlung, jeder Schauer und jede Gänsehaut waren willkommen.
Ein Ton signalisierte das Eintreffen einer E-Mail. Krakauer ging zum Schreibtisch zurück, rief das Postfach auf, das er extra für seine Recherchen bei einem Anbieter aus der Schweiz eingerichtet hatte, und las den Betreff.
Weidmannsheil!
Sein Herz stolperte. Ungeduldig klickte er auf die Nachricht.
Lieber Krake! Ihre Startgebühr wurde bestätigt und akzeptiert. Vergessen Sie nicht, die » Spielregeln zu lesen. » Zum Spiel. Halali und Weidmannsheil!
Krake war der erstbeste Benutzername, der Krakauer eingefallen war, als er bei der Registrierung danach gefragt wurde. Nicht besonders originell, aber egal.
Er klickte auf den Link zum Spiel. Nach dem Log-in baute sich der interne Bereich auf seinem Bildschirm auf.
Halali und Weidmannsheil, Krake!
Ihr Jägercode: ZU93PR
Ihre Trophäen: 0
Kurswert des Jackpots: € 648.843
» Opferbereich
» Spielregeln
» Forum
» Persönliche Nachrichten (0)
» Ausloggen
Krakauer klickte gleich auf Opferbereich.
Er sah Fotos von Menschen, Männer wie Frauen, alt wie jung. Zwölf quadratische Bilder. Über manchen lag ein rotes X.
Krakauer klickte auf eines davon. Eine Unterseite erschien.
Er sah neue Fotos.
Und vergaß zu atmen.
5Hamburg, 23.41 Uhr
Mavie Nauenstein
Mavie war da. Verausgabt, aber sie hatte es geschafft. Sie hätte es nie für möglich gehalten, aber sie war den Polizisten tatsächlich entkommen. Dem Stadtpark sei Dank.
Nun stand sie vor einem der Treppenhäuser eines riesigen, vierstöckigen Wohnblocks am Rübenkamp. Zum hundertsten Mal schaute sie sich um, aber da war keine Polizei.
Was jetzt?
Sie war schweißnass und bereute, dieses Wagnis überhaupt eingegangen zu sein. Sie würde dafür büßen. Ihre Eltern würden sie bestrafen. Irgendwie würden sie es herausfinden. Wie schon so oft.
Silas.
Ihre Fingerspitze lag mehrere Sekunden lang auf dem Knopf, neben dem »Dahrendorf« stand. Silas Dahrendorf. Aber sie drückte nicht. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu blamieren, war riesengroß. Sie nahm die Hand weg, ging zwei Meter zurück und schaute die Fassade hinauf. Sie hörte Musik, Menschen unterhielten sich lautstark, lachten und grölten. Die Party fand also wirklich statt. Kein Trick, um sie vorzuführen.
Aber so, wie sie jetzt aussah, konnte sie unmöglich hinaufgehen. Ihre Haare hatten sich aus dem Pferdeschwanz gelöst und fielen ihr schweißnass ins Gesicht, das Spaghetti-Top klebte an ihrem Körper. Bestimmt drückte sich viel zu viel durch. Auch das Geschenk für Silas war in erbärmlichem Zustand. Bei der Hetzerei durch den Stadtpark war es vom Fahrrad gefallen. Als hätte sie nicht schon Angst genug gehabt, hatte sie umkehren und es in der Dunkelheit suchen müssen. Jetzt war die Verpackung zerrissen. Nein, so konnte sie nicht rauf.
Sie wollte gerade kehrtmachen, als sie Schritte hörte. Sie versuchte, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, bückte sich und gab vor, einen Namen auf der großen Klingeltafel zu suchen. Mehrere Leute kamen, blieben direkt hinter ihr stehen, ein Mann steckte den Schlüssel ins Haustürschloss und hielt den anderen die Tür auf.
»Kommst du oder nicht?«, fragte der Mann einen Moment später an ihren Rücken gewandt.
Sie drehte sich um. Er starrte sie an. Und ihren Körper. Dann blickte er den anderen nach, die schon die Stufen hochstiegen.