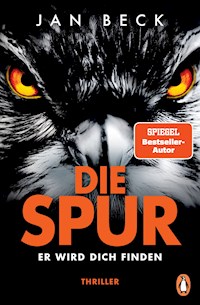9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Björk und Brand Reihe
- Sprache: Deutsch
Der finale Band der SPIEGEL-Bestsellerreihe jetzt im Taschenbuch: Jan Beck fesselt ab der ersten Seite und lässt bis zum atemberaubenden Finale nicht mehr los.
Deine Zeit läuft ab. Und nirgends wirst du sicher sein.
Deine Zeit läuft ab. Und nirgends wirst du sicher sein.
Eine verstörte Frau steht an einer der meistbefahrenen Straßen Kölns. Sie macht einen Schritt in den fließenden Verkehr und ist augenblicklich tot. Zur gleichen Zeit taucht im Internet ein Livestream auf, der einen Mann in seinem Wohnzimmer zeigt. Er ahnt nicht, dass er gefilmt wird. Vor laufender Kamera wird er ermordet, und jeder kann dabei zusehen. Menschen, die scheinbar nichts miteinander verbindet, sterben vor den Augen der Welt. Europols Topermittler Inga Björk und Christian Brand sollen dem grausamen Spektakel ein Ende bereiten. Dabei gibt es nur ein Problem: Die neue Chefetage von Europol, die ihre beiden Star-Ermittler öffentlichkeitswirksam inszenieren will.
Entdecken Sie den ultimativen Nervenkitzel. Eine fulminante Thriller-Reihe, deren Bände sie alle unabhängig voneinander lesen können:
Das Spiel – Es geht um dein Leben. Thriller
Die Nacht – Wirst du morgen noch leben? Thriller
Die Spur – Er wird dich finden Thriller
Das Ende – Dein letzter Tag ist gekommen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bevor Jan Beck sich dem Schreiben widmete, arbeitete er als Jurist. Seine Thriller Das Spiel, Die Nacht und Die Spur – die seine Leser tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken lassen – standen alle auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald.
Außerdem von Jan Beck lieferbar:
Das Spiel. Es geht um dein Leben. Thriller.
Die Nacht. Wirst du morgen noch leben? Thriller.
Die Spur. Er wird dich finden. Thriller.
Jan Beck
DAS ENDE
Dein letzter Tag ist gekommen
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Covergestaltung: bürosüd
Covermotiv: www.buerosued.de
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30092-0V002
www.penguin-verlag.de
Prolog
Es war Punkt acht Uhr morgens, als ich die Stadtvilla im Herzen Amsterdams betrat. Ich musste mich weder ausweisen, noch wurde ich nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Angesichts der Ereignisse, die sich hier zugetragen hatten, wunderte mich das.
»Kommen Sie«, sagte der Bedienstete – ein Butler, wie ich seiner Kleidung nach vermutete – und führte mich durch das weitläufige Atrium.
Hier muss es irgendwo passiert sein, dachte ich, sah auf den Marmorboden und seufzte unwillkürlich. Die Sache hatte weite Kreise gezogen. Sogar die Klatschpresse in meiner Heimat war darauf angesprungen und hatte über ein Verbrechen berichtet, das schrecklicher nicht hätte sein können.
Ich folgte dem Butler über die Treppe nach oben. Überall sah ich die Insignien einer jahrhundertealten Dynastie, die mit der Bluttat ein abruptes Ende gefunden hatte.
Was will sie ausgerechnet von mir?, fragte ich mich zum tausendsten Mal. Ich war weder Hercule Poirot noch Sherlock Holmes – meine Talente lagen eindeutig in anderen, weniger subtilen Bereichen. Außerdem gab es hier nichts mehr zu ermitteln. Der Täter hatte vor diesem Haus auf seine Verhaftung gewartet. Monate später war er zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden.
Da erblickte ich sie, in der Bibliothek, die sich im ersten Obergeschoss öffnete. Sie saß der Treppe zugewandt, als hätte sie mein Kommen sehnsüchtig erwartet. Als sie mich sah, lächelte sie.
Ihre Schönheit überraschte mich. Man hatte sie penibel vor den Medien abgeschirmt, sodass diese nur unvorteilhafte Schnappschüsse von ihr veröffentlicht hatten – auf einer Tragbahre, im Fenster eines Krankenhauses und bei der Beerdigung ihres Mannes, der der letzte Nachkomme einer Familie gewesen war, die zu den reichsten in ganz Holland zählte.
Sie begrüßte mich und deutete auf einen Stuhl an der Seite des Schreibtischs, der inmitten der riesigen Bibliothek stand. Nachdem der Butler uns mit Getränken versorgt hatte, ließ er uns allein.
»Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind«, sagte sie.
»Gerne.«
»Bestimmt fragen Sie sich, warum ich Sie eingeladen habe.«
Ich nickte und musste mich beherrschen, nicht auf den Rollstuhl zu starren, in dem sie saß.
Sie hob den Blick und sah durch ein Fenster nach draußen. »Es ist jetzt ein Jahr her«, sagte sie leise, »seit sich alles geändert hat.«
»Mein aufrichtiges Beileid.«
Es hieß, sie habe nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch das ungeborene Kind. Derselbe Messerstich, der den Embryo getötet hatte, habe auch ihr Rückenmark durchtrennt. Ich wusste, dass die Klatschpresse zu Übertreibungen neigte. Doch was ich sah, ließ meine Wut auf diesen Angreifer nur größer werden.
»Danke. Nun ist es, wie es ist.«
Sie machte eine kurze Pause.
»Wissen Sie, dass er es angekündigt hatte?«, fuhr sie fort.
»Der, der Ihnen das angetan hat?«
Sie nickte.
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Ruben erhielt einen Drohbrief, in dem die Tat exakt so beschrieben wurde, wie sie später begangen wurde.«
Ich konnte es nicht glauben. »Aber wie kann das sein? Haben Sie denn nicht die Polizei verständigt?«
Sie verzog den Mund zu einem bitteren Lächeln. »Natürlich haben wir das«, antwortete sie. »Wir haben ihnen sogar den richtigen Verdächtigen genannt: einen ehemaligen Mitarbeiter meines Mannes, der sich für seine Entlassung rächen wollte. Aber die Polizei konnte nichts tun. Menschen wie wir müssen mit solchen Bedrohungen leben. Solange nichts weiter passiert …«
Ich sah, wie ihre Augen feucht wurden, und überlegte, ob es angemessen war, ihr ein Taschentuch zu reichen. Doch dann fing sie sich wieder und sprach weiter: »Besser gesagt: Solange es keine konkreten Anhaltspunkte oder Beweise gibt – die es nicht gab –, sind dem Staat die Hände gebunden.«
Sie blickte mir tief in die Augen, als sie mit fester Stimme sagte: »Deshalb, mein Lieber, habe ich Sie zu mir gerufen. Ich will verhindern, dass so etwas wieder geschieht. Ich möchte anderen Menschen in ähnlicher Lage helfen, sich zu schützen. Mit allem, was ich habe.«
Sie machte eine Geste, die auf den Prunk und Reichtum anspielte, der sie umgab.
»Nun frage ich Sie: Wollen Sie mir dabei helfen, zu helfen?«
Sie legte ihre Hände in den Schoß und wartete geduldig auf meine Reaktion.
Ich musste nicht lange überlegen. »Was stellen Sie sich vor?«, fragte ich und konnte den Ballast förmlich sehen, der ihr von der Seele fiel.
1
Sie wusste, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Mit jedem Schritt entspannte sie sich weiter. Sie sah frohes Treiben – lachende Menschen, Betrunkene, Bemalte und Küssende und alles, was man mit ausgelassenem Feiern in Verbindung brachte. Musik drang von überallher und vermischte sich zu einem Brei aus Lärm, gegen den das Partyvolk nach Kräften anbrüllte.
Keiner beachtete sie und ihren kleinen Sohn.
Der schlaue Ratgeber auf ihrem Nachtkästchen hatte recht gehabt: Es tat ihr gut, wieder unter Leute zu kommen. Oder wenigstens in deren Nähe. Dabei war es nicht das Buch gewesen, das sie hierhergeführt hatte. Sondern Tim. Das Kind hatte es nicht länger in der Wohnung ausgehalten, wo sie am Fenster gestanden und das Leben draußen beobachtet hatten. Er wollte nicht länger zusehen. Er wollte mitten rein. Sein Freiheitsdrang hatte sie schon mehrmals in Situationen gebracht, die jenseits ihrer eigenen Komfortzone lagen. Und das war gut so.
Er war gut so.
»Los, Mama! Ich will den Wagen sehen.«
Ihre Mundwinkel hoben sich. Natürlich wollte Tim den Wagen sehen, von dem unablässig Süßigkeiten in die Menge hinabgeworfen wurden. Zwar herrschte zu Hause kein Mangel an Zuckerzeug, doch irgendein seltsamer Charakterzug drängte ihren Sohn dazu, Geschenktem den Vorzug zu geben. Vielleicht hatte er bemerkt, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit dem Haushaltsbudget durchzukommen. Obwohl sie sich alle Mühe gab, es ihn nicht spüren zu lassen.
Sie fühlte Regentropfen im Gesicht, was sie wunderte – schließlich hatte der Wetterbericht keinen Niederschlag vorhergesagt. Der Blick in den aufgelockerten Himmel bestätigte diese Prognose. Sie wischte sich die Wange ab und roch daran. Als sie merkte, dass es Bier war, schüttelte sie sich vor Ekel.
»Schneller, Mama! Gleich ist er weg!«
Tim drängte sich zwischen Leuten hindurch, schob fremde Beine weg und zog seine Mutter einfach hinter sich her. Wie kräftig er geworden war!
Sie kamen in Wurfreichweite des Wagens. Tim bückte sich, um ein Bonbon aufzuheben und in seine Tasche zu stecken, wozu er seinen Teddy kurz unter den Arm klemmen musste. Dann lief er weiter.
»Langsamer, Tim!«, rief sie und wusste schon, dass er sie nicht hören würde – oder wollte. Sie ließ ihn gewähren. Weil er eigene Erfahrungen machen musste. Außerdem konnte ihnen in all dem Trubel nichts passieren.
Belüg dich nicht selbst, sagte die innere Stimme. Tausend Sachen konnten geschehen. Immer wieder hörte man von Amokfahrten. Noch mehr von Unfällen. Ganz besonders, wenn die Leute so ausgelassen waren wie hier und so viele große Wagen herumfuhren … aber es würde schon gut gehen.
Es musste gut gehen.
Als sie endlich beim Wagen waren und Tim seinen Teddy durch die Luft schwang, um die Aufmerksamkeit der Werfer zu erregen, war ihre Stimmung so gut wie seit vielen Wochen nicht mehr. Da war er, ihr kleiner Sonnenschein, und streckte dieser kalten Welt seinen Teddy entgegen. Er war mutig und unerschrocken. Er würde nicht verbittern. Oder aufgeben. Oder sich zeitlebens verkriechen, wie sie das am liebsten getan hätte. Tim würde sich allem stellen, und er würde seinen Weg machen.
Eine Frau auf dem Wagen, aufgetakelt und stark überschminkt, hatte Tim entdeckt und winkte ihm lachend zu, bevor sie in ihren Korb fasste und eine volle Hand Süßigkeiten in seine Richtung warf. Begeistert riss er sich von ihr los und streckte die freie Hand nach oben, bekam aber nichts zu fassen. Also bückte er sich runter und suchte den Boden ab.
»Tim!«, rief sie und wollte ihm gerade die Hand entgegenstrecken, als sie einen heftigen Stoß in die Seite spürte und aus der Balance geriet. Sie stolperte mehrere Schritte zur Seite, bevor sie den Nächsten in der Menge anrempelte, der dies mit einem angeheiterten »Hey!« quittierte.
»Tim!«
Sie sah ihn nicht mehr.
Eine Gruppe Kostümierter hielt sich an den Händen gefasst und verbaute ihr den Rückweg. Mit aller Kraft warf sie sich den fremden Armen entgegen, bis es ihr gelang, die Barriere zu durchbrechen.
»Tim?«, schrie sie jetzt.
Sie bückte sich auf seine Höhe hinunter, brüllte seinen Namen und ahnte, dass sie ihn verloren hatte. Dabei konnte er nicht weit gekommen sein. Fünf Meter, vielleicht zehn … Doch mit jeder Sekunde wurden es mehr Menschen. Wenn sie ihn noch finden wollte, dann jetzt!
Da entdeckte sie den Teddy. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf der Straße. Der Teddy war ihre einzige Rückversicherung in dieser Welt. Sonst trug sie nichts bei sich. Kein Handy, keine Schlüssel, keinen Ausweis, nichts.
Weil alles sie verraten konnte.
Vor ihrem geistigen Auge lag Tim genauso da, nur ein paar Meter weiter. Sie hätte sich niemals verziehen, wenn ihm etwas zugestoßen wäre …
Schnell bückte sie sich und hob den Stoffbären auf. Sie fühlte etwas Scharfkantiges, dachte im ersten Moment an den versteckten Inhalt, der womöglich zerbrochen war; sah, dass ihr in Wirklichkeit das zersplitterte linke Auge des Teddys in die Fingerkuppe schnitt – und spürte den nächsten Stoß, den sie gerade so ausbalancieren konnte. Wie von Sinnen suchte sie weiter, in der Hoffnung, irgendwo Tims knallgelbe Jacke hervorleuchten zu sehen. Doch er war bei Weitem nicht der Einzige, der diese Farbe trug.
Sie verfluchte sich selbst. Sie hätte seinem Betteln nicht nachgeben dürfen. Sie war die Erwachsene, und sie trug die Verantwortung für sie beide. Sie durfte nicht versagen. Doch genau das tat sie jetzt.
Und was dann kam, wusste sie genau.
Danach kam ER.
Ein eiskalter Schauer jagte ihr über den Rücken, während sie die blanke Hysterie zu bekämpfen versuchte, die sie bei jedem Gegenstand packte, den sie auf der Straße liegen sah. Doch Tim war wie vom Erdboden verschluckt.
»Kann ich helfen, Schätzelchen?«, fragte eine Frau und fasste sie am Oberarm.
»Nein, nein, geht schon«, antwortete sie schnell, machte sich los und rannte weiter, während sich die Welt vor ihren Augen zur Fernrohrperspektive zusammenzog, von zahllosen bunten Punkten umschwirrt. Sie spürte ihre zitternden Beine und befürchtete, jeden Moment ohnmächtig zu werden – als sie die Kirche St. Severin sah, die ihr neue Hoffnung schenkte. Weil mit dem Gotteshaus ein Satz in ihrer Erinnerung auftauchte. Der vereinbarte Treffpunkt. Sie hatte ihn Tim eingebläut, wieder und wieder, als sie IHM damals entkommen waren.
Egal, was passiert: Wir treffen uns in der Kirche.
Doch das war eine andere Kirche. Eine andere Stadt.
Ein anderes Leben.
Als sie die schwere Tür aufstieß und hineinging, wurde sie von der für Gotteshäuser typischen schummrigen Dunkelheit umfangen. Die Kälte des Winters steckte noch in den Mauern, doch sie spürte sie kaum. Sie schwitzte. Trotz des schlechten Lichts sah sie gleich, dass die Bänke leer waren.
Aber Tim war klein und konnte sich überall verstecken. Bestimmt war er verängstigt. Vielleicht hatte er sich im hintersten Winkel verkrochen, im Beichtstuhl oder hinter dem Taufbecken, und traute sich kaum, einen Atemzug zu machen.
Oder er war einfach nicht hier.
Wieder spürte sie die Tränen kommen. Sie kämpfte sie weg und zwang sich, weiter reinzugehen. Hinter ihr fiel die Holztür ins Schloss. Hätte Tim sie überhaupt aufbekommen? Er war doch noch so klein.
Hier ist er nicht, Nicole, sagte die innere Stimme. Warum sollte er auch hier sein? Er käme nie auf diese Möglichkeit. Er ist da draußen, ganz allein, und du suchst ihn ausgerechnet in der Kirche? Wie blöd bist du? Kannst nicht mal auf ein Kind aufpassen!
Sie zitterte. Alles war falsch. Rauszugehen ebenso wie hier zu suchen. Sie hatte Tim verloren und würde ihn nicht wiederfinden, und niemand konnte ihr noch helfen …
»Mama?«, hörte sie. Im selben Moment zupfte etwas an dem Stoffbären, den sie in ihrer rechten Hand hielt.
Noch bevor sie sich runterbeugen und ihren Jungen in die Arme schließen konnte, fing sie hemmungslos an zu weinen.
»Ich wollte nicht weglaufen«, sagte er so schuldbewusst, als fürchtete er sich vor einer Strafe. »Du warst auf einmal nicht mehr da!«
»Oh, Tim, mein süßer, tapferer Tim«, wimmerte sie und presste ihn so fest an sich, dass er ächzend dagegen protestierte.
Sie wollte ihn nie wieder loslassen, doch er entwand sich der Umklammerung und fragte: »Was ist mit Teddy?«
»Was meinst du?«
Tim drehte das Gesicht des Stofftiers zu ihr, sodass sie das zersplitterte Auge sehen konnte.
»Damit müssen wir zum Onkel Doktor«, sagte sie. »Der macht alles wieder gut.«
Tim reagierte besser als erwartet: Er zuckte bloß mit den Schultern und zog dann an ihrer Hand, genau wie vorhin im Getümmel. »Komm, Mama. Kerzen anzünden.«
»Das tun wir!«, bekräftigte sie seinen Vorschlag. Alles hätte sie getan, jeden Wunsch hätte sie ihm erfüllt, ein Rieseneis gekauft, Pizza und Pommes, und das ungesündeste Zeug der Welt hätte er von ihr haben können, doch was wollte er? Ausgerechnet Kerzen anzünden.
Woher diese Frömmigkeit in ihm kam, war ihr ein Rätsel. Sie hatte mit Gott abgeschlossen und jahrzehntelang kein Gotteshaus mehr betreten. Doch ihr Kleiner war davon fasziniert. Von den bunten Fenstern. Den hohen Gewölben. Den Heiligenfiguren, den Malereien und all dem Brimborium, das die Kirche machte, um ihre Schäfchen zu beeindrucken.
Ganz besonders mochte er die Opferkerzen, die auch hier zu Dutzenden in mehreren Reihen standen, angezündet von Menschen, deren Schicksale und Gebete ihr so fremd bleiben würden wie diese Stadt.
»Schau, so viele!«, rief Tim und zeigte begeistert darauf. »Da hat aber jemand viele Wünsche gehabt!«
Sie lachte und wischte sich die Tränen weg. Beten und wünschen war für Tim dasselbe. An Weihnachten betete er abwechselnd zum Christkind und dann wieder zum Weihnachtsmann, weil man ja nie wissen konnte, wer von beiden mächtiger war. Sein allergrößter Wunsch war es, einen Papa zu haben. Einen Papa, den sie ihm nicht geben konnte.
»Können wir auch so viele anzünden?«
»So viele du willst«, sagte sie sanft und holte ihre Geldtasche hervor. Ein Zwanzigeuroschein war alles, was noch übrig war. Sie faltete ihn zusammen und steckte ihn durch den schmalen Schlitz.
»Wie viele darf ich?«
»Zwanzig Stück!«
Tim johlte. Die Zahl zwanzig lag noch jenseits seiner Vorstellungskraft, auch wenn er schon weiter zählen konnte. Er musste seine ganze Konzentration darauf richten, ein Kerzchen nach dem anderen aus dem großen Karton zu holen und neben den übrigen aufzureihen. Leise zählte er mit, und mit jeder Kerze und jeder Zahl, die nicht zwanzig war, wurden seine Augen größer.
Gemeinsam zündeten sie die Kerzen an. Das Streichholz mit beiden Händen über die Dochte zu führen, hatte etwas Meditatives. Mit jeder neuen Flamme entspannte sie sich weiter … als sie etwas hörte.
Als sie IHN hörte.
»Hier seid ihr also«, sagte er.
Sie war wie gelähmt. Ihr Körper wollte sich tot stellen. Doch das hätte nichts genutzt.
Lauf, Nicole, lauf!
Nun musste sie ihrer inneren Stimme folgen. Weil es die einzige Möglichkeit war. Noch blieb ihr ein Vorsprung. Doch das bedeutete nichts. Wie immer war er sich seiner Sache sicher und verzichtete auf jede Eile.
Weil er uns ohnehin kriegt.
Sie verbot sich, über die Schulter zu blicken, packte Tim, der sie erschrocken ansah, hob ihn mit erstaunlicher Leichtigkeit hoch – und rannte los.
»Du kannst nicht vor mir davonlaufen!«
Schau her, wie ich kann!, konterte sie still, obwohl sie wusste, dass sie sich selbst belog. Aber sie musste es wenigstens versuchen.
»Gib ihn mir!«
Sie erreichte den Ausgang und warf sich gegen die schwere Holztür, die keinen Millimeter nachgab. Bis sie kapierte, dass sie nicht drücken, sondern ziehen musste, war bereits ihr halber Vorsprung dahin. Sie riss am Griff, bekam die Tür auf, war mit Tim schon draußen, rannte panisch auf das Karnevalstreiben zu, tauchte darin unter und dachte schon, es schaffen zu können – als sie plötzlich spürte, wie eine unbändige Kraft Tims anderen Arm zu fassen bekam und daran zu ziehen begann.
2
Norbert Karl saß in seinem Wohnzimmer und mühte sich mit den Tücken des Homeoffice. Von zu Hause aus zu arbeiten, hörte sich nur so lange gut an, bis man es tatsächlich mal eine Zeit lang getan hatte. Zwischen Computer-Updates, Zoom-Konferenzen und Bewegungsmangel musste auch der private Alltag noch irgendwo Platz finden. Immerhin hatte er jetzt, wo die Katze satt war, seine Ruhe …
Als wollte ihn das Schicksal Lügen strafen, klingelte es an der Tür. Karl dachte nach. Er bekam keinen Besuch und erwartete auch keine Lieferung. Spendenkeiler fanden an der Haustür einen eindeutigen Hinweis, dass sie unerwünscht waren. Womit nur der Reparaturdienst übrig blieb, den er vor gut einer Stunde über ein Online-Formular kontaktiert hatte.
Er sah auf die Uhr und war fassungslos, dass es in Münster wirklich einen Handwerker gab, der so schnell aufkreuzte. Dabei sollte er selbst jetzt endlich ans Arbeiten kommen …
Er seufzte, setzte das Headset ab und legte den Laptop zur Seite. Die Katze, die sich an seinen Oberschenkel gekuschelt hatte, sah ihn erwartungsvoll an.
»Es gibt nichts mehr«, sagte er zu ihr.
Fürs Aufstehen von der Couch brauchte er gleich zwei Anläufe – ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich das Homeoffice auch an seinen Hüften bemerkbar machte.
Dabei war er heilfroh, dass die Sache mit dem verstopften Abfluss endlich erledigt werden sollte. Seit einer Woche wollte das Wasser im Spülbecken in der Küche nicht mehr ablaufen. Er hatte es mit verschiedensten Hausmitteln und Tipps aus dem Internet versucht. Doch egal, was er probierte – von aggressiven Chemikalien über Gummisauger und Reinigungsspiralen bis zu einem teuren pistolenartigen Ding, das garantiert jeden Abfluss freibekam außer seinem –, es machte das Problem bloß noch schlimmer. Mittlerweile ekelte ihn der Geruch in der Küche so sehr, dass er sie nur noch betrat, wenn es unbedingt notwendig war.
Wieder klingelte es. »Ja, ja, ich komm ja schon!« Gerade als er das Wohnzimmer verlassen wollte, signalisierte der Laptop auf der Couch einen neuen Anruf, den er als Online-Supporttechniker schnellstmöglich anzunehmen hatte, wenn er nicht in Pause war. Er hatte vergessen, sich abzumelden. Doch der Klempner war eindeutig wichtiger.
Karl öffnete die Tür und sah einen Mann, der nicht wie ein Handwerker aussah. Er hätte ihn für einen Gerichtssachverständigen gehalten, der eher einen Bleistift als ein Werkzeug anfasste.
»Tag!«, sagte Karl und setzte ein freundliches Gesicht auf.
Der andere starrte ihn bloß an.
»Bitte, kommen Sie rein.«
Der Mann folgte ihm in die Küche. »Hier«, sagte Karl, »ein ganz schwerer Fall. Nichts, was ich versucht habe, hat was gebracht …« Er trat ans Becken und musste fast würgen, als er die Essensreste sah, die im trüben randhohen Spülwasser trieben. Auf der Ablage daneben stapelten sich schmutziges Geschirr und Töpfe, mittlerweile gab es in der Küche nichts Sauberes mehr. »Verzeihen Sie, dass es hier so aussieht, aber das erleben Sie bestimmt öfter, oder?«
Doch der andere ging nicht darauf ein. Kein aufmunterndes Wort kam über seine Lippen, kein »Schaffen wir schon«, kein »So was kenn ich, keine Sorge« oder was auch immer Karl sich erwartet hätte. Außerdem hatte der Mann nichts bei sich. Ob er sich zuerst mal ein Bild machen wollte, bevor er schweres Werkzeug heraufholte? Schließlich gab es im Haus keinen Aufzug. Oder war er bloß schnell vorbeigekommen, um die Misere in Augenschein zu nehmen und dann einen Kostenvoranschlag zu schicken, in ein bis drei Wochen vielleicht? Was auch erklärt hätte, wieso der Typ keine Arbeitskleidung trug. Karl brach der Schweiß aus bei dem Gedanken, dass in Zeiten wie diesen überhaupt nichts mehr sofort ging, schon gar nicht bei Handwerksfirmen, die sich für jeden Handgriff den Arsch vergolden ließen …
»Dann lass ich Sie mal machen, ja?«, schlug er vor, um den anderen zu irgendeiner Reaktion zu verleiten.
Im Wohnzimmer piepte der Laptop schon wieder. Nach drei versäumten Support-Anrufen nahm man ihn automatisch offline, worauf sich sein Vorgesetzter melden würde. Karl müsste sich eine richtig gute Entschuldigung zurechtlegen, warum er sich nicht abgemeldet hatte …
Aber der Mann tat nichts. Er schien sich nicht mal für die Spüle zu interessieren. Er starrte Karl bloß an. Konnte er kein Deutsch? Dabei war das Problem doch selbsterklärend.
Karl spürte, wie sich Wut in ihm regte. Er hatte nicht vor, den Kerl fürs Zeitschinden zu bezahlen. Falls das die Taktik dieser Firma sein sollte, deren Homepage sich Rohrhilfe-Sofort schimpfte und auf Platz eins der Suchergebnisse erschien, würde die ihr blaues Wunder erleben …
Da kam der dritte Support-Anruf. Jetzt musste er unbedingt rangehen. Wortlos wandte er sich ab und eilte in den Gang hinaus.
Erst jetzt ging ihm auf, wie seltsam die Situation war. Ein Fremder stand in seiner Küche. Ein Handwerker ohne Werkzeug. Kam er am Ende gar nicht von dieser Firma? Also doch ein Spendenkeiler? Und Karl hatte ihn einfach reingelassen … Musste er noch die Polizei rufen, um ihn wieder aus der Wohnung rauszukriegen?
Das Knarzen einer Bodendiele, die er längst überschritten hatte, gab ihm eine Ahnung davon, dass die Situation noch viel dramatischer war, als er dachte.
Der andere war ihm in den Gang gefolgt.
Karl erstarrte. Plötzlich hatte er Angst, und diese Angst lähmte ihn.
Er hörte einen weiteren Schritt.
Er war allein. Zu dieser Tageszeit war kaum jemand im Haus. Würde ihn jemand hören, wenn er um Hilfe schrie?
Schlappschwanz!, schimpfte er sich still. Er war ein Mann, und Männer wehrten sich. Männer kämpften gegen andere Männer. Männer führten Kriege, und Männer beschützten ihr Zuhause.
Wenn der andere kein Handwerker war, dann hatte er verdammt noch mal auch nichts in seiner Wohnung verloren.
»Was zur Hölle wollen Sie?«, rief er, fuhr wutentbrannt herum – und sah, dass der andere direkt hinter ihm stand, bereits ausgeholt hatte und jetzt den Arm in seine Richtung schwang. Karl blieb keine Zeit, ihn abzuwehren. Nur sein Gehirn war noch schnell genug, um verschiedene Versionen dessen durchzuspielen, was kam.
Ein Fausthieb vielleicht, der ihn ausknocken sollte, damit der Fremde anschließend in Ruhe die Wohnung ausräumen konnte?
Oder der Teigroller, der oben auf dem Geschirrberg lag?
An das lange Küchenmesser hatte Karl nicht gedacht.
3
Der Trubel, der an jenem Rosenmontag in Köln herrschte, spottete jeder Beschreibung. Die Straßen waren so voll wie seit Jahren nicht mehr. Selbst routinierte Karnevalsfreunde waren überrascht von der Inbrunst, mit der die Masse sang, sich tanzend und trinkend in den Armen lag und allzu oft die eigenen Grenzen vergaß, was den Rettungskräften eine Rekordzahl an Einsätzen bescherte. Alkoholvergiftungen waren darunter und kollabierte Kreisläufe, aber auch Knochenbrüche, Schnittwunden und zahllose kleinere Blessuren, die man sich im Feierrausch schon mal zuziehen konnte.
Die beiden jungen Streifenpolizisten, die an diesem Montag am Severinskirchplatz postiert waren, hatten bedeutend weniger zu tun als die Kollegen vom Rettungsdienst. Dennoch schienen sie keine Freude an dem Geschehen zu haben. Oft genug wurden sie für kostümierte Beamte gehalten und angepöbelt, gerne auch von Frauen, die sich unterhakten und augenzwinkernd um ihre Verhaftung baten – und fast enttäuscht waren, dass die beiden Polizisten nicht darauf eingingen.
Abseits solcher Begegnungen gab es für die beiden Polizeimeister nicht viel zu tun, außer weiterhin streng dreinzuschauen, den Funkverkehr zu verfolgen und darauf zu achten, dass ihnen keiner der Spaßvögel an die Waffen ging. Wie die meisten Polizisten fanden sie es ätzend, während der Karnevalszeit Dienst zu schieben.
Das Treiben schien sich etwas aufzulockern, als es plötzlich hektisch wurde. Aus dem Grölen, der Musik und dem allgemeinen Lärm arbeiteten sich Schreie heraus, die nach Protest klangen und nach Schreck.
Einer der Polizisten, Gregor Born, blieb stehen und drehte sich um. Er sah, wie jemand hinfiel. Ein anderer Passant stolperte zur Seite, und immer wieder schimpfte jemand.
Da sah Born die Frau, die wie von Sinnen durch die Menge rannte. Sofort versuchte er, seinen Kollegen darauf aufmerksam zu machen, doch dieser war schon ein paar Meter weitergegangen, das Funkgerät am Ohr. Er lauschte angestrengt und machte eine entschuldigende Geste.
Born sah zu der Frau zurück. Immer wieder stieß sie mit jemandem zusammen, geriet ins Straucheln und rappelte sich wieder hoch, wobei sie sich keinen Deut um die vielen Beschimpfungen kümmerte, die sie erntete. Sie blutete aus einer Wunde an der Stirn.
Er wusste, dass er handeln musste.
Der andere Beamte deutete in eine Seitengasse. Bestimmt waren sie gerade per Funk dorthin beordert worden.
»Warte!«
»Wir können nicht warten!«, entgegnete der Kollege und eilte los.
Seinen Partner ließ man nicht allein, schon gar nicht bei einem Trubel wie diesem. Aber gerade rannte die Frau einen weiteren Passanten nieder, keine fünf Meter von ihm entfernt.
»Halt!«, rief Born, die flache Hand nach vorne gestreckt, und stellte sich ihr in den Weg.
Als die Frau ihn sah, schien sie zu erschrecken, blieb abrupt stehen – und wechselte die Richtung. Er lief ihr hinterher und bat die Zentrale per Funk um Verstärkung. Auf die Schnelle konnte er keine exakte Position durchgeben. Er fühlte sich überfordert und war es wohl auch. »Halt! Polizei!«, rief er und hörte die drängende Stimme seines Partners am Funk: »Es läuft hier aus dem Ruder! Komm endlich!«
Aber er konnte nicht. Endlich gelang es ihm, die Frau einzuholen und an der Schulter zu packen. Als sie ins Stolpern geriet, sorgte er dafür, dass sie nicht fiel. »Was ist los mit Ihnen?«, fragte er, ohne sie loszulassen. Er sah, dass sie einen Stoffbären in den Händen hielt, was er zunächst aber nicht weiter beachtete.
»Hallo? Hören Sie mich? … Do you understand?«
Die Frau schwieg. Sie zitterte. Die Platzwunde an ihrer Stirn war nicht groß, blutete aber stark. Panisch sah sie in eine Richtung, einen Augenblick später in eine andere. Dutzende Augenpaare waren auf sie gerichtet, und der Lärm um sie herum war schlagartig verstummt.
»Verdammt, wo steckst du?«, schimpfte der Kollege am Funk.
»Vor wem laufen Sie davon? … Hallo? Hören Sie mich? … Wissen Sie, dass Sie verletzt sind? Sie brauchen einen Arzt.«
»Er ist weg«, sagte sie so plötzlich wie geistesabwesend.
»Wer?«
»Sie kennen ihn nicht!«
Ein Blick auf den Stoffteddy gab ihm eine Ahnung. »Suchen Sie Ihr Kind? … Ihren Sohn?«, versuchte er zu ihr durchzudringen.
Die Stimmen, die aus dem Funkgerät drangen, wurden hektisch. Die Zentrale forderte eine konkrete Angabe, wohin man die Verstärkung denn nun beordern solle und was eigentlich los sei. Er fürchtete, einen Fehler nach dem anderen zu machen. Die theoretische Vorgehensweise in einem solchen Fall, wie er sie auf der Polizeischule gelernt hatte, war ihm komplett entfallen, und er musste versuchen, mit seinem Menschenverstand weiterzukommen.
»Wir finden ihn schon«, versuchte er die Frau zu beruhigen. »Ich gebe es gleich durch, und im Nu …«
»Nein!«, schrie sie, schüttelte den Kopf und machte Anstalten, erneut davonzustürmen.
Ihre Verzweiflung war so offensichtlich, dass Born helfen musste. »Warten Sie hier, und ich kümmere mich. Okay?«
Schnell warf er einen Blick in die Seitengasse, in die sein Kollege gerannt war, sah diesen aber nicht mehr. Er musste schnellstmöglich hin.
Als er sich wieder der Frau zuwandte, sah er, dass sie bereits losgerannt war und durch die Menge stürmte, genauso schnell und rücksichtslos wie vorhin. Sie einzuholen, würde zu viel Zeit kosten.
»Wo bleibst du denn, verdammt?«, kam es über den Funk.
»Schon unterwegs!«, antwortete Born und lief zu seinem Partner.
4
Der Trubel in Köln war noch lange nicht zu Ende, als Polizeimeister Gregor Born endlich Dienstschluss hatte. Entgegen seinen üblichen Gewohnheiten duschte er in der Wache und zog sich anschließend die private Kleidung an, die er wie jeder andere Polizist als Reserve in seinem Spind hatte.
Er wich nicht bloß deshalb von seiner gewohnten Routine ab, weil er verschwitzt war und seine Uniform nach eingetrocknetem Bier stank. Er war auch nervlich erschöpft, und sein Kopf begann zu schmerzen, weshalb er auf dem Heimweg nicht als Polizist erkannt und angequatscht werden wollte.
Die heiße Luft aus dem Föhn bescherte ihm einen Tagtraum. Er war in einem fremden Land, wo man bloß seine Nase in den Wind zu strecken brauchte, um Ähnliches zu fühlen: Sommer, Sonne, Sonnenschein …
Erst in den letzten Jahren hatte er die Vorzüge eines per Urlaub abgekürzten Winters kennengelernt. Als Kind wären Flugreisen in ferne Länder undenkbar gewesen. Doch mit seiner Volljährigkeit war auch die Freiheit gekommen, eigene Entscheidungen zu treffen, was er gerne und ausgiebig in Anspruch nahm.
Born war immer schon der Sommertyp gewesen. In den Monaten vor Weihnachten wünschte er sich den letzten Sommer zurück, und danach konnte ihm der nächste nicht schnell genug kommen. Er hasste den Winter und alles, was damit verbunden war – so auch den Karneval, weshalb er in dem Ruf stand, eine notorische Spaßbremse zu sein.
»Hey, Greg«, sagte einer seiner Kollegen – Marvin Schröder –, der prinzipiell duschte, selbst nach einem Tag am Schreibtisch, und ebenso prinzipiell anschließend sein unbedecktes Teil Gassi führte, bis es garantiert jeder gesehen hatte. Born musste sich seiner eigenen Ausstattung nicht schämen, doch männliches Imponiergehabe dieser Art war immer schon der Grund gewesen, weshalb er Gemeinschaftsduschen hasste.
»Wie war’s bei euch?«, fragte Schröder.
Born brummte eine Antwort, die nicht mal er selbst verstand. Dann legte er den Föhn weg und verteilte Wachs in den Haaren.
»Miese Laune, was?«
Ja, er war schlecht drauf. Die Ereignisse des Tages hatten ihm auch allen Grund dazu gegeben. Beim Karneval war mindestens so viel los gewesen wie befürchtet. Er und Kollege Gharbi hatten unzählige Personen aus diversen Gründen ermahnt, Identitäten festgestellt, eine Handvoll angezeigt, eine besonders zügellose Truppe beinahe festgenommen und mindestens zwei Dutzend Alkoholleichen zu Sanitätszelten und Rettungswagen eskortiert. Ohne ein einziges Dankeschön zu bekommen. Dafür wurden sie mehrmals bespuckt, beschimpft und mit diversen Gegenständen beworfen.
Nüchtern betrachtet, hatte man als Polizist alle Gründe für schlechte Laune. Selbst die alten Kollegen gaben zu, dass sie den Jungen die Zukunft nicht neideten. Den Respekt früherer Zeiten gab es nicht mehr. Auf Streife war man stets mit einem Fuß auf dem Asphalt und mit dem anderen in einem Disziplinarverfahren. Weshalb man vor allem eines schnell lernte: Dinge zu erdulden. Im Dienst hatte das Ego keinen Platz. Überall warteten Menschen darauf, dass sie Verfehlungen von Polizisten filmen und veröffentlichen konnten.
Natürlich waren nicht alle Tage so anstrengend und trist wie dieser. Manchmal machte die Arbeit auch Spaß. Dann wusste Born wieder, was er daran schätzte. Das Unvorhersehbare. Die Abwechslung. Die Freiheit und die frische Luft. Und eines Tages, wenn er es erst in den Kriminaldienst geschafft hatte, würde ihm und seiner Arbeit auch der nötige Respekt entgegengebracht werden.
»Lust, was zu trinken?«, ließ Schröder nicht locker.
Born steckte seine Brieftasche in die Hose und warf sich die Lederjacke über. Er vermied den Blickkontakt zu seinem Kollegen. Schon die Perspektive aus den Augenwinkeln reichte aus, um zu sehen, dass dieser immer noch unbekleidet war.
»Ein andermal, ja? Ich bin fix und fertig.«
Schröder schwieg. Born brummte etwas, was nach Abschied klingen sollte, und ging los. Er war schon an der Tür, als sein Kollege ihm in den Rücken sprach: »Das mit der Frau mitbekommen?«
Er hätte gern so getan, als hätte er die Frage überhört, doch dafür hatte Schröder zu laut gesprochen. Außerdem: Wenn Schröder es für erwähnenswert hielt, musste es wohl wichtig sein. Also drehte er missmutig den Kopf. »Hm?«
»Junges Ding. Schlimme Sache. Ganz nah bei euch, zur selben Zeit wie die Prügelei in der Bar. Wir sind als Erste hingekommen.«
Nun war auch klar, weshalb Schröder etwas trinken wollte: weil ihn der Einsatz mitnahm. Was auch bedeutete, dass das mit der Frau wohl heftig war.
Das mit der Frau …
Plötzlich erinnerte er sich wieder an die Frau, die völlig außer sich durch die Menge gestürmt war, mit einer stark blutenden Platzwunde an der Stirn. Die, die er laufen lassen hatte – oder die ihm entwischt war, je nachdem, wie man es sah.
Hatte sie nicht einen Teddy bei sich gehabt? Die Schlägerei in der Bar, zu der sie anschließend gerufen worden waren, hatte ihn völlig davon abgelenkt …
»Was war denn?«, fragte er.
Schröder zischte zuerst, als wollte er die Bedeutung des Folgenden unterstreichen, bevor er sagte: »Straßenbahn.«
»Marvin, sprich in ganzen Sätzen oder lass es! Und zieh dir endlich was an.«
»Schon gut, schon gut. Zeit, dass du nach Hause kommst, was?«
»Was war mit der Frau?«, ließ er nicht locker. Er wusste sofort, dass ihn die Sache so lange belasten würde, bis er sicher sein konnte, dass es nicht um die ging, der er nicht geholfen hatte.
»Von der Straßenbahn überrollt«, sagte Schröder.
»Tot?«
Er nickte. »So tot, wie man nur sein kann.« Dann hob er den rechten Arm und legte ihn quer vor seine Brust, als wollte er signalisieren, wo genau sie erwischt worden war. Die Bilder, die Borns Fantasie entsprangen, waren zu schlimm, um sie zu Ende zu denken.
»Wer war sie?«
Jetzt sah Schröder ihn skeptisch an, bevor er mit einer Gegenfrage antwortete: »Wieso interessierst du dich so für die?«
»Ich … will es einfach wissen. Weil es in unserer Nähe passiert ist. Vielleicht kann ich ja helfen.«
»Helfen?«, gluckste Schröder. »Der kann keiner mehr helfen. Oder wie haste das gemeint?«
Obwohl es mehr als unwahrscheinlich war, dass ausgerechnet der Kollege etwas Sinnvolles in der Sache beizutragen hatte, schaute Born ihn erwartungsvoll an.
Dieser sprach schließlich von sich aus weiter: »Hatte überhaupt nichts bei sich, keinen Ausweis, kein Handy, kein Geld. Ist wie aus dem Nichts auf die Straße gerannt. Einem Augenzeugen zufolge war sie schon verletzt, bevor …«
»Wo?«, fiel Born ihm ins Wort, während er spürte, wie sein Puls in die Höhe schnellte.
»Was? Karolingerring.«
»Nein, das meine ich nicht. Wo war sie schon verletzt?«
»Wieso?«
»Sag’s mir einfach, Marvin.«
»Am Kopf.«
Im Geist stand sie wieder vor ihm, mit ihrer Platzwunde an der Stirn, den wirren Augen – und dem Teddy, den sie verzweifelt umklammert hielt.
5
»Guten Tag, Frau Björk«, sagte die neue Europol-Direktorin Leona Willems und bat sie ins Direktionsbüro.
Inga Björk verneinte die Frage nach Kaffee oder Wasser und hoffte, dass die Neue im Gegenzug auf Small Talk verzichtete. Ihr Schreibtisch war voll. Die Anfragen aus den Partnerländern stapelten sich und mit ihnen auch die Bürokratie, auf die Björk liebend gern verzichtet hätte.
Als sie sich setzte, musterte Willems kurz ihre Arme. Wie immer waren sie von langen Ärmeln verdeckt, die zu einem Rollkragenshirt gehörten. Damit versuchte Björk, das Tattoo zu verbergen, das sich über ihren ganzen Körper zog, was meistens auch gelang. Aber leider nicht immer. Im Internet kursierten Dutzende Fotos davon, geschossen nach Einsätzen, bei Tatortbesichtigungen und vor einem Gerichtstermin. Björk hatte sich an Journalisten und Pressefotografen vorbeidrängen müssen und dabei unfreiwillig Teile des Kunstwerks auf ihrem Körper offenbart. Zuletzt hatte ihr ein Wochenmagazin viel Geld für eine Reportage geboten, die mit Wild Style meets True Crime betitelt gewesen wäre – doch mit dem Modeln und nackter Haut, die zweifellos im Mittelpunkt dieser Reportage gestanden hätte, hatte Björk schon vor mehr als einem Jahrzehnt abgeschlossen.
»Sie fragen sich bestimmt, weshalb ich Sie sprechen möchte«, eröffnete Willems das Gespräch.
»Ich nehme an, Sie wollen sich ein Bild von mir machen.«
Willems wirkte kurz irritiert. Dann, als hätte Björks Antwort ihr die Erlaubnis dazu erteilt, glitt ihr Blick erneut an Björk hinab, über den Hals, das Shirt, die Arme … womit klar war, dass sie von dem großen Baumtattoo wissen musste, das sich über Björks gesamten Körper erstreckte und bis zu den Hand- und Fußgelenken verästelte.
»Es geht um Veränderungen, die ich hier gern umsetzen würde«, sagte Willems bedeutungsschwer und starrte ihr in die Augen.
Björk nickte einmal. Sie wusste nicht viel über die Neue, außer dass sie um die fünfzig war, Ende der Neunziger bei der belgischen Polizei angefangen hatte, dann in ein Ministerium gewechselt und dort aufgestiegen war – bevor sie plötzlich zur Europol-Direktorin berufen wurde. Was ihre Ansichten und Überzeugungen betraf, war sie ein weißes Blatt, weshalb in dem Wort Veränderungen sofort etwas Bedrohliches für Björk mitschwang.
»Genauer gesagt, geht es darum, unser Profil zu schärfen«, sagte Willems, erhob sich und schritt langsam zum Fenster. Björk sah ihr nach. Unverkennbar war sie sportlich aktiv und achtete auf ihre Gesundheit, während ihr Outfit sachlich-nüchtern und erstaunlich farblos war. Dass sich darunter Tattoos oder Piercings verbergen könnten, war eine aberwitzige Vorstellung. Das einzig Außergewöhnliche an ihr waren die Haare, die in schwarzen Spiralen abstanden und aussahen, als hätte Willems sie im Abfalleimer eines Metallbaubetriebs gefunden.
»Und wie kann ich dabei helfen?«, fragte Björk mit wachsender Ungeduld.
Willems seufzte und sprach zum Fenster: »Sie und Christian Brand haben zuletzt ja für einiges Aufsehen gesorgt.«
»Wir haben nur unseren Job gemacht«, entgegnete Björk schnell, in einer seltsamen Mischung aus Bescheidenheit und Rechtfertigungsdruck. Immer noch konnte sie nicht einschätzen, wohin das Gespräch führte, aber es schien mit den Einsätzen zu tun zu haben, die Brand und sie regelmäßig in die Medien gebracht hatten. Einsätzen, die gut für sie ausgegangen waren und damit auch Europol genützt hatten.
»Den Job haben Sie gemacht, ja … in auffälliger und sehr unkonventioneller Weise«, sagte Willems und seufzte erneut.
»Was soll das heißen?«
Die Europol-Direktorin drehte sich um und sah sie direkt an. Das Baumtattoo glühte jetzt förmlich unter Björks Kleidung. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Björk. Auffällig und unkonventionell ist unsere ganze Welt, nicht wahr? Das soll unter meiner Leitung auch für Europol gelten, und deswegen werden Sie und Christian Brand ein gemeinsames Team bilden, in einer neu zu gründenden Abteilung.«
Björk zog die Augenbrauen zusammen. Ein Team mit Brand? In ihren Augen war es gut, dass sie bei Europol in unterschiedlichen Bereichen arbeiteten und bloß hin und wieder zusammen ermittelten. Auch Brand schien es recht so zu sein.
»Wir werden die Abteilung Internationale Serienkriminalität nennen. Gefällt Ihnen der Name?«
Björk schwieg. Was würde es aus Brand und ihr machen, wenn sie nun in einem Team waren, sich womöglich den Schreibtisch teilten? Ein absurder Gedanke.
»Sie sind von allen belanglosen Dingen entbunden, für die Sie sonst angefragt werden. Schluss mit der Überführung kleiner Drogenkrimineller. Niemand wird Ihnen mehr die Zeit stehlen und Ihr Talent für Kleinkram verschwenden. Sie erhalten ein eigenes Budget, direkten Zugriff auf alle wesentlichen Stellen im Haus – und einen Pressesprecher.«
Langsam ahnte Björk, was hier im Zentrum stand: Public Relations. Die Neue wollte sich gut in der Öffentlichkeit verkaufen und hatte bestimmt schon den nächsten Karriereschritt im Hinterkopf. Und Brand und Björk sollten dafür offenbar den nötigen Rückenwind liefern. Doch was Björk betraf, hatte sie nicht die geringste Lust, zur PR-Polizistin zu verkommen, und Brand bestimmt genauso wenig.
Andererseits klang es verlockend, nicht mehr an Drogenprojekten mitarbeiten zu müssen, für die man sie wegen ihrer Stärke beim Identifizieren von Menschen nur allzu oft anfragte. Sie fühlte sich nicht gut dabei, kleinen Hanfzüchtern das Handwerk zu legen, und kam sich jedes Mal wie eine kleinkarierte Spießerin vor.
»Christian Brand wird die Abteilung leiten«, sprach die Neue in die Stille hinein.
»Was?«, rief Björk.
Willems setzte ein seltsames Gesicht auf – nicht grinsend, aber auch nicht so, als wollte sie eine gewisse Schadenfreude vor Björk verbergen. »Eine moderne Behörde braucht ein modernes Image«, dozierte sie, »allerdings sollte man es auch nicht zu weit damit treiben.« Wieder starrte die Direktorin Björks bedeckte Arme an. »Auffälligkeit ist gut. Solange man mit Leistung auffällt. Sie, Frau Björk, haben die unbestrittene Fähigkeit, Menschen zu finden und Zusammenhänge zu erkennen. Aber Ihr Auftreten kommt nicht überall gut an. Man hält Sie für kühl und unnahbar, vielleicht sogar arrogant. Nicht dass ich so über Sie denken würde. Ich will Sie bloß aus der Schusslinie nehmen und dafür sorgen, dass Sie in Ruhe arbeiten können.«
Björk hörte die Worte, war aber zu empört, um ihre Bedeutung zu erfassen. Sie wusste selbst, dass man sie für arrogant hielt, doch auf die Meinung anderer Leute gab sie keinen Cent. Nun sollte sie dafür bestraft werden?
»Christian Brand ist ein Macher mit jugendlichem Charme und zugleich eine lebende Waffe im Kampf gegen das Böse«, sprach Willems weiter. »Die Leute da draußen lieben ihn.«
Lebende Waffe, dachte Björk und stieß die Luft aus. Ohne sie wäre Brand niemals zu Europol gekommen, sondern in Österreich geblieben, wo man ihn mittlerweile längst aus der Spezialeinheit Cobra geworfen hätte. Er konnte unmöglich ihr Chef sein. Er war zehn Jahre jünger als sie, außerdem …
»Frau Björk. Nichts gegen Sie und Ihre unbestrittenen Fähigkeiten und Erfolge. Aber uns fehlt ein breitentaugliches Profil.«
»Sein Bizeps ist also breitentauglicher als mein Tattoo.«
Willems gab sich keine Mühe, dies abzustreiten. Stattdessen setzte sie wieder dieses dämliche Grinsen auf. »Versuchen Sie, damit zurechtzukommen. Ich würde ungern auf Ihre Dienste verzichten. Geben Sie Christian Brand eine Chance.«
»Am Arsch«, fluchte Björk auf Schwedisch.
»Wie bitte?«
Björk ballte die Fäuste und hielt sich zurück, auch wenn sie innerlich kochte. Wofür Brand nichts konnte. Auch er würde nicht gerade begeistert von dieser Botschaft sein. Wobei ihr einfiel, dass er ihr in den letzten Tagen mehrmals aus dem Weg gegangen war.
Etwa deswegen?
»Weiß die lebende Waffe schon von ihrem Glück?«, fragte sie Willems mit letzter Beherrschung.
»Ich wollte das zunächst unter uns Frauen klären. Aber ich denke, wir werden keine Probleme haben. Nicht wahr?«
Nichts fiel Björk leichter, als den Kopf zu schütteln, wenn auch ganz anders gemeint.
»Dann guten Tag, Frau Björk, und viel Erfolg.«
6
Als Gregor Born sich dem Unfallort näherte, wurden seine Kopfschmerzen stärker. Er musste bald eine Triptan-Tablette nehmen, um die einsetzende Migräneattacke abzuwehren, doch er hatte keine bei sich und wollte auch nicht nach einer Notapotheke suchen, die jetzt noch offen hatte.
Der Linienbus, in dem er saß, bewegte sich im Schneckentempo vorwärts. Der Fahrer musste neu in seinem Job sein und steuerte das Gefährt wie auf Glatteis. Mehrmals brachte er den Bus abrupt zum Stehen, weil jemand unversehens die Spur wechselte, Fußgänger auf die Straße sprangen oder Fahrradfahrer nicht nur den niedrigen Temperaturen, sondern auch dem Alkoholgehalt in ihrem Blut zu trotzen versuchten. Überhaupt war die Welt da draußen so übergeschnappt, wie sie es nur im Kölner Karneval sein konnte.
Aber schließlich schafften sie es zum Chlodwigplatz, wo Born den Kragen seiner Jacke hochstülpte, bevor er den Halteknopf drückte und ausstieg. Eiskalte Luft strömte ihm entgegen, die er tief einatmete in der Hoffnung, die Migräne so noch etwas hinauszuzögern.
Mit schnellen Schritten ging er in Richtung Karolingerring, wo die Frau von der Straßenbahn überrollt worden war. Nichts ließ dort mehr die Aufregung erkennen, die ein tödlicher Verkehrsunfall für gewöhnlich mit sich brachte. Die Einsatzkräfte, die bestimmt mit einem Großaufgebot gekommen waren, waren inzwischen längst wieder abgerückt. Born sah weder ein Absperrband noch Kerzen und Blumen, wie er sie an einem Ort erwartet hätte, an dem erst vor wenigen Stunden ein Leben so tragisch zu Ende gegangen war.
Ich hätte es verhindern können, dachte er zum wiederholten Mal, als er bei den Straßenbahngleisen ankam und die Stelle fand, wo der Unfall passiert war. In einem Umkreis von fünf Metern war der Boden nass. Die Feuerwehr hatte das, was nicht mehr eingesammelt werden konnte, einfach weggespült. Geblieben waren die mit grüner Farbe auf den Untergrund gesprayten Umrisse eines Körpers.
Ihres Körpers.
Born seufzte tief, als sie lebhaft in seiner Erinnerung auftauchte. Sie hatte so verzweifelt gewirkt, keine zweihundert Meter von hier entfernt, wo er ihr in all dem Trubel nicht hatte helfen können und sie weggelaufen war. Hierher, direkt in den Tod.
Das weißt du noch gar nicht, meldete sich seine innere Stimme zu Wort, die immer noch an einen Zufall glauben wollte, an irgendeine Frau, die zufällig ebenfalls eine Kopfwunde gehabt hatte, vielleicht weil sie zu viel getrunken und sich irgendwo gestoßen hatte, statt wie eine Besessene durch die Menge zu rennen … ohne Ausweis, Handy oder Geld.
Wieso hatte sie nichts bei sich?, grübelte Born wieder. Jeder hatte ein Handy dabei, und falls nicht, so doch wenigstens etwas Geld, besonders wenn man für ein Kind verantwortlich war …
Wurde sie bestohlen? Vor oder nach dem Unfall?
Eine Autohupe riss Born aus den Überlegungen. »Von der Straße runter, du Penner!«, rief jemand aus dem Fahrerfenster eines vorbeirasenden Autos und verfehlte Born nur um wenige Zentimeter.
Dieser machte zwei schnelle Schritte zurück, sah dem Pkw hinterher und rieb sich die Stirn. Überall war Verkehr, überall schrien und grölten Menschen, überall brüllte Musik aus Lautsprechern, und alles vermengte sich in seinem Kopf zu einem pulsierenden Ungetüm.
Was habe ich mir bloß davon versprochen, hierherzukommen?, fragte er sich und wusste es selbst nicht mehr. Hier konnte er keinem mehr helfen und würde weder Antworten noch einen Freispruch für sein Gewissen bekommen. Kein: »Nein, du hast heute nicht versagt. Es war eine andere. Die, die dir entwischt ist, hat ihr Kind längst wiedergefunden und ist zu Hause, wo sie gerade Abendbrot macht und sich von der Aufregung erholt. Alles gut!«
Gar nichts war gut. Am wenigsten sein Kopf. Born schaffte es kaum noch, einen klaren Gedanken zu fassen. Man musste Migräne am eigenen Leib erfahren, um das verstehen zu können. Born hatte früh gelernt, sich nicht auf das Verständnis und noch weniger auf das Mitleid seiner Mitmenschen zu verlassen. Wer Migräne hatte, war in allzu vielen Augen ein wehleidiger Jammerlappen. Immerhin gab es heute wirksame Medikamente, die das Leid erträglich machten. Vorausgesetzt, man hatte welche bei sich …
Der Gedanke an die erlösende Tablette ließ ihn schließlich aufbrechen. Er ging gerade zur nächstgelegenen Haltestelle los, als er etwas aus einem übervollen Abfallbehälter ragen sah. Unbewusst sah er ein zweites Mal hin und war schon daran vorbei, als er realisierte, was es war. Abrupt hielt er inne – und drehte sich dann langsam um.
Er hoffte immer noch auf einen Zufall, als er das Ding, von dem er nur Teile sah, aus dem Müllberg herauszog. Mehrere Glasflaschen kippten über den Rand und zersprangen am Boden.
Sein Kopf wollte zerspringen, als er es ins fahle Licht der Straßenbeleuchtung hielt.
Es war der Teddy der Frau.
Der Teddy ihres Kindes, begriff er noch, bevor er sich vor Schmerzen und Betroffenheit übergeben musste – und dafür schallendes Gelächter von einer Männergruppe erntete.
7
Von allen frühen Vögeln, die es in der Seniorenresidenz am Dachsberg gab, war Margarethe Stramm stets die Erste, die im Wintergarten auftauchte und Platz am Frühstückstisch nahm. Pünktlichkeit war ihr heute noch so wichtig wie in den vierundvierzig Jahren ihres Berufslebens. Auf sie konnte man sich stets verlassen, mehr noch: Nach ihr konnte man die Uhr stellen. Disziplin war ihr Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Was mit zunehmendem Alter und wachsenden Beschwerden allerdings erforderte, den Wecker immer weiter zurückzustellen, um pünktlich um sechs salonfähig im Wintergarten erscheinen zu können.
Nicht dass es jemanden gekümmert hätte. Die anderen Residenten, wie Margarethe sie leicht spöttisch nannte, trudelten ein, wann es ihnen passte oder wann die Pfleger sie brachten. In Rollstühlen oder an Rollatoren wurden sie zu den Tischen geführt und hingesetzt. Dort blieben sie meist sich selbst überlassen, ob sie nun aßen oder nicht. Manchen von ihnen – besonders denen, die keine Angehörigen mehr hatten – konnte man förmlich beim Abmagern zusehen, bis eines Tages der Arzt kam und sie an Infusionen hängte und das Elend seinen Lauf nahm. Solange sie konnte, wollte sich Margarethe dieses Schicksal ersparen.
Genau wie ich mir ersparen wollte, überhaupt hier zu landen, rief sie sich bitter in Erinnerung.
Heute waren ihre Anlaufschmerzen besonders schlimm gewesen. Schlimmer als je zuvor, wenn sie ehrlich war. Trotz doppelt so vieler Übungen wie sonst fühlte sie sich immer noch nicht richtig in Schuss.
»Guten Morgen, Frau Stramm.«
Margarethe sah von ihrer Zeitung auf, die sie zunehmend als Alibi benutzte, um oberflächlichen Gesprächen aus dem Weg zu gehen. In Wahrheit konnte sie keinen Text mehr lesen, sondern bloß die Überschriften, die so verrückt waren, dass sie gar nicht mehr wissen wollte.
»Guten Morgen«, erwiderte sie.
Die junge Angestellte schob den Servierwagen mit den Frühstückstellern herum und verteilte sie auf den Tischen. Margarethe glaubte nicht, die Frau mit den roten Haaren schon einmal gesehen zu haben. In der Residenz herrschte ein Kommen und Gehen, nicht nur beim älteren, sondern auch beim jüngeren Personal. Aber diese Frau wäre Margarethe bestimmt aufgefallen. Sie seufzte leise. Den Menschen von heute schien es gar nicht mehr wichtig zu sein, eine langfristige Arbeitsstelle zu haben.
Eine Zeit lang hatte Margarethe sich bemüht, sich die Namen des Personals einzuprägen, um jeden mit dem richtigen anzusprechen, aber irgendwann hatte sie es aufgegeben. Sie musste bloß aufpassen, dass man deshalb nicht ihre kognitiven Fähigkeiten in Zweifel zog, denn dann gab es Pillen, und Pillen waren wie Infusionen eine Sackgasse, aus der es kein Entrinnen gab.
Margarethes Höflichkeit drängte sie zu einer kleinen Nettigkeit, einer aufmerksamen Bemerkung, doch ohne den Namen der jungen Frau zu kennen, war alles, was sie sagte, zur Oberflächlichkeit verdammt. Also schwieg sie.
Die Rothaarige pfiff eine Melodie, was Margarethe verriet, dass sie noch nicht lange hier sein konnte. Zu pfeifen wurde einem hier schnell ausgetrieben, besonders von Herrn Kowalski, der gar nicht schwerhörig genug sein konnte, um nicht das leiseste Pfiffeln, wie er es nannte, mitzubekommen und den Missetäter lautstark zurechtzuweisen. »Wenn ich Menschen pfeifen hören will, gehe ich in den Zirkus!«, hörte sie den alten General sagen. Als sie sich sein ledriges Gesicht mit den Hängebacken eines Rottweilers vorstellte, fiel ihr ein, dass Kowalski ja letztens ausgecheckt hatte, wie die junge Generation es nannte – was sie erneut seufzen ließ.
»Da haben wir heute aber kein schönes Wetter«, quatschte die Rothaarige drauflos.
Margarethe verdrehte insgeheim die Augen und brummte ein unverbindliches »Hmmm«, in der Hoffnung, damit ausreichend artikuliert zu haben, dass sie das Wetter für das oberflächlichste aller Gesprächsthemen hielt. Das Wetter war, wie das Wetter eben war. Es war vor allem eines: gerecht. Es regnete nicht um die Reichen herum und selbst den dümmsten Bauern aufs Feld. Letztlich war das Wetter die gerechte Strafe für alles, was der Mensch mit der Umwelt anstellte.
Ob die junge Frau ihr solche Gedanken zutraute? Oder gehörte sie zu der Sorte, die jeden über fünfundvierzig anbrüllte, weil Menschen solch biblischen Alters nicht nur senil, sondern auch schwerhörig sein mussten?
»Dann wollen wir mal schön frühstücken«, rief sie, als wollte sie Margarethes Eindruck bestätigen, und stellte den Teller auf der Zeitung ab. »Ich mach Ihnen noch das Plastik ab«, sagte sie und fingerte am Teller herum.
Jetzt reichte es Margarethe. »Ich mach das schon!«, protestierte sie und winkte die Hände der Servierkraft weg wie eine lästige Fliege.
»Das sagen Sie jeden Tag, Frau Stramm, und dann plagen Sie sich wieder daran ab. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, dafür bin doch da!«
Margarethe spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss. Schnell führte sie den Selbsttest durch, den sie seit einigen Jahren verinnerlicht hatte. Geburtsdatum, Rentenversicherungsnummer, ehemalige Adressen – alles da.
Zögerlich hob sie den Blick und musterte die junge Frau, die ihr nun tatsächlich vertraut vorkam. »Sie haben eine neue Haarfarbe«, riet sie, zitternd vor Unsicherheit.
»Hätten Sie mich fast nicht erkannt, was? Ich bin’s, Katja!«
Margarethe lächelte, während ihr innerlich ein ganzer Felsen vom Herzen rollte. Alles war besser, als der Demenz zum Opfer zu fallen. »Sie werden den jungen Männern jedenfalls ordentlich den Kopf damit verdrehen, Fräulein Katja.«
»Meinen Sie, ja?« Die junge Angestellte trat an ihre Seite und half Margarethe mit dem Plastiküberzug.
Plötzlich war ihr der Small Talk recht. »Ist ja nicht leicht, heutzutage jemandem aufzufallen, mit dem ganzen Smartphone-Gedöns«, plapperte sie drauflos.
»Ach, wem sagen Sie das, Frau Stramm … Oh, gucken Sie mal hier, die sehen aber happy aus«, sagte Katja und gackerte wie ein Huhn.
Margarethe folgte ihrem Zeigefinger zu einem Artikel, der schon die ganze Zeit vor ihrer Nase gelegen hatte.
Hof bei Braunschweig setzt voll auf smarte Landwirtschaft, lautete die Überschrift, die zu belanglos und obendrein viel zu smart gewesen war, um Margarethes Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Darunter war das Foto eines landwirtschaftlichen Gebäudes abgedruckt, auf dessen Dach unzählige Solarpanels in der Sonne glänzten. Vor dem Hof stand eine Handvoll Menschen, die tatsächlich sehr glücklich wirkten.
Aber da war noch etwas …
Margarethe zwängte die Augen zusammen … und hörte auf zu atmen. Zehn, dann zwanzig Sekunden, in denen sie bloß dasitzen konnte, die rechte Hand vor den Mund geschlagen. Dann streckte auch sie den Zeigefinger aus und ließ ihn ungläubig über die Gesichter gleiten. Bei einem davon stoppte sie.
»Geht’s Ihnen nicht gut, Frau Stramm? Sie sind ja plötzlich ganz blass!«
8
Christian Brand betrat das Europol-Gebäude in der Eisenhowerlaan in Den Haag. Seine Stimmung hätte kaum schlechter sein können. Der Brief, den er in seiner Jackentasche hatte, wog tonnenschwer, war aber zugleich der letzte Ausweg, den er sah. Die Vorstellung, Inga Björks Vorgesetzter zu sein, war blanker Horror. Egal, welchen Sinn die neue Direktorin von Europol darin zu erkennen glaubte.
Bei dem Termin gestern Abend hatte Leona Willems viel geredet, aber keine Diskussion über ihre Entscheidung zugelassen. Von allem, was sie gesagt hatte, war ihm am lebhaftesten in Erinnerung geblieben: dass auch Männer unter ihrem Kommando Karrierechancen haben sollten