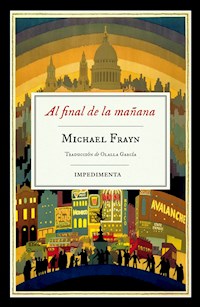Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten im Krieg spielen zwei Kinder Krieg: Im harmlosen Nachbarn erkennen Keith und Stephen einen Mörder, im Boden unter ihnen vermuten sie Geheimgänge, und ein leer stehendes Haus kommt ihnen höchst verdächtig vor. Doch auf einmal entwickelt ihr Spiel eine unheimliche Dimension: Keiths schöne, kultivierte Mutter hat nämlich tatsächlich etwas zu verbergen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mitten im Krieg spielen zwei Kinder Krieg: Das einzige Grundstück, das in dem stillen englischen Villenvorort von einer Bombe getroffen wurde, bietet Keith und Stephen ein ideales Versteck. Von hier aus versuchen sie, die trügerische Ordnung der bürgerlichen Welt zu entlarven: Im scheinbar harmlosen Nachbarn erkennen sie einen vielfachen Mörder, der Boden unter ihren Füßen, davon sind sie überzeugt, wimmelt von Geheimgängen, und finstere Gestalten gehen ein und aus in einem Haus, das auch bei Tag immer verdunkelt bleibt. Und dann stellt Keith fest, dass seine Mutter eine deutsche Spionin ist. Nach einer Weile merkt Stephen, dass sie mit ihrem Detektivspiel Dinge in Gang gesetzt haben, die außer Kontrolle geraten und eine unheimliche Eigendynamik entwickeln. Keith’ schöne, kultivierte, immer so beherrschte Mutter hat nämlich tatsächlich etwas zu verbergen, und Stephen ahnt zwar, was es sein könnte, und tut doch mit schrecklicher Unausweichlichkeit immer wieder das Falsche.
Mit großer Meisterschaft und sparsamen Mitteln macht Frayn feinste psychische Regungen, komplizierte Beziehungen und schleichende Veränderungen in diesen Beziehungen sichtbar. Frayn, der Zauberkünstler, demonstriert nicht zum ersten Mal, dass das, was sich scheinbar vor unseren Augen ereignet, sich oft als etwas entpuppt, was wir überhaupt nicht sehen können.
Hanser E-Book
Michael Frayn
Das Spionagespiel
Roman
Aus dem Englischen
von Matthias Fienbork
Carl Hanser Verlag
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Titel Spies bei Faber and Faber in London.
ISBN 978-3-446-25527-2
© Michael Frayn 2002
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:© Carl Hanser Verlag München 2004/2016
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München unter Verwendung eines Fotos © Bettman/Corbis
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
1
Die dritte Juniwoche, und da ist er wieder, dieser fast peinlich vertraute süßliche Hauch, der sich alljährlich um diese Zeit bemerkbar macht. Ich registriere ihn in der warmen Abendluft, wenn ich an den gepflegten Gärten in meiner ruhigen Straße vorbeigehe, und für einen Moment bin ich wieder ein Kind und alles liegt vor mir – all die ängstigenden, halb verstandenen Versprechungen des Lebens.
Er muß aus einem der Gärten kommen. Aber welchem? Ich kann es nicht erkennen. Und was ist es? Es ist nicht die herzzerreißend zarte Süße blühender Linden, für die diese Stadt bekannt ist, und auch nicht das heitere Sommerglück von Geißblatt. Es ist etwas ziemlich Intensives und Aufdringliches. Es riecht unangenehm, fast ein wenig obszön. Und es irritiert mich, wie immer. Ich empfinde – ja was? Unruhe. Eine Sehnsucht, hinter dem Wäldchen am Ende der Straße zu sein, weit weg. Aber gleichzeitig eine Art Heimweh nach dem Ort, wo ich gerade bin. Ist das möglich? Ich habe das Gefühl, daß es irgendwo noch etwas Ungelöstes gibt, daß ein Geheimnis in der Luft liegt, das seiner Enthüllung harrt.
Wieder eine Andeutung dieses Geruchs im leichten Sommerwind, und dann weiß ich, daß es meine Kindheit ist, nach der ich mich zurücksehne. Das Haus, nach dem ich Heimweh habe, existiert ja vielleicht noch. Jeden Sommer, Ende Juni, wenn dieser süße Duft kommt, stelle ich fest, daß es billige Flüge in dieses ferne, nahe Land gibt. Zweimal greife ich zum Hörer, um zu buchen, zweimal lege ich wieder auf. Du kannst nicht zurück, das weiß jeder … Ich werde also nie zurückkehren? Ist das meine Entscheidung? Ich werde alt. Wer weiß, vielleicht ist dieses Jahr die letzte Gelegenheit …
Aber was ist es, das so schrecklich irritierend in der Sommerluft liegt? Wenn ich nur wüßte, wie diese geheimnisvolle Blüte heißt, wenn ich sie nur sehen könnte, vielleicht wäre mir dann klar, woher ihre Kraft rührt. Plötzlich registriere ich den Duft, während ich meine Tochter und ihre beiden kleinen Kinder nach ihrem wöchentlichen Besuch zum Auto begleite. Ich lege ihr eine Hand auf den Arm. Sie kennt sich aus mit Pflanzen und in Gartenfragen. »Riechst du das? Da … jetzt … Was ist das?«
Sie schnuppert. »Die Kiefern«, sagt sie. Im sandigen Boden stehen hohe Kiefern, die den bescheidenen Häusern Schutz vor der Sommersonne bieten und unserer berühmten guten Luft eine belebende Frische verleihen. Der Geruch, der sich so listig aufdrängt, hat aber nichts Sauberes oder Würziges. Meine Tochter rümpft die Nase. »Oder meinst du diesen … ein bißchen ordinären Geruch?« sagt sie.
Ich lache. Sie hat recht. Der Geruch ist wirklich ein bißchen ordinär.
»Liguster«, sagt sie.
Liguster … Hilft mir auch nicht weiter. Den Namen habe ich natürlich schon gehört, aber es entsteht kein Bild in mir und keine Erklärung der Macht, die dieser Geruch über mich hat. »Es ist ein Strauch«, sagt meine Tochter. »Ziemlich verbreitet. Hast du in den Grünanlagen bestimmt schon gesehen. Sieht sehr langweilig aus. Erinnert mich immer an deprimierende, verregnete Sonntagnachmittage.« Liguster … Nein. Und doch rührt und regt sich alles in mir, als wieder ein Hauch dieser schamlosen Aufforderung über uns hinwegweht.
Liguster … Und doch flüstert er von etwas Geheimnisvollem, etwas Dunklem und Verstörendem tief in meinem Innern, von etwas, an das ich nicht gern denken möchte … Nachts wache ich auf, das Wort läßt mir keine Ruhe. Liguster …
Moment mal. Hatte meine Tochter Englisch gesprochen, als sie dieses Wort erwähnte? Ich hole mir das Wörterbuch … Nein. Und als ich sehe, was es auf englisch heißt, muß ich wieder lachen. Natürlich! Ganz klar! Diesmal lache ich auch aus Verlegenheit, weil ein professioneller Übersetzer bei einem so simplen Wort nicht passen sollte und weil es mir – nun da ich weiß, was es ist – als Auslöser derart intensiver Gefühle so lächerlich banal und unpassend erscheint.
Jetzt erinnere ich mich wieder an alle möglichen Dinge. Lachen zum Beispiel. An einem Sommertag vor fast sechzig Jahren. Ich habe nie mehr daran gedacht, aber da ist sie wieder, die Mutter meines Freundes Keith, im längst vergangenen grünen Sommerschatten, die braunen Augen funkeln, sie lacht über etwas, das Keith geschrieben hat. Jetzt verstehe ich natürlich, warum, da ich weiß, was es war, und ich den Geruch wieder spüre, der uns umgab.
Dann hört das Lachen auf. Sie sitzt weinend auf der Erde vor mir, und ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll. Um uns herum ist dieser süßlich betörende Geruch, unbemerkt dringt er bis in die verborgensten Winkel meines Gedächtnisses vor, um zeit meines Lebens in mir zu bleiben.
Keith’ Mutter. Sie muß jetzt in den Neunzigern sein. Oder tot. Wie viele der anderen wohl noch leben? Wie viele werden sich erinnern?
Und Keith selbst? Ob er je an die Ereignisse jenes Sommers denkt? Es könnte sein, daß er ebenfalls tot ist.
Vielleicht bin ich der einzige, der sich erinnert. Oder halbwegs erinnert. Verschiedene Dinge schießen mir blitzartig durch den Kopf, in beliebiger Reihenfolge, und sind schon wieder verschwunden. Funkenregen … Scham … Jemand, den man nicht sieht, hustet und versucht, das Husten zu unterdrücken … Ein Krug, bedeckt von einem Tuch, an dem vier blaue Glasperlen hängen …
Ja, und auch die Worte meines Freundes Keith, die alles überhaupt erst in Gang setzten. Oft ist es nicht ganz leicht, sich genau an die Worte zu erinnern, die jemand vor einem halben Jahrhundert gesagt hat, aber in diesem Fall ist es einfach, weil es nur so wenige waren. Sechs, um genau zu sein. Leichthin ausgesprochen wie die allerbeiläufigste Bemerkung, leicht und schwerelos wie Seifenblasen. Und doch haben sie alles verändert.
Wie das bei Worten eben ist.
Und nun, da ich einmal angefangen habe, wird mir plötzlich klar, daß ich gern länger über all diese Sachen nachdenken würde, um sie zu strukturieren, Verbindungen herzustellen. Es gab Dinge, die nie erklärt wurden. Dinge, die niemand aussprach. Es gab Geheimnisse. Jetzt möchte ich sie endlich ans Tageslicht bringen. Und obwohl ich inzwischen weiß, woher meine Unruhe rührt, spüre ich schon, daß immer etwas Ungelöstes bleiben wird.
Ich sage meinen Kindern, daß ich für ein paar Tage nach London fliegen werde.
»Haben wir dort eine Adresse von dir?« fragt meine praktisch denkende Schwiegertochter.
»Memory Lane vielleicht«, sagt mein Sohn trocken. Wir sprechen jetzt Englisch miteinander. Er spürt meine Unruhe.
»Genau«, antworte ich. »Das letzte Haus vor der verrückten Kurve, wo dann die Amnesie-Allee anfängt.«
Ich erwähne nicht, daß ich einem Strauch auf der Spur bin, der im Sommer ein paar Wochen blüht und mir den Seelenfrieden raubt.
Ich erwähne schon gar nicht, wie dieser Strauch heißt. Ich mag selbst kaum daran denken. Es ist zu absurd.
2
Alles ist wie früher, stelle ich fest, als ich mein Reiseziel erreicht habe, und alles hat sich verändert.
Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit ich zuletzt an dieser kleinen Station aus Holz ausgestiegen bin, aber meine Füße tragen mich mit müheloser, traumwandlerischer Selbstverständlichkeit hinunter zu der friedlichen, nachmittäglich belebten Hauptstraße, nach links zu der unordentlichen kleinen Ladenzeile und am Briefkasten wieder links in die vertraute Allee. Auf der Hauptstraße gibt es lauter komplizierte neue Verkehrsregelungen, die Geschäfte haben neue unpersönliche Namen und Fassaden, und aus den schmächtigen Pflaumenbäumchen, die in meiner Erinnerung die Allee säumten, sind nun weise und würdevolle Bäume geworden. Doch als ich um die Ecke biege, von der Allee in den Close …
Dort ist es noch wie früher. Die gleiche altvertraute, stille, süße, langweilige Durchschnittlichkeit.
Ich stehe an der Ecke, betrachte das alles, höre es, atme es ein, kann nicht genau sagen, ob ich gerührt bin, nach all dieser Zeit wieder dazusein, oder ob es mich gleichgültig läßt.
Langsam gehe ich weiter bis zu dem kleinen Wendekreis ganz am Ende. Dieselben vierzehn Häuser, ruhig und zufrieden an diesem warmen, trägen Sommernachmittag, genau wie früher. Langsam gehe ich wieder zur Ecke zurück. Alles ist noch da, genau wie früher. Ich weiß nicht, warum ich das so überraschend finde. Etwas anderes hatte ich nicht erwartet. Trotzdem, nach fünfzig Jahren …
Und während der erste Schock der Vertrautheit nachläßt, merke ich allmählich, daß überhaupt nichts so ist wie früher. Alles hat sich verändert. Die Häuser sind jetzt sauber und langweilig, ihre architektonische Vielfalt gewissermaßen homogenisiert durch neue Vorbauten und Lampen und aufgesetztes Fachwerk. In meiner Erinnerung war jedes Haus eine eigene Welt, so verschieden von den anderen wie die Menschen, die darin wohnten. Jedes Haus war, hinter seinem Schirm von Rosen oder Geißblatt, Linden oder Buddleia, ein Mysterium. Nun sind diese üppigen Pflanzen fast überall verschwunden und durch Abstellplätze und Autos ersetzt worden. Auch am Straßenrand bilden Autos geräuschlos eine Schlange. Die vierzehn einzelnen Reiche haben sich vereinigt zu einer Art gärtnerisch gestalteten Parkplatz. Alle Mysterien sind gelöst. In der Luft der höfliche, internationale Geruch von schnellwachsenden Immergrünpflanzen. Doch von dem wilden, unanständigen Geruch, der mich hierherlockte, ist selbst an diesem Spätjunitag nicht ein Hauch geblieben.
Ich schaue in den Himmel, das einzige Element jeder Landschaft und jeder Stadt, das von Generation zu Generation und von Jahrhundert zu Jahrhundert fortbesteht. Doch selbst der Himmel hat sich verändert. Einmal stand dort, in einem Wirrwarr heroischer Kondensstreifen, der Krieg geschrieben. Es gab die aufgerichteten Finger der nächtlichen Scheinwerfer und die riesigen bunten Leuchtraketengebäude. Jetzt ist selbst der Himmel mild und nichtssagend geworden.
An der Ecke zögere ich wieder. Langsam komme ich mir ziemlich töricht vor. Habe ich diese Reise unternommen, nur um die Straße hinauf- und hinterzugehen und den Duft der Zypressenhecken zu riechen? Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun oder empfinden könnte. Ich bin am Ende meiner Pläne angekommen.
Und dann merke ich, daß sich die Atmosphäre um mich herum verändert, als würde die Vergangenheit aus der Luft heraus wieder Gestalt annehmen.
Es dauert einen Moment, bis ich die Ursache erkenne. Es ist ein Geräusch – das Geräusch eines unsichtbaren Zuges, erst gedämpft und fern, plötzlich ganz deutlich, als er in dem Einschnitt hinter den Häusern am oberen Ende des Close auftaucht, genau wie der Zug, mit dem ich vor zwanzig Minuten angekommen bin. Unsichtbar fährt er den Bahndamm entlang, hinter den Häusern auf der linken Straßenseite, überquert dann eine Brücke und nähert sich, langsamer werdend, dem Bahnhof.
Während dieser vertrauten Abfolge von Geräuschen verändert sich vor meinen Augen das ganze Erscheinungsbild des Close. Das Haus links an der Ecke, vor dem ich stehe, gehört nun den Sheldons, das Haus gegenüber den Hardiments. Jetzt höre ich noch andere Geräusche. Das endlose Klappern von Mr. Sheldons unsichtbarer Gartenschere hinter der hohen Buchenhecke, die inzwischen verschwunden ist. Die endlosen Tonleitern, die die blassen Kinder der Hardiments in dunklen Räumen hinter dem Schirm aus hübsch miteinander verwachsenen Linden (noch vorhanden) spielten. Ich weiß, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, werde ich weiter unten die beiden Geest-Zwillinge bei einem komplizierten Himmel-und-Hölle-Spiel sehen, die identischen Pferdeschwänze identisch wippend … und auf der Zufahrt der Averys ein ölverschmiertes Knäuel aus Charlie und Dave und den Einzelteilen eines zerlegten Dreirads …
Aber im Moment richte ich den Blick natürlich auf Nr. 2, das Haus neben den Hardiments. Selbst dieses Haus ähnelt sonderbarerweise all den anderen, obwohl es mit Nr. 3 verbunden ist – das einzige Doppelhaus hier im Close. Inzwischen hat es offenbar einen Namen: Wentworth. Als ich darin wohnte, hatte es nur eine Nummer, und auch das kaum, denn das Namensschild am Gartentor war mit Teerfarbe überstrichen. Aber trotz des grandiosen neuen Namens und der frisch verputzten Fassade und der strikten Herrschaft, die Steinplatten und ein unpersönlich wirkender Rasen über den Vorgarten ausüben, strahlt das Haus noch immer eine gewisse Verlegenheit aus. Unter dem glatten weißen Putz glaube ich fast das alte, rissige, wasserfleckige Grau sehen zu können. Aus den Fugen der schweren Steinplatten sprießen die Geister wilder unbekannter Sträucher, um die mein Vater sich nie kümmerte, und das kleine kahle Rasenstück. Unsere Haushälfte wurde noch unansehnlicher durch die andere Hälfte, die in einem noch schlimmeren Zustand war, weil der Garten der Pinchers als Müllhalde für ausrangierte, vom Regen verzogene Möbel und Holz- und Metallreste diente, die Mr. Pincher an seinem Arbeitsplatz gestohlen hatte. Zumindest glaubten das die Leute in der Straße. Vielleicht, denke ich jetzt, lag das auch nur an seinem Namen. Jedenfalls waren die Pinchers die unerwünschten Elemente im Viertel – noch weniger erwünscht als wir –, und wegen der furchtbaren Verbindung unserer Häuserhälften färbte das auch auf uns ab.
Heute kann ich das so sehen. Aber hat er das damals auch schon so gesehen? Ich meine den schüchternen Jungen, der in diesem unordentlichen Haus zwischen den Hardiments und den Pinchers wohnt – Stephen Wheatley, der mit den Segelohren und dem zu kurzen grauen Schulhemd aus Flanell, das aus den zu langen grauen Flanellshorts hängt. Ich sehe, wie er aus der verworfenen Haustür tritt und sich noch immer einen Rest vom Nachmittagstee in den Mund stopft. Alles an ihm ist Grau, in den verschiedensten Tönen – selbst der elastische Gürtel, gestreift wie das Band eines altmodischen Strohhuts und zusammengehalten mit einer S-förmig verschlungenen Metallschlange. Die Streifen des Gürtels sind in zwei unterschiedlichen Grautönen, denn Stephen ist ganz und gar monochrom, und zwar deswegen, weil ich ihn so in Erinnerung habe, von den alten Schwarzweißfotos her, über die meine Enkel ungläubig lachen, wenn ich ihnen erkläre, daß ich das bin. Ich bin genauso ungläubig wie sie. Ohne die Schnappschüsse würde ich nicht wissen, wie Stephen Wheatley aussieht, oder jemals ahnen, daß er und ich verwandt sind, wenn auf der Rückseite nicht der Name stünde.
Aber noch jetzt spüre ich in den Fingerspitzen die zart schuppige Beschaffenheit der Schlangenhaut.
Stephen Wheatley … Oder einfach Stephen … Auf den Zeugnissen S.J. Wheatley, im Klassenzimmer oder auf dem Sportplatz einfach Wheatley. Merkwürdige Namen. Keiner paßt so richtig zu ihm, wenn ich ihn jetzt vor mir sehe. Er dreht sich noch einmal um, bevor er die Haustür zuwirft, und ruft mit vollem Mund irgendein unpassendes Schimpfwort als Antwort auf eine der vielen herablassenden Bemerkungen seines unerträglichen älteren Bruders. Einer seiner schmuddeligen Tennisschuhe ist nicht zugeschnürt, und ein grauer Strumpf schlängelt sich als dicker Wulst um seine Knöchel. In den Fingerspitzen spüre ich, so deutlich wie die Schuppigkeit der Schlange, das hoffnungslos ausgeleierte Gummiband des heruntergerutschten Strumpfs.
Weiß er in seinem Alter eigentlich schon, welchen Ruf er in der Straße genießt? Er weiß es sehr wohl, auch wenn er nicht weiß, daß er es weiß. In seinem Innersten spürt er, daß bei ihm und seiner Familie etwas nicht ganz stimmt, daß sie nicht ganz passen zu den Geests mit ihren Pferdeschwänzen und den ölverschmierten Averys, nie ganz passen werden.
Die Gartentür braucht er nicht zu öffnen, denn sie ist schon offen, hängt schief in den Angeln. Ich weiß, wohin er geht. Nicht hinüber zu Norman Stott, der ganz in Ordnung wäre, wenn nicht sein jüngerer Bruder Eddie wäre. Irgend etwas mit Eddie stimmt nicht – er hängt ständig herum, sabbert, grinst und will einen immer anfassen. Nicht zu den Averys oder den Geests. Ganz sicher nicht zu Barbara Berrill, die so listig und verräterisch ist wie die meisten Mädchen und noch unsympathischer, seit sein Bruder Geoff sich Brillantine ins Haar schmiert und in der Abenddämmerung mit Barbaras älterer Schwester Deirdre herumsteht und Zigaretten raucht. Der Vater der beiden Mädchen ist in der Armee, und alle sagen, daß die beiden es bunt treiben.
Wie ich schon ahnte, überquert Stephen nun die Straße, zu sehr in Gedanken, um auf den Verkehr zu achten – allerdings gibt es mitten im Krieg auch nicht viel Verkehr, auf den er achten müßte, abgesehen von gelegentlichen Fahrrädern und den langsam dahintrottenden Pferden, die den Karren des Milchmanns und des Bäckers ziehen. Stephen geht langsam, den Mund leicht geöffnet, in einem unbestimmten Tagtraum verloren. Was empfinde ich bei seinem Anblick? Vor allem wohl den Wunsch, ihn an den Schultern zu packen und zu schütteln, ihm zu erklären, er solle endlich aufwachen und nicht so … unbefriedigend sein. Ich erinnere mich, daß ich nicht der erste bin, der diesen Wunsch hat.
Ich folge ihm, vorbei an Trewinnick, dem mysteriösen Haus mit den ständig geschlossenen Verdunkelungsvorhängen und dem ungepflegten Garten hinter einem nordisch kalten und düsteren Kiefernwald. Trewinnick wirkt aber nicht schandbar wie unser Haus und das der Pinchers, von seiner düsteren Verschlossenheit geht etwas Unheimliches aus. Niemand weiß, wie die Leute heißen, die dort wohnen, oder wie viele es sind. Ihre Gesichter sind dunkel, ihre Kleider schwarz. Sie kommen und gehen bei Dunkelheit und lassen die Vorhänge auch bei Tag geschlossen.
Stephens Ziel ist das benachbarte Haus, Nr. 9, Chollerton. Die Haywards. Er öffnet die weiße, gutgeölte Gartentür und macht sie sorgfältig hinter sich zu. Er geht den mit Ziegeln gepflasterten Weg entlang, der sich durch die Rosenbeete windet, und hebt den schmiedeeisernen Klopfer an der schweren Eichentür. Zwei respektvolle, nicht zu laute Klopfer, gedämpft durch das solide Holz.
Ich warte draußen vor dem Gartentor und studiere diskret das Haus. Es hat sich weniger verändert als die meisten anderen. Die mattroten Backsteine sind sauber verfugt, die hölzernen Fensterrahmen, die Giebel und das Garagentor so makellos weiß wie damals, als Mr. Hayward sie in einem ebenso makellos weißen Overall anstrich, unentwegt pfeifend, von morgens bis abends. Der gepflasterte Weg windet sich noch immer durch die Rosenbeete, deren Ränder so geometrisch exakt sind wie früher. Die Haustür ist noch immer aus unlackierter Eiche und noch immer mit einem kleinen, rautenförmigen Fenster aus Drahtglas versehen. Der Name, der diskret auf dem oxydierten Kupferschild neben der Tür steht, lautet noch immer Chollerton. Hier jedenfalls ist die Vergangenheit in all ihrer Perfektion bewahrt worden.
Stephen wartet vor der Tür. Jetzt erst, zu spät, bemerkt er sein Äußeres. Er zieht den heruntergerutschten Strumpf hoch und beugt sich hinunter, um den einen Tennisschuh zuzuschnüren. Doch schon geht die Tür einen Spalt auf, ein Junge in Stephens Alter zeigt sich, eingerahmt von der dunklen Diele. Auch er trägt ein graues Flanellhemd und eine kurze graue Flanellhose. Sein Hemd ist allerdings nicht zu kurz, seine Hose nicht zu lang. Die grauen Strümpfe sitzen ordentlich bis knapp einen Fingerbreit unter dem Knie, und seine braunen Ledersandalen sind ordentlich zugeschnallt.
Er dreht den Kopf zur Seite. Ich weiß, warum. Er hört seine Mutter fragen, wer an der Tür ist. Stephen, antwortet er. Sie sagt, er solle ihn hereinbitten oder aber mit ihm spielen gehen, jedenfalls nicht auf der Schwelle herumstehen, nicht richtig drinnen, nicht richtig draußen.
Keith macht die Tür ganz auf. Stephen säubert seine Schuhe rasch über dem eisernen Schuhabstreifer, dann ein zweites Mal auf der Matte im Haus, und der Strumpf mit dem lockeren Gummiband rutscht wieder herunter. Hinter ihm schließt sich die Tür.
Hier fing die Geschichte an. Bei den Haywards. An dem Tag, als Keith, mein bester Freund, diese sechs einfachen Wörter aussprach, die unsere Welt von Grund auf veränderten.
Ich frage mich, wie es in diesem Haus inzwischen aussieht. Das erste, was man damals sah, wenn sich die Tür öffnete, war eine Flurgarderobe aus polierter Eiche, mit Kleiderbürsten, Schuhlöffeln und Haken und einem Gestell für Stöcke und Regenschirme. Und wenn man eingetreten war, dunkle Eichentäfelung, zwei Aquarelle der Trossachs von Alfred Hollings und zwei Porzellanteller mit blauen Pagoden und kleinen blauen Figuren mit Strohhüten auf kleinen blauen Brücken. Zwischen Wohnzimmer und Eßzimmer befand sich eine Standuhr, die alle Viertelstunde schlug, nicht ganz im Takt mit den Uhren in anderen Zimmern, so daß das Haus viermal die Stunde von einer ätherischen Musik erfüllt wurde, die nie ganz gleich klang.
Und mittendrin mein Freund Keith. Das Bild ist natürlich nicht mehr monochrom, denn ich sehe jetzt die Farbe unserer Gürtel. Der von Keith, ebenfalls mit einem metallenen schlangenförmigen Verschluß, hat zwei gelbe Streifen auf schwarzem Grund, meiner dagegen zwei grüne Streifen. Das sind Farbcodes zwecks rascher sozialer Zuordnung. Gelb und Schwarz sind die Farben der richtigen Grundschule, an der jeder Schüler die Aufnahmeprüfung für eine Privatschule ablegt und besteht und jeder seinen eigenen Kricketschläger hat, seine eigenen Stiefel und Knieschützer und einen besonders langen Beutel, in den man das alles steckt. Grün und Schwarz sind die Farben der falschen Schule, deren Schüler zur Hälfte schlaksige Lümmel sind wie mein Bruder Geoff, die die Aufnahmeprüfung nicht bestanden haben. Kricket spielen wir mit ramponierten Schlägern, die Eigentum der Schule sind, und einige von uns tragen braune Turnschuhe und die übliche kurze graue Hose.
Mir war schon damals bewußt, welch unglaubliches Glück es war, Keith zum Freund zu haben. Jetzt, als Erwachsener, erscheint es mir noch viel erstaunlicher. Nicht nur sein Gürtel, alles an ihm war Gelb und Schwarz, während alles an mir Grün und Schwarz war. Er war das Offizierskorps in unserer Zwei-Mann-Armee, ich war die Mannschaftsdienstgrade – und dankbar dafür.
Bei all unseren Unternehmungen und Projekten war er stets der Führer, ich der Geführte. Jetzt sehe ich, daß er nur der erste in einer Reihe dominanter Figuren in meinem Leben war, deren Jünger ich wurde. Seine Autorität gründete, völlig zu Recht, auf seiner geistigen Überlegenheit und seiner größeren Phantasie. Keith war es, nicht ich, der sich die Seilbahn zwischen unseren Häusern ausgedacht hatte, mit der Botschaften hin und her gehen konnten wie Geldscheine und Münzen auf einem Ladentisch, und anschließend die erstaunliche Untergrundbahn konstruierte, die wie jenes pneumatische Geldtransportsystem funktionieren würde, das wir bei Expeditionen in ein nahe gelegenes Kaufhaus gesehen hatten, und mit der wir, unbemerkt von den Nachbarn, rasch und mühelos hin und her fahren konnten. Beziehungsweise fahren würden, sobald die Pläne umgesetzt waren.
Keith war es, der entdeckt hatte, daß Trewinnick, das mysteriöse Nachbarhaus mit den ständig geschlossenen Gardinen, von den Juhn bewohnt wurde, einer üblen Organisation, die offenbar hinter allen möglichen Betrügereien und Verschwörungen stand. Er war es, der eines Sonntagabends am Bahndamm hinter den Häusern den geheimen Durchgang entdeckt hatte, durch den die Juhn kamen und gingen. Beziehungsweise hätte er ihn im nächsten Moment entdeckt, wenn sein Vater ihm nicht aufgetragen hätte, rechtzeitig zu Hause zu sein und seine Kricketschuhe zu reinigen, damit sie für den nächsten Schultag parat waren.
Keith und Stephen stehen also jetzt in der Diele, umgeben von der dunklen Täfelung und dem Schimmer der Silberdinge und dem feinen Ticken der Uhren, und denken sich aus, was sie an diesem Nachmittag machen wollen. Beziehungsweise Stephen wartet darauf, daß Keith sich etwas ausdenkt. Vielleicht hat ihm der Vater die eine oder andere Arbeit im Haus aufgetragen, bei der Stephen mithelfen darf. Sein Fahrrad pflegen beispielsweise oder den Boden rings um die väterliche Werkbank in der Garage fegen. Besonders das Fahrrad verlangt viel Pflege, weil Keith jeden Tag damit in die Schule fährt und weil es ein spezielles Sportmodell ist, das mit speziellem Öl geölt und mit speziellem Reinigungsmittel gereinigt werden muß, bis der grüne Rahmen glänzt und Chromlenker und Felgen und Dreigangnabe in der Sonne funkeln. Mit dem Rad zur Schule zu fahren ist natürlich die einzig wahre Art. Mit dem Bus zu fahren, in den Stephen jeden Tag an der rissigen Betonhaltestelle auf der Hauptstraße einsteigt, ist eindeutig die falsche Art. Grün ist die richtige Farbe für ein Fahrrad, aber die falsche für einen Gürtel oder einen Bus.
Oder vielleicht gehen sie nach oben, ziehen sich in Keith’ Spielzimmer zurück. Sein Spielzimmer ist genauso ordentlich wie das übrige Haus. Keine blöden Brüder oder Schwestern machen sich breit und bringen alles durcheinander, wie in Stephens Familie und überall in der Nachbarschaft, wo es Kinder gibt. Keith’ Spielzeug gehört ihm ganz allein, es ist ordentlich in Schubladen und Schränken verstaut, oft noch in der Originalverpackung. All die solide gebauten Rennautos und Motorboote mit ihrem Federwerk verbreiten den wunderbar richtigen Geruch von Uhrmacheröl. Es gibt aufwendige Konstruktionen, sauber nach Anleitung zusammengebaut, mit Zahnrädern und Sperrklinken und Schneckengetrieben, außerdem maßstabgetreue Modelle von Spitfires und Hurricanes, aus Bausätzen zusammengeklebt, mit Kanzeln aus Plexiglas und Tragflächen mit ausfahrbarem Fahrwerk in wunderschönem Enteneiblau. In manchen Schubladen sind batteriegetriebene Gegenstände – Taschenlampen, die in drei verschiedenen Farben leuchten, und kleine optische Instrumente, die Licht durch Linsen und Prismen werfen –, alle in funktionstüchtigem Zustand. Auf einem Bücherregal stehen Abenteuergeschichten, in denen einsame Inseln kolonisiert, Doppeldecker geflogen und Geheimgänge entdeckt werden. In einem zweiten Regal stehen Bücher, in denen zu lesen ist, wie man aus leeren Zigarrenkisten einen Überlagerungsempfänger baut und wie man Eier in seidene Tücher verwandelt.
Bei schönem Wetter und wenn sein Vater nicht gerade den Rasen gemäht hat, spielen sie vielleicht draußen im Garten. Sie bauen eine Eisenbahn, die vom Flachland der Blumenbeete hinter der Garage hinaufführt zu den hohen Bergpässen des Luftschutzbunkers, auf spektakulären Brücken atemberaubende Schluchten überwindet, dann durch gefährliches Banditengebiet durch den Küchengarten und weiter hinunter in das wichtige Industrie- und Hafengelände hinter dem Gurkenbeet führt. Beziehungsweise sie werden sie bauen, sobald Keith von seinem Vater alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt hat.
Vielleicht gehen sie auch hinaus zum Golfplatz, wo Keith ein sonderbares wildes Tier beobachtet hat, eine Art sprechenden Affen, der sich hinter dem Stechginster versteckt, oder zu den Kleingärten von Paradise, wo er einmal ein abgestürztes deutsches Flugzeug gesehen hat, dessen Pilot tot im Cockpit saß. Dabei sprechen sie über ihren Plan, einen Ein-Mann-Gleitsegler zu bauen, der vom Dach aus starten könnte, oder ein richtiges Auto mit richtigem Lenkrad. Den Gleitsegler und das Auto hat natürlich Keith konstruiert, aber bei der Entwicklung des Autos spielt Stephen eine wichtige Rolle, denn es soll mit vielen alten Federwerken angetrieben werden, die nicht aus Keith’ unantastbaren Spielsachen ausgebaut, sondern aus dem reichhaltigen Vorrat an kaputten Motoren in Stephens chaotischer Spielzeugkommode geplündert werden.
Ganz viele Vorhaben sind in der Planung, und ganz viele Geheimnisse müssen aufgeklärt werden. Eine Möglichkeit ist jedoch so abwegig, daß sie überhaupt nie in Betracht käme – die Vorstellung, bei Stephen zu spielen. Warum auch? Durch die uninteressanten Savannen seines Gartens fährt keine große Interkontinentaleisenbahn, und Stephen würde nie auf die Idee kommen, andere Jungen, schon gar nicht Keith, in das Zimmer einzuladen, in dem er und Geoff nicht nur spielen, sondern auch schlafen und Hausaufgaben machen. Schon die beiden Betten sind hinderlich; bei Keith ist das Schlafzimmer ganz woanders als das Spielzimmer. Schlimmer ist, was in, auf und unter den Betten liegt – ein hoffnungsloses Durcheinander aus Bindfäden und Plastilin und Verlängerungsschnüren und vergessenen Strümpfen und Staub, alten Kartons mit vergammelten Schmetterlingen und zerbrochenen Vogeleiern, Überreste unvollendeter alter Projekte.
Ich versuche, mir das Unmögliche vorzustellen, daß Keith nämlich seine Mutter fragt, ob er bei Stephen spielen dürfe … Ich muß lachen bei dem Gedanken. Seine Mutter sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa, schaut von ihrem Buch aus der Leihbücherei auf und zieht die perfekt gezupfte Augenbraue leicht in die Höhe. Was wird sie sagen?
Ich weiß genau, was sie sagen wird: »Schätzchen, ich glaube, das fragst du lieber Daddy.«
Und was würde Daddy sagen, wenn Keith soviel Mut und Entschlossenheit aufbrächte, auf diesem absurden Vorschlag zu beharren? Würde er sich umdrehen und ausnahmsweise einmal Stephen ansehen, voller Erstaunen über die Unverschämtheit? Natürlich nicht. Er würde auf die Frage auch nicht antworten. Er würde nur irgend etwas sagen wie: »Hast du schon deinen Kricketschläger eingeölt, Junge?«, und damit hätte es sich. Sie würden in die Küche gehen, sich von Mrs. Elmsley eine Zeitung geben lassen, diese auf den Boden legen und dann Keith’ Kricketschläger einölen.
Heute wundert mich, daß Keith’ Eltern ihrem Sohn überhaupt erlaubt haben, unterirdische Gänge und eine Drahtseilbahn zu Stephens Haus zu bauen, Vogelnester mit ihm zu plündern und auf Affenjagd zu gehen, Stephen einzuladen, mit seinen tadellos gepflegten Spielsachen zu spielen und beim Reinigen seines speziellen Sportrads zu helfen. Es ist möglich, daß Keith’ Vater Stephen überhaupt nicht wahrgenommen hat, während Keith’ Mutter ihn durchaus beachtete. Sie sprach ihn nicht persönlich an, sondern wandte sich kollektiv an Keith und an ihn – als »ihr beide« oder »Jungs«. »Möchtet ihr beiden ein Glas Milch?« sagte sie vielleicht am Vormittag und sah dabei Keith an. Oder: »Los, Jungs, es wird Zeit, daß ihr eure Spielsachen aufräumt.« Manchmal beauftragte sie Keith, Stephen etwas von ihr auszurichten: »Schatz, muß Stephen keine Hausaufgaben machen …? Keith, Liebes, möchtest du, daß Stephen zum Tee bleibt?«
Sie sprach sanft und lächelte dabei, still amüsiert und ohne die Lippen viel zu bewegen. Einen großen Teil des Tages ruhte sie mit hochgelegten Beinen auf dem Sofa oder in ihrem Zimmer auf dem Bett, und überhaupt machte sie immer den Eindruck, als ruhe sie. Wenn sie in der Tür des Spielzimmers stand, um bekanntzugeben, daß sie Tante Dee besuchen oder einkaufen gehen wolle, fragte sie ruhig, entspannt und gelassen: »Ihr kommt zurecht, ja? Ihr könnt euch beschäftigen?« Wenn sie nicht einkaufen oder Tante Dee besuchen ging, dann ging sie zum Briefkasten. Stephen schien es, als würde sie mehrmals am Tag Briefe einwerfen.
Keith’ Vater dagegen arbeitete den ganzen Tag. Nicht in einem unsichtbaren Büro, wie Stephens Vater und all die anderen Väter, die nicht bei den Streitkräften waren, sondern im Garten, im Küchengarten und ums Haus herum. Man sah ihn unentwegt graben und düngen, zurückschneiden und stutzen, unentwegt grundieren und anstreichen, Leitungen verlegen und erneuern, die Vollkommenheit unentwegt weiter vervollkommnen. Selbst die Hühner hinten im Garten führten ein untadelig elegantes Leben, hochmütig stolzierten sie in einem weitläufigen Reich, das von einer schnurgeraden Mauer aus funkelndem Maschendraht umgrenzt war, zogen sich dann zurück und legten saubere braune Eier in einem Stall, in dem die vertrauten Gerüche von Futter und Kot sich dezent vermischten mit dem Duft von frischem Teeranstrich draußen und frischer Tünche im Innern.
Seine Operationszentrale war jedoch die Garage. Das vordere Tor wurde nie geöffnet, aber es gab eine kleine Tür an der Seite, gegenüber der Küche, und wenn Keith seinen Vater um Erlaubnis bitten mußte, den Rasen zu betreten oder auf den Gehwegen Bahngleise zu verlegen, konnte Stephen, hinter ihm stehend, manchmal einen Blick in dieses wundervolle Privatreich werfen. Keith’ Vater beugte sich über ein Stück Holz oder Metall, das in dem großen Schraubstock der Werkbank eingespannt war, und feilte, sägte oder hobelte; oder er schärfte seine diversen Stechbeitel an einem rotierenden Schleifstein; oder er suchte in den hundert ordentlich aufgeräumten Schubladen und Fächern über und unter der Werkbank nach Schleifpapier einer ganz bestimmten Körnung oder nach einer Schraube mit einem ganz bestimmten Durchmesser. Ein charakteristischer Geruch lag in der Luft. Was war es? Sicherlich Sägespäne und Maschinenöl. Vielleicht gefegter Boden. Und Auto.
Auch das Auto war ein Muster an Vollkommenheit, eine kleinere Limousine, deren blitzende Chromteile in der dunklen Garage schimmerten; Karosserie und Motor waren tadellos gepflegt, damit der Wagen, wenn es nach Kriegsende wieder Benzin gab, einsatzbereit zur Verfügung stand. Manchmal waren von Keith’ Vater nur die Beine zu sehen, die aus einem Lichtschein unter dem Auto hervorragten, wenn er regelmäßig die vorgeschriebenen Inspektionen einschließlich Ölwechsel durchführte. Nur die Räder fehlten. Das Auto stand, völlig unbeweglich, auf vier sorgfältig hergerichteten Holzblöcken, damit es, wie Keith erklärte, bei einer deutschen Invasion nicht beschlagnahmt werden konnte. Die Räder hingen ordentlich an der Wand, neben einem Picknickkorb, Tennisschlägern in Holzspannern, unaufgeblasenen Luftmatratzen und Gummireifen – all dem Zubehör eines vergessenen Freizeitlebens, das, wie so vieles andere, für die Dauer des Krieges suspendiert war, dieses großen, alles überragenden Umstands, der aller Leben in der unterschiedlichsten Weise prägte.
Stephen faßte sich einmal ein Herz und fragte Keith im Vertrauen, ob die Deutschen mit ihrem berüchtigten Scharfsinn denn nicht die Räder von der Wand nehmen und anmontieren würden. Keith erklärte ihm, daß die Radmuttern in einem Geheimfach im Nachttisch seines Vaters versteckt seien, zusammen mit dem Revolver, den er als Offizier im letzten Krieg getragen hatte und mit dem er im Falle einer Invasion den Deutschen diesmal eine böse Überraschung bereiten werde.
Keith’ Vater arbeitete unaufhörlich und pfiff dabei. Er pfiff unbeschwert und fröhlich wie ein Singvogel, eine unendlich komplexe, mäandernde Melodie, die nie ein Ende fand – ebensowenig wie seine Arbeit. Selten hatte er einen Augenblick Zeit, um etwas zu sagen. Wenn, dann waren es rasch hingeworfene, trockene, ungeduldige Worte. »Frisch gestrichen, die Tür«, konnte er beispielsweise zu Keith’ Mutter sagen. Wenn er gut gelaunt war, sagte er »mein Junge« zu Keith. Manchmal wurde daraus »Junge«, was schon einen befehlsmäßigen Unterton hatte: »Fahrrad in den Schuppen, Junge!« Manchmal bezeichnete er Keith aber als »Freundchen« und verzog dabei die Lippen zu etwas, das wie Lächeln aussah. »Wenn dein Flugzeug das Gewächshaus trifft, Freundchen, setzt es was«, sagte er lächelnd. Keith glaubte ihm offenkundig. Desgleichen Stephen. Im Flur standen neben den Spazierstöcken und Regenschirmen auch ein paar Rohrstöcke. Zu Stephen sagte er nie etwas – er sah ihn nicht einmal an. Selbst wenn es Stephen war, der das Gewächshaus zu beschädigen drohte, war Keith das »Freundchen«, und es war Keith, der den Rohrstock abbekam, denn Stephen existierte nicht. Aber auch Stephen sprach nie mit ihm und sah ihn nie an, ob er nun lächelte oder nicht. Vielleicht weil er Angst hatte, oder vielleicht weil das nicht geht, wenn man nicht existiert.
Keith’ Vater flößte aber noch aus anderen Gründen Respekt ein. Keith hatte einmal erzählt, daß sein Vater im letzten Krieg fünf Deutsche getötet hatte und dafür mit einen Orden ausgezeichnet worden war. Er hatte sie mit einem Bajonett erstochen, wenn Stephen sich auch nicht traute, zu fragen, wie Keith’ Vater denn ein Bajonett an dem berühmten Revolver aufgepflanzt hatte. Allerdings existierte das Bajonett, es wippte furchteinflößend über dem khakibehosten Hintern, wenn Keith’ Vater jedes Wochenende in seiner Uniform der Home Guard loszog; allerdings ging er, wie Keith einmal erklärt hatte, genaugenommen nicht zur Home Guard, sondern zu einer speziellen Arbeit für den Geheimdienst.
Die Haywards waren mustergültig. Und trotzdem tolerierten sie Stephen! Er war vermutlich der einzige Mensch aus der Nachbarschaft, der je ihr Haus oder auch nur ihren Garten betreten hatte. Ich versuche mir vorzustellen, wie Norman Stott in Keith’ Spielzimmer herumtrampelt … oder wie Barbara Berrill zum Tee eingeladen wird … Meine Phantasie läßt mich im Stich. Ich kann mir nicht einmal vollkommen anständige und wohlerzogene Kinder wie die beiden Geests oder die blassen Musikanten von Nr. 1 vorstellen, wie sie brav zwischen den Rosenbeeten spielen. Einen Erwachsenen kann ich mir übrigens genausowenig vorstellen. In Gedanken stehe ich hinter Keith, der gerade an die Wohnzimmertür klopft … »Herein«, sagt die Stimme seiner Mutter, kaum erhoben. Er öffnet die Tür, und nun sieht man, kultiviert mit seiner Mutter Tee trinkend … wen? Natürlich nicht Mrs. Stott oder Mrs. Sheldon. Nicht meine Mutter (völlig absurde Vorstellung!). Nicht Mrs. Pincher …
Niemanden. Nicht einmal Mrs. Hardiment oder Mrs. McAfee.
Keith’ Mutter kann man sich aber auch nicht in irgendeinem der anderen Häuser im Close vorstellen.
Ausgenommen bei Tante Dee.
Tante Dee war noch so ein bemerkenswertes Schmuckstück der Familie Hayward.
Sie wohnte drei Häuser weiter, auf derselben Straßenseite, fast gegenüber von Stephen, hinter schokoladenbraunem Fachwerk und blühenden Mandelbäumen. Für meine Mutter und die übrige Straße war sie Mrs. Tracey. Keith’ Mutter war hochgewachsen, Tante Dee war klein. Keith’ Mutter war nie gehetzt und lächelte immer ruhig; Tante Dee war immer in Eile und lächelte alles andere als ruhig, sondern fröhlich und mit bedenkenlos entblößten weißen Zähnen. Keith’ Mutter ging ständig einkaufen, nicht nur für sich, auch für Tante Dee, weil Tante Dee von der kleinen Milly beansprucht wurde, und wenn sie nicht einkaufte, ging sie zu Tante Dee und kümmerte sich um Milly, während Tante Dee unterwegs war.
Manchmal schickte Keith’ Mutter ihren Sohn an ihrer Statt los, mit zwei, drei frisch gelegten Eiern aus dem vorbildlichen Hühnerstall im hinteren Teil des Gartens oder einer Zeitung voll frisch geerntetem Frühjahrsgemüse, und Stephen kam mit. Tante Dee begrüßte uns, sobald die Tür aufging, mit einem unbekümmerten Lächeln, und sie redete nicht nur mit Keith, sondern mit uns beiden, als existierte ich genauso wie Keith. »Hallo, Keith! Du hast dir ja deine Haare schneiden lassen! Sieht prima aus! Hallo, Stephen! Deine Mama hat erzählt, du und Geoff hattet gräßlichen Schnupfen. Geht’s dir besser inzwischen …? Na, Gott sei Dank! Setzt euch einen Augenblick zu Milly, ich schau mal, ob ich ein Stück Kuchen für euch finde.«
Und Keith und ich saßen verlegen im Wohnzimmer, inmitten des Kuddelmuddels von Kinderspielsachen, die auf dem Boden herumlagen, und verzogen unwillig das Gesicht, wenn Milly ihre Puppen und Bilderbücher anschleppte und versuchte, uns auf den Schoß zu klettern, lächelnd und zutraulich wie ihre Mutter. In diesem Haus sah es fast so schlampig aus wie bei uns. Der Garten draußen vor der Terrassentür war noch schlimmer. Auf dem vernachlässigten Rasen stand das Gras so hoch wie die Krockettore, die seit mehreren Sommern dort vergessen vor sich hin rosteten. Wenn wir bei Tante Dee waren, hatte Keith immer diesen ungnädigen Gesichtsausdruck seines Vaters, die Augenlider leicht gesenkt, die Lippen gespitzt, als wollte er gleich zu pfeifen anfangen. Aus meiner Sicht hatte das aber nichts mit der vollendeten Tantenhaftigkeit seiner Tante zu tun. Tanten hatten einfach fröhlich und gastfreundlich und unordentlich zu sein. Sie hatten kleine Kinder, die einen anlachten und einem auf den Schoß krabbelten. Keith’ tadelnder Blick war nur der Blick, den ein guterzogener Neffe im Haus seiner Tante eben aufsetzte. Es war ein weiterer Beweis der unerschütterlichen Korrektheit seines Elternhauses.
Es gab ja auch einen Grund für die Unordnung. Tante Dee und sogar die Unordnung selbst schienen erfüllt von einem frommen Lichtschein, wie eine Heilige mit ihren Attributen auf einem religiösen Gemälde, denn beide spiegelten Onkel Peters Ruhm wider.