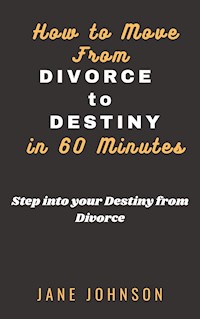9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wunderschöner Roman über Liebe, Verlust und neue Chancen im malerischen Cornwall.
Cornwall 1954: Nach der Trennung von ihrem Mann zieht die 26-jährige Mila mit ihrer Mutter Magda und ihrer fünfjährigen Tochter Jane in das halb verfallene Herrenhaus White Cove, um ein neues Leben zu beginnen. Doch kurz nach ihrem Einzug stellen die drei fest, dass sie nicht allein in dem großen Haus sind. Ein Fremder namens Jack Lord, der beharrlich über seine Vergangenheit schweigt, hat sich in dem alten Gemäuer eingerichtet. Nach anfänglichem Befremden freunden sie sich mit Jack an, der ihnen bei den Renovierungsarbeiten hilft. Zwischen Mila und Jack entwickelt sich schnell eine tiefe Nähe. Doch kann sie ihm trauen? Zumal sich bald herausstellt, dass White Cove voller Geheimnisse steckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Buch
Cornwall 1954: Nach der Trennung von ihrem Mann zieht die 26-jährige Mila mit ihrer Mutter Magda und ihrer fünfjährigen Tochter Jane in das halb verfallene Herrenhaus White Cove, um ein neues Leben zu beginnen. Doch kurz nach ihrem Einzug stellen die drei fest, dass sie nicht allein in dem großen Haus sind. Ein Fremder namens Jack Lord, der beharrlich über seine Vergangenheit schweigt, hat sich in dem alten Gemäuer eingerichtet. Nach anfänglichem Befremden freunden sie sich mit Jack an, der ihnen bei den Renovierungsarbeiten hilft. Zwischen Mila und Jack entwickelt sich schnell eine tiefe Nähe. Doch kann sie ihm trauen? Zumal sich bald herausstellt, dass White Cove voller Geheimnisse steckt …
Weitere Informationen zu Jane Johnson
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorinfinden Sie am Ende des Buches.
JANE JOHNSON
Das Sturmhaus
ROMAN
Deutsch von pociao und Roberto de Hollanda
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The White Hare« bei Apollo Publishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2026
Copyright © 2022 by Jane Johnson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2026
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: FinePic® c/o ZERO Werbeagentur GmbH, München
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32854-2V001
www.goldmann-verlag.de
Für Abdel und die Robben, die unterhalb des Gartens im Meer schwimmen
Es gibt keine Landschaft, die völlig unschuldig ist.
Anselm Kiefer
1
Die Leiche liegt am Ufer des Strandes, umspült von den Ausläufern der Brandung. Wenn sich das Wasser wieder zurückzieht, bleiben kleine Bäche und Strudel um Kopf und Füße, Kieselsteine rasseln, und das lange rote Haar wogt wie Seetang.
Eine Mantelmöwe schießt hinab, um sich ein Bild von der Lage zu machen. An diesem tückischen Küstenabschnitt werden häufig Robben, hin und wieder auch Delfine, angespült. Die instinktive Neugier, gepaart mit dem kollektiven Gedächtnis, treiben den ewigen Aasfresser dazu, die Sache zu untersuchen. Doch das tote Ding ist weder eine Robbe noch ein Delfin. Es verströmt auch keinen Gestank, als der Vogel darüber hinweggleitet, und so fliegt er weiter und lässt sich am westlichen Arm der Bucht von einem Aufwind über die dunklen Wälder am Berghang tragen.
Am östlichen Horizont bricht eine blasse Sonne durch den Dunst, Meer und Landzunge verschmelzen in der Ferne zu einer Fata Morgana, aus der sich vielleicht Festungen erheben und wieder versinken oder Geisterschiffe mit zerfetzten Segeln nach ihren verlorenen Mannschaften suchen. Es könnte jederzeit sein – oder zu keiner Zeit.
Und die Leiche liegt noch immer da, größere Wellen heben ihre Hand leicht an, als versuchte sie schwach um Hilfe zu rufen, doch niemand kommt.
Austernfischer fliegen vorbei, dicht über der glatten Oberfläche des Ozeans, ihre klagenden Stimmen durchbohren die kühle Luft. Aus dem Wald erheben sich krächzende Krähen unter plötzlichem Flügelschlagen, das im dunklen Spalt des Tals widerhallt.
Sandmücken sammeln sich um einen Haufen von Algen, die weiter oben von der Flut angespült wurden, und driften träge über den Leichnam, während die Wellen sich langsam wieder ins Meer zurückziehen. Ein graugrüner kleiner Krebs krabbelt aus einem Tümpel im Felsen, bewegt sich seitwärts über die von der Gischt überfluteten Steine und den Fuß der Leiche, hält kurz inne, um die ungewohnte Beschaffenheit der Oberfläche zu erfassen, und setzt dann seinen Weg fort, schneller diesmal, als hätte die Entdeckung ihn verstört.
Die Sonne klettert höher. Die Leiche liegt nun vollständig frei, ein deutlicher Markstein am Ufer. Wie jemand, der sich auf die Seite gelegt hat, um auszuruhen, den Arm über den Kopf geworfen, das Gesicht vom Land abgewandt, als wollte er menschlichen Kontakt meiden. Die Fußsohlen sind lilienweiß und schon ein bisschen runzlig. Ein Knie ist angezogen, sodass es aussieht, als würde er tanzen. Die Flecken auf seiner Kleidung heben sich von den gedämpften Farben der natürlichen Umgebung ab und unterstreichen die Szene wie ein Schrei.
Blaue Flecken blühen wie dunkle Rosen auf den blassen Gliedmaßen. Entlang dieses Küstenabschnitts gibt es viele vom Wasser überflutete Felsen. Es ist ein Ort, an dem Seeleute von ihren sturmgepeitschten Schiffen geschleudert werden und versuchen, sich ans Ufer zu retten, um dann festzustellen, dass die Strömung gegen sie arbeitet. Nur wenige überleben einen Schiffbruch hier, wenn überhaupt. Aber diese Leiche ist nicht das Opfer eines Schiffbruchs.
In dieser Gegend heißt es, dass für eine kurze Zeit die Augen der Toten das geisterhafte Bild des Mörders oder der Mörder festhalten, auf die ihr letzter Blick fiel. Aber vielleicht kamen diejenigen, die diese Leiche fanden, zu spät, denn in ihren klaren blauen Augen spiegelt sich nur der leere Himmel wider.
2
1954
Der Sommerwind fährt durch die Bäume, bis sie schwanken und ächzen, als unser Morris Oxford die enge Straße zum Haus in White Cove hinunterholpert und wir auf den harten Ledersitzen hin- und hergeworfen werden. Ein Mittelstreifen aus hohen, mit Löwenzahn und anderem bunten Unkraut gemischten Gräsern lässt erkennen, dass die Straße wenig befahren wird. Noch nie im Leben war ich an so einem abgelegenen Ort. Selbst die sogenannte Hauptstraße, von der wir eine Meile zuvor abgebogen sind, war so schmal, dass man teilweise eine der hohen Hecken streifen musste, wenn einem der örtliche Bus entgegenkam, was uns auch prompt passiert war.
»Glaubst du, dass die Umzugsleute es bis hierher schaffen?«, frage ich im Versuch, eine Unterhaltung zu beginnen, während ich mich an dem ledernen Haltegurt festklammere.
»Jedenfalls zahle ich ihnen genug dafür.«
Meine Mutter Magda konzentriert sich auf die kurvenreiche Straße, ohne eine Miene zu verziehen. Meine Skepsis hat sie verärgert, und dann mache ich auch alles noch schlimmer. »Der Bauernhof, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, sah ziemlich trostlos und runtergekommen aus. Was für eine einsame Gegend.«
Magdalena wirft mir einen Blick von der Seite zu. »Wir wollten den Menschen aus dem Weg gehen, falls du dich erinnerst, meineLiebe.« Sie macht eine grausame Pause, dann sagt sie: »Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal ein wenig Dankbarkeit zeigen.«
Ich werde rot. »Ich habe mich schon hundertmal bedankt. Was soll ich noch tun?«
»Nie bądź głupia, Mila. Zeig ein bisschen mehr Grips.«
Grips ist das englische Lieblingswort meiner Mutter.
Vom Rücksitz meldet sich eine kleine Stimme. »Sind wir schon da?«
»Janey, Herzchen.« Ich drehe mich um und betrachte meine Tochter, ihre ganzen fünf und etwas Jahre, das kurze blonde Haar zerzaust, die Wangen rosa und zerknittert vom Liegen auf einem Kleiderhaufen, den Stoffhasen an die Brust gepresst, und plötzlich ist alles wieder in Ordnung. »Hast du gut geschlafen?«
»Nein.« Das klingt entschieden. »Das Auto ist sehr ungemütlich.«
»Tja, Janeska, wir müssen uns nun mal nach der Decke strecken«, schimpft Magdalena.
»Es ist viel zu heiß für eine Decke.«
»Granny will sagen, dass wir es uns nicht leisten können, das wenige Geld, das wir haben, für ein schickes Auto zu vergeuden.«
»Daddy hatte auch eins.«
»Dein Vater hatte viele Dinge. Ehrlichkeit gehörte leider nicht dazu«, sagt Magdalena scharf. »Und nenn mich nicht Granny. Das hört sich an, als wäre ich hundertzwei!«
Janey lacht. »Granny ist hundertzwei Jahre alt.«
»Du solltest deiner Tochter endlich Manieren beibringen«, schnauzt Magdalena mich an und tritt vor einer Kurve auf die Bremse.
»Streiten wir uns nicht. So wollen wir doch nicht ein neues Leben beginnen.« Das klingt so flehentlich. Seit wann bin ich derart … kraftlos?
Hinter der Kurve gibt eine Lücke in der Hecke den Blick auf ein weißes Haus frei, mit dunklen Bäumen und einer dichten Vegetation dahinter. Sie reicht bis zu einem langen, geschwungenen, hellen Strand hinunter, begrenzt von Landzungen, gegen die graue Wellen anrollen. Ist es das? Das muss es sein – es ist das einzige Haus weit und breit. Das in White Cove. Zum ersten Mal sehe ich unser neues Zuhause; zur Besichtigung und der anschließenden Versteigerung reiste Mutter allein nach Cornwall, wo sie sich knallhart gegen alle anderen Bewerber durchsetzte.
Wir hätten auch ein Haus auf dem Land außerhalb von London kaufen können, denke ich, und das nicht zum ersten Mal. Warum sind wir dreihundert Meilen weiter nach Westen gekommen, an einen Ort, an dem das Land dermaßen steil zum Meer abfällt? Doch als mir klar wurde, dass das Magdas Plan für unseren Neuanfang war, stand ich bereits vor vollendeten Tatsachen.
Dann quietschen die Bremsen, ich pralle mit der linken Schulter schmerzhaft gegen die Tür, und das Auto schlittert ruckartig die Straße entlang. Magda flucht auf Polnisch. Als der Straßenrand mit alarmierender Geschwindigkeit auf uns zukommt, bin ich sicher, dass wir jeden Moment kopfüber in den tiefen, dunklen Wald stürzen werden. Der Motor blockiert, und Rauch zieht bedrohlich über die Windschutzscheibe, als wollte er den Blick auf unseren bevorstehenden Tod verschleiern. Dann stottert der Motor ein letztes Mal, und wir bleiben im hohen Gras des Grünstreifens stehen, die Motorhaube dem Meer zugewandt.
Magdalena sitzt erschrocken da. Dann holt sie tief Luft und sagt fröhlich, als wäre überhaupt nichts passiert: »Da. Seht euch das an: unser kleines Stück vom Himmel.«
Ich bin erleichtert und verkneife mir den Vorwurf, dass sie uns mit ihrer unvorsichtigen Fahrweise um ein Haar umgebracht hätte. Von hier sieht das Haus ziemlich magisch aus, die weißen Wände heben sich scharf vom dunklen Wald und dem grünen Laub ab. »Schau dir das an, Janey«, sage ich und drehe mich zu ihr nach hinten. »Unser neues Zuhause.«
Aber meine Tochter hat die Nase an die andere Scheibe gepresst und sieht nicht auf das Meer hinunter, sondern auf die Straße hinter uns. Ich warte, dass sie sich abwendet, das Haus inspiziert und ihr Urteil fällt, wie ein Kinderorakel, das den künftigen Verlauf unseres Lebens bestimmen wird. Ich höre sie in der Stille atmen – klingt es ein bisschen japsend? Hat sie eine Sommererkältung? Aber dann sagt sie eindringlich: »Guck mal, Mummy – genau wie Rabbit!«
Ich recke den Hals. Was meint sie? Und dann sehe ich ihn reglos mitten auf der Straße sitzen: einen riesigen Hasen, so weiß wie Schnee, die großen Ohren zum Himmel aufgerichtet, der mich mit dunklen Augen fixiert. Mir läuft es kalt den Rücken herunter. Es ist ein unheimlicher Augenblick, die spürbare Verbindung zu einem Geist der Wildnis, Zeichen eines Wunders zwischen den Welten von Mensch und Natur. Und dann ist der Hase mit einem Mal verschwunden. Einen Augenblick springt mein Sehvermögen zwischen wirren Nachbildern hin und her, wie nach dem Blick in ein allzu grelles Licht, und ich blinzle und blinzle, bis es sich wieder beruhigt.
»Na so was …«, sage ich und atme tief aus. »Nicht zu glauben.«
»Du hast ihn auch gesehen!«, kräht Janey. »Hast du das mitgekriegt, Granny? Hast du das große Kaninchen auch gesehen?«
Magda dreht sich nicht um, als hätte sie uns gar nicht gehört.
»Ich glaube, es war ein Hase«, korrigiere ich meine Tochter leise. »Sie sind größer als Kaninchen.«
»Es war ganz groß! Und weiß! Wie Rabbit.« Als Beweis schwingt sie ihren Begleiter, ein kleines, ziemlich abgewetztes Stofftier mit einer schicken blauen Weste, die ich auf der Singer-Nähmaschine fabriziert habe. Sie hat drei winzige Knöpfe und ist mit Paisley-Seide gefüttert. Ein kleines rotes Bändchen mit einem Glücksknoten darin soll böse Geister abwehren – ein Geheimnis, das nur Janey, ich und Rabbit kennen. Meine Großmutter hat mich nie ohne ein Stück roter Kordel am Handgelenk oder am Kinderwagen aus dem Haus gelassen. Diejenige, die Babcia, die Mutter meiner Mutter, für mich gemacht hatte, habe ich bis heute aufgehoben – und so wird dieser alte Aberglaube von Generation zu Generation weitergegeben.
»Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass ein Hase so weiß ist. Vielleicht ist es noch seine Wintertarnung.« Die Erklärung kommt sogar mir eher unwahrscheinlich vor.
Magdalena geht gar nicht erst darauf ein, hebt nur ihr goldenes Kruzifix an die Lippen und steckt es sich dann wieder in den Ausschnitt. Als sie versucht, den Wagen neu zu starten, streikt der Motor, gibt ein schwaches Röcheln von sich und säuft ab. Leise fluchend, versucht sie es immer wieder, bis er schließlich inmitten einer Rauchwolke zu so etwas wie einem Halbleben erwacht. Sie legt den Rückwärtsgang ein, fährt zurück auf die Straße, und wir tuckern das letzte Stück auf das Haus zu.
3
Das Anwesen wirkt größer als auf dem Foto, das mir Mutter nach ihrem Besuch vor zwei Monaten gezeigt hatte, als die Frühlingssonne seine Ränder weich zeichnete und die Räume vom Licht gesprenkelt waren, das durch die hohen Fenster und den verwilderten Garten mit seiner Fülle an halb tropischen Pflanzen fiel. Jetzt im Sommer ist es grell und unbarmherzig, und das Haus erscheint erschreckend groß.
Magda lenkt den Wagen in einem Bogen über den knirschenden Kies, bremst dann abrupt ab und zieht die Handbremse an. Zwei Krähen, die von unserer Ankunft gestört wurden, erheben sich kreischend in die Luft und lassen sich auf dem Dach der nahen Scheune nieder. Sie beobachten, wie wir aus dem Fahrzeug aussteigen, und drehen die Köpfe, als wären sie eins. Die Luft ist scharf und schmeckt nach Salz. Ich atme tief durch. Sie fühlt sich kühl und fest in meiner Lunge an.
Mutter reckt ihr Kinn dem Wind entgegen und kneift in kontrollierter Ekstase die Augen zusammen. »Hier zu sein, wird uns allen guttun.«
»Ja, sicher«, stimme ich ihr zu.
Janey krabbelt vom Rücksitz hervor. »Strand!«, ruft sie und läuft über den abschüssigen Rasen.
Ich renne hinterher und packe sie am Arm. »Nein! Ohne Granny oder mich gehst du nicht da runter zum Strand. Niemals. Hast du verstanden?« Ich schüttele sie ein bisschen, um mein Verbot zu unterstreichen, und schleife sie wieder zurück zum Wagen.
»Ich will aber!«
»Wir machen später einen Spaziergang, wenn du brav bist.«
Janey schaut mich mit ihren strahlend hellen Augen an. »Versprochen?« Sie traut den Worten der Erwachsenen nicht, und wer kann ihr das verdenken?
»Versprochen. Aber jetzt bleibst du im Auto sitzen. Granny und ich gehen ins Haus, um uns erst einmal umzuschauen.« Ich halte die Tür auf und sehe, wie Janey und Rabbit sich mit einer Ausgabe des Eagle hinsetzen, die sie sich beim Zeitungshändler in Penzance erbettelt hatte.
»Das ist doch eher was für Jungs«, hatte Magda missbilligend gesagt.
»Sie liebt Dan Dare«, antwortete ich. »Lass es ihr. Es ist besser als die Heftchen voller Ballerinen und Prinzessinnen aus dem Mädcheninternat.«
Nach einer weiteren Ermahnung an Janey gehen Magda und ich auf das Haus mit der doppelten Flügeltür im Schutz einer breiten Säulenveranda zu. Magdalena nimmt sich entschlossen die drei – drei! – Einsteckschlösser samt Riegeln vor, schiebt die laut knarzenden Türen weit auf, und ich folge ihr in die Eingangshalle. Angesichts der unerwarteten Höhe verrenke ich mir fast den Hals. Eine Treppe führt ins obere Stockwerk. Ungeachtet der Sonne draußen dringt mir die Kälte bis in die Knochen – eine feuchte Kälte, wie man sie nur in Häusern findet, die lange unbewohnt waren. Ich reibe mir die Oberarme und wünschte, ich hätte einen Mantel angezogen. Magda geht mit klappernden Absätzen über die steinernen Fliesen. Das Geräusch hallt wider, und ich drehe mich um die eigene Achse. Die wuchtigen dunklen Möbel waren wohl bei der Versteigerung mit enthalten: eine riesige mit handgeschnitzten Herzen, Disteln und rennenden Tieren verzierte Truhe; eine prunkvolle Garderobe mit einem halb blinden Spiegel und eine lange Sitzbank unter den eisernen Kleiderhaken.
Die ersten Eindrücke erinnern mich an die Sonntagsschule in Surrey, das Dorf, in dem ich während des Krieges evakuiert war. Keine glückliche Zeit, doch für ein leeres Haus fühlt es sich seltsam belebt an, fast, als würde ich beobachtet. Wahrscheinlich ist das nur meine übliche Angst vor einer neuen Umgebung. Ich werde mich daran gewöhnen, daran gewöhnen müssen, und ignoriere das ungute Gefühl, das mich beschleicht. Ich bin an Lärm von draußen gewöhnt, an Autohupen und Fahrradklingeln, an rufende Menschen und lachende Kinder. Wie soll ich mich an eine solche Stille gewöhnen?
Magda dreht sich um. »Ich werde dieses alte Ungetüm entsorgen, nur den vergoldeten Spiegel dorthin stellen und Topfpalmen neben die Tür. Die alte Vertäfelung und die hohe Sockelleiste müssen restauriert werden. Hörst du mir überhaupt zu? Vielleicht machst du dir bei unserem Rundgang schon mal ein paar Notizen.«
Noch vor wenigen Monaten wohnte ich in meinem eigenen Haus, das ich nach meinem Geschmack eingerichtet hatte, und hatte mein eigenes Geld …
Der formelle Salon neben der Eingangshalle ist ein hübscher, origineller Raum, der schon viel erlebt haben muss. Ich kann mir vorstellen, wie das Feuer in dem großen, verrußten Kamin die plaudernden Gäste mit ihren Sherrygläsern in der Hand wärmt, und der Gedanke stimmt mich froh, trotz des Blicks durch die hohen Fenster auf den abfallenden Rasen, hinter dem sich kaum hundert Meter entfernt das graue Meer an den Strandfelsen bricht.
Unterdessen murmelt meine Mutter vor sich hin. »Schrecklich, einfach schrecklich, in was für einem Zustand es ist. Weiß der Himmel, wie wir einen so riesigen Kamin für die Gäste absichern sollen. Ich würde ihn nur ungern mit Holzlatten verkleiden, aber vielleicht wäre es sauberer und praktischer obendrein.«
Ich sehe zu, wie sie in den nächsten Raum tappt, und ärgere mich über ihre Gefühllosigkeit, als hätte ich mitbekommen, wie sie jemanden beleidigt, dem sie gerade erst vorgestellt wurde. Ich würde dem Haus gern vermitteln, dass Mutter alle Renovierungsarbeiten geschmackvoll erledigen wird, dass sie ein ausgezeichnetes Auge für Design hat und eine Liebe für die englische Geschichte hegt, die viel tiefer reicht als die der meisten Einheimischen.
In der Stille, die sie hinterlässt, höre ich ein tiefes, dumpfes Donnern, wie den Herzschlag eines riesigen Tieres. Es dauert einige Sekunden, bis ich erkenne, dass es die Wellen sind, die gegen das Ufer branden.
»Lange Vorhänge«, sagt Magdalena, ohne zu merken, dass sie ein Selbstgespräch führt, »aus mittelblauem … nein, tiefgrünem Samt als Hintergrund.« Sie dreht sich zu mir um und runzelt die Stirn. »Ich glaube nicht, dass meine Sofas hier reinpassen. Sie wären zu klein, und ich glaube, sie sind auch einfach zu modern. Vielleicht finden wir in den hiesigen Auktionshäusern ein paar gute Chesterfields. Mach dir eine Notiz, dass wir den Raum ausmessen müssen.«
Seufzend notiere ich mir diese Anweisung. Dann kritzele ich ein Spinnennetz und in die Mitte eine Spinne mit Magdas Gesicht.
Auf der hinteren Seite des Hauses befindet sich ein großer, mit Schiefer gefliester Raum und Fenstern auf zwei Seiten, einem alten Herd, Tischen und Stühlen, die wie im ungenutzten Speisesaal eines Internats aufeinandergestapelt sind. Ein Eindruck, der durch die Luke zur Küche noch verstärkt wird. Aus dem Seitenfenster sehe ich über weite Flächen von Brombeeren und Ginster hinweg eine Landzunge in der Ferne; am hinteren Fenster führt ein grasbewachsener Hang steil zum schattigen Wald empor.
Die Küche ist kompromisslos funktional mit ihrem kalten Marmor, zwei tiefen Keramikspülen, einem rostigen schwarzen Herd und einem Dutzend verwaister Pfannen, die von dem eisernen Kronleuchter baumeln.
Magdalena stemmt die Hände in die Hüften. »Ich habe nichts gegen altmodisches Zeug, aber das hier ist ja schon mittelalterlich. Wir müssen die Küche auf Vordermann bringen, wenn wir für ein volles Haus kochen wollen.«
Du meinst du, nicht wir, denke ich, spreche es aber nicht aus. Bei der Vorstellung, an einem so abgelegenen Ort ein Gästehaus zu betreiben, kann einem schwindlig werden; für die Verpflegung einer Schar von Fremden verantwortlich zu sein, ist definitiv furchterregend.
»Hier stellen wir einen großen Tisch hin«, sagt sie, »und einen Frigidaire.« Sie geht durch den Raum und wirft einen Blick aus der Tür. »Ein weiterer Kostenaufwand.« Sie seufzt schwer, wie um anzudeuten, dass das alles meine Schuld ist.
Daneben gibt es noch eine mit Regalen und einer Tür nach draußen ausgestattete Spülküche. Der Pfad dahinter führt wieder zurück zur Veranda und der Eingangshalle. »Warte nur, bis du die Schlafzimmer siehst!«, zwitschert Magdalena.
Ich gehe nach ihr die breite, gewundene Treppe hinauf, sehe aus dem hohen Bogenfenster auf halber Höhe zum Auto hinaus und kann gerade noch Janeys blonden Kopf erkennen, der über ihren Comic gebeugt ist. Trotz all ihrer Energie und ihres Temperaments ist sie ein pflegeleichtes Kind. Ihre Liebe zum Lesen hat uns beiden im vergangenen schwierigen Jahr eine Atempause verschafft.
Beruhigt folge ich Mutter nach oben zu den Schlafzimmern. Es gibt insgesamt sechs davon, plus zwei Badezimmer. »Du musst Janey bei dir unterbringen, bis wir eins davon unterteilen können«, sagt Magdalena. »So ein großes Zimmer können wir nicht an ein kleines Mädchen verschwenden.«
Von hier oben ist der Blick auf das Meer unvermeidlich: vier der sechs Schlafzimmer sind ihm zugewandt. Im Moment kann man nicht einmal sehen, wo das Meer endet und der Himmel beginnt. Ungewöhnlich für den Juli ist heute alles unterschiedlich grau, obwohl es draußen schwül ist. Die Hitze ist unter den dunklen Wolken gefangen, die sich auf der Westseite der Bucht auftürmen und Regen ankündigen.
»Wann kommen die Möbelpacker?«, frage ich, weil ich es kaum erwarten kann, diese großen, leeren Räume mit vertrauten Gegenständen zu füllen.
Magdalena sieht auf die Uhr. »Sie müssten längst da sein. Also wirklich, man zahlt ihnen gutes Geld, und sie lassen einen trotzdem hängen. Such dir aus, welches der beiden hinteren Schlafzimmer dir lieber ist.«
Kein Meerblick für mich.
Ich wandere durch den schummrigen Korridor. Die hinteren Schlafzimmer sind verdunkelt und seit Langem nicht benutzt worden. Sie strahlen etwas Trostloses aus, als wären sie dem Leben so lange entzogen worden, dass sie einfach aufgegeben haben. Ich ziehe die Vorhänge im westlichen Zimmer zurück, blicke in den dichten Wald oberhalb des Hauses und bin vorerst beruhigt. Die Bäume und ihre Schatten haben etwas Vertrautes, die Landschaft ist überschaubarer und weniger exponiert als das endlose Meer und der Himmel. Am liebsten würde ich Janey und mich hier einschließen, um Winterschlaf zu halten, bis ich wieder zu Kräften gekommen bin.
Ich trete zu dem riesigen, hölzernen Kleiderschrank. Die Türen sind mit einem verschnörkelten silbernen Schlüssel verschlossen. Als ich ihn umdrehe, springen sie auf. An der Innenseite einer der Türen befindet sich ein ovaler Spiegel. Ich starre mein eigenes Spiegelbild an, etwas, das ich jetzt schon seit Monaten vermieden habe. Meine Güte, habe ich abgenommen. Die Kleider schlackern um mich herum, als hätte ich sie mir von einer größeren Frau geliehen; mein Haar ist strähnig, und unter den Augen haben sich Ringe gebildet. Ich sehe blass und krank aus, älter als meine sechsundzwanzig Jahre. Du musst etwas aus dir machen, sage ich mir verbittert, und da fällt mein Blick auf den Mantel.
Er schmiegt sich in die Dunkelheit des Schrankinneren, aber als ich ihn herausziehe, wirbele ich einen Strom von Goldpartikeln auf. Kein Staub, stelle ich fest, sondern winzige gelbe Motten. Der Mantel ist aus einem silbrig schimmernden Fell gemacht und liegt schwer in meinen Händen. Wie kann man nur ein so teures Stück in einem verlassenen Haus zurückzulassen?
Ich drücke den Mantel an mich, straffe die Schultern, wölbe den Hals und setze den Schmollmund einer Schaufensterpuppe auf. Es ist lächerlich, aber ich kann nicht anders, öffne die Haken und Ösen und streife ihn über. Der Mantel schmeichelt mir, der Kragen schmiegt sich kühl und seidig an meine Wange. Ich kann gerade noch einen schwachen Hauch von Gesichtspuder und einem teuren Parfüm ausmachen – Givenchy vielleicht oder Chanel. In einem plötzlichen Überschwang von Ausgelassenheit drehe ich eine Pirouette, sodass die Mantelschöße sich erst ausbreiten und dann wieder an meine Beine schmiegen wie große, weiche Katzen.
»Was in aller Welt machst du da?« Magdalena steht in der Tür. »Hast du ihn hier gefunden?« Es ist ein Vorwurf, keine Frage. Sie ärgert sich, dass ich den Schatz vor ihr entdeckt habe.
»Die vorigen Besitzer haben wohl vergessen, ihn einzupacken. Aber er scheint voller Motten zu sein.« Ich ziehe den Mantel aus und hänge ihn wieder in den Schrank. »Wir sollten herausfinden, wer sie sind, und ihnen schreiben.«
Magdalena kommt zu mir, befühlt den Mantel und untersucht ihn mit dem kritischen Blick einer Frau, die solchen Prunk gewohnt ist. »Keine schlechte Qualität. Ich nehme ihn mit nach Penzance in die Reinigung.«
Also darf die Finderin ihn nicht behalten? Ich spüre einen Anflug von Ärger. »Ich nehme dieses Zimmer.«
Meine plötzliche Bestimmtheit verblüfft sie. »Wahrscheinlich war es eine der Gesindestuben«, sagt sie und eilt hinaus, um ihre Begutachtung fortzusetzen.
Ich streiche über den Ärmel des Mantels, als wäre er noch lebendig. Die Vorstellung, dass er es einmal war, verstört mich. Wie schrecklich, dass Tiere sterben mussten, nur um reiche Frauen mit ihrer Schönheit zu schmeicheln. Einen Augenblick lang widert es mich an, dann macht es mich traurig. Die armen Dinger. Gefangen in einem Kleiderschrank, eingesperrt hinter einer Spiegeltür. Ich frage mich, wer die Besitzerin des Mantels war und warum sie ihn hier zurückgelassen hat, obwohl der Rest des Anwesens doch so leer und verwaist ist. Sie muss groß gewesen sein, denn der Saum reicht bis knapp über meine Knöchel, und die Ärmel fallen halb über die Hände. War sie alt oder jung? Hübsch oder schlicht? Hatte ihr Mann ihr den Mantel zum Geburtstag oder aus einem Schuldgefühl heraus geschenkt, oder hatte sie ihn sich selbst gekauft, in einem Augenblick des Überschwangs?
Als wäre er von meinen Spekulationen angeregt, wird der Duft ihres Parfüms plötzlich stärker, erfüllt meine Nase und schwebt durch den Raum. Ich spüre ihre Abwesenheit. Dann erfasst mich eine schreckliche Melancholie, und plötzlich halte ich es im Zimmer oder im Haus nicht mehr aus.
Ich laufe die mit Teppich ausgelegte Treppe wieder nach unten auf die Veranda und atme tief die erfrischende Seeluft ein. Dann gehe ich über den knirschenden Kies, um nach Janey zu sehen.
Schon lange ehe ich das Auto erreiche, weiß ich, dass es leer ist. Mein Herz bleibt erst stehen und macht dann ein paar schnelle Sprünge. Sie ist verschwunden. Vielleicht hat sie sich ganz tief über ihren Comic gebeugt, aber als ich die hintere Tür aufreiße und mich hineinbeuge, weiß ich mit schrecklicher Sicherheit, dass etwas anderes dahintersteckt.
Der Eagle liegt verloren auf dem Rücksitz, aber Janeys Stofftier ist auch verschwunden. Ich schieße so abrupt zurück, dass ich mit dem Kopf gegen den Metallrand des Türrahmens schlage und den Schmerz kaum wahrnehme.
»Janey!«
Ein paar Möwen heben vom Dach ab und fliegen über den Garten hinweg, ihre schrillen Schreie ahmen den meinen nach.
Ich schirme die Augen ab und starre auf die weitläufige Rasenfläche und das Gestrüpp, die zum Strand hin abfallen. Kein blonder Kopf, kein roter Fair-Isle-Pullover. Ich drehe mich um und schaue hinauf zur Straße und dem Wald auf der Suche nach einem sich bewegenden Farbklecks, sehe aber nichts. Ich laufe ins Haus zurück und rufe den Namen meiner Tochter. Der Klang wird von den leeren Räumen ausgedünnt, abgeschwächt und schließlich verschluckt.
Am oberen Ende der Treppe taucht Magdalena auf.
»Sie ist weg!«, schreie ich ihr entgegen. »Janey – sie ist nicht im Auto.«
»Hör auf, immer diese Panik zu verbreiten!« Magda kommt ohne große Eile die Treppe hinunter. »Wahrscheinlich ist sie nur auf Erkundungstour.«
»Aber sie ist doch erst fünf.«
Magdalena kräuselt die Lippen. »Du warst schon immer so ein Angsthase. Mit fünf Jahren wäre ich längst auf einen Baum geklettert.«
Wir durchsuchen die Zimmer im Erdgeschoss, was nicht lange dauert, weil es keine Verstecke gibt, dann gehen wir wieder nach draußen, laufen ums Haus herum und rufen Janeys Namen. Wir schauen in dem von Brombeersträuchern überwucherten Gewächshaus nach, unter dem Gebüsch, zwischen der üppigen Vegetation am Ufer des Bachs, der neben dem Garten entlangfließt. Ich renne weiter abwärts, fast bis zum Strand, finde eine niedrige Steinbrücke aus großen Granitplatten, die auf kurzen Pfeilern über den Bach führen, und rufe immer wieder nach ihr. Zwischen den vielen dichten Pflanzen geht meine Stimme unter. Ich erreiche den Strand, meine Augen suchen die weit ausgedehnten grauweißen Felsen ab, aber bis auf ein paar Austernfischer, die im Seegras am Strand picken, bewegt sich nichts.
Verzweifelt rufe ich immer wieder Janeys Namen, erhalte aber keine Antwort, außer der des Meeres, das gierig an den Steinen saugt, die sich dem Sog der Wellen knirschend widersetzen. Ich laufe den Pfad wieder nach oben und stoße auf meine Mutter, die neben der steinernen Scheune steht und ruft: »Komm da raus, Janeska! Niemand ist böse auf dich, aber jetzt reicht es.«
Atemlos bleibe ich neben ihr stehen. »Du hast sie auch nicht gefunden?«
Meine Mutter zeigt auf das kleine Fenster über dem Scheunentor. »Ich hab da oben irgendwas gesehen.«
Ich starre zu der dunklen Stelle hinauf, sehe aber nichts. Darunter führt das Scheunentor in einen Innenraum, der schwarz wie die Sünde ist. Ich hole die Taschenlampe aus dem Pannenkasten im Auto und leuchte wild die dunkle Scheune mit ihren Unmengen von Spinnweben, dicken Seilen und alten Netzen ab, die an Haken von den Holzbalken hängen, neben Stapeln von Werkzeugen und Maschinenteilen.
Eine Leiter führt in die obere Etage. »Gib mir die Taschenlampe«, verlangt Magdalena. Sie reißt sie mir förmlich aus der Hand und klemmt sie sich zwischen die Zähne. Dann zieht sie ihren Bleistiftrock bis über die Knie und klettert die Leiter hinauf wie ein furchterregender Pirat mit einem Entermesser.
»Sei bloß vorsichtig!«, rufe ich und stelle mir vom Holzwurm befallene Sprossen und gebrochene Beine oder noch Schlimmeres vor.
Der wacklige Lichtstrahl der Taschenlampe verschwindet auf dem Dachboden, und dann höre ich einen gedämpften Schrei und Stimmen. Eine davon ist unbekannt und eindeutig männlich.
4
»Wer zum Teufel sind Sie, und was haben Sie in unserer Scheune verloren?«
Finster mustert Magdalena den Fremden, der gerade hinter Janey und ihr die Leiter vom Heuboden hinuntergestiegen ist. Ich sehe mich nach einer Waffe um. Drüben an der Wand lehnt ein Spaten. Wäre ich schnell genug, falls er sie angreift? Würde ich ihn benutzen? Er ist größer und bestimmt auch stärker als wir beide zusammen: groß, breitschultrig, mit kräftigen Gesichtszügen. Sein Ausdruck ist schwer zu deuten, selbst als er kapitulierend beide Hände in die Höhe hält.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich werde jetzt gehen.«
»Nicht so hastig.« Magdalena ist unnachgiebig. »Ich will wissen, wer Sie sind und was Sie auf unserem Grundstück zu suchen haben. Das ist Hausfriedensbruch, verstehen Sie?«
Ist da ein Hauch von Emotion in den tief liegenden Augen, als er sie erst an- und dann wieder wegschaut? Ich glaube, ich kann da etwas erkennen – Wut? Misstrauen? Ich nehme Janey an der Hand und ziehe sie zu mir heran. Auch meine Tochter muss ein paar Fragen beantworten, sie hat meine Anweisung, im Auto zu bleiben, missachtet, wirkt aber völlig unbeeindruckt.
»Er heißt Jack«, piepst sie. »Stimmt’s?«
»Yes, Mam.«
Er nimmt die Mütze ab und macht eine lustige Verbeugung vor ihr. Dann schweift sein Blick zu meiner Mutter, und er reckt trotzig das Kinn. »Ich hatte nicht die Absicht, Ihren Hausfrieden zu stören. Ich war zu Fuß unterwegs, und dann hörte ich Ihr Auto kommen – es klang nicht besonders gut, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben –, und als ich sah, dass Sie zwei allein reisende Damen waren, hab ich mich in die Scheune verzogen, um keine Unannehmlichkeiten zu verursachen. War wohl eine schlechte Entscheidung, ich hätte stehen bleiben und mich vorstellen sollen. Als ich Sie dann ins Haus gehen sah, dachte ich, die Luft wäre rein, und gerade, als ich gehen wollte, hat Ihre Tochter mich entdeckt, da bin ich, statt mich aus dem Staub zu machen, auf den Heuboden geklettert.«
»Das ist nicht meine Mummy, sondern meine Granny«, unterbricht Janey ihn streng.
»Danke, mein Schatz.« Magdalena gibt Janey einen etwas stärkeren Klaps auf die Hand als nötig. »Hab ich dich nicht gebeten, mich nicht so zu nennen? Und was hast du dir dabei gedacht, einfach die Leiter raufzuklettern … das ist alles andere als ladylike.«
»Du bist doch auch da hochgeklettert«, entgegnet Janey mit unschlagbarer Logik.
Magda verzieht den Mund und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Mann. »Warum haben Sie Janey nicht gleich wieder nach unten gebracht? Es muss Ihnen doch bewusst sein, dass ein fremder Mann allein mit einem Kind an einem solchen Ort nichts zu suchen hat?«
Er blickt über Magdas Schulter auf das Meer und den Himmel, die Geste wirkt schüchtern und irgendwie arrogant zugleich; als wollte er andeuten, dass sie kein Recht hat, solche Fragen zu stellen, weil sie hier die Fremde ist. Dann blickt er auf seine Hände hinab, die eine Stoffmütze umklammern, und ich erkenne, dass seine Knöchel weiß vor Anspannung sind.
»Nennen Sie mir Ihren vollen Namen«, verlangt Magdalena unerbittlich.
Er wirft mir einen Blick zu, und ich bin sicher, dass ich Panik in seinem Gesicht sehe. Ich weiß, wie es ist, Magdas scharfer Zunge ausgesetzt zu sein.
»Ich heiße Jack«, sagt er. »Jack Lord.«
»Jack ist kein Name für eine offizielle Vorstellung«, erklärt Mutter. »John oder Jonathan?«
Er scheint nicht darauf eingehen zu wollen, und Magda kräuselt die Lippen. »Ich bin Magdalena Prusik, und das ist meine Tochter Mildred.«
»Mila«, korrigiere ich sie. »Ich heiße Mila.«
Mutter verdreht die Augen und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder Jack zu. »Und Janeska haben Sie ja bereits kennengelernt.«
»Ihre Tochter, ich meine, Ihre Enkelin wollte unbedingt hochkommen und mich begrüßen.«
»Ja«, nickt Janey. »Ich wollte dir Rabbit vorstellen.« Sie streckt ihm das Stofftier entgegen.
Rabbit befindet sich in einem ziemlich erbärmlichen Zustand: ein Ohr ist zerfleddert, und ein Auge hängt an einem Baumwollfaden, aber Janey erlaubt niemandem, es zu flicken.
»Es war mir eine Ehre, Rabbit und dich kennenzulernen«, sagt Jack Lord feierlich.
Ich spüre, wie meine Angst ein wenig nachlässt; von diesem Fremden scheint keine unmittelbare Gefahr auszugehen.
»Und ebenso freue ich mich, auch Sie beide kennengelernt zu haben.« Sein Lächeln verwandelt seine grimmigen Gesichtszüge, es macht ihn jünger, sogar attraktiv. »Tut mir wirklich leid, dass ich Sie erschreckt habe.« Er streckt Magdalena die Hand entgegen. Sie sieht sie einen Augenblick an und verschränkt dann die Arme.
Ich reiche ihm die Hand; meine Mutter ist schrecklich unhöflich, egal, was sie tut. Als er sie schüttelt, spüre ich ein unerwartetes, ängstliches Flackern im Bauch. Seit Dennis habe ich keinen Mann mehr angefasst.
Jack Lord zieht sanft seine Hand zurück, und ich stelle verlegen fest, dass ich sie einen Moment zu lange festgehalten habe.
»Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe«, wiederholt er. »Es wird nicht wieder vorkommen.« Dann sieht er sich wehmütig um. »Das arme, alte Haus könnte etwas Pflege und Aufmerksamkeit gebrauchen. Seit Jahren kümmert sich niemand mehr darum.«
»Kennen Sie seine Geschichte?«, will meine Mutter wissen.
Kurzes Schweigen.
»Nicht wirklich.« Er wirft einen Blick auf die abblätternde Farbe. »Ziemlich groß für drei Damen, wenn Sie verzeihen …«
Janey, die gerade zu den Erwachsenen gezählt wurde, strafft die Schultern.
»Wenn wir die Arbeit erledigt haben, werden wir nicht mehr allein sein«, entgegnet Magdalena scharf. »Sagen Sie, Mr Lord, kennen Sie sich in der Gegend hier aus?«
»Einigermaßen. Ich gehe gern auf Entdeckungstour.«
»Ich bin auch Entdeckerin!«, ruft Janey. »Deshalb habe ich dich gefunden. Zeigst du mir, was du schon gefunden hast?«
»Immer mit der Ruhe, junge Dame«, schimpft Magdalena, ehe sie sich wieder Jack Lord zuwendet.
»Ich kenne die Pfade, die hier in der Gegend durch die Wälder führen. Im Frühling sind sie voller Glockenblumen, wissen Sie, und es gibt ein paar sehr malerische Wanderwege an der Landzunge entlang. Ich könnte Ihnen die Gegend zeigen, wenn Sie gern wandern.«
Magdalena sieht ihn unverwandt an, immer noch kühl. »Vielleicht, wenn wir Sie etwas besser kennen. Was machen Sie hier, Mr Lord? Wohnen Sie im Dorf?«
Er wendet den Blick ab. »Ich wohne in der Nähe und mache dieses und jenes.« Er klingt ausweichend, und vielleicht merkt er das, denn dann setzt er hinzu: »Nach meiner Entlassung aus der Armee war es schwer, eine Arbeit zu finden, die mir gefällt. So bin ich von Ort zu Ort gezogen und habe Gelegenheitsjobs angenommen, und am Ende bin ich hier gelandet. Wie Treibholz.«
»Was für Gelegenheitsjobs?«, frage ich, aber als er sich zu mir umdreht, schaue ich weg. Seine durchdringenden Augen und sein kantiges Kinn machen mich nervös.
»Hauptsächlich Motoren reparieren – das war mein Job während des Krieges. Aber ich kann alles Mögliche: Dinge instand setzen, Wände streichen, Gärten umgraben, Holz hacken. Viele Frauen haben ihre Männer verloren, und ich helfe gern aus.«
»Ein Hansdampf in allen Gassen«, tönt Magdalena und freut sich über ihre Sprachfertigkeit.
Er lacht. »So könnte man es nennen.«
»Arbeiten Sie auf eigene Rechnung oder im Auftrag?«
»Ich schufte nicht gern für andere«, gibt er zu. »Ich bin lieber mein eigener Herr.«
Magdalena wirkt ein bisschen enttäuscht. »Kennen Sie einheimische Firmen, denen man unser Projekt anvertrauen kann?«
Jack sieht sie nachdenklich an. »Ich könnte mich für Sie umhören. Wird nicht einfach sein, einige der größeren Firmen dazu zu bringen, einen Auftrag an einem so abgelegenen Ort anzunehmen. Der Zugang ist nicht ohne, und das Haus hat einen gewissen … Ruf.«
»Was soll das heißen?«
Er wirkt unbehaglich. »Die Leute sagen, es bringe Unglück. Nicht nur das Haus, das ganze Tal. Es hat eine lange, dunkle Geschichte.«
Magda winkt ab. »Geschwätz und Märchen interessieren mich nicht. Wir fangen hier ganz neu an.«
Jack Lord nickt. »Bitte entschuldigen Sie mich.« Plötzlich sieht er zum Hügel auf, als hätten seine Ohren etwas aufgeschnappt, das wir anderen nicht gehört haben. »Ich muss jetzt los.« Als er losgehen will, fragt Magda scharf: »Sagten Sie nicht, Sie seien Mechaniker?«
Jack dreht sich wieder um. »Ja, mit Motoren kenne ich mich ziemlich gut aus.« Seine Augen verengen sich. »So wie Ihr Morris die Straße herunterkam, hörte er sich ziemlich unglücklich an.«
Wie auf ein Stichwort hin ertönt jetzt eine Hupe. Der Umzugswagen erscheint oben auf dem Gipfel des Hügels, genauer gesagt, zwei British Road Service Trucks mit Anhängern. Die Fracht ist mit Planen geschützt. Langsam bewegen sie sich die Straße hinab.
Jack Lord setzt seine Mütze wieder auf und zieht sie sich über die Augen. »Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg.«
»Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns mit den Möbeln helfen könnten«, sagt Magda unerwartet. »Und sich anschließend vielleicht unseren Morris ansehen würden.« Und dann schenkt sie ihm plötzlich ein umwerfendes Lächeln.
Ich runzle die Stirn. Meine Mutter ist einundfünfzig Jahre alt und hat die unerträgliche Angewohnheit, mit attraktiven jüngeren Männern zu flirten, egal wie unpassend die Umstände sind.
Eine Sekunde zögert Jack Lord, sieht zu Boden, dann wieder auf und sagt schließlich leise: »Mit Vergnügen.«
Aus dem ersten Lastwagen steigt ein grimmig dreinblickender Mann und aus dem zweiten ein jüngerer, der sich die schmutzigen Hände an seinem Overall abwischt.
»Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen«, sagt Magdalena gereizt. »Wie kommen Sie dazu, unser Hab und Gut dermaßen schlampig zu transportieren? Ich habe für einen ordentlichen Umzugswagen bezahlt.«
»Umzugswagen!« Der Ältere der beiden Männer verdreht die Augen. Er ist stämmig, kahlköpfig und rot im Gesicht.
»Die Dame hat einen Umm-zugswagen bestellt!« Er dehnt das Wort spöttisch in die Länge, sodass es absurd und exotisch klingt.
»Kein Umzugswagen schafft es über diese Straße«, sagt der zweite Mann und lacht.
»Wir mussten in die Stadt zurückfahren und zwei kleinere Lieferwagen holen.« Der erste Mann spricht mit näselnder Stimme jede Silbe einzeln aus – Lieh-fer-wah-gen –, als wollte er eine vornehme englische Stimme parodieren. »Wir mussten alles erst aus- und dann wieder einladen. Und dann kriegt unser Bobby hier einen Platten.« Er deutet auf den jüngeren Mann. »Das kostet extra.«
»Ach was«, sagt Magdalena rasch. »Ich erwarte ein Mindestmaß an Ortskenntnis und ein bisschen Grips, wenn ich eine derart exorbitante Rechnung bezahlen muss. Und sollte etwas kaputtgegangen sein, werde ich mich an Ihren Geschäftsführer wenden.« Sie verschränkt die Arme und starrt die Männer an, bis sie missmutig dazu übergehen, die Lastwagen zu entladen, wütend, weil sie sich von einer hochnäsigen Ausländerin herumkommandieren lassen müssen.
Meine Mutter kann herrisch sein. In ihrem Dior-Kostüm und Pumps, das kastanienbraune Haar zu glänzenden Locken aufgetürmt, ähnlich wie die junge Königin, sieht sie aus, als wäre sie soeben den Seiten der Vogue entstiegen. Gebt ihr einen Umhang und einen Dreizack, und sie wäre ein hervorragendes Modell für Britannia, die ihre Truppen sammelt, Polin hin, Polin her.
Auch mein Vater war Pole – ein Jagdflieger, der im Krieg für die Royal Air Force zum Einsatz kam, nachdem meine Eltern vor der deutschen Invasion geflohen waren. Sein Flugzeug wurde über dem Ärmelkanal abgeschossen. Posthum erhielt er einen Orden, doch der konnte den Verlust eines Ehemanns oder Vaters nicht ersetzen. Damals hatte ich das Gefühl, dass seine Abwesenheit mich härter traf als Magda, die kaum eine Träne vergoss, aber Mutter ist schwer zu durchschauen, wenn überhaupt. Sie hat sich und alles um sie herum immer unter Kontrolle.
»Mila!«
Ich fahre zusammen. »Sorry, was ist?«
»Ich habe gefragt, warum du nicht mit Janey spazieren gehst oder dich mit ihr ins Auto setzt, bis alles hier reingebracht wurde? Ihr steht sonst nur im Weg.«
»Spielen wir Entdecker!« Beflügelt von dieser Idee, hüpft Janey auf und ab.
»Ich zeig Ihnen gern ein paar Wanderwege«, sagt Jack.
Ich nicke ihm steif zu. »Das ist sehr nett von Ihnen, Mr Lord. Vielleicht, wenn wir uns richtig eingerichtet haben.«
»Jack, bitte.«
Ich spüre, wie Mutter uns beobachtet; ihre Feindseligkeit gilt eher mir als dem Fremden. Warum muss sie unbedingt jeden Tropfen männlicher Aufmerksamkeit aufsaugen?
»Jack«, mischt sie sich ein. »Wenn alles ausgeladen ist, müssen Sie bleiben und mit uns zu Abend essen. Mila ist eine wunderbare Köchin. Ich bin sicher, das Essen reicht für vier, ich esse ohnehin wie ein Vogel.« Damit klopft sie sich auf die schmale Taille.
»Es ist Janeys erste Nacht in einem fremden Haus«, sage ich leise.
Janey hört auf herumzuhüpfen. »Ich will, dass Jack bleibt. Und Rabbit will das auch, stimmt’s, Rabbit?« Ihr Spielzeug nickt sanft.
Ich ziehe Janey einen roten Dufflecoat an, in den sie sicher niemals hineinwachsen wird; sie sieht damit eher wie eine Höhlenbewohnerin als ein kleines Mädchen aus. Dann schlüpfe ich in meinen eigenen Regenmantel, binde mir das Kopftuch unter dem Kinn zu und krame im Kofferraum des Morris nach unseren Gummistiefeln.
»Rabbit hat keine Gummistiefel!«, klagt Janey.
»Rabbit braucht keine Gummistiefel.«
»Braucht er wohl, sonst kriegt er nasse Füße und holt sich eine Jung-ver-zün-dung.«
»Lungenentzündung. Hast du schon mal ein Häschen Stiefel tragen sehen?«
»Das tun sie, wenn sie auf Entdeckungstour gehen.«
»Nun, Rabbit ist ein kleiner Spielverderber, wenn es ums Entdecken geht. Er sagt, er würde lieber schön warm in deiner Tasche bleiben.«
Janey wirft Rabbit einen bösen Blick zu, doch der sagt nichts. Sein Auge hängt lässig an dem Baumwollfaden. »Na schön, aber in Zukunft musst du dich besser abhärten«, ermahnt sie ihn, und ich zucke zusammen – das ist einer von Magdas Sprüchen.
Los geht’s, an der Scheune vorbei und die schmale Straße hinauf bis zum Briefkasten oben auf dem Hügel – ein beruhigendes Zeichen der Zivilisation. Von hier aus haben wir einen guten Blick auf die Szene weiter unten, wo Magdalena den Verkehr regelt: »Erst die Betten, dann die Matratzen … Die Standuhr am Schluss, es sei denn, es fängt an zu regnen.« Ihre Stimme hallt kristallklar durch die stille Luft, und ich bin froh, aus der Schusslinie zu sein.
Nach der nächsten Biegung kommen wir zu einem Gatter, das in den Wald führt. Janey zerrt an meiner Hand. »Gehen wir da lang!«
Wahrscheinlich könnten wir dem Fußweg durch den Wald über dem Haus folgen und mit etwas Glück auf der anderen Seite wieder herauskommen, wo die Bäume in Farnkraut übergehen, und von da wieder einen Weg zu den Gärten finden. Und wenn nicht, können wir immer noch umkehren. Es wäre nicht schlecht, sich einen Überblick von dem zu verschaffen, was ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen kann. Es wird helfen, uns zurechtzufinden und mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.
Ich klettere über das Gatter – es ist ein wenig wackelig, aber nicht gefährlich – und greife nach hinten zu Janey, die bereits mit größtmöglicher Anstrengung den Fuß auf die erste hohe Latte gesetzt hat. Der Trick dabei ist, ihr zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie nicht stürzt, ohne ihre Bewegungsfreiheit allzu sehr einzuschränken. Janey ist eigensinnig und lässt sich nicht gern etwas vorschreiben. Aber jetzt packt sie meine Hand und fliegt förmlich über das Gatter. Kaum sind wir im Wald, scheint die Temperatur um einige Grad gesunken zu sein. Wir stapfen über eine dicke Schicht aus jungfräulichem Mulch, die sich nach vielen Jahren rieselnden Laubs angesammelt hat und einen durchdringenden Geruch nach Harz und Fäulnis verströmt. Die umgestürzten Stämme sind mit Knollenblätterpilzen und Galläpfeln verziert, doch in den Sonnenflecken, die nun durch das Blätterdach fallen, wachsen kleine Buschwindröschen und Lichtnelken. Die Schulwanderungen durch die Natur in Surrey waren also doch nicht ganz umsonst, denke ich, als mir die Namen wieder einfallen.
Janey beginnt, Schätze zu sammeln – einen Stein hier, einen Tannenzapfen dort. Bald ist die Manteltasche, die nicht von Rabbit besetzt ist, prall gefüllt. Wir finden eine große schwarze Feder, wahrscheinlich stammt sie von einem Raben.
»Wird er ohne die fliegen können? Sollen wir ihn suchen und sie ihm zurückgeben?«, fragt Janey. »Wenn ich so eine Feder verlieren würde, wäre ich sehr traurig.«
»Wir nehmen sie mit und fragen jeden Raben, dem wir begegnen, ob sie ihm gehört. Was meinst du?«
Damit scheint sie einverstanden zu sein, aber nach einer Weile, als hätte sie darüber nachgedacht, sagt sie plötzlich: »Es könnte eine sie sein. Wie der Hase.«
Der Hase. Ich erinnerte mich an das fast strahlende Weiß seines Fells, an seinen verwirrenden Blick. »Woher weißt du, dass der Hase eine sie ist?«
Janey zuckt die Schultern. »Ich weiß es eben.« Sie hüpft ein paar Schritte weiter und fragt dann: »Wachsen Rabenfedern wieder nach?«
»Ganz bestimmt, wenn sich das jemand stark genug wünscht.«
»Wirklich?« Sie ist gespannt. So viel Macht zu haben – wie ein Zauberer in einem Märchen. »Dann mach ich das.« Sie schließt die Augen und konzentriert sich, wobei das verkniffene Gesicht unter der viel zu großen Kapuze an das einer weisen alten Frau erinnert. »So. Darf ich jetzt die Feder behalten?«
»Ja, es sei denn, der Rabe will sie wiederhaben. Es wäre unhöflich, sie dann zu behalten, außerdem können Raben wie Krähen Unglück bringen.«
»Okey-dokey.«
»Du weißt, dass Granny das nicht gern hört.«
»Und du weißt, dass Granny nicht gern Granny genannt werden will.«
Wir wechseln einen komplizenhaften Blick.
Tief im Wald stehen die Bäume weiter auseinander, und der Pfad dazwischen ist weniger deutlich, weil er unter wuchernden Brombeeren und Brennnesseln verschwindet. »Fass die nicht an«, warne ich. »Sie stechen.«
Janey ist fasziniert von den gezackten, haarigen Blättern. »Wie sollen sie stechen? Sie haben doch keine Stacheln.«
Ich erzähle ihr was von künstlerischer Freiheit, aber das lässt sie unbeeindruckt. »Sie brennen«, sagt sie hochnäsig, »deshalb heißen sie Brennnesseln! Dumme Mummy!« Wie schnell sie erwachsen wird.
Nach ein paar weiteren Minuten scheint der Pfad sich im Nichts zu verlieren. Ich sehe auf: Der Himmel ist jetzt lila und grau, die Sonne geht langsam unter, und die Luft hat eine neue Frische bekommen. Zwischen Farnen und moosbewachsenen Felsen fließt ein kräftiger Bach. »Wir folgen ihm und gehen nach Hause«, sage ich zu Janey. »Wasser fließt immer bergab.«
Janey runzelt die Stirn. »Nein, tut es nicht.«
»Aber sicher, das weißt du doch. Es findet immer einen Weg.«
Meine Tochter schüttelt heftig den Kopf. »Das Meer ist flach! Das Meer ist flach!«
Plötzlich bin ich zu müde, um ihr die Gezeiten, Strömungen und die Anziehungskraft des Mondes zu erklären. Stattdessen nehme ich sie an die Hand und versuche, sie wegzuschleifen.
»Ich will nicht da lang! Ich will nach oben!«
Mit bemerkenswerter Kraft stemmt sie sich gegen mich.
»Die Sonne geht gleich unter, Herzchen. Wenn wir weitergehen, verlaufen wir uns noch.«
»Ich will mich verlaufen!«
»Janey!« Ich zerre an ihrem Arm, aber sie zappelt und brüllt, Warnzeichen für einen ihrer berüchtigten Wutanfälle. Wir kämpfen. Und ehe wir uns versehen, fällt Rabbit aus ihrer Manteltasche in den Bach. Sie ist so darauf versessen, ihren Willen durchzusetzen, dass sie gar nicht mitkriegt, wie ich sie warne, und als sie es endlich merkt, ist Rabbit schon im rasch dahinströmenden Wasser verschwunden.
»Rabbit!«, ruft Janey und rutscht und schlittert mit mir im Schlepptau den Hang hinunter auf den Bach zu, bis uns ein wilder Hortensienbusch, der in ein Brombeerdickicht übergeht, den Weg versperrt.
»Verdammt!« Meine ganze Kraft wird von einer Welle der Erschöpfung hinweggeschwemmt.
Janey sieht zu mir auf, und ich erwarte, dass sie tränenüberströmt und panisch reagiert, doch als sie mein Gesicht sieht, sagt sie: »Keine Angst, Mummy. Es ist ein schöner Wald. Er mag uns. Rabbit wird es hier gut haben, das kann ich spüren.«
Grinsend mustere ich mein launisches Kind. »Bist du sicher?«
Janey nickt nachdrücklich. »Rabbit wird es hier sehr gut haben.«
Wir sind beide müde und verwirrt, und ich sehne mich danach, diesen Wald zu verlassen. »Können wir jetzt nach Hause?«, frage ich, obwohl ich es wirklich besser wissen sollte. Das Licht wird schwächer, und die Sonne verschwindet hinter dem Hügel. »Wir kommen morgen wieder hier hoch und suchen nach Rabbit.«
Zu meiner Überraschung stimmt sie zu. Ich bin so erschöpft, dass ich Janey erlaube, uns zu führen. Wir bahnen uns einen Weg in die zunehmende Dunkelheit, wo der Wald wieder dichter wird. Als ich mich umsehe, um mich zu orientieren, taucht ein grünweißer Blitz in meinem peripheren Blickfeld auf, der mich kurz einhüllt und dann an mir vorbeischießt. Ein Nachbild rast im Zickzack hinterher, mit Lichthöfen, die sich weiten und ausdehnen, bis ich kaum noch etwas sehen kann. Ich schließe die Augen, aber es ist immer noch da, schillernd, sprunghaft, wie eine gezackte, gehörnte Sichel. Mein Rücken fühlt sich an, als stünde er in Flammen, aber es ist keine Hitze, sondern eine kalte Flamme, ein grünweißes Feuer.
»Mummy, Mummy, du tust mir weh!«
»Oh, tut mir leid, mein Herz.« Ich löse meinen Griff. »Hast du das gesehen?«
»Was denn?«
Ich schüttele den Kopf. »Ach, nichts. Ich glaube, ich kriege wieder meine Migräne.«
»Ich pass auf dich auf. Hier lang«, sagt Janey zuversichtlich. Sie zerrt an mir, bis ein Pfad zwischen den Bäumen auftaucht, und dann sind wir auf freiem Feld, mit einem schmalen Fußweg, der steil hinunter zu einer Lücke in einer Hecke führt, hinter der wir die Umrisse eines Hauses erkennen. Unseres Hauses.
Die gezackten Blitze tanzen und jagen über mein Blickfeld, und in meinem Mund sammelt sich bittere Galle. Ich drehe mich zur Seite und übergebe mich heftig. Licht und Kaskaden von schwarzen Sternen pulsieren in meinem Kopf.
Ich muss das Bewusstsein verloren haben, denn als Nächstes erinnere ich mich daran, wie ich in der Kälte auf dem Rücken liege und nur unermessliche Schwärze vor mir sehe, durchsetzt von weißen Punkten – und als ich mich konzentriere, wird mir klar, dass es echte Sterne sind, keine Sehstörung. Was ist passiert? Warum bin ich hier draußen in der kalten Nacht? Ich strecke die Hand aus – nasses Gras? Eine dumpfe Erinnerung taucht auf, an den Wald, an das Geräusch von fließendem Wasser, und dass ich von irgendwas mitgerissen wurde …
Dann packt mich die Angst. Wo ist Janey? Ich versuche, mich aufzurichten, zu schnell; mein Kopf schwirrt, mir wird schwindelig. Ich atme tief durch.
Es ist nur die Migräne. Ich bekomme sie manchmal, wenn ich müde oder gestresst bin. Aber wo ist meine Tochter? Die Angst ist ein Echo der Furcht, die ich heute Nachmittag hatte, als Janey plötzlich verschwunden war. Aber diesmal, ohne die beruhigende Anwesenheit von Magdalena, schwillt sie zur Gewissheit einer Katastrophe an. Janey für immer verloren, von einer Klippe gestürzt, in eine Erdspalte gefallen, von wilden Tieren verschleppt, im Meer ertrunken.
»Janey!«, rufe ich, als ich wieder genügend Luft bekomme, aber der Ton, der herauskommt, ist schrill und schwach.
Ich stemme mich in eine schlappe, halb aufgerichtete Position und sehe mich um. Hinter mir hebt sich der dunkle Wald von einem dunklen Himmel ab. Eine Eule schreit, unheimlich, aber nichts bewegt sich. Weder ein kleiner roter Mantel noch ein blonder Haarschopf. Ich atme tief ein und aus, um meine Angst unter Kontrolle zu bringen. In der Ferne zeichnet das Mondlicht einen Silberpfad über das Meer, und eine einzelne Möwe gleitet durch mein Blickfeld, gelassen und unbeeindruckt von unserem menschlichen Schicksal. Ihr gedämpfter Schrei dringt durch die Nachtluft.
Doch als der Schrei erneut ertönt, sträuben sich mir die Haare. Das ist keine Möwe: Es ist Janey.
»Mummy, Mummy!« Und da ist sie, in ihrem roten Dufflecoat kommt sie mit ausgebreiteten Armen den Hang hinauf und auf mich zu.
»O mein Gott, Janey!«
Die winzige Gestalt stürzt sich auf mich, und wir umarmen uns erleichtert.
»Ich hab Hilfe geholt!«, ruft sie. »Hier ist sie, Jack!«
Über der Schulter meiner Tochter sehe ich eine Gestalt aus der Dunkelheit auftauchen – einen Mann – den Mann aus der Scheune, und er hebt mich auf, so leicht, als wäre ich ein Kind.
»Halten Sie sich fest«, sagt er, und durch unsere Kleidung hindurch spüre ich die Wärme seines Körpers.
5
Als ich die Augen aufschlage, schwebe ich körperlos zwischen den Welten. Über mir springen und tanzen Lichtfäden. Es dauert ein paar Sekunden, bis ich begreife, dass es der Widerschein der Sonne auf dem Wasserglas neben mir ist und nicht etwa visuelle Störungen von der Migräne. Ich liege in meinem schmalen Bett im hinteren Schlafzimmer des Hauses.
Als ich die Ereignisse des vergangenen Tages wieder zusammensetze und erneut in Panik gerate, beruhige ich mich mit der Erinnerung daran, wie ich Janey gleich zweimal hintereinander verloren und wiedergefunden habe. Ich erinnere mich an das unheimliche Gefühl, das im Wald durch mich hindurch und an mir vorbei rauschte, an die Zackenblitze. Meine Migräne scheint schlimmer zu werden. Dann erinnere ich mich an Jack und das vorübergehende Gefühl von Sicherheit, das ich hatte, als er mich in seinen Armen trug. Aber das ist kein Trost, denn im Hintergrund schweben dunkel und bedrohlich die größeren Ereignisse, die mich hierherführten. Das Gewicht der Scham und der Verantwortung brechen erneut über mich herein. Wie naiv ich doch war. Der Umzug hierher war ein Versuch, diese grässliche Situation hinter mir zu lassen und Janey vor bösen Zungen zu schützen. Sie hat keine Schuld an alledem.
Ich sollte optimistisch sein und mich auf diese neue Herausforderung freuen. Aber so ist es nicht. Warum habe ich mich dazu zwingen lassen, jeden Penny, den ich durch Mutters schmutziges kleines Geschäft verdient habe, in dieses heruntergekommene Haus am Ende der Welt zu stecken? Ich hätte irgendwo anders ein abgelegenes kleines Häuschen kaufen können; niemand hätte es je erfahren. Und jetzt bin ich hier, in einer Gegend namens West Penwith. Selbst der Name hat einen wehmütigen, fernen Klang, als beschriebe er nicht einen Platz in der realen Welt, sondern einen, an dem normale Regeln nicht mehr gelten, an dem man sich drei Minuten von seinem Haus entfernt im Wald verirrt oder auf der Straße vor einem seltsame Tiere aus dem Nichts auftauchen und eine sonst so effiziente Frau wie meine Mutter dazu bringen, mit dem Auto von der Straße abzukommen.
Außerdem ist es so verdammt still, wenn man vom Rauschen des Meeres in der Ferne absieht.
Ich vermisse die Betriebsamkeit und den Verkehr im südöstlichen London: den Kiosk an der Ecke, die Bäckerei gegenüber, den schmuddeligen Park am Ende der Straße, den Geruch von Dieselabgasen und Kohleöfen, das ständige Stimmengewirr und Lachen von Menschen, die quietschenden Bremsen der Busse. Und ich vermisse Dennis.
Seufzend richte ich mich auf und blicke durch das riesige Zimmer auf Janeys Bett. Es ist leer, aber die Decke ist zerknüllt. Meine Tochter ist eine Frühaufsteherin, immer voller Vorfreude auf einen neuen Tag. Darin ähnelt Janey ihrer Großmutter. Ich ziehe mir einen Morgenmantel an und schlüpfe in die Schuhe von gestern, um ins Bad gehen zu können, ohne mir die Fußsohlen an den Splittern der nackten Holzdielen zu verletzen. Dort mache ich meine Katzenwäsche und frage mich, wie Janey es geschafft hat, sich heimlich aus dem Bett zu stehlen und anzuziehen, ohne mich zu wecken.
Im Erdgeschoss finde ich meine makellos zurechtgemachte Mutter in einem dunkelblauen Kleid mit einem bunt gemusterten Seidenschal um die Schultern. Sie sitzt in einem Spindelstuhl, die Ellbogen auf den Armlehnen, hält eine Tasse Tee in der Hand und hat die an den Knöcheln verschränkten Beine vor sich ausgestreckt. Dazu trägt sie Halbschuhe, das einzige Zugeständnis an unsere Umsiedlung aufs Land.
Die Tür des Ofens ist geöffnet, und die ausströmende Wärme macht den zweckmäßigen Raum fast gemütlich. Ich bin verblüfft von den verborgenen Fähigkeiten meiner Mutter. Janey sitzt über eine große Schüssel mit Cornflakes gebeugt am Tisch. Auf der Tischplatte ist Zucker verstreut, und in der Mitte steht eine Flasche mit frischer Milch – halb leer, ohne Deckel.
»Besser spät als nie, Darling«, sagt Magda und hebt eine perfekt nachgezogene Augenbraue. »Was hast du denn da an?«
Ich trage eine senfgelbe Bluse und eine weite Twillhose, die ich mit einem Gürtel festhalten muss, weil ich so stark abgenommen habe. »Ich dachte, es gäbe was zu tun.« Typisch für Mutter, dass sie nicht einmal fragt, wie es mir nach meinem Zusammenbruch gestern Abend geht, aber das ist keine Überraschung. Sie war noch nie besonders mütterlich und vertritt in puncto menschliche Schwächen gelinde gesagt eine eher strenge Haltung.
»Was für ein erfreulicher Anblick! Ich hoffe, es geht Ihnen besser. Ich habe mir Sorgen gemacht.«
Jack Lords hochgewachsene Gestalt steht in der Türöffnung. Er bietet mir eine Tasse Tee an, als wäre er der Gastgeber und ich der Gast. »Tut mir leid, ich weiß nicht, wie Sie ihn trinken. Ich habe Milch hinzugefügt, aber keinen Zucker?«
Was macht er hier? Es läuft mir eiskalt über den Rücken. Hat er hier übernachtet? Und wenn ja, wo? Ich kann nicht glauben, dass meine Mutter dermaßen schamlos sein könnte. Ich werfe ihr einen Blick zu, aber sie ist geschmeidig und beherrscht wie eine Rassekatze. Er muss heute früh auf ihre Bitte hin gekommen sein. Das würde auch das Feuer im Ofen erklären. Sie bekommt ihn nicht an und hat wahrscheinlich gedacht, es würde mir nicht gut genug gehen, um diese Aufgabe zu übernehmen.
Ich nehme ihm den Becher ab, nicke dankend und setze mich neben meine Tochter. »Viel besser, danke.« Ich kann ihn nicht ansehen. Seine Anwesenheit so früh am Morgen ist zu viel für mich. Aber ist es denn wirklich früh? Ich sehe auf meine Armbanduhr und stelle schockiert fest, dass es schon fast zehn ist. Ich weiche seinem Blick aus und streiche Janey die Ponyfransen aus den Augen. »Hast du gut geschlafen, Kleines?«
Janey verdrückt den letzten Löffel Cornflakes. »Ja, Mummy, aber Rabbit ist die ganze Nacht herumgerannt und jetzt fix und fertig!«
Fix und fertig: genau das hat Dennis immer gesagt, wenn er von einem seiner einwöchigen Ausflüge zurückkam.
Ich runzle die Stirn. »Hast du ihn gefunden?«
»Nein, aber ich weiß, dass er große Abenteuer erlebt hat.«
Als ich genauer hinsehe, fällt mir auf, dass sie Schlammreste unter den Fingernägeln hat und einen Fleck auf der Wange. »Also wirklich, Mutter, hast du Janey denn nicht gebadet, bevor du sie ins Bett gebracht hast?«
»Nein, meine Liebe. Es wird langsam Zeit, dass Janeska lernt, sich um sich selbst zu kümmern. Außerdem war ich noch nie gut darin, Kinder zu baden. Ich habe mich bewusst immer aus dem häuslichen Bereich herausgehalten.« Magdalena sieht Jack an und verdreht die Augen. »Ich bin viel zu alt, um Kindermädchen zu spielen.«
»Unsinn, Mrs Prusik«, sagt Lord galant wie auf ein Stichwort hin. »Sie sind für nichts zu alt.«
»Ah, Sie schmeicheln mir!« Magda genießt es.
Mir wird schlecht. Ihre Koketterie wird von Jahr zu Jahr schlimmer, als spürte sie das hässliche Alter im Nacken. »Du wirst noch vielen Leuten hinterherlaufen müssen, wenn wir den Laden hier auf Vordermann bringen wollen«, fahre ich sie an und überrasche mich damit selbst. Meine Güte, Mila, ein bisschen mehr Rückgrat.
»Nachdem«, korrigiert mich Magdalena. »Nachdem wir das Gästehaus auf Vordermann gebracht haben. Es ist unser gemeinsames Unternehmen. Und wenn Janeska in der Schule ist, wird die meiste Rennerei an dir hängen bleiben, meine Liebe, nicht an mir. Ich werde die Leitung übernehmen.«
Ja, deshalb bin ich hier